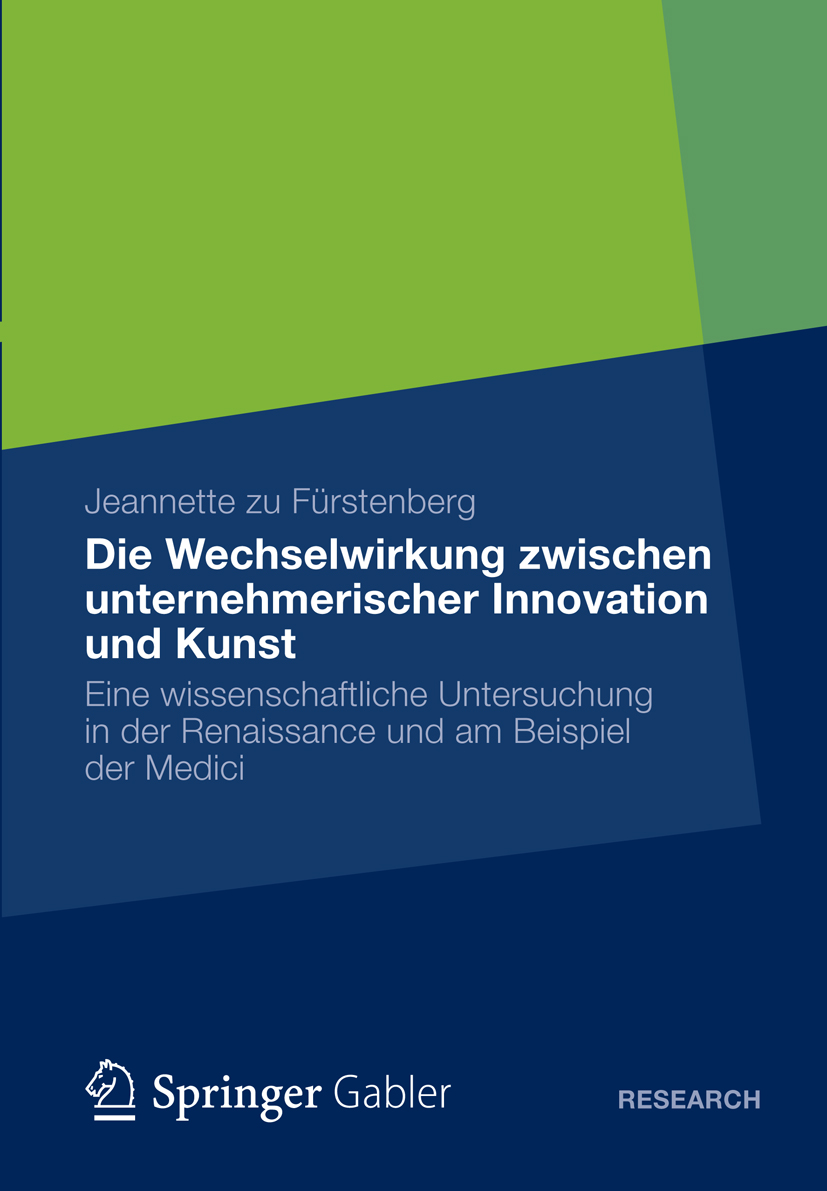21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Schluss mit dem Pessimismus! Mit ihren Investitionsentscheidungen und ihrem untrüglichen Gespür für unternehmerisches Potential geht die wohl erfolgreichste Risiko-Kapitalgeberin Deutschlands oft aufs Ganze. Ihre Mission: dabei helfen, zwischen der traditionellen deutschen Industrie und dem Start-up-Ökosystem Brücken zu bauen. Ihr Credo: Deutschland hat das Know-how und die Köpfe, um wirtschaftlich ganz vorne weiter mit dabei zu sein. In ihrem Buch fordert sie ein Ende des Narrativs vom "kranken Mann", ruft zur Rückbesinnung auf Deutschlands historische Innovationsstärke auf und sieht gerade in der Verbindung von traditionellen Unternehmen und KI-getriebenen Startups einzigartige Chancen, vor allem technologisch aufzuholen. "Ich will mit daran arbeiten, dass in zehn Jahren drei der weltweit zehn größten Tech-Konzerne europäisch sind." Jeannette zu Fürstenberg gewährt tiefe Einblicke in ihr Arbeitsleben einschließlich der vielen lehrhaften Erfahrungen während ihres Aufstiegs zu einer der meistgeachteten Investorinnen Europas. Dadurch entsteht nicht nur ein ganz anderer Blick auf Deutschland, sondern auch das sehr persönliche Porträt einer ungewöhnlichen Frau. Sie plädiert für ein zunehmend resilientes Europa, für mehr Mut und Dynamik in Deutschland und für einen drastischen Bürokratieabbau, um die Chancen tatsächlich zu nutzen, die sich für die Wirtschaft derzeit historisch einmalig bieten. Jeannette zu Fürstenberg wurde vom Handelsblatt zur Investorin des Jahres 2022 ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Gedicht
Vorwort
Teil I – Tausendundeine Idee
1 Pioniere
2 Nullpunktfaszination
3 Underdog Spirit
4 Chancenland
5 Mindset
6 Der menschliche Faktor
Zukunftserzählungen 2040
Teil II – Anatomie des Erfolgs
1 Neue Paradigmen
2 Ketten-Logik
3 Unter Strom
4 Wahrhaft wehrhaft
5 Politics
6 Die Unsichtbaren
Nachwort
Zitierte und empfohlene Quellen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Widmung
Für Upata, meinen geliebten Großvater, den Künstler und Unternehmer
Gedicht
Spaziergang
Schon ist mein Blick am Hügel, dem besonnten,dem Wege, den ich kaum begann, voran.So fasst uns das, was wir nicht fassen konnten,voller Erscheinung, aus der Ferne an –
und wandelt uns, auch wenn wirs nicht erreichen,in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind;ein Zeichen weht, erwidernd unserm Zeichen …Wir aber spüren nur den Gegenwind.
Rainer Maria Rilke
Vorwort
Seit mehr als zehn Jahren begleite ich als Risikokapitalgeberin Unternehmensgründerinnen und -gründer bei ihren ersten Schritten in die Zukunft – zu einer Zeit also, in der noch gar nicht klar ist, wohin ihre Reise geht. Warum tue ich das? Vielleicht hängt es mit der Faszination des Anfangens zusammen. Diese Faszination entsteht für mich vor allem dadurch, dass mich die, die ich begleite, mit ihren Ideen der Zukunft ein Stück näher bringen. Oder, um bei Rilke zu bleiben, dem sonnigen Hügel, dem Horizont. Aus manchen dieser innovativen Gründungen sind in kurzer Zeit florierende, hoch bewertete Unternehmen geworden, in die längst auch andere investiert haben – echte europäische Erfolgsgeschichten.
Meine Investitionsentscheidungen haben viel mit Risiko zu tun. Gerade am Anfang, wenn die Gründungsideen derart vage sind, dass von regulären Firmen noch überhaupt keine Rede sein kann und keiner weiß, was passieren wird. Doch die Risiken interessieren mich weniger. Mich faszinieren vielmehr die Chancen.
Denn meine Arbeit kann nur erfolgreich sein, wenn ich mich von den Chancen leiten lasse und wenn ich mir mit jedem neuen Engagement eine Vorstellung davon mache, welche Möglichkeiten darin liegen. Wenn ich also dem Horizont entgegenlaufe, ohne genau zu wissen, was dahinter ist.
Diese Suche nach dem Möglichen hat meinen Blick auf Deutschland und auf Europa substanziell verändert. Ich sehe die vielen Möglichkeiten, die sich uns bieten. Und das inzwischen nicht mehr nur in Bezug auf Gründungsideen, die sich zu Unternehmen entwickeln lassen, sondern weit darüber hinaus.
Bei meiner Arbeit erstaunt mich immer wieder, wie sehr unsere Wahrnehmung der Dinge unser Handeln lenkt. Es ist der Blick auf die Wirklichkeit, der den Umgang mit den Möglichkeiten determiniert. Und da macht es einen erheblichen Unterschied, ob die Risiken, ob vermeintliche oder auch reale Fallstricke oder gar ein potenzielles Scheitern unser Handeln bestimmen oder aber die großartigen Chancen, die es bei uns so zahlreich gibt.
Lassen Sie mich Ihnen also von meinem Blick auf unsere europäische Wirklichkeit erzählen, von meinem Vertrauen in die Zukunft und von meinem Glauben an Deutschland und Europa.
Teil I – Tausendundeine Idee
1Pioniere
Für einen Moment bleiben wir stehen und blicken aufs Wasser. Es ist Herbst in Berlin und noch spätsommerlich warm, ein Oktobernachmittag im Jahr 2020, an den ich mich noch heute lebhaft erinnere. Vor uns schiebt sich behutsam die Spree durch Berlins Mitte – vorbei am Pergamonmuseum in Richtung Havel. Torsten hat aufgehört zu sprechen. Es ist still. Ich denke darüber nach, was er mir gerade erzählt hat. Heute weiß ich, wie früh er und seine Mitgründer haben kommen sehen, was wir jetzt »Zeitenwende« nennen. Und ich weiß inzwischen auch, was ich an jenem Nachmittag noch nicht wissen konnte: wie richtig und wichtig es war, dass ich damals am Ufer der Spree beschlossen habe, Teil ihrer Mission zu werden.
Ich kenne Torsten Reil schon etliche Jahre. Wir sind beide Mitglieder im Aufsichtsrat eines Unternehmens, in das sowohl er als auch ich investiert haben. Weil Torsten beim Reden gerne geht, verabreden wir uns regelmäßig zu Spaziergängen. Heute heißen solche Treffen »Walking Meetings«. Er hat recht: Schwierige Themen lassen sich in der Intimität, die entsteht, wenn man nebeneinander herläuft, viel besser besprechen als in einem Konferenzraum. Und an jenem Nachmittag ging es um ein komplexes Thema.
Torsten denkt in großen Rahmen und für einen Gründer ungewöhnlich politisch. Als er mich damals anrief, um sich wieder einmal zu verabreden, wusste ich noch nicht, wie politisch dieser Nachmittag werden sollte. Es ging um Deutschland im Zentrum eines Europas, das sich zwischen den zwei geopolitisch entscheidenden Blöcken zu verlieren drohte und das sich im Falle eines militärischen Angriffs nicht würde verteidigen können. Die Annexion der Krim lag seinerzeit sechs Jahre zurück und war in der öffentlichen Wahrnehmung nahezu in Vergessenheit geraten. Ein möglicher Überfall Russlands auf die Ukraine erschien – gefühlt – in weiter Ferne. »Das muss nicht so bleiben«, sagte mir Torsten damals und setzte hinzu: »Europa muss verteidigungsfähig werden.« Auf das »muss« legte er eine fast flehende Betonung. Auch daran erinnere ich mich noch.
Torsten Reil ist Biologe mit einem Master auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz, hat in Oxford studiert und ein Vierteljahrhundert in England gelebt. Als Spin-off seiner Universität gründete er 2001 ein Unternehmen, das visuelle Effekte für Kinofilme produzierte, darunter für ganz große Hollywoodproduktionen wie Herr der Ringe, Harry Potter oder auch Star Wars. Er nannte es »NaturalMotion«. Ein paar Jahre später begann er, mit seiner Firma Computerspiele zu entwickeln. Die Firma hob ab, wurde zum größten Game Publisher Europas. 2014 verkaufte er sie an den amerikanischen Konkurrenten Zygna für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag, ließ sich noch für drei weitere Jahre verpflichten und stieg 2017 endgültig aus. Mit einem Mal war er »Vorruheständler«, wie er von sich selbst sagt. Er erzählte mir einmal, dass er in der ersten Woche nach seinem Ausstand alle Küchengeräte entkalkt hatte, weil er nicht wusste, was er den ganzen Tag über tun sollte. Auch erfolgreiche Gründer plagt mitunter Langeweile. Und vielleicht ist das ganz gut so. Seine Enttäuschung über den Brexit trieb ihn zunächst nach Deutschland zurück. In Berlin ließ er sich zwischenzeitlich nieder. Teile seines Kapitals investierte er als »Business Angel« in Startups.
Als wir uns 2018 kennenlernten, fiel mir zunächst seine Zurückhaltung auf. Ein ungeachtet seines Erfolges sehr bodenständiger, feinfühliger Mensch stand mir da gegenüber, in Art und Umgang weit entfernt von dem Habitus so vieler selbstbewusster Gründer, von denen nur wenige in einer derartigen Tiefe von einer Mission getrieben sind wie er. Schon häufig hatten wir beim Gehen über die Zukunft Deutschlands und Europas diskutiert: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie positionieren wir uns zwischen den beiden Supermächten Vereinigte Staaten und China? Was haben wir Europäerinnen und Europäer noch zu bieten? Und: Können wir den beiden Supermächten auf dem Feld der Hochtechnologie und Künstlichen Intelligenz etwas entgegensetzen? Spielen wir überhaupt mit, oder stehen europäische Unternehmen schon auf den Übernahmelisten der immer hungrigen, global agierenden Tech-Konzerne aus Amerika und dem Fernen Osten?
Torsten Reil ist nicht nur ein vehementer, fast radikaler Verfechter westlicher Demokratien, sondern hegt ein unerschütterliches Vertrauen in die wirtschaftliche und technologische Leistungsfähigkeit Europas. An einen seiner Sätze erinnere ich mich noch sehr genau: »Ich glaube, dass wir uns in Europa in jeder Hinsicht stark unter Wert verkaufen.« Als hätten wir vergessen, wie viel wir wirklich können. »Wir haben unglaublich viel Talent und damit alle Möglichkeiten, in der Technologie vorne dabei zu sein«, setzte er hinzu. »Wir müssen es nur wollen.« Ich nicke.
Wir schlendern weiter am Uferweg der Spree entlang. Als wir das Bode-Museum hinter uns lassen und auf die Alte Nationalgalerie mit ihrem prachtvollen Kolonnadenhof zusteuern, kommt er zu seinem eigentlichen Anliegen. Er spricht über die demokratischen Werte und dass sie verteidigt werden müssen, sowohl im Inneren des Landes als auch nach außen. Bevor es zu der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland gekommen sei, habe der Westen bezüglich dieser Möglichkeit die Augen verschlossen gehabt, auch er selbst. Wahrscheinlich aus Bequemlichkeit. Oder aus dem schlichten Grund, dass es schon nicht so schlimm kommen werde, weil es nicht so sein dürfe. Wir hätten dem russischen Präsidenten dadurch auf geradezu fatale Weise signalisiert, dass es fortan wieder möglich sei, völkerrechtlich anerkannte Grenzen zu verschieben – mit Waffengewalt und ohne Konsequenzen. Was, fragt er, wenn sich Putin irgendwann der Ukraine bemächtigte? Und was käme danach? Würde er immer weiter nach Westen vordringen?
Er muss sich eine ganze Weile schon mit dem Thema befasst haben, denke ich, als er mit einem Mal sehr detailliert über den Zustand der Bundeswehr und schließlich der europäischen Verteidigungskräfte spricht. Die Verteidigung kranke, sagt er, an einem veritablen Softwareproblem, das enorme Verteidigungslücken kreiere. »Die Industrie«, setzt er hinzu, »habe diese Entwicklung komplett verschlafen.« Er wolle hier etwas tun, ein neues Unternehmen gründen. Eine reine Softwarefirma bauen, die auf Basis Künstlicher Intelligenz die Verteidigungsmöglichkeiten auf ein ganz anderes Niveau heben werde. Und dann erklärt er mir, wie ein solches Unternehmen in Zukunft aussehen könnte. Es würde, davon ist er fest überzeugt, die gesamte europäische Rüstungsindustrie revolutionieren.
Welche Ambition, denke ich. Unwillkürlich kommt mir der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter in den Sinn und sein allzu häufig zitierter Ausspruch der »schöpferischen Zerstörung«, eine Wortkombination, die in diesem Kontext fast zynisch klingen mag. Torsten hat recht, überlege ich. Um die Verteidigungsfähigkeit eines Landes zu verändern, braucht die veraltete Rüstungsindustrie genau das: einen Kreativprozess, der eine qualitative Niveauverschiebung nach sich zieht, einen Shift in eine ganz andere Dimension. Torsten und seine Mitgründer hatten nicht weniger als genau das im Sinn.
Als wir uns an jenem Nachmittag darüber unterhielten, gab es das Unternehmen, das Torsten vorschwebte, zwar formal noch nicht. Aber mit seinen Mitgründern war er bereits inmitten der Planung. Einer von ihnen hatte zuvor im Verteidigungsministerium auf Abteilungsleiterebene gearbeitet. Ein anderer hatte ein kleines, vielversprechendes Unternehmen aufgebaut, das die Verteidigungsindustrie hie und da in Europa mit innovativer Software versorgte.
Als Investorin, die seit gut einem Jahrzehnt das Kapital ihrer Kunden in Technologie-Neugründungen investiert, welche noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, bin ich es gewohnt, dass Ideen nicht ganz präzise sein können. Sie müssen sich entwickeln. Ich weiß, dass es wenig Sinn macht, Gründerinnen und Gründer mit allzu strikten Anforderungen an auf Daten basierenden Vorhersagen herauszufordern. Das kann dazu führen, dass man ein Pflänzchen zertritt, bevor es überhaupt die Chance hatte zu wachsen. Im Falle der Pläne von Torsten Reil aber musste ich mich dahin gehend nicht zurückhalten. Erstens hatte er ja bereits sagenhaft erfolgreich gegründet und verkauft. Wer, wenn nicht er, musste wissen, wie es geht? Und zweitens waren seine Überlegungen bereits derart präzise, das Umfeld so genau ausgeleuchtet und recherchiert, dass sich viele Fragen von vornherein erübrigten. Das Thema war mir nicht fremd, immer wieder hatte ich mich mit meinem Freund und Mentor René Obermann, früher Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, damals bereits Aufsichtsratschef von Airbus, dazu ausgetauscht. Der Mangel an Bedeutung dieses Themas hatte uns immer zutiefst besorgt. Jetzt wollte sich Torsten tatsächlich in eine Industrie wagen, der in Deutschland mit großer Skepsis begegnet wird.
Es gab damals bei unserem Gang an der Spree noch einen anderen Gedanken, der mich elektrisierte. Torsten wollte zeigen, dass man in Europa richtig große, sehr erfolgreiche Unternehmen aufbauen kann. Ihm schwebte eine Art Leuchtturmprojekt vor, welches in mehrfacher Hinsicht ein Vorbild für die vielen anderen Gründerinnen und Gründer sein sollte, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren, sondern das Große im Auge zu behalten, sich auf skalierbare Ideen zu fokussieren, sich gute Investoren zu suchen, solche, die das Risiko mitgehen und die Gründer nicht aus Ängstlichkeit vor dem eigenen Kapitalverlust zu sehr an die Kette legen. Er war überzeugt, dass es in Europa dafür genügend Talent und Energie gäbe. Er selbst hätte Energie für zwei gehabt. Ihn trieb seinerzeit ja nicht nur das Thema der Verteidigungsfähigkeit Europas um. Er hätte sich auch vorstellen können, ein europäisches Open AI aufzubauen, sagte er mir, ein Softwareunternehmen, das sich mit der Entwicklung Künstlicher Intelligenz befasse. Warum sollte man dieses Feld weiterhin vor allem den Amerikanern überlassen? Lange hatte ich niemanden mehr getroffen, der sich traute, in Bezug auf Europa ähnlich groß zu denken und das auch auszusprechen.
Groß denken – das will ich auf den folgenden Seiten ebenfalls versuchen. Viel größer, als wir das in Europa gemeinhin gewohnt sind. Ich glaube, dass wir in Europa und damit auch in Deutschland vor der historisch einmaligen Chance stehen, technologisch aufzuholen. Bis zum Jahr 2040 kann es uns gelingen, mit drei Unternehmen in die Liga der zehn weltweit größten Technologiekonzerne vorzustoßen. Dies könnte in einer wirtschaftlichen Renaissance Europas münden.
Womöglich halten Sie mich für eine Utopistin. Mit dieser Bezeichnung kann ich leben und würde Ihnen gleichwohl drei Umstände entgegenhalten, die für meine These sprechen und die gerade jetzt zugunsten Europas zeitlich zusammenfallen: erstens die enorme Fertigungstiefe und -vielfalt der immer noch sehr starken europäischen Industrie. Zweitens eine weltweit wohl einzigartige Anzahl an Talenten vor allem auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Und drittens die inzwischen gereifte Einsicht darin, dass wir in Europa und besonders in Deutschland wieder unabhängiger werden müssen von einer internationalen Arbeitsteilung, auf die wir uns zu lange verlassen haben. Durch die Künstliche Intelligenz steht die Industrie vor einer Transformation, die aus Europa heraus angeführt werden kann. Wir müssen sie nur organisieren, müssen die Protagonisten unseres Startup-Ökosystems mit der Welt der etablierten Industrie verbinden. Aus einer solchen Verbindung werden nicht nur eine Vielzahl von Neugründungen hervorgehen, mit intelligenten technologischen Anwendungen für jede einzelne industrielle Fertigungsstufe, sondern auch ein sehr viel größeres Wertschöpfungspotenzial für traditionelle Unternehmen, für Industriekonzerne genauso wie für den Mittelstand. Das Ergebnis ist ein Wiederaufleben nachhaltigen Wirtschaftswachstums mit sehr vielen Beschäftigungsmöglichkeiten.
Woher nehme ich meine Zuversicht? Aus meiner zehnjährigen Erfahrung als Risikokapitalgeberin, als die ich nicht nur solchen Pionieren wie beispielsweise dem Gründerteam um Torsten Reil begegne, sondern auch ganz unterschiedlichen Vertretern unserer etablierten Industrie, auf die Europas internationale Stärke bis heute zurückzuführen ist.
Das Momentum ist da, wir müssen zusehen, dass sich die Schwungräder schneller drehen, dass diese Transformation mit all ihren Chancen in Gang kommt. Wie das funktionieren könnte, werde ich im zweiten Teil dieses Buches genauer beschreiben. Vorher aber will ich versuchen, noch ein paar andere Ingredienzien für eine europäische Renaissance aufzuführen, die für diese konstitutiv sein werden. Sie haben etwas mit unserer Geisteshaltung zu tun.
Der Ton, der seit Jahren die öffentliche Debatte beherrscht, ist der der Resignation. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa trauen wir uns das Denken in großen Dimensionen nicht mehr zu. Wer groß denkt, wird nicht selten als Illusionist abgetan oder gar als Utopist verlacht, als Weltfremder oder – in meinem Fall – Weltfremde, die die Realität nicht akzeptieren will. Ich wüsste nicht genau zu datieren, wann diese jüngste Welle der Selbstentwertung eingesetzt hat, vielleicht mit dem Aufstieg der Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley. Und später dann nahm sie mit der atemberaubenden technologischen Aufholjagd der Volksrepublik China noch mehr an Kraft zu. Mit diesen beiden Entwicklungen scheint eine in Europa und allen voran in Deutschland weitverbreitete Verminderung des Selbstwertgefühls einherzugehen, die, wenn wir sie nicht bekämpfen, schwerwiegende Folgen haben wird. Denn wir versagen uns von vornherein den Mut, unsere Zukunft selbst zu gestalten. Wohin soll das führen?
Wir haben uns Google und Facebook ergeben, die heute Alphabet und Meta heißen, vorher schon Microsoft und Apple, obwohl der Computer hierzulande erfunden wurde. Wir haben diesen Konzernen scheinbar nichts entgegenzusetzen. Als Nächstes, so wird gemutmaßt, wird es die einst so stolze europäische Automobilindustrie erwischen, wenn nicht nur der chinesische Elektromobilkonzern BYD (Build Your Dreams) mit Macht auf den europäischen Markt drängt.
Seit Mitte der 2010er-Jahre hören wir wiederholt die immer gleiche Geschichte: Europa sei dabei, den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren – wirtschaftlich, technologisch. Seit Ende 2023 hören wir diese Erzählung zumindest für Deutschland auch von der Bundesregierung. Mit einem Unterschied: Wir hören sie nicht mehr im Konjunktiv, also im Könnte-Modus, sondern in der Gegenwartsform im Modus der Wirklichkeit, als handelte sich um eine weitgehend abgeschlossene Phase, mit deren unumstößlichem Ergebnis wir nun konfrontiert sind: »Die Wirtschaft ist in schwerem Fahrwasser« oder »Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig«. Kurz: Das Land hat den Anschluss verloren. Aber woran? An den technologischen Fortschritt, an die internationale Produktivitätsentwicklung, die natürlich an den technologischen Fortschritt gekoppelt ist? Oder an das europäische oder weltweite Wirtschaftswachstum? Und noch eine Feststellung kursiert: Deutschland sei der kranke Mann eines ohnehin lahmenden europäischen Kontinents, der als Ganzes an Bedeutung verliere.
Diese Sicht allerdings ist gesellschaftspolitisch nicht ganz ungefährlich, vor allem dann nicht, wenn sie so apodiktisch ausgerechnet von den Regierungspolitikern proklamiert wird, die doch eigentlich an den Hebeln sitzen, um genau daran etwas zu ändern. In wirtschaftlicher Hinsicht suggeriert diese Bestandsaufnahme eine gewisse Unumkehrbarkeit, die Unternehmen veranlasst, sich nach Standorten in anderen Teilen der Welt umzuschauen, wo die Veränderungsdynamik größer und vielversprechender ist.
Die politische Brisanz dieser Sichtweise liegt in der möglichen Reaktion der Bevölkerung. Eine solche, für ein Industrieland derart verheerende Diagnose des vermeintlichen Anschlussverlusts muss hervorragend ausgebildete junge Leute dazu bewegen, Deutschland oder auch Europa zu verlassen und anderswo auf der Welt, am ehesten in Kalifornien in der Bay Area und im Silicon Valley, ihr Glück zu suchen. Andere wiederum treibt dieser Abgesang in die Arme von Populisten und Systemgegnern.
Ich werde mich in diesem Buch mit all meinen Erfahrungen, meinen Begegnungen, meinem Wissen und meinen Investitionsentscheidungen, von denen ich berichten werde, leidenschaftlich gegen dieses falsche Krisennarrativ positionieren. Ich erzähle eine ganz andere Geschichte: eine von Europas und auch Deutschlands Stärken. Die Gründung des Unternehmens von Torsten Reil und seinen Mitstreitern im Jahr 2021 ist so eine Geschichte. Es hat also einen Grund, warum ich sie an den Anfang meiner Erzählung gestellt habe. Sie ist der Inbegriff des »Thinking-Big«. Und sie kann vor allem eines signalisieren: Genau das können wir in Europa auch.
Torsten Reil und seine Mitgründer Gundbert Scherf und Niklas Köhler haben ihr neues Unternehmen »Helsing« genannt. Ich weiß, dieses Beispiel ist für viele mindestens provokant, wenn nicht sogar verstörend, weil es sich um ein Unternehmen der Rüstungsbranche handelt. Es gäbe genügend andere Beispiele von Gründerinnen und Gründern, deren Ideen mich überzeugt haben, sodass ich das Kapital meiner Investoren bei ihnen gut aufgehoben sehe. Die Wertentwicklung dieser einst kleinen, scheinbar noch so unbedeutenden Startups bestätigt meinen Optimismus: Aus Europa heraus lassen sich binnen kurzer Zeit neue Unternehmen gründen, die erstens aufgrund ihrer Exzellenz so sehr das Interesse internationaler Investoren wecken, dass sie binnen weniger Jahre mit mehreren Milliarden Euro bewertet werden. Und die zweitens in der Lage sind, jene brillanten Köpfe vor allem aus Amerika wieder nach Europa zurückzuholen, die einst nicht nur diese Krisennarrative, sondern vor allem Ambition und Neugierde über den Atlantik getrieben haben.
Helsing aber ist noch ein bisschen anders. Es wächst schneller, spektakulärer – auch aufgrund der folgenden Entwicklung: Nur anderthalb Jahre nach unserem Spaziergang an der Spree überfiel Russland die Ukraine. Dass die geopolitische Zuspitzung das Wachstum des Unternehmens derart befördert, ist allerdings kein Zufall. Es liegt zuallererst an einer fast hellsichtigen Analyse seiner drei Gründer, die sich damals aufgrund ihrer Befürchtungen für die Rüstungsindustrie entschieden haben. Ich habe auch deshalb ausgerechnet die Gründungsgeschichte von Helsing an den Beginn dieses Buches gestellt, weil sie sich mit einer sehr spezifischen europapolitischen Mission weit über die Verteidigung unseres Wohlstands hinaus verbindet. Es geht den Gründern um unsere europäischen Werte, unsere Haltung, unsere kulturelle Vielfalt und unsere Möglichkeit, Demokratie in einer Form zu leben, die weltweit ihresgleichen sucht. Das sind nicht nur für sie die Quellen unseres Potenzials, die es unbedingt zu schützen gilt.
Auf diesen Quellen fußt mein Urvertrauen in den »Old Continent«: Wir können in Europa und auch in Deutschland auf eine einzigartige Kultur-, Ideen- und Innovationsgeschichte zurückblicken. Künstlerisch so oder so mit unseren großen Malern, Bildhauern und Komponisten. Aber auch mit unseren Dichtern, die in ihren Werken die wichtigsten Themen der Menschheit verhandeln – Freiheit und Schaffensdrang, Krieg und Versöhnung, Schuld und Vergebung, die Brüderlichkeit, die Menschlichkeit, den Humanismus und die bahnbrechenden Ideen der Aufklärung. Darüber hinaus hat Europa Philosophen und Gesellschaftswissenschaftler hervorgebracht, die uns den Weg in die Moderne geebnet haben, indem sie die Würde eines jeden Einzelnen ins Zentrum ihres Denkens rückten und damit Gesellschaften von Grund auf veränderten. Auf Basis ihrer Ideen sind Demokratie und die Gleichheitsidee gewachsen. Nicht zuletzt sind da die großen Erfinderinnen und Erfinder, die aus Europa und vielfach aus Deutschland kommen.
Wir leben also in einer europäischen Welt, die seit der Renaissance unendlich viele Vordenker hervorgebracht hat, Personen, deren Ideen immer wieder den Beginn einer neuen Epoche markieren, weil sich die Erkenntniskoordinaten derart verschieben, dass sie nicht nur die Wissenschaften sprunghaft nach vorne bringen, sondern auch die Wirtschaft. Und viel mehr noch, dass sie die Art des Zusammenlebens der Menschen verändern. Häufig zum Besseren. Beispiele gibt es unzählige: den Buchdruck, das Reinheitsgebot, die Glühbirne, das Telefon, das Periodensystem, die Relativitätstheorie, die Quantenphysik, die Kernspaltung, den Dynamo, die Bakteriologie und das Antibiotikum, das Automobil, die Röntgenstrahlung, das Aspirin, die Kleinbildkamera, das Fernsehen und sogar der Computer, die Chipkarte und das MP3-Format, die Genschere CRISPR und nicht zuletzt den mRNA-Impfstoff, der uns während der Pandemie geholfen hat. Wir leben in einer Weltregion, die an historischer, gesellschaftlicher, kultureller, erfinderischer und auch wirtschaftlicher Vielfalt ihresgleichen sucht. Oder anders: Europa ist eine hoch pulsierende Region – allen Unkenrufen zum Trotz. Das Charakteristikum dieses Pulsierens ist die kulturelle Vielfalt, die einen ganz eigenen europäischen Rhythmus geboren hat. Einen anderen als den amerikanischen und einen, der überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem des Fernen Ostens.
»Wir sind nicht wie die anderen«, hat im April 2024 der französische Präsident Emmanuel Macron in seiner zweiten, wirklich wegweisenden Sorbonne-Rede allen Europäerinnen und Europäern zugerufen. »Europäisch zu sein, bedeutet nicht einfach, in einem Land zwischen der Ostsee und dem Mittelmeer oder vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer zu leben.« Da sei so viel mehr: vor allem ein Menschenbild, welches das freie, rationale und aufgeklärte Individuum über alles stelle. »Wir haben uns stets dazu entschieden, den Menschen im Allgemeinen über alles zu stellen. Und von der Renaissance über die Aufklärung bis hin zur Überwindung der Totalitarismen ist es das, was Europa ausmacht.«
Auf allen gesellschaftlichen Ebenen nehmen wir unsere Einzigartigkeit als nichts Besonderes, gar als selbstverständlich an. Es war ja seit Jahrhunderten nie anders. Wir sind damit aufgewachsen. Aber diese Einzigartigkeit ist überaus fruchtbar. Wir sollten genau dieses Pulsieren als etwas begreifen, das in einem hohen Maß für geistigen Ausdruck steht – die Grundlage für unsere historische Innovationsstärke. Ich sehe keinen Grund, warum aus dieser Vielfalt nicht weiterhin Neues entstehen soll, das die Kraft hat, die Welt zu verändern. Wir müssen uns nur darauf einlassen, uns »hineinlehnen« in diese pulsierende, mitunter etwas kleinteilig erscheinende Mannigfaltigkeit, die immerzu Ideen zutage fördert. Vielfach müssen wir diese Ideen suchen, Forscherinnen und Forscher verstärkt bewegen, die Türme dieser weltweit einzigartigen Wissenschaftslandschaft zu verlassen. Wir müssen ihre Erkenntnisse und Ideen fördern, ihnen einen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Rahmen geben, damit sie in der Alltagswirklichkeit ihren Niederschlag finden: nicht nur als Gemälde oder Skulpturen, als architektonische Meisterwerke, als provozierend neue Opern, sonders als so vieles mehr und vor allem als immer neue Unternehmen.
Unlängst war ich auf dem Weg ins Marais. Beruflich wieder einmal. Ich bin Aufsichtsratsmitglied eines französischen Startups, bei dem sich die Risikokapitalgesellschaft La Famiglia engagiert hat, die ich mitgegründet habe. Das Marais ist jenes Viertel im Zentrum von Paris, das die unerbittlichen Modernisierungsbestrebungen von Frankreichs berühmtestem Stadtplaner Baron Haussmann überstanden und sich deshalb sehr viel von seiner Ursprünglichkeit erhalten hat. Wer ins Marais gelangt, scheint plötzlich in einer anderen Welt zu sein. So einzigartig europäisch und architektonisch sichtbar älter als andere Teile der französischen Hauptstadt. Mit einem individuellen urbanen Charme, den man in seiner Singularität nur in europäischen Großstädten findet. Es wird sicher kein Zufall gewesen sein, dass mir dort wieder einmal die faszinierende europäische Vielfalt durch den Kopf ging, die eben auch in Paris – aller Stadtplanung zum Trotz – so gut zu beobachten ist. Wenn ich durch San Francisco laufe oder durch Palo Alto im Silicon Valley, sieht alles sehr viel gleichförmiger aus als hier, dachte ich. Regelmäßig bin ich dort, vor allem seit dem Herbst 2023. Seinerzeit hatten wir beschlossen, die vergleichsweise kleine Firma La Famiglia mit der vielfach größeren amerikanischen Risikokapitalgesellschaft General Catalyst zu fusionieren, um Zugriff auf Kapital zu haben, das wir in Europa und vor allem in Deutschland dringend brauchen. Die Welt in Amerika ist so viel homogener, dachte ich auch. Die Vereinigten Staaten sind eine Art Plattform, auf der jeder anlanden kann und willkommen ist. Vielleicht ist es die Vielfalt, die dieses Ankommen in Europa nicht ganz so einfach und Amerika deshalb vordergründig so viel stärker macht.
Dabei sind die Vereinigten Staaten einst von Europäern quasi gebaut worden. Mit ihrer Kultur und ihren Werten sind sie Anfang des 17. Jahrhunderts aufgebrochen, um ihre Welt auf der anderen Seite des Atlantiks noch einmal zu errichten. Auf einem »Level Playing Field«. Eigentlich müssten wir, dachte ich, genau diesen Archetyp von Gründerinnen und Gründern suchen, Menschen wie jene, die es damals ins Ungewisse gezogen hat, die über das Meer gesegelt sind, um noch einmal ganz neu anzufangen. Es muss einen Grund dafür geben, warum in der internationalen und vor allem amerikanischen Technologie-Spitzenforschung auffällig viele Menschen mit europäischem Hintergrund Durchbrüche zuwege bringen – so wie die drei jungen Franzosen mit ihrer neuen, erfolgreichen Firma, denen ich dann als Aufsichtsrätin einige Stunden in Paris zuhörte und von denen ich später noch einmal erzählen werde.
Eine Erklärung dafür habe ich nicht, nur eine ganz unwissenschaftliche Deutungsvermutung. Die Vielfalt in Europas Städten und Regionen, die Brüche, mit denen man überall schon als Kind konfrontiert wird, ergeben ein ganz anderes Mindset. Die dauerhafte Konfrontation mit Andersartigkeit, mit unterschiedlichsten Sprachen und Dialekten, ganz diversen Gebäudestilen, mit immer anderen Gebräuchen, die sich anders als in den Vereinigten Staaten nie wirklich eingeebnet haben – das alles verfehlt seine Wirkung auf die Menschen schon im Kindesalter nicht. Und zwar auch dann nicht, wenn Kinder nicht in jenen bildungsbürgerlichen Schichten aufwachsen, die mit ihrem Nachwuchs durch Europa reisen, um die historische und soziale Vielfalt vor Ort zu erleben. Ich bin überzeugt, dass schon eine sehr oberflächliche Erfahrung dieser Vielfalt und Brüchigkeit von klein auf Menschen prägt. Die Konfrontation mit Andersartigkeit stellt uns immer wieder infrage, schürt die Selbstzweifel als positive Herausforderung, als Antrieb dafür, Erklärungen zu suchen – eine für mich notwendige Voraussetzung, neu zu denken und Neues zu erschaffen.
Diese Vielfalt beeinflusst die Art und Weise, wie wir mit Ambivalenz umgehen und wie wir die verschiedensten Dinge ganz intuitiv in Bezug zueinander setzen. Das Ergebnis ist eine andere Haltung gegenüber dem Unperfekten, dem Zweifelhaften. Mehr noch: Es gibt uns Europäern ein anderes Radarsystem. Natürlich ist das nur ein Eindruck, eine Form anekdotischer Wahrnehmung aus meinen Begegnungen heraus oder die gedankliche Spinnerei, die sich mir an jenem Tag in Paris durch die Frische der weißen Fassaden des Marais wieder einmal aufgedrängt hat und die aufzuschreiben sich schon aufgrund der Pauschalisierung eigentlich verböte. Und trotzdem will ich Ihnen diesen Gedanken nicht vorenthalten.
Damals jedenfalls beschloss ich, dass ich mich auf die Suche nach Menschen machen will, die in Europa aufgewachsen sind und in Amerika die großen Technologieunternehmen von innen erlebt haben. Vielleicht kann ich dabei helfen, sie für die Idee einer europäischen Renaissance zu begeistern und einige von ihnen nach Europa zurückzuholen. Denn sie haben wahrscheinlich genau die Einstellung, die Europa braucht, um aus seiner Heterogenität heraus wieder große innovative Unternehmen zu bauen. Was meine ich damit? Ich würde es so formulieren: Bei ihnen kommen die Stärken europäischer Sozialisation mit amerikanischer Risikofreude und Größenerfahrung zusammen, eine Kombination, die sie dazu prädestiniert, aus Europa heraus transformative Technologieunternehmen ganz groß zu machen.
Neben der europäischen Vielfalt gibt es noch einen weiteren Grund für meine Zuversicht für Deutschland und Europa: Das sind die enormen Erfahrungen und das Wissen europäischer Unternehmen im Hinblick auf die Komplexität der Produktionsprozesse. Oder nennen Sie es Fertigungstiefe. Das international wohl eindrücklichste Beispiel: der deutsche Maschinenbau. Weltweit ist er in seiner Produktionspräzision, seinem Erfindungsreichtum, seiner Innovationskraft und ebenjener Fertigungstiefe einzigartig. Dazu ist er oftmals mittelständisch, mit einer fast flächendeckenden Vielzahl an hoch spezialisierten Weltmarktführern, die die Öffentlichkeit und – leider zu häufig – auch die Politik gar nicht wahrnehmen. Er ist darüber hinaus geprägt von sehr unterschiedlichen Unternehmerpersönlichkeiten, die umsichtig und arbeitnehmerfreundlich agieren, die neugierig, innovativ und nicht selten auch noch sozial enorm engagiert sind.