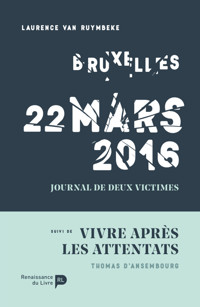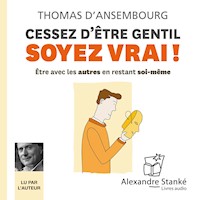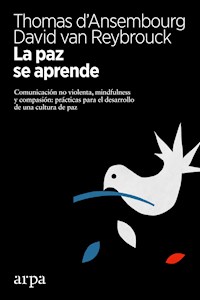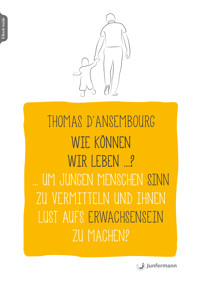
Wie können wir leben ...? Um jungen Menschen Sinn zu vermitteln und ihnen Lust aufs Erwachsensein zu machen? E-Book
Thomas D'Ansembourg
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Junge Menschen hören nicht auf das, was du sagst. Sie achten auch nicht auf das, was du tust. Sie achten darauf, wie du bist!" Was denken Jugendliche, wenn sie beobachten, wie Erwachsene ihren Alltag bewältigen, mit Konflikten und Frustration umgehen und ihre Work-Life-Balance organisieren? Etwa: "Erwachsensein ist super. Ich kann es kaum erwarten, bis auch ich in meinem eigenen Tempo lernen und mich entwickeln kann, um dann, im Einklang mit mir selbst, sagen zu können: Ich freue mich, dass ich so bin"? Oder sagen sie nicht doch eher: "Die spinnen doch. Ständig sind sie in Hektik und gestresst, träumen aber von Ruhe. Sie fordern Respekt, ohne sich selbst zu respektieren. Sie wollen sich auf das Wesentliche konzentrieren – und verzetteln sich ständig." Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, sich selbst zu hinterfragen sowie kreative und inspirierende Antworten auf u. a. folgende Fragen zu finden: - Wie zeigen wir durch unsere Art miteinander zu reden, dass Respekt, Klarheit und Empathie nicht nur Ideen, sondern gelebte Werte sind? - Wie setzen wir klare und verständliche Grenzen, ohne die andere Person oder uns selbst einzuschränken? - Wie vermitteln wir Jugendlichen durch unsere Art zu sein – als Eltern oder Lehrer*innen – einen Sinn für Schönheit und Freude, trotz des Schmerzes und der Verwirrung, die das Leben mit sich bringt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thomas d’Ansembourg
Wie können wir leben ...?
… um jungen Menschen Sinn zu vermitteln und ihnen Lust aufs Erwachsensein zu machen?
Über dieses Buch
„Junge Menschen achten darauf, wie du bist!“
Was denken Jugendliche, wenn sie beobachten, wie Erwachsene ihren Alltag bewältigen, mit Konflikten umgehen und ihre Work-Life-Balance organisieren? Etwa: „Erwachsensein ist super. Ich kann es kaum erwarten, bis auch ich in meinem eigenen Tempo lernen und mich entwickeln kann, um dann, im Einklang mit mir selbst, sagen zu können: Ich freue mich, dass ich so bin“? Oder sagen sie: „Die spinnen doch. Ständig sind sie in Hektik und gestresst, träumen aber von Ruhe. Sie fordern Respekt, ohne sich selbst zu respektieren. Sie wollen sich auf das Wesentliche konzentrieren – und verzetteln sich ständig.“
Als Erwachsene gilt es, kreative und inspirierende Antworten auf u. a. folgende Fragen zu finden:
Wie zeigen wir durch unsere Art miteinander zu reden, dass Respekt, Klarheit und Empathie nicht nur Ideen, sondern gelebte Werte sind? Wie setzen wir klare und verständliche Grenzen, ohne die andere Person oder uns selbst einzuschränken? Wie vermitteln wir Jugendlichen durch unsere Art zu sein – als Eltern oder Lehrer:innen – einen Sinn für Schönheit und Freude, trotz des Schmerzes und der Verwirrung, die das Leben mit sich bringt?Thomas D’Ansembourg, geb. 1957, arbeitete nach dem Studium zunächst als Jurist. Anschließend Ausbildung zum Therapeuten und in Gewaltfreier Kommunikation, insbesondere bei Marshall B. Rosenberg.https://thomasdansembourg.com
Copyright © der deutschen Ausgabe: Junfermann Verlag, Paderborn 2022
Published originally under the title: Notre façon d’être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? © 2020, Éditions de L’Homme, division of Groupe Sogides, inc. (Montréal, Québec, Canada)
Coverfoto: © ALNOR Media / Shutterstock
Covergestaltung / Reihenentwurf: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Übersetzung: Claudia Seele-Nyima
Fachliche Begleitung der Übersetzung: Petra Quast
Satz: Peter Marwitz, Kiel (etherial.de)
Layout & Digitalisierung: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsjahr dieser E-Book-Ausgabe: 2022
ISBN der Printausgabe: 978-3-7495-0328-5
ISBN dieses E-Books: 978-3-7495-0329-2 (EPUB), 978-3-7495-0331-5 (PDF), 978-3-7495-0330-8 (EPUB für Kindle).
Über menschliche Beziehungen wissen wir heute kaum mehr, als Barbiere früher über die Kunst der Chirurgie wussten, mit deren Ausübung sie betraut waren. ANTOINE DE LA GARANDERIE
Sprechen wir mit unseren Kindern über Glück. Sonst wird die Gesellschaft ihnen die ihr eigenen Lektionen erteilen und sie auf Irrwege des Materialismus, des Egoismus und des Konkurrenzdenkens führen. CHRISTOPHE ANDRÉ
Gewalt ist in einer Gesellschaft ein Zeichen dafür, dass mit der Art, wie zwischenmenschliche Beziehungen geführt werden, grundsätzlich etwas im Argen liegt. ALBERT JACQUARD
Ich habe gelernt, dass die Menschen vergessen werden, was du gesagt hast; sie werden vergessen, was du getan hast, aber sie werden niemals vergessen, wie sie sich deinetwegen gefühlt haben. MAYA ANGELOU
Vorwort
Und wann leben wir die Werte, die uns inspirieren und uns am Herzen liegen?
„An ein Kind geben wir vor allem das weiter, was wir sind, unsere Art zu sein.“
(Catherine Gueguen)
Ein kleiner Hinweis des Autors vorweg
Ich nehme großen Anteil an der Gleichstellung der Geschlechter und beschäftige mich aktiv damit. Ich persönlich finde es jedoch sehr ermüdend, einen Text in sogenannter gendergerechter Sprache zu lesen, in der jedes zulässige Wort systematisch mit Sternchen oder sonstigen Zeichen versehen ist, die es ebenso unlesbar wie unaussprechlich machen. Im vorliegenden Buch möchte ich es daher so halten, dass das Maskulinum als neutral gilt und das Geschlecht gelegentlich abwechselnd verwendet wird. Und ich erlaube mir, Diderots großartige liebevolle Formulierung „Überall, wo nichts auf dem Blatt steht, sollten Sie lesen, dass ich Sie liebe“ zu paraphrasieren, und möchte Ihnen anempfehlen: „Wo immer der Text ‚einem Geschlecht zugeordnet‘ ist, lesen Sie ihn so, dass er den Menschen in Ihnen anspricht (und dass ich Sie so liebe, wie Sie sich fühlen!).“
Seit mehr als 25 Jahren beobachte ich das alltägliche Leben von Einzelnen, Familien und Gruppen, in meinem eigenen Privatleben wie auch bei der Begleitung von Menschen auf ihrem persönlichen inneren Weg. Ich sehe, was tiefes Wohlbefinden, Lebensfreude, ein Gefühl der Weite und Verbundenheit, Kreativität, Dankbarkeit und wohlwollende Freundlichkeit hervorbringt. Ein solcher innerer Zustand geht mit Selbstachtung und Rücksichtnahme einher, mit Durchsetzungsvermögen und Solidarität, mit der Fähigkeit zum Engagement und zur Selbstbesinnung.
Ich erkenne aber auch, was Gefühle der Leere und Einsamkeit hervorruft, Ohnmacht, unergründliche Traurigkeit und Wehmut, ein Gefühl der Zersplitterung, Anspannung oder Abkapselung, und stelle fest, dass sich solche inneren Zustände nicht zuletzt in Depressionen, Hyperaktivität, Aggressivität, Überkonsum aller Art und anderen Kompensationsmechanismen äußern.
Und ich weiß, dass das größte Geschenk, das wir als Erwachsene unseren Kindern und generell allen jungen Menschen machen können, dieses ist: ihnen – auf Grundlage unserer Erfahrungen im Alltag – zu zeigen, dass das Leben durch Freuden und Leiden hindurch ein Prozess der Selbsterkenntnis ist. Wir werden friedlich und wir handeln friedlich, um der gemeinsamen Liebe und Lebensfreude willen.
Nicht weil ich weltfremd bin, sondern ganz im Gegenteil, weil ich jahrelang mit Menschen aus allen Lebensbereichen gearbeitet und ganz pragmatisch die Mechanismen von Ursache und Wirkung beobachtet habe, bin ich nach und nach zu der Überzeugung gelangt: Wir verfügen über eine Macht, die ebenso erstaunlich wie „explosiv“ ist. Wir können uns verändern und einen maßgeblichen Einfluss ausüben – nicht nur auf unser Familienleben oder den Schulalltag, sondern auch auf das gesellschaftliche Leben insgesamt. Und zwar, indem wir uns regelmäßig die folgende Frage stellen:
der Tatsache, dass Hinhören und Empathie nicht gelehrt werden
von kritischen, feigen, zynischen Einstellungen,
von Phrasendrescherei, Heuchelei und Ego-Verwicklung,
angesichts der Faszination für das Tun, für Materielles und für das Haben
und angesichts dessen, dass das Sein und der Geist eher vernachlässigt werden:
Bin ich selbst das Problem oder bin ich Teil der Lösung?
Das Thema dieses Buches ist gleichzeitig das Thema eines Vortrags, den ich seit mehr als zehn Jahren halte und um den ich immer noch regelmäßig gebeten werde, weil er die Menschen berührt. Er hilft ihnen, wie sie selbst sagen, eine andere Haltung einzunehmen – zunächst in ihrer Beziehung zu sich selbst, dann in ihrer Beziehung zu anderen wie auch zum Leben allgemein.
Eine andere Haltung einnehmen – das ist für uns heutzutage eine große Herausforderung. Wir erleben gerade die Corona-Pandemie, eine historische Periode, mit Ausgangsbeschränkungen weltweit und den damit einhergehenden Problemen: Ungewissheit, Sorge um das Einkommen, Angst, Stress, Einsamkeit oder, im Gegenteil, extreme Nähe rund um die Uhr. Wir sind damit konfrontiert, in unseren Gewohnheiten begrenzt zu werden und auch in dem, was wir uns hinsichtlich Kommunikation und zwischenmenschlichen Beziehungen wünschen. Vor allem den zahlreichen Äußerungen und geteilten Beiträgen in den sozialen Netzwerken nach zu urteilen, wurde vielen von uns zugleich bewusst, nach welchen Werten wir leben wollen. All die Unannehmlichkeiten, Reibereien, Streitigkeiten und manchmal auch Trennungen, die durch den belastenden Lockdown ausgelöst wurden, sollen durchaus nicht geleugnet werden, aber dennoch haben viele von uns …
gelernt, mehr mit sich selbst, mit allen Teilen der eigenen Persönlichkeit in Kontakt zu sein, und haben sich selbst besser kennengelernt, indem sie sich bereitwillig auf die zermürbenden Umstände eingelassen haben.
ihre Beziehungen zur Familie und zu ihren Lieben durch einen echten Austausch von Mensch zu Mensch vertieft, der sich um mehr drehte als nur um Dinge, die „zu tun“ sind.
die Leichtigkeit, Sanftheit und Kreativität (wieder)entdeckt, die sich aus einem entspannteren Verhältnis zur Zeit und einem vereinfachten Zeitplan ergeben. Viele Menschen hatten so die Muße, zu betrachten, wie im Frühling nach und nach alles aufblüht, in den Gärten der Stadt ebenso wie auf dem Land.
das Leben in einem ruhigen Tempo genossen; zu Hause, ohne Staus oder überfüllte öffentliche Verkehrsmittel, in einer reineren Luft, in der mehr Raum für Stille war.
ihre Einkäufe und damit ihre Ausgaben auf das Wesentliche (Lebensmittel und Unterkunft) beschränkt.
sogar den Übergang vom Kaufzwang zur glücklichen Genügsamkeit (wie Pierre Rabhi es ausdrückt) vollzogen – zumindest einige von uns.
sich Spiele, Geschichten, Gags ausgedacht und miteinander geteilt und alle möglichen Arten von Humor entfaltet.
überraschende inspirierende und verbindende künstlerische und musikalische Kreationen hervorgebracht ...
Dieses Buch ist eine Einladung, eine andere Haltung einzunehmen, und dort, wo wir stehen, mit den Mitteln, die wir haben, und seien sie noch so gering, ein Klima zu schaffen, das uns selbst gefällt und das sinnvoll und verlockend ist.
Viele Dinge sind zwar sinnvoll, aber nicht verlockend. Andere wiederum sind verlockend, aber nicht besonders sinnvoll. Träumen wir nicht alle davon, ebenso von der Lust auf etwas inspiriert und angetrieben zu werden wie vom Sinn? Diese beiden Aspekte sind meines Erachtens die Antriebskräfte unserer Lebensfreude und unserer Art des Miteinander. Wie können wir sie miteinander in Einklang bringen?
Ob Sie Kinder haben oder nicht, ob Ihnen etwas an Jugendlichen liegt oder nicht, ob Sie ihnen als Eltern oder Lehrer Ihr ganzes Leben oder nur einen Teil davon widmen, ob sie Ihnen gleichgültig sind oder Sie sich sogar über sie ärgern: Sie alle waren selbst einmal ein Kind, und schon allein deswegen könnte Sie die Frage, die dieses Buch stellt, interessieren. Denn: „Jüngere haben Erwartungen an Ältere, weil Letztere – so glauben sie – über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die ihnen verlockend erscheinen, und das macht jeden Erwachsenen zu einem potenziellen Erzieher.“1
Was sagen sich die Jugendlichen um uns herum, wenn sie sehen, wie wir unser Leben führen, unsere Werte verkörpern, Prioritäten setzen und die damit einhergehenden Frustrationen bewältigen; wie wir notwendigen Verzicht akzeptieren, den Alltag genießen und unseren Rhythmus finden, wie wir Freuden ebenso wie Leiden feiern; offen für Veränderungen sind, wenn es an der Zeit ist, und in Ruhe rechtzeitig eine neue Seite aufschlagen; wie wir unseren Platz mit Respekt vor anderen einnehmen und die unvermeidlichen Konflikte durchstehen? Wenn sie sehen, wie wir unser Erwachsenenleben führen, sagen sie sich dann, „Erwachsen sein ist super, ich kann es kaum erwarten; ich lerne und verändere mich in meinem eigenen Tempo, um mich dann eines Tages – ausgeglichen, im Einklang mit mir selbst und verantwortungsbewusst – freuen zu können, dass ich so bin, wie ich bin“?
Oder sagen sich viele Jugendliche angesichts des Verhaltens der Erwachsenen in ihrem Umfeld eher etwas anderes? Nämlich: „Die spinnen doch! Ständig sind sie in Hektik und machen Werte geltend, die sie selbst nicht leben. Zum Beispiel fordern sie Respekt, ohne sich selbst zu respektieren. Oder sie wollen, dass man ihnen zuhört, hören aber selbst niemandem zu. Sie sind in einem Tempo unterwegs, das ihnen nicht entspricht, beschweren sich über ihr stressiges Leben, tun aber nichts, um es wieder langsamer angehen zu können. Sie behaupten, dass sie von Ruhe träumen, und davon, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, organisieren aber trotzdem alles so, dass sie gestresst sind und sich verzetteln.“
Mit diesen Ausführungen möchte ich ermutigen und keinesfalls Schuldgefühle wecken, denn Schuld ist ein lähmendes Gift, wohingegen Verantwortung ein Vitamin ist, das belebt und Antrieb gibt. Ich habe Jahre gebraucht, um mich von meinen Schuldgefühlen zu entgiften und zur Vitalität der Verantwortung zu finden. Und ich habe nicht vor, in jenen emotionalen Aufruhr, in jene Spaltung-Zersplitterung-Verzettelung zurückzufallen, die immer dann entsteht, wenn wir Schuldgefühle bei uns selbst oder bei anderen erzeugen. Im Gegenteil, ich möchte dazu ermutigen, dass wir dem ersten Menschen, der uns anvertraut ist – also uns selbst, – Sanftmut und Wohlwollen entgegenbringen: uns selbst – was nicht ausschließt, dass wir uns selbst auch fordern. Stellen wir uns einmal vor, der Titel dieses Buches sei keine etwas unverblümte – wenn nicht gar bittere – Frage mehr, sondern eine strahlende Realität, die zudem übertragbar oder wechselseitig ist! Stellen wir uns vor, wir könnten uns bald froh beglückwünschen, ohne jeden Narzissmus, einfach, weil wir angesichts der zunehmenden Beweise objektiv feststellen: „Von nun an ist unsere Lebensweise, ob wir nun Jugendliche oder Erwachsene sind, für alle sinnvoll und verlockend!“
Damit wir eines Tages an diesen Punkt gelangen, halte ich es für sinnvoll, dass wir uns fragen, warum wir nicht schon dort sind. Wir sind auf dem Mond umhergelaufen, haben einen Tunnel unter dem Ärmelkanal hindurchgegraben, Hochgeschwindigkeitszüge erfunden, das weltweite Internet entwickelt und gelernt, alle möglichen Krankheiten zu heilen – weil wir es wollten, so entschieden haben und es angegangen sind. Warum entscheiden wir uns dann nicht für einfache, freudvolle, fließende Beziehungen zwischen allen Generationen? Das ergibt doch Sinn, finden Sie nicht? Und verlockend ist es auch. Warum nehmen wir diese Baustelle nicht in Angriff?
Schätzen Sie einmal kurz ein, wie viel unterstützende und tragende Energie im Spiel ist, wenn Sie etwas tun, das Sie sinnvoll finden und sich zutiefst wünschen. Wenn Sie … den Menschen, den Sie lieben, immer öfter treffen; sorgfältig ein Geschenk aussuchen, eine Geburtstags-Überraschungsparty planen, viele Jahre tapfer studieren, um den lang erwarteten Abschluss zu machen; arbeiten, um für die Sicherheit Ihrer Familie zu sorgen oder sich aus schwierigen Lebensumständen zu befreien; eine neue Sprache oder Sportart erlernen, für den nächsten Wettkampf trainieren, eine Reise organisieren, zu einem entspannteren Verhältnis zur Zeit gelangen; wenn Sie sich abends um Ihre lieben Kleinen kümmern, die Sie seit dem Morgen nicht mehr gesehen haben, und nachts aufstehen, wenn es nötig ist, randvoll mit unendlicher Zärtlichkeit ... Wenn Sinn und Verlockung zusammenkommen, haben wir eine wunderbare Energie, sanft und kraftvoll zugleich, die Berge versetzen kann.
Von welcher Art von Verlockung ist hier die Rede? Ich spreche nicht von flüchtiger Lust auf etwas, dem Ergebnis von Emotionen, die ihrerseits veränderlich und flüchtig sind wie Kräuselungen an der Wasseroberfläche; nicht von ziellosen Wünschen, die lediglich Ausdruck unserer Konditionierung oder unseres Egos sind, jenes Egos, das uns an der Leine führt, von Leckerbissen zu Leckerbissen, und unser tiefstes Wesen hungrig, ja sogar geschwächt zurücklässt. Ich spreche von jener tiefen Sehnsucht nach Leben, die uns durchweht und dauerhaft trägt, wie eine Unterströmung, wie eine magnetische Anziehungskraft, vielleicht sogar wie ein Ruf. Fassen Sie es in Ihre eigenen Worte, so wie der Philosoph Henri Bergson, der es als „Élan vital“ – Lebensschwung – bezeichnet. Dieses Prinzip des Élan vital stand im Mittelpunkt der Arbeit meines großartigen Freundes Guy Corneau2 und ist auch das Zentrum meiner eigenen Arbeit: Richten wir uns (wieder) auf unseren Lebensschwung aus, denn so sind wir freudiger, verantwortungsvoller, großzügiger und kreativer.
Und der Sinn? Ihn verstehe ich erstens als Richtung („Hier geht’s lang!“), zweitens als Bedeutung („Wir verstehen, warum!“) und drittens als Vernunft („Das ist wirklich plausibel!“).
Diese doppelte Polarität von Sinn und Verlockung erzeugt – richtig verstanden – eine Dynamik, die bei uns allen ganz natürlich von innen heraus entsteht. Sie hat deshalb den Vorteil, dass sie speziell uns zu eigen ist, und trägt so dazu bei, dass wir uns nicht von einem kollektiv vorgefertigten Mainstreamdenken – einer wahren Geißel unserer Zeit – verdummen lassen. Letzteres ist eher ein automatisiertes Mainstream-Nichtdenken, das uns zum Spielball werden lässt von nicht entschlüsselten Emotionen, Mehrheitsvorstellungen und -maßstäben, Moden und anderen von außen kommenden Vorgaben in allen möglichen Bereichen.
Würden wir uns im Leben nach dem richten, was sinnvoll und verlockend ist, dann könnten wir ohne zu zaudern und ohne weiteren Aufschub – für die Jugendlichen erkennbar – jene Werte verkörpern, nach denen wir leben wollen. So könnten wir junge Menschen dazu inspirieren, ihrerseits für die nachfolgenden Generationen zu inspirierenden Erwachsenen zu werden.
Einleitung
Dieses Buch richtet sich an alle, die das Leben und gute zwischenmenschliche Beziehungen wertschätzen, die ein tiefes, produktives und, falls möglich, ein Leben im Fluss führen wollen. Es richtet sich an diejenigen, die bereit sind, dafür ihre Interpretationen, Denk- und Glaubenssysteme, ihr Verhältnis zur Zeit, zum Haben und zum Sein neu zu betrachten. Und an alle, die beim Sprechen auf ihren Tonfall und ihr Vokabular achten, ebenso wie beim Zuhören auf ihre geistige Präsenz, damit sie nach und nach die Beziehungsqualität herstellen können, die ihnen am Herzen liegt. Das Buch basiert auf einem ähnlich betitelten Vortrag, den ich seit mehr als zehn Jahren halte. Natürlich gehe ich im Folgenden darauf ein, wie sich meine Überlegungen im Verlauf dieser Jahre entwickelt haben. Sie werden in dem Buch aber auch Geschichten, Fälle oder Bilder vorfinden, die Sie vielleicht schon an anderer Stelle von mir gelesen oder gehört haben – und das keineswegs deswegen, weil ich zerstreut oder senil wäre! Vielmehr liegt der Grund darin, dass all das sehr wesentliche Erfahrungen sind, denen ich viel zu verdanken habe.
Als im Februar 20013 mein erstes Buch erschien, war ich noch ein Anfänger-Papa. Ich hatte also den wunderbaren Dienst der Vaterschaft erst vor relativ kurzer Zeit angetreten und dieses neue Leben für mich entdeckt. Da überdies meiner Frau Valérie und mir sehr bewusst war, dass auch in unserem eigenen Inneren jeweils ein neuer Mensch „geboren“ und ein neues Verantwortungsgefühl geweckt worden war, beschlossen wir, die Annonce zur Geburt unseres ersten Kindes folgendermaßen zu formulieren: „Camille ist sehr glücklich, die Geburt ihrer Eltern am 1. Dezember 1998 bekannt zu geben.“ Damals, 2001, war Camille gerade zwei Jahre alt, unsere zweite Tochter Anna fast ein Jahr, und Jiulia, die letzte, wartete wahrscheinlich schon ungeduldig darauf, drei Jahre später bei uns zu landen.
Das ist heute mehr als 20 Jahre her. Bestimmte Geschichten haben während all dieser Jahre meinem Denken als Vater Nahrung gegeben und meine Einstellung inspiriert, und sie tun das immer noch. Von diesen Geschichten habe ich mich auch als Lehrender leiten lassen, auf der Suche nach einer möglichst lebendigen, sinnvollen Pädagogik. Einige davon sind meines Erachtens besonders aussagekräftig, um bestimmte thematische Aspekte des vorliegenden Buches zu veranschaulichen und unseren Bewusstwerdungsprozess weiter zu verfeinern. Falls Sie meine Arbeit schon etwas kennen, werden Sie einige der Geschichten im vorliegenden Buch wieder entdecken, wenn auch – hoffentlich – unter einem neuen Blickwinkel. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die acht Stockwerke des Turms von Pisa über eine Wendeltreppe erklimmen. Sie hätten achtmal eine Sichtachse, aber sie wäre jedes Mal höher, sodass Sie dieselben Dinge aus einem anderen Winkel, aus größerer Höhe und einer weiteren Perspektive sehen können. Dementsprechend hoffe ich, dass diejenigen, die schon etwas von mir gelesen und meine Vorträge gehört haben, ein solches Herangehen und die Überschneidungen nicht als Wiederholung empfinden werden und dass wir einige dieser ähnlichen Themen erkunden können, indem wir sie von einem anderen Treppenabsatz aus einem neuen Blickwinkel betrachten.
Darüber hinaus erforsche und vertiefe ich seit 25 Jahren bestimmte Themen, die im Mittelpunkt meiner Arbeit als therapeutischer Begleiter und Dozent stehen. Das, was ich seit über zehn Jahren mithilfe der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) und über diesen Ansatz hinausgehend vermitteln möchte, könnte man als Gewaltfreies Bewusstsein bezeichnen. Unsere Sprache und Kommunikation entsprechen unserem Bewusstsein: Ist es vollgepfropft mit Gewohnheiten und Mechanismen der Gewalt, dann hat es keinen Sinn, die Sprache der Gewaltfreien Kommunikation darüberzulegen! Denn das eigentliche Ziel der GFK ist nicht, einfach nur zu lernen, wie man die richtigen Worte benutzt, sondern sich für ein neues Bewusstsein zu öffnen, frei von den Konditionierungen und Programmierungen, die in Kapitel 1 beschrieben werden und die uns gewissermaßen in einer Art „infernalem Kerker4“ gefangen halten.
Und schließlich möchte ich vor allem dazu beitragen, Folgendes bekannt zu machen: Wir verfügen über ebenso beträchtliche wie bislang unbeachtete Ressourcen, die uns helfen, uns selbst besser kennenzulernen und besser zusammenzuleben. Diese Ressourcen zu entdecken erfordert einiges an Offenheit und Neugierde wie auch die Fähigkeit, uns selbst zu hinterfragen, und deswegen manchmal auch Mut. Um neue Fähigkeiten und Gewohnheiten zu entwickeln, muss man alte loslassen, Geduld aufbringen und entschlossen sein, und das ist nicht unbedingt bequem. Aus diesem Grund brennen zwar viele Menschen darauf, ihre Beziehungen zu verbessern und Einsamkeit, Hilflosigkeit sowie fortwährende Reibereien zu überwinden, doch nur wenige tun es am Ende auch. Denn dazu müssen wir bestimmte Gewohnheiten loslassen, an denen wir noch festhalten. Wie Bertrand Piccard sagt: „Eine Innovation besteht nicht so sehr darin, eine neue Idee zu haben, sondern sich von alten Glaubenssätzen zu lösen.5
Wir haben also sehr viel Macht, etwas zu bewegen, auch über unsere ängstlichen Überzeugungen hinausgehend. Oft reicht es schon, dass wir unsere Einstellung, unsere Art zu interagieren, ändern. Ich möchte jedoch klarstellen: Manche Situationen – insbesondere, wenn es um Kinder geht – können wir nicht aus eigener Kraft verändern, nicht zuletzt deswegen, weil wir nicht allein betroffen sind.
Zum einen kreuzen sich in jedem Menschen die verschiedensten persönlichen und familiären Geschichten (wir sind von Generation zu Generation wechselseitig miteinander verbunden). Daher brauchen wir vielleicht Hilfe, um all das unbewusste Erbe zu verstehen, das wir ungewollt und leider ohne Inventurliste erhalten haben. Das gilt ebenso für die Szenarien, die wir „heruntergeladen“ haben und unbewusst in uns tragen. Hier ist es von unschätzbarem Wert, den Mut aufzubringen und um Hilfe zu bitten, um dann bestimmte Knoten zu entwirren und den Vorfahren das zurückzugeben, was zu ihnen gehört. Es gibt heutzutage viele Ansätze zur Transformation und Heilung familiärer und generationenübergreifender Probleme, zur Bewältigung von Missbrauch und Traumata. Ebenso gibt es Verfahren zur Reinigung der Erinnerungen oder zur Arbeit mit Energien, die uns helfen können, das zu überwinden und uns von dem zu entlasten, was andernfalls einem Bann oder sogar einem Fluch gleichkommt.
Zum anderen liegt es daran, dass ein Kind möglicherweise mit einem bestimmten Naturell auf diese Welt kommt, das für Eltern und Gleichaltrige nicht leicht zu verstehen ist. Oft versuchen sie vergeblich, dieses kleine Wesen so zurechtzubiegen, wie ein Kind ihrer Auffassung nach sein sollte. Was macht diese Kinder aus, die manche als Indigo- oder Regenbogenkinder oder als Hochsensible bezeichnen? Ist es eine besonders ausgeprägte emotionale Intelligenz, eine Energie- oder Schwingungsebene, eine Rolle, die sie spielen, oder eine Lebensmission? Setzen Sie jeweils die Begriffe ein, die Sie möchten.
Ob wir dem nun skeptisch gegenüberstehen oder nicht, ob solche Vorstellungen uns fremd sind, uns stören, ob sich alles in uns dagegen sträubt oder ob sie uns in der Tiefe unseres Seins ansprechen: Viele Forscher und Autoren befassen sich heutzutage mit diesem Thema und sind sich offenbar darin einig, dass immer mehr Kinder heute in einem neuen Bewusstseinszustand auf die Erde kommen und sich deswegen kaum anpassen können, weder an die Schwerfälligkeit und Starrheit unserer Denksysteme noch an den erdrückenden Mangel an Kreativität, Visionen und Sinn in unseren Bildungssystemen und insgesamt auch nicht an die von diesen Systemen geschaffene Form der Gesellschaft. Viele Jugendliche, denen ich begegne, ersticken an dem materialistischen, konkurrenzorientierten System, das wir geschaffen haben und das sich auf Angst stützt: auf die Angst, dass es an etwas mangeln könnte (Zugehörigkeit, Anerkennung oder Ressourcen); die Angst, nicht mithalten zu können oder nicht gut genug zu sein (Dominanzbeziehungen und Wettbewerb); die Angst, keinen Job zu finden oder, wenn doch, ihn zu vermasseln ... Keine Energie hat eine derart negative Wirkung auf das Lernen wie die Energie der Angst: Sie führt u. a. zu Reizbarkeit oder Hyperaktivität, zu zwanghafter Aufschieberitis, zu mangelnder Beteiligung oder Nichterscheinen, zu Ersatzhandlungen, die das Nicht-entkommen-Können kompensieren.
Seit mehreren Jahrzehnten [...] – und derzeit in sehr großer Zahl – werden „andere“ Kinder geboren. Sie entsprechen nicht den „Normen“ der Kinderpsychiatrie, sie haben eine Art zu sein, eine Art zu schauen, die verstörend ist. [...] Sie bringen uns aus dem Konzept durch das, was sie sagen, durch ihre Reife, ihren Scharfblick [...]. Unser gesamtes Bildungs- und Schulsystem ist erwiesenermaßen nicht auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. In der Schule langweilen sie sich oft, vergeuden ihre Zeit, manche von ihnen werden zu „faulen Schülern“, obwohl sie über ein außergewöhnliches Potenzial verfügen.
Sie sind sehr sensibel, extrem feinfühlig und sie stören. […] Unzureichend betreut, in ihrer Besonderheit nicht anerkannt, können sie unkontrollierbar, unsozial, ja sogar kriminell werden.6
Unser kulturelles Erbe ist in Bezug auf Erziehung und Pädagogik zutiefst von einer rationalen, logischen Weltsicht geprägt, darum sind wir für eine solche Begegnung schlecht gerüstet. „Gegenwärtig trifft eine Mehrheit von ‚linkshirnigen Erwachsenen‘ auf eine Mehrheit von ‚rechtshirnigen Kindern‘, was im Zusammenleben und in der Verständigung nicht ganz ohne Probleme abläuft.“7 Ich persönlich bin zu folgender Überzeugung gelangt:
Das mitunter verzweifelte Streben mancher Jugendlicher nach dem, was für sie sinnvoll und verlockend ist, basiert auf einigen Verhaltensweisen, die wir Erwachsenen nur allzu gern schnell in eine Schublade stecken, weil wir uns nicht selbst hinterfragen, um herauszufinden, was wir sinnvoll und verlockend finden.
Eine größtmögliche Offenheit des Herzens und des Geistes, möglichst wenige vorgefasste Meinungen und Erwartungen und gleichzeitig wirklich präsent, aufmerksam und empathisch sein – das ist offenbar in vielen Fällen ein wichtiger Schlüssel, um zusammen zu leben und um zu erziehen.
Ein mögliches Offenwerden, das neuen Schwung, neuen Appetit auf Leben und auf „neue Nahrung“ hervorbringt, hängt weitgehend vom emotionalen Klima während der Adoleszenz ab. Die Beweggründe der Erwachsenen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ihr Interesse an dem, was sie tun, und darüber hinaus an den Entdeckungen, die das Leben mit sich bringt, ist wahrscheinlich für Jugendliche das, was sie am stärksten motiviert.8
* * *
Mit zwölf Jahren litt eine meiner Töchter unter dem ambivalenten Verhalten einer Lehrerin. Wir verstanden nicht sofort, was da passierte, und so ertrug sie die Situation, ohne richtig darüber zu sprechen, bis wir erkannten: Sie hatte wirklich ihre Lebensfreude, ihr spontanes Lachen, ihre Kreativität und Motivation verloren und geriet – sehr weit von ihrem fröhlichen Wesen entfernt – offenbar in eine depressive Phase.
Als wir ihr zuhörten, wurde uns klar, dass die Lehrerin in ihrer Sprache zwiespältig war, mit lähmender Wirkung auf die Kinder. Einerseits ermutigte sie die Schüler ausdrücklich dazu, sich am Unterricht zu beteiligen und sich einzubringen. Wenn jedoch eine Antwort nicht richtig war oder eine Äußerung nicht ihren Erwartungen entsprach, mokierte sie sich andererseits über die betreffenden Schüler, darüber, wie sie es nur wagen könnten, eine solche Antwort zu geben, das Thema sei doch in den vorangegangenen Unterrichtsstunden behandelt worden. So brachte sie die sensibelsten Kinder in seelische Not. Meine Tochter erzählte: „Sie verlangt von mir, dass ich mitmache, und das möchte ich auch wirklich tun, denn wenn ich versuche, eine Antwort auf etwas zu finden, macht mir das Lernen Spaß. Aber wenn ich es vermassle, haut sie mir eine schlechte Note rein ...“
Diese Lehrerin glaubte, die Schüler zu ermutigen, und erkannte nicht, dass sie sie abqualifizierte. Als ich sie aufsuchte, dankte ich ihr zunächst für ihre Konsequenz und ihren Anspruch auf inhaltliche Qualität, bevor ich sie unendlich taktvoll fragte, ob ihr klar sei, dass die Art und Weise, wie sie bestimmte Ansichten zum Ausdruck brachte, trotz ihrer sehr lobenswerten Absichten bei einigen Schülern Ängste hervorrief, so auch bei meiner Tochter. Und ich fügte hinzu, Angst sei aus meiner Sicht für das Lernen das kontraproduktivste Gefühl. Ich versuchte, Verbundenheit herzustellen, das „Wir“ zu nähren.
Ihre Antwort wirkte auf mich sehr scharf und defensiv, obwohl ich nach meinem Empfinden kein sehr aggressiver oder böswilliger Gesprächspartner bin: „Ich bin durchaus in der Lage, mich selbst infrage zu stellen, dafür brauche ich nicht die Meinung anderer.“ Dann brach sie das Gespräch ab und erhob sich hinter ihrem Schreibtisch, ohne sich auf eine weitere Diskussion einzulassen.
Ich gebe diese persönliche Begebenheit hier wieder – heute mit Empathie für die, wie mir scheint, große Unsicherheit dieser Frau –, weil ich weiß, dass es nicht nur eine individuelle Geschichte ist. Nein, sie veranschaulicht auch das althergebrachte und häufig immer noch gängige Muster des vorherrschenden Schulsystems.
Jeder Erzieher oder Lehrer, insbesondere wenn er sich in der Weitergabe seines Wissens bedroht und verunsichert fühlt, ist der Versuchung ausgesetzt, zu beherrschen und zu kontrollieren. Er wird dann Inhalte vermitteln wollen, die feststehen und über Jahrhunderte hinweg unantastbar geblieben sind, als garantiere ihr dauerhaftes Bestehen ihre Richtigkeit. Bei einer erzieherischen Tätigkeit ist Missbrauch eine immanente Gefahr [...].9
Ich weiß, dass viele Lehrende selbst unter institutioneller Gewalt leiden – was bis hin zu Burn-out und Depressionen führen kann. Glücklicherweise gibt es immer mehr Schulen, die sich selbst hinterfragen und wirklich in den Dienst des Lebens stellen. Das Schulsystem spiegelt jedoch (nach Aussagen der Familien, die ich dort treffe, wo ich hauptsächlich unterwegs bin: in Belgien und Frankreich) weitgehend das bislang vorherrschende Denksystem wider – und es ist an der Zeit, unser Unbewusstes von eben diesem System zu entkolonialisieren. Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Der Fokus liegt auf dem Ergebnis, dem Materiellen und darauf, es richtig zu machen, was im Gegensatz steht zum Fokus auf dem Selbstwertgefühl, der Freude am Lernen und einem guten Miteinander, bei dem die Beteiligten sich wohlfühlen.
Beziehungen basieren auf Macht, nicht auf Zusammenarbeit.
Vorherrschend ist Autorität über andere, nicht die gemeinsam mit anderen ausgeübte Autorität.
Es gilt die Einstellung, sich selbst zu schützen/andere zu dominieren, im Gegensatz zur Einstellung, die eigene Zerbrechlichkeit anzunehmen/die Andersartigkeit der anderen zu akzeptieren/Empathie zu entwickeln/zusammenzuwirken.
Die Haltung, als Wissender Nichtwissenden gegenüberzustehen, führt zu mangelnder Selbsthinterfragung, was im Gegensatz zu einem lernenden Miteinander steht.
Es besteht ein angespanntes Verhältnis zur Zeit.
Der Fokus liegt auf dem Individuum, intellektuellem Wissen und auf einer
Ich-sitze-den-ganzen-Tag-auf-dem-Stuhl-ohne-mich-zu-bewegen-
Haltung. Das steht im Gegensatz zu einer ganzheitlichen Sicht der Welt einschließlich einer bewussten Körperpräsenz (Atmen, Meditation, Yoga, Tai chi), zu körperlichem Ausdruck, Kunst, Kreativität und Erfindungsgeist (Gesang, Musik, Theater, Improvisation, öffentliches Sprechen und Deklamieren, Bildhauerei, Malerei, Modellieren und Werken); auch im Gegensatz zur Zugehörigkeit zu einer Gruppe und zur solidarischen Zusammenarbeit (kooperative Spiele, Sportarten mit gegenseitiger Hilfeleistung, wie Klettern; Heimwerken, Gartenarbeit, gemeinsames Erarbeiten eines Projekts).
Meine Tochter musste das Jahr wiederholen, weil sie in den betreffenden Fächern nicht die erforderlichen Noten erreicht hatte. Wir haben sie daraufhin in einer Schule angemeldet, in der es ein Bewusstsein dafür gibt, dass die Qualität der Beziehung Vorrang hat vor dem Ergebnis, denn die Qualität der Beziehung macht das Ergebnis überhaupt erst möglich. Im folgenden Jahr war sie stolz auf ihre Noten in besagten Fächern und auf die Freude der Lehrer über ihre lebhafte Teilnahme am Unterricht.
Was ich an dem gesamten Vorfall als das Bedrückendste empfand, war das, was mir die Direktorin der ersten Schule anvertraute: Sie sei sich zwar des Problems bewusst, da sehr viele Eltern Ähnliches geäußert hätten (ich selbst hatte etwa zehn solcher Aussagen gesammelt), sie könne aber dennoch nichts tun, um dieser Lehrerin zu kündigen, denn diese sei Beamtin auf Lebenszeit. Am aufschlussreichsten war für mich dagegen die Tatsache, dass unsere Tochter mit ihrem ganzen Wesen wusste, dass das Verhalten dieser Lehrerin weder schlüssig noch fair war. Meine Frau und ich erkannten beide, dass ihr Verhalten insgesamt dieses Bewusstsein ausdrückte: „Was ich hier erlebe, ist nicht richtig, und ich schalte lieber ganz ab, als dass ich mich zu sehr an dieses System anpasse, das weder Sinn ergibt noch verlockend ist.“ Genau dieses innere Unterscheidungsvermögen sollte durch Erziehung gefördert, nicht betäubt werden.
Wollen wir unsere Kinder in einem System, das sich als demokratisch versteht, immer noch zwingen, in ihren zartesten, sie für ihr ganzes weiteres Leben prägenden Jugendjahren die subtile Gewalt von Lehrern zu ertragen, die wahrscheinlich weder ihre eigenen Wunden geheilt noch ihre Affekte im Griff haben? Die sich wahrscheinlich ihrer selbst nicht bewusst sind, ebenso wenig wie der Gedanken, die ihre Haltung und ihren Tonfall steuern; und die zudem noch auf Lebenszeit verbeamtet sind? Ist das nicht erschreckend? Und ich schäme mich nicht, zuzugeben, dass mir beim Schreiben dieser Zeilen der Gedanke „auf Todeszeit verbeamtet“ in den Sinn gekommen ist.
Wie bereits im Vorwort erwähnt, habe ich das tägliche Leben von Einzelpersonen, Familien und Gruppen im Blick. Ich sehe die Einstellungen, Gewohnheiten und die Atmosphäre, aus denen tiefes Wohlbefinden, gemeinsame Freude, Sinn und Verlockung hervorgehen, sehe aber auch das, was Kummer, Leere, Einsamkeit und Hilflosigkeit erzeugt, ebenso wie die Aggressivität und den Missbrauch, die sich unweigerlich daraus ergeben, und zwar sowohl Menschen als auch anderen Lebewesen gegenüber (Tiere und die gesamte Natur).
Ich bin weder Historiker noch Soziologe und behaupte nicht, dass die Dinge anderswo oder in der Vergangenheit schlechter oder besser sind oder waren. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt etwas tun, dort, wo wir stehen.
Und es geht weniger darum, anders zu handeln, als vielmehr darum, anders zu sein.
1. Unsere Denkgewohnheiten und Programmierungen erschaffen unsere Welt: Ändern wir sie – und wir verändern die Welt
„Wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast.“ (Paul Watzlawick)
Unsere Welt mit all ihren beklagenswerten Ungereimtheiten, ihrer Zersplitterung, ihrer Hetze und ihrem Stress, ihrer alltäglichen Brutalität und wiederkehrenden Gewalt, ihrer Oberflächlichkeit und ihrem Materialismus – diese Welt haben wir selbst erschaffen. Sie entspricht unseren Überzeugungen und Vorstellungen vom Leben, von der Natur, vom Menschen und davon, in welchem Verhältnis diese verschiedenen Bereiche zueinander stehen. Aufgrund unserer Denkweise haben wir Dinge auf eine bestimmte Art und Weise getan, haben unsere Organisationen und Strukturen geschaffen und Machtausübungsmuster und Entscheidungsprozesse etabliert. Dieselbe Denkweise lenkt unsere Sprachgewohnheiten. Sie hat Einfluss darauf, ob wir mit anderen eher zusammenarbeiten oder ihnen etwas aufzwingen, ob wir dienen oder ausnutzen, teilen oder an uns reißen.
Nun ist es aber so, dass die Grundlagen für die Organisation unseres Gehirns in den ersten Lebensjahren gelegt werden: Es entstehen neuronale Systeme und Bahnen, und aus dieser enormen Vernetzungsarbeit geht die grundlegende Organisation des Denkens und Fühlens hervor. Ein Kind behält die am häufigsten genutzten synaptischen Verbindungen bei – diejenigen, die durch regelmäßig wiederholte Erfahrung gestärkt werden –, während die seltener genutzten Verbindungen schwächer werden und verschwinden. Diesen Prozess bezeichnet man als Neuroplastizität.
Aber halten wir Folgendes fest: Das Gehirn achtet nicht auf die Qualität dessen, was es löscht oder behält, sondern es verstärkt nur die am häufigsten gemachten Erfahrungen und eliminiert die anderen. Uns sollte absolut klar sein: Die Plastizität des kindlichen Gehirns verfügt nicht über ein kritisches Urteilsvermögen. Sie nimmt die Umwelt so an, wie diese sich ihr darbietet, ohne zu bewerten [...] Wie wir uns im Alltag geben, unsere Art zu sprechen, zu reagieren, was wir mit dem Kind tun, all das ist im wahrsten Sinne des Wortes an der Verdrahtung seines Gehirns beteiligt. Wir tragen daher eine immense Verantwortung. Unsere Einstellung bereitet die Einstellung der Kinder vor.10
Die Autorin dieser Zeilen, Céline Alvarez, führte ein Experiment in einer französischen Vorschule durch. Die Schule befand sich in einem bildungspolitischen Schwerpunktgebiet (ZEP; zone d’éducation prioritaire), wo ein Plan zur Gewaltbekämpfung („Plan Violence“) Anwendung fand. Céline Alvarez respektierte „die natürlichen kindlichen Gesetzmäßigkeiten“, und ihre außergewöhnlichen Ergebnisse zeugen von der uns allen eigenen erstaunlichen Fähigkeit zur Veränderung. Sie ermutigen dazu, das Wagnis einzugehen, anders zu denken, um anders zu erziehen, und zwar von frühester Kindheit an.
Vielleicht kennen Sie den diesem Kapitel vorangestellten Ausspruch von Paul Watzlawick. Ich zitiere ihn regelmäßig, weil er den Schlüssel zur Veränderung bereithält: Wenn wir in unseren Beziehungen etwas anderes erreichen wollen – egal, ob in der Beziehung zu einem (Ehe-)Partner, zu einem Kind, zu Schülern oder Studenten (wie überdies auch in unserer Beziehung zu Besitz, Konsum oder Geld, zum „Haben“, zur Erde und zu den natürlichen Ressourcen ...) – dann müssen wir etwas anderes tun. Und darin sind wir uns alle einig: Es ist wirklich nötig, dass wir etwas anderes tun. Aber wie können wir etwas anderes tun, wenn wir dasselbe denken? Das ist schlicht unmöglich. Und deshalb liegt der Schlüssel zur Veränderung darin, unser Denksystem infrage zu stellen, damit wir etwas anderes tun und etwas anderes bewirken können.
Warum sind unsere Beziehungen nicht so, wie wir sie uns erträumen: wahrhaftig, tief, produktiv und fließend?
Uns Menschen reicht es nicht allein, zu überleben und unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Wir träumen darüber hinaus von wahrhaftigen, tiefen, produktiven und fließenden Beziehungen. Wir haben genug von unechten Beziehungen, die von Heuchelei, Phrasendrescherei, Hintergedanken und Machtspielen geprägt sind; wir möchten wahrhaftige Beziehungen. Wir haben genug von oberflächlichen Beziehungen, in denen das, worum es wirklich geht, nicht angesprochen und vermieden, verschleiert oder verleugnet wird; wir wünschen uns tiefe Beziehungen. Wir haben genug von sterilen Beziehungen, von Klatsch und Tratsch, Blablabla und anderem Smalltalk, der zu nichts führt und bei dem wir uns überhaupt nicht wohlfühlen; wir wollen im besten Sinne produktive Beziehungen. Wir haben genug von – manchmal durchweg – ärgerlichen und deshalb konfliktreichen Beziehungen; wir träumen von Beziehungen, die im Fluss sind – oder von Beziehungen, die wir ohne allzu große Schwierigkeiten wieder ins Fließen bringen können.
Höchstwahrscheinlich gibt es Milliarden von Menschen, die mit ihrem ganzen Wesen nach solchen viel nährenderen, freudvolleren und inspirierenderen Beziehungen streben. Was hält uns alle davon ab, diesem Streben nicht allererste Priorität zu geben? Was blockiert, untergräbt oder sabotiert unsere Initiative, wenn nicht gar unseren Unternehmungsgeist?
Seit mehr als 25 Jahren begleite ich Menschen durch die Zyklen und „Jahreszeiten“ des Daseins, durch das Auf und Ab des Lebens. In dieser Zeit bin ich zu der folgenden Überzeugung gelangt: An vielen Verhaltensweisen, Gedanken und Überzeugungen halten wir einfach aus Gewohnheit fest und nicht etwa, weil wir sie bewusst als nutzbringend einschätzen. Einige dieser Gewohnheiten haben uns manchmal gute Dienste geleistet, und so halten wir an ihnen fest, auch wenn sie uns heute schaden. Es kann sogar passieren, dass Menschen (und beinahe hätte auch ich dazugehört) in einem Zustand verharren, in dem es ihnen schlecht geht; er ist aber trotz allem für sie eine Komfortzone. Sie bringen nicht den Mut auf, einen Zustand herbeizuführen, der anfangs naturgemäß ungewiss ist, in dem es ihnen aber mit der Zeit gut gehen wird. Da die Gewohnheiten – und sei es nur zeitweise – einen Nutzen hatten, sehen wir nicht, mit welchem „Fluch“ sie beladen sind. In Bezug auf unsere Beziehungen im Allgemeinen und in Bezug auf erzieherische Beziehungen im Besonderen sind wir oft so sehr in Gewohnheiten gefangen, dass uns noch nicht einmal in den Sinn kommt, wie nützlich und vielversprechend die Verbesserung unserer Beziehungen sein könnte. Wir glauben nicht, dass wir nennenswert etwas daran ändern können, wie wir miteinander umgehen, und das liegt hauptsächlich daran, dass wir noch nicht einmal darüber nachdenken! In der festen Überzeugung, unsere Gedanken seien frei, wiederholen und durchlaufen wir unsere Automatismen wie eine programmierte Software.
Fünf Programmierungen und Mechanismen, die uns in unseren Beziehungen und unserer Entwicklung blockieren
„Ungedacht“ nenne ich das, von dem ausgehend man denkt und das man eben deswegen nicht denkt: das, worauf das Denken sich stützt.“ (François Jullien)
Bei meiner Arbeit habe ich mindestens fünf weitverbreitete Gewohnheiten, automatische Denkweisen, Überzeugungen oder Programmierungen identifiziert, die die Qualität der Beziehungen und des Lebens, die wir uns erhoffen, erheblich beeinträchtigen können – und zwar nicht nur auf der persönlichen oder zwischenmenschlichen Ebene, sondern auch kollektiv. Diese Gewohnheiten haben wir so tief verinnerlicht, dass wir sie nicht mehr sehen; wir ahnen noch nicht einmal, dass sie unser Denken und Verhalten steuern und unsere Entscheidungen leiten ...
Wir wissen natürlich, dass wir beim Erlernen unserer Muttersprache nicht nur Wörter verinnerlichen, die die Realität der Dinge und Vorstellungen erfassen, sondern auch eine Denkweise, die dies ebenfalls tut und die bestimmt, wie wir uns ausdrücken, wie wir zuhören, uns verhalten und welche Einstellung wir haben. In seinem Roman 1984 hat George Orwell eine Welt ersonnen, in der aus der vom totalitären Staat auferlegten Sprache Newspeak (oder Neusprech) bestimmte Wörter herauszensiert wurden – insbesondere alle Hinweise auf individuelle Freiheit –, um zu verhindern, dass revolutionäre Gedanken aufkommen. Da kein Wort für Freiheit existiert, ist es, als gäbe es sie nicht. Die Sprache ist Ausdruck unseres Bewusstseins. So sind wir alle in einem bestimmten Sprachsystem aufgewachsen und haben dementsprechend Denkgewohnheiten und Überzeugungen verinnerlicht, die in unserer Art des In-Beziehung-Seins Automatismen auslösen können. Als regelrechte Selbstblockademechanismen können sie jegliche Weiterentwicklung verhindern.
Es gibt kein reines Denken, denn das Denken ist immer Teil eines Systems, das den Rahmen der Analyse, der Argumentation und des Verhaltens vorgibt. Das wissen wir zwar, aber „wir glauben nicht, was wir wissen“11 – um hier die treffende und zugleich etwas verblüffende Formulierung des Philosophen Jean-Pierre Dupuy zum Thema globale Erwärmung und Risiken des Zusammenbruchs natürlicher Systeme zu verwenden. Wir meinen, frei zu denken und zu sprechen, obwohl wir von Worten und den Gedanken, die die Worte hervorbringen, geführt werden wie eine Straßenbahn, die ihren Schienen folgt. Solche Bahnen können sich als tragisch erweisen: als unbewusste infernale Gefangenschaft 12.
Professor Daniel Favre erinnert in seinem Buch L’addiction aux certitudes an diese Starrheit, ja Unbeweglichkeit, indem er aufzeigt, wie sehr wir Gefangene unserer Gedanken sind, obwohl wir glauben, wir seien frei: „Das Denken blockiert sich selbst und blockiert das Aufkommen neuer Ideen.“13 Das geht so weit, dass selbst in der Wissenschaft – von der man sich doch eine größere Offenheit und Zugänglichkeit gegenüber Neuem erhoffen könnte – „bestimmte Theorien trotz der Fakten, die sie widerlegen, weiterbestehen“.14 Daniel Favre beschreibt dieses Phänomen als eine manchmal auch kollektiv auftretende Art der Hypnose: Vom Dogmatismus bis hin zum Fanatismus – wir halten an Vorstellungen fest, die falsch und veraltet sind, und wollen genau das nicht sehen. Diese Vorstellungen zu hinterfragen ist nämlich etwas sehr Beängstigendes, das uns aus unserer Komfortzone herausführen könnte. Er fährt fort:
Erfahrungsgemäß hängen wir alle einmal emotional an einer Vorstellung, sei es im Bereich der Physik, der Psychologie, der Wirtschaft oder der Spiritualität [...] In den banalsten Alltagsmomenten kann sich dieses Festhalten an Vorstellungen zeigen [...] Ist es uns also überhaupt möglich, zu denken, ohne von unseren Gedanken vereinnahmt zu werden, und zuzuhören, ohne in eine emotionale Trance zu verfallen, die uns unseres freien Willens beraubt?15
Wenn wir unsere Erziehungsgewohnheiten ändern wollen und auch etwas an dem, wie wir etwas weitergeben – und was –; wenn wir von Kindheit an die von uns angestrebte Art der Beziehung mitgestalten wollen, dann müssen wir unbedingt möglichst genau und bewusst hinsehen. Wir müssen bestimmte stark verbreitete Programmierungen als das erkennen, was Professor Favre „kollektive hypnotische Trance“ nennt, um sie dann aufzulösen.
Durch diese Wachsamkeit können wir auch die Gefahr der „Normose“ abwenden, die so viele Erwachsene außer Gefecht setzt und zahlreiche junge Menschen demotiviert, denn sie betäubt das Gefühl, lebendig zu sein. Der Begriff „Normose“ (normosis) wurde von dem Sozialpsychologen Pierre Weil geprägt, der feststellte, dass „ein großer Teil der Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen, über die ein allgemeiner Konsens besteht, uns diktieren, was ‚normal‘ ist, und uns in Wirklichkeit zu einer Normose führen. Denn solche Übereinkünfte stellen ebenso viele Formen sozialen Drucks dar, die das Individuum auf die eine oder andere Weise zwingen, sich an anormale Normen anzupassen.“16 Ein kleines Beispiel: Im Schulsystem gilt ganztägiges Stillsitzen als normal; es ist jedoch unnatürlich und läuft dem Lebensschwung zuwider. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass wir, die wir so sehr gegen unsere Natur erzogen wurden, es als „normale“ Lebensweise ansehen, jeden Morgen im selben Stau zu stehen und das ganze Jahr über vor dem Bildschirm zu hocken. Unser Denken verengt sich so sehr, dass wir nicht mehr erkennen, worauf es wirklich ankommt. Wir lassen zu, dass das Gewohnte wichtiger wird als das Sinnvolle, dass das „Normale“ das Lebendige erstickt und Langeweile sich als Lebensweise etabliert.
Im Folgenden stelle ich fünf von den vielen kollektiven Programmierungen vor. Meines Erachtens sind sie echte Selbstblockademechanismen, nicht nur in unserem individuellen Leben und in unseren erzieherischen Beziehungen, sondern auch in unserer kollektiven Emanzipation.