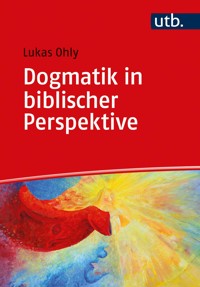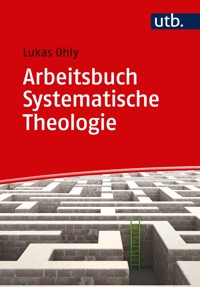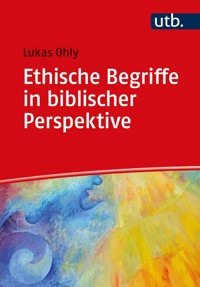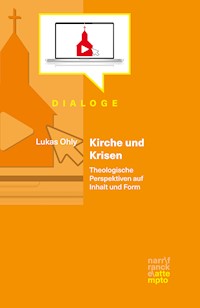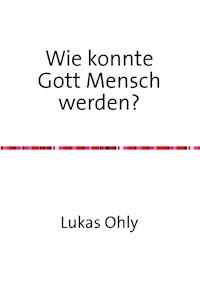
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Buch rekonstruiert Stärken und Schwächen klassischer Denkmodelle zu den zwei Naturen Jesu Christi in der Theologiegeschichte. Dabei werden alle Autoren konstruktiv weitergeführt, ihre blinden Flecken aufgezeigt und Lösungen skizziert. Neben drei typischen Modellen der Alten Kirche werden die innerreformatorischen Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts untersucht. Den Schwerpunkt bilden aber die Modelle von Theologen des 20. und anfangenden 21. Jahrhunderts. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Studierende der Theologie, Religionswissenschaften und für alle, die dem Kern christlicher Modellentwicklung auf die Spur kommen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Wie konnte Gott Mensch werden?
16 Modelle der christlichen Zweinaturenlehre
Lukas Ohly
published by epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
© Lukas Ohly
ISBN 978-3-8442-8272-6
Inhaltsverzeichnis
Einleitung. 2
Nestorius von Konstantinopel – Die phänomenologische Einheit von Gott und Mensch 6
Kommentar und Weiterführung. 9
Cyrill von Alexandrien – Untereinander angeordnete Naturen. 13
Kommentar und Weiterführung. 17
Das Chalcedonense – Das personale Bestimmtwerden durch Anderes. 22
Kommentar und Weiterführung. 24
Die lutherische Interpretation der Communicatio Idiomatum.. 29
Kommentar und Weiterführung. 33
Johannes Calvin – Das Extra-Calvinisticum.. 40
Kommentar und Weiterführung. 45
Friedrich Schleiermacher – Die Einheit des Prozesses mit dem Gehalt 48
Kommentar und Weiterführung. 55
Karl Barth – Der Vorrang des Werdens vor dem Sein. 61
Kommentar und Weiterführung. 65
Paul Tillich – Das Neue Sein als Symbol Gottes. 70
Kommentar und Weiterführung. 74
Gerhard Ebeling – Die Einheit in der Relation. 81
Kommentar und Weiterführung. 84
Wolfhart Pannenberg – Die Identität eines abgeschlossenen Prozesses. 90
Kommentar und Weiterführung. 94
Jürgen Moltmann – Die Vereinigung der Personen in einer Natur 99
Kommentar und Weiterführung. 103
Friedrich-Wilhelm Marquardt – Israel als Integral von Gott und Mensch. 109
Kommentar und Weiterführung. 116
Ingolf U. Dalferth – Der einheitliche Referenzrahmen des Handelns Gottes. 120
Kommentar und Weiterführung. 125
Wilfried Härle –Was Wesen und Erscheinung verbindet 130
Kommentar und Weiterführung. 135
Dietrich Korsch – Die Unbedingtheit von Selbst- und Weltverhältnis in der richtigen Form 139
Kommentar und Weiterführung. 144
Hermann Deuser – Verschlungene Repräsentationen. 149
Kommentar und Weiterführung. 154
Schluss: Tendenzen der christologischen Modelle. 157
Einleitung
Bestimmt hätte Gott auch einfach irgendjemanden von den Toten auferwecken können. Spätestens zu diesem Zeitpunkt käme aber die Frage auf, wie viel von seinem Menschsein dann noch übrig geblieben wäre. Dieselbe Frage reicht ins Leben dieses Menschen, sobald seine Auferweckung in Zusammenhang zu seinem Leben steht. Wenn es dieser Mensch gewesen ist, der aus Nazareth kam, einige Jahre um den See Genezareth herumstrich, um dort das Reich Gottes anzusagen – und der dann schließlich von Gott auferweckt wurde, dann wird der Zusammenhang fraglich zwischen seinem Menschsein und dem, was durch seine Auferweckung von seinem Menschsein übrig geblieben wäre. In einer zeitlichen Abfolge lässt sich dieser Zusammenhang nicht darstellen: Denn nehmen wir einmal an, dieser Mensch wäre bis zu seinem Tod ein Mensch gewesen und nach seiner Auferweckung zu einem anderen Wesen verwandelt worden. Welche ontologische Basis besteht dann noch, in beiden Stadien von demselben Wesen zu sprechen? Selbst eine Referenztheorie, die auf einen und denselben Gegenstand referiert[1], ohne dabei auf seine Eigenschaften Bezug zu nehmen, führt hier nicht weiter. Denn dazu müssten zumindest die faktischen Bedingungen, unter denen wir einen Gegenstand erstmalig identifizieren, auf alle kontrafaktischen Situationen zutreffen, in denen wir noch von ihm reden und auf ihn referieren.[2] Dann wäre also dieser Auferweckte immer schon ein anderes Wesen gewesen. Und das heißt, dass er entweder nie ein Mensch war (Doketismus) oder dass er eine Art Zwitterwesen zwischen Mensch und Übermensch ist.
Nehmen wir dagegen an, es sei einem Menschen möglich, von den Toten aufzuerstehen. Dabei sei nicht eine Rückkehr ins irdische Leben gemeint, sondern eine Existenzweise, die mit den traditionellen Begriffen „Himmelfahrt“ und „Sitzen zur Rechten des Vaters“ verknüpft ist. Immerhin nehmen Christen an, dass sie auch einmal von den Toten auferstehen werden. Dann besitzen Menschen also mögliche Eigenschaften, die sie zurzeit noch nicht realisieren können aufgrund ihrer spezifischen menschlichen Natur. Verändert sich dann nicht ihre Natur, sobald sie von den Toten auferstehen? Wenn sie sich aber nicht verändern soll und dennoch die Auferstehung für die menschliche Fortexistenz nach dem Tod wesentlich ist, so muss eine naturinterne Differenz unterstellt werden: Es verträgt sich dann mit der menschlichen Natur, dass sie Eigenschaften annehmen kann, die sie verändern, ohne dass sie dabei eine andere Natur wird. In diesem Fall muss die Identität der Menschen durch etwas sichergestellt werden, das nicht ihre Natur allein sicherstellen kann, aber doch mit ihr vereinbar ist. Diese Strategie verfolgt die christliche Zweinaturenlehre.
Die Zweinaturenlehre ist das ontologische Zentrum des christlichen Glaubens. Sie erschöpft sich nicht nur in der Frage, wie Jesus sowohl Gott als auch Mensch sein konnte. Denn wie wir eben gesehen haben, schließen zentrale Motive des christlichen Glaubens ein Wirklichkeitsverständnis ein, in dem auch unser Menschsein auf dem Spiel steht. Die Aussage, dass Gott Mensch wurde, ist zwar nicht der historische Ausgangspunkt des christlichen Glaubens, sondern die Erfahrung der Auferstehung Jesu von den Toten. Es ist aber folgerichtig, das Verhältnis seines Menschseins mit seinen Eigenschaften zu reflektieren, die seit seiner Auferstehung hinzugekommen sind. Dass Gott Mensch wurde, reflektiert also in geltungslogischer Hinsicht das Erste, während die Auferstehung Jesu dann das Zweite ist.
Damit ist aber nur das Problem formuliert und noch nicht gelöst. Wie Gott Mensch werden konnte, ohne beides zu relativieren oder in einem Dritten („Zwitter“) aufzuheben, ist die entscheidende Herausforderung der christlichen Ontologie. Es geht um nichts weniger als um das Zusammensein Gottes bei den Menschen: Wie kann Gott bei seiner Schöpfung sein, ohne selbst zum Geschöpf zu werden? Wie kann er Mensch werden, ohne seine Gottheit aufzugeben? Dieses Problem werde ich im Fortgang das „Problem der Zweinaturenlehre“, das „Zweinaturenproblem“ oder das „christologische Problem“ nennen.
In diesem Buch habe ich 16 theologische Modelle zur Zweinaturenlehre konstruktiv dargestellt. Ich lasse es also nicht dabei bewenden, diese Modelle nachzuerzählen. Vielmehr benutze ich sie als Werkzeuge, um das Herzstück der Ontologie des christlichen Glaubens zu entfalten. Insofern werden meine Interpretationen manchem Leser etwas kühn vorkommen. Ich bohre tief, um Aufschluss über das Wirklichkeitsverständnis des christlichen Glaubens zu bekommen, das in diesen Modellen zum Ausdruck gebracht wird. Jedes Modell wird daher etwa in gleichen Anteilen einen schwerpunktmäßig referierenden Abschnitt und eine kritische Weiterführung enthalten. Doch selbst diese Abschnitte sind nicht methodisch klar getrennt, sondern geben nur eine Tendenz meiner Interpretationsarbeit wieder. Theologische Fortgeschrittene werden teilweise andere Schlüsse ziehen, als ich es tue. Falls es so ist, so handelt es sich auf meiner Seite um ein produktives Missverstehen der Sache wegen. Nicht primär der jeweilige Autor soll zu seinem Recht kommen, sondern die Sache, die er meint.[3]
Dieses Buch ist zugleich mit einer hohen Wertschätzung für die geistigen Werke der behandelten Autoren verbunden. Ich teile sie nicht ein in orthodoxe und häretische Autoren und fühle mich in der Interpretation einer bestimmten konfessionellen Prägung aus methodischen Gründen nicht verbunden. Glücklicherweise sind die Zeiten überwunden, in denen Theologen mit ihrem Denken riskierten, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Diese sachliche Entkrampfung führt dazu, dass sie auf Augenhöhe zueinander behandelt werden können. Zugleich kann spielerisch mit ihren Gedanken umgegangen werden. Die Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Autor war für mich außerordentlich fruchtbar, weil ich das Wahrheitsinteresse jedes einzelnen Modells stark gespürt habe. Deshalb habe ich stets in meiner Weiterführung versucht, das jeweilige Modell so weiterzuentwickeln, dass es so stark wie möglich wird und das Problem der Zweinaturenlehre möglichst umfassend löst. Diese Weiterführungen sollen jeweils meine Wertschätzung für die Autoren bezeugen. Deshalb werde ich versuchen, aus ihren eigenen Modellressourcen schlüssige Fortentwicklungen zu generieren. Ich halte Theologie für Modellierungsarbeit[4], weswegen ich frei, spielerisch und konstruktiv mit theologischen Lehrentwicklungen umgehe.
Bei der Auswahl der Autoren liegt der klare Schwerpunkt in der Modellentwicklung der deutschsprachigen evangelischen Theologie des 20. Jahrhunderts. Die übrigen Autoren oder die Konzilsentscheidung von Chalcedon sind dagegen vor allem aus hermeneutischen Gründen ausgewählt worden, um eine grobe Linie zur methodischen Herangehensweise zu ziehen, wie sie die Theologie im 20. Jahrhundert prägt. Paradigmatisch für die christologische Lehrentwicklung war der sogenannte nestorianische Streit zwischen dem Bischof von Konstantinopel Nestorius und dem alexandrinischen Bischof Cyrill im 5. Jahrhundert. In der Folge führte er zum zentralen christologischen Dogma von Chalcedon im Jahr 451. Diese drei Modelle werden jedoch weitgehend für sich untersucht, ohne auf den kirchengeschichtlichen und politischen Kontext einzugehen. Auf diese Weise soll jedes Modell vorbehaltlos auf seine Stärken hin untersucht werden.
Eine zweite zentrale theologiegeschichtliche Auseinandersetzung zeigt sich in den innerreformatorischen Meinungsverschiedenheiten zur Präsenz Christi beim Abendmahl. Ihnen liegt zwar das gemeinsame Modell der Communicatio Idiomatum zugrunde, das im entsprechenden Kapitel auch als hermeneutische Folie der Christologie untersucht und gewürdigt werden soll. Lutheraner und Reformierte brachten darüber hinaus unterschiedliche Innovationen ein, die eine eingehende Untersuchung wert sind. Zuletzt rundet der Blick auf Friedrich Schleiermachers christologischen Ansatz aus dem 19. Jahrhundert den historischen Ausflug ab. Schleiermachers Ansatz ist im ausgehenden 20. Jahrhundert vor allem von Dietrich Korsch aufgenommen und weiterentwickelt worden.
Dieses Buch soll als Lehr- und Arbeitsbuch zur eigenen intensiveren Beschäftigung mit den Primärtexten einladen. Deshalb habe ich weitgehend auf den Verweis von Sekundärliteratur verzichtet. Am ehesten bringe ich ihn in der Darstellung der altkirchlichen Texte ein, da es sich zum einen um fremdsprachige Texte handelt, die oft ungenau übersetzt sind (bei Cyrill) oder nur sehr fragmentarisch vorliegen (bei Nestorius). Sekundärliteratur hat hier eine korrektive Funktion und wird auch nur darauf beschränkt. Ansonsten aber möchte ich meine Interpretation an den Primärtexten direkt vornehmen, um den Lesern den Einstieg zu erleichtern, ihre Beobachtungen direkt an den Texten abzugleichen, ohne vorher ein Gestrüpp von Sekundärverweisen abgehen zu müssen. – Für die intensivere Beschäftigung mit den Autoren findet sich hin und wieder ein Exkurs über die literarische Abhängigkeit eines Modells von bestimmten philosophischen Richtungen – dies trifft vor allem auf meine Darstellung von Paul Tillich und Hermann Deuser zu. Solche Exkurse sollen Denkfiguren leichter nachvollziehbar machen und Anschlusspunkte für eine vertiefende Beschäftigung setzen, sind aber ansonsten für die Erstbegegnung mit den Texten entbehrlich.
Am Anfang jedes Kapitels stelle ich einen oder zwei Literaturtipps voran, in denen sich die Leser „aus erster Hand“ über das jeweilige christologische Modell informieren können. Dabei wird auffallen, dass ich jeweils nur relativ kurze Abschnitte als zentrale Textstellen vorschlage. Zwar habe ich die vorgeschlagene Textauswahl auf die wichtigsten Passagen komprimiert, um den Lesern eine schnelle Übersicht in der Primärliteratur zu erleichtern. Dennoch überrascht, dass sich die neuzeitlichen Autoren – Schleiermacher eingeschlossen – mit dem Zentrum des christlichen Wirklichkeitsverständnisses nicht annähernd intensiv beschäftigen wie noch die Theologie bis ins Zeitalter der Reformation. Das ist ein überraschender Befund, der darauf hindeutet, dass die Probleme neuzeitlicher christologischer Lehrbildung anders gelagert erscheinen und man von der Zweinaturenlehre weniger Lösungspotenzial für diese Probleme erwartet. Fragt man etwa nach dem Sinn des Kreuzestodes, so wird in erster Linie das Theodizeeproblem berührt. Fragt man nach der Möglichkeit von Auferstehung, so werden anthropologische und/oder naturwissenschaftliche Fragen gestellt. Allerdings zeigen die behandelten Autoren, dass ihr methodischer Weg auch Konsequenzen für die Auffassung der Zweinaturenproblematik hat. Ich stelle deshalb die umgekehrte These auf, dass eine konsequente Bearbeitung des Zweinaturenproblems auch Horizonte eröffnet, wie das Kreuz Christi theologisch zu entschlüsseln ist und wie seine Auferstehung von den Toten möglich ist.
Zitatangaben aus den Quellen, denen die vorgeschlagenen Textpassagen entnommen sind, werden im Haupttext erscheinen, während die übrige Literatur wie üblich als Anmerkungen aufgeführt werden.
Als Lehr- und Arbeitsbuch ist dieses Buch nicht darauf angelegt, dass es kontinuierlich in eine Richtung gelesen wird. Ich selbst habe die Kapitel nicht in der chronologischen Reihenfolge geschrieben, wie sie jetzt vorliegen. Die Leser können sich ihre „Rosinen rauspicken“. Sie können sich sowohl auf die Autoren konzentrieren, die sie besonders interessieren, als auch sich entscheiden, ob sie ausschließlich referierende Abschnitte lesen möchten oder ein jeweiliges Gesamtkapitel. Kundige Leser werden bei ihrer Lektüre ihren Schwerpunkt in meiner konstruktiven Weiterführung setzen. Das Buch gibt keine fertigen Antworten, sondern gibt einen Werkstattbericht für eine Arbeit, die es wert ist, fortgesetzt zu werden.[5]
Nestorius von Konstantinopel – Die phänomenologische Einheit von Gott und Mensch
Brief des Nestorius an Cyrill; in: P.-Th. Camelot: Ephesus und Chalcedon. Geschichte der ökumenischen Konzilien Bd. II; Mainz 1963, 225– 228; Tragoedia oder Historia; in: F. Loofs (Hg.): Nestoriana. Die Fragmente des Nestorius; Halle 1905, 203–208 (Fragment); im Folgenden T abgekürzt
Von Nestorius liegen nur wenige Dokumente vor, die zudem oft fragmentarisch sind. Manche Dokumente warten noch auf eine Übersetzung. So liegt das größte Fragment, die Tragoedia, in syrischer Sprache vor und ist wiederum nur teilweise durch Referate anderer altkirchlicher Theologen ins Griechische oder Lateinische übersetzt worden. Daneben lässt sich seine Position einigermaßen rekonstruieren durch die gedankliche Auseinandersetzung mit ihm, die Cyrill von Alexandrien vor allem mit dem Buch „Quod unus sit Christus“ nach dem Konzil in Dialogform nachträglich nochmals geführt hat.[6] Der geringe Quellbestand ist auf die Verurteilung des Nestorius auf dem Konzil von Ephesus im Jahr 431 zurückzuführen. Der Bischof Nestorius von Konstantinopel hatte in einem Streit zwischen den damaligen theologischen Hochburgen Alexandria und Antiochia einen Schlichtungsversuch unternommen, der aber von alexandrinischer Seite als Parteinahme für Antiochia gewertet und schließlich Nestorius zum Verhängnis wurde.[7] In diesem Kapitel soll geprüft werden, ob Nestorius’ Erklärung, wie der Mensch Jesus zugleich Gott sein kann, wirklich so erhebliche Mängel aufweist, wie man ihm vorgeworfen hatte.
In dem Streit ging es darum, ob Maria, die Mutter Jesu, „Gottesgebärerin“ (Theotokos) oder „Menschengebärerin“ (Anthropotokos) genannt werden dürfe. Die alexandrinische Schule vertrat die erste Position. Nestorius brachte in den Streit den Kompromissbegriff „Christotokos“ ein: Christusgebärerin (231). Wichtig war ihm dabei, die Gottheit Jesu Christi nicht zu vermenschlichen oder gar von einem Mensch, Maria, abhängig zu machen. Eine Vermischung der göttlichen mit menschlichen Eigenschaften müsse vermieden werden. „Das alles, was das Wort in dem mit ihm vereinigten Fleisch um unsertwillen auf sich genommen hat, ist gewiß anbetungswürdig, aber es seiner Hoheit zuzuschreiben, wäre eine Lüge“ (232). Ein solcher Satz hat Nestorius den Vorwurf eingebracht, er bete zwei Christusse[8] oder gar einen Menschen[9] an. Dieser Vorwurf ist terminologisch nicht unberechtigt, gibt aber die Sache nicht ganz richtig wieder. Nestorius wollte gerade nicht die menschlichen Eigenschaften vergöttlichen: In Christus werde die menschliche Natur von Gott zu eigen gemacht (231). Eine solche „Aneignung“ dürfe aber nicht heißen, dass die menschlichen Eigenschaften dem göttlichen Logos zugeschrieben werde (231f.). Nestorius will also gerade verhindern, dass die menschliche Natur angebetet und verehrt wird, und stellt sich in diesem Punkt gegen die Alexandriner und gegen Cyrill. Daher betont er ihm gegenüber die Unterschiedenheit der göttlichen und der menschlichen Natur. „Er ist nämlich Sohn Davids dem Fleische nach und sein Herr der Gottheit nach“ (231).
Dementsprechend besteht die große Herausforderung darin, die Einheit in Christus herauszustellen. Hierfür bedient sich Nestorius dreier begrifflicher Werkzeuge. Das erste Werkzeug besteht in der Differenz zwischen Gott und Gottheit (T 205). Der Sohn Gottes (231) vereinigt sich mit der menschlichen Natur, also nicht die Gottheit selbst, sondern der Logos (T 205), Gott in seiner zweiten trinitarischen Position. Ohne die Unterscheidung von Gott und Gottheit würden Verdrehungen entstehen, dass etwa der Heilige Geist die Gottheit zeugt und zu seinem Geschöpf macht (231) und dass die göttliche Substanz verändert werde (T 205). Unter Gottheit scheint dabei Nestorius die göttliche Natur zu meinen („Natur der Gottheit“, 231), die nicht in die Welt eingehe oder vergänglich und leidensfähig (230f.) werden könne. Die Einigung der beiden Naturen dagegen ereignet sich anscheinend in der Welt. So zitiert Nestorius einen Teil der Einsetzungsworte Jesu beim letzten Abendmahl und kommentiert sie folgendermaßen: „’Dies ist mein Leib’ – und nicht ‚meine Gottheit’ –, der für euch hingegeben wird… Vielmehr war das die mit der Natur der Gottheit vereinigte Menschennatur“ (231). Damit ist ein Doketismus abgewehrt, wonach das Dasein Gottes in dem Menschen Christus nur eine Erscheinung gewesen ist. Nestorius scheint vielmehr an der Menschwerdung Gottes festzuhalten, ohne allerdings die Menschwerdung der Gottheit zuzuschreiben. Die Gottheit bleibt über diesem Geschehen erhaben und unberührt. Das heißt nichts anderes als dass sich die Einigung der beiden Naturen außerhalb der göttlichen Natur vollzieht.
Doch worin besteht der theologische Unterschied zwischen Gott und Gottheit? Ist Gott weniger als Gottheit? Die Kompromissformel „Christotokos“ scheint ja anzudeuten, dass Christus ein Drittes aus zwei Naturen darstellt, nämlich weder Gottheit noch menschliche Natur, weil er Gott ist. Nestorius zieht dafür biblische Textstellen heran, nach denen auch andere Menschen von Gott „Gott“ genannt werden – Mose etwa oder das Volk Israel (T 206f.). Auch seien die Könige Saul, Kyrus und David „Christus“ genannt worden (T 207). An dieser Stelle droht Christus zu einem Nebengott zu werden.
Das bestätigt das zweite Werkzeug, das die Einheit der beiden Naturen in Christus nur nominell vollzieht. Die Gemeinschaft der Namen, etwa von Mose und Christus, macht nicht die Gleichheit ihrer Würde (T 207). Christus ist der Name für die gemeinsamen Eigenarten beider Naturen (229). Indem die Väter des nicänischen Glaubensbekenntnisses diesen einen Namen vorangestellt haben, „wollten sie einerseits vermeiden, daß man die zur Natur des Sohnes und des Herrn gehörigen Namen trennte, andererseits der Gefahr begegnen, daß man die Eigenarten der beiden Naturen einfach verschwinden und in der einen und einzigen Sohnschaft aufgehen läßt“ (229). Spürbar ist hier, wie Nestorius sich bemüht, Christus nicht als Drittes, als „Zwitter“ beider Naturen erscheinen zu lassen: Darum soll keine Vermischung „zu einer einzigen Sohnschaft“ statthaben. Zugleich wird aber für Nestorius das Problem nur nominell gelöst: Die Väter benutzten einfach einen Namen für das Wechselspiel der Naturen. „’Jesus’, ‚Christus’, ‚eingeboren’ und ‚Sohn’“ seien angeblich „Bezeichnungen, die der Gottheit und Menschheit gemeinsam sind“ (229). In diesem Argument liegt teilweise ein Zirkelschluss vor, denn „Jesus Christus“ wird einerseits als Name eingesetzt und andererseits als Eigenschaft, die die Namensnennung mit „Jesus Christus“ rechtfertigen soll. Somit bleiben nur die beiden anderen Eigenschaften „eingeboren“ und „Sohn“ als reale gemeinsame Eigenschaften übrig. Führen sie über eine nominelle Einheit hinaus zu einer realen Einheit? Bleibt man auf der Ebene der Natur, also der nicht-individuellen Allgemeinheit der Eigenschaften von Gottheit und Menschheit, so kann auch nur in einem allgemeinen Sinn gesagt werden, dass „eingeboren“ und „Sohn“ gemeinsame Eigenschaften sind. So wie ich der Sohn meiner Eltern bin, sind alle Männer Söhne ihrer Eltern. Aber daraus folgt nicht, dass wir eine reale Einheit bilden, weil wir nämlich verschiedene Individuen sind. Vielmehr lässt sich allenfalls eine einheitliche Klasse nominell bilden: die Klasse der Söhne. Von der Klasse aller Söhne kann allerdings nicht gesagt werden, dass sie selbst ein Sohn ist. Nestorius macht dementsprechend Christus zu einer Klasse von verschiedenen Individuen, die einige gemeinsame Eigenschaften besitzen. Als Name für diese Klasse ist Christus aber keines der Individuen, die in ihr vorkommen.
Für eine reale Einheit müsste also anstatt von „gemeinsamen Eigenschaften“ der beiden Naturen von den Eigenschaften eines Individuums gesprochen werden. Geht man über die Eigenschaften, um dieses Individuum zu bestimmen, so kann es folglich nur ein Individuum geben, das diese Eigenschaften zugleich besitzt. Die Konjunktion der Eigenschaften „Sohn“ und „eingeboren“ erfüllt allerdings diese Bedingung noch nicht. Sie würden sie nur dann erfüllen, wenn die Relation zu Gott dem Vater mit prädiziert werden würde: Christus ist dann der, der sowohl in seiner göttlichen also auch in seiner menschlichen Natur der eingeborene Sohn Gottes des Vaters ist. Obwohl also die Naturen sich gegenseitig widersprechen, kann mit Christus auf ein Individuum referiert werden, das beide Naturen hat. In diesem Fall ist Christus der logische Referent eines Individuums, auf das zwei einander widersprechende Beschreibungen zutreffen.
Solche scheinbar paradoxen Referenzen sind nicht selten und in der analytischen Philosophie[10] herausgearbeitet worden. Paradigmatisch ist hierfür der Stern Venus und seine Eigenschaft, als erster Stern am Abendhimmel zu erscheinen und auch am Morgen noch am hellsten sichtbar zu sein. So ist es begrifflich falsch, die Eigenschaft, Abendstern zu sein, so zu beschreiben: „Der Abendstern scheint am Morgen“. Empirisch aber kann dieser Satz wahr sein. Es liegt aber dann eben nicht an der Eigenschaft, Abendstern zu sein, dass der Abendstern am Morgen scheint. Sondern es liegt daran, dass der Stern, der die Eigenschaft hat, der Abendstern zu sein, auch die Eigenschaft hat, der Morgenstern zu sein. Während sich also die Eigenschaften „Abendstern“ und „Morgenstern“ in ihrer Bedeutung gegenseitig ausschließen, können auf ein und denselben Stern beide Eigenschaften zutreffen.
Legt man dieses Verständnis zugrunde, so helfen also gerade keine nominellen Lösungen, um das christologische Problem zu beheben. Es hilft dann auch nicht, Christus über „gemeinsame Eigenschaften“ oder auch über den Vergleich von Eigenschaften zu identifizieren. Vielmehr kann ein Individuum auch Eigenschaften besitzen, die sich auf rein begrifflicher Ebene gegenseitig ausschließen. Das dritte Werkzeug, dessen sich Nestorius bedient, geht in diese Richtung, die kontingente Identität zwischen Christus in zwei Naturen zu begründen, obwohl die Naturen auf begrifflicher Ebene sich gegenseitig sogar ausschließen. Dieses dritte Werkzeug ist Nestorius’ Vorschlag, die Verbindung der beiden Naturen im Begriff „Prosopon“ zu finden (230).[11] Interpreten übersetzen diesen Begriff in der Regel mit „Person“, manchmal auch mit der Betonung der persönlichen Willenskraft, die anstelle einer natürlichen Verbindung die Einheit der Naturen willentlich herstellt.[12] Prosopon kann aber auch „Gesicht“ heißen. Schon Alois Grillmeier hat diese Übersetzung herangezogen.[13] Er versteht die Bemühungen von Nestorius so, dass er auf ontischer Ebene die Einheit Christi herausstellen wolle, ohne dabei auf den Wesensbegriff als Basis zurückzugreifen.[14] In diesem Fall allerdings ist die Einheit der zwei Naturen in Christus nur eine unwesentliche Einheit: Christus sieht nur so aus, als ob er Gott und Mensch sei. Da wir oben schon gesehen haben, dass Nestorius einen Doketismus abwehren will, kann er sich mit dieser Lösung nicht zufrieden geben.
Kommentar und Weiterführung
Mit dem folgenden Vorschlag möchte ich die Prosopon-Einheit bei Nestorius phänomenologisch untermauern. Nun ist der Quellbestand bei Nestorius nicht umfangreich genug, um zu belegen, dass Nestorius wirklich so gedacht hat, wie ich das nun entwickle. Allerdings schließt der Quellbestand meinen Vorschlag auch nicht aus. Das Prosopon als Gesicht zu verstehen, bedeutet phänomenologisch, dass beim Anblick Christi beide Naturen begegnen, obwohl begrifflich ausgeschlossen ist, dass eine Entität beide Naturen zugleich haben kann. Christus hat keine zwei Gesichter. Im Anblick seines Gesichts sind seine Naturen ununterscheidbar vereint. Wird das Gesicht phänomenologisch begriffen, so tritt es einem Gegenüber in Erscheinung. Das Gesicht begegnet einem anderen Menschen. Niemand kann sich selbst ins Gesicht sehen, es sei denn dass er sich in einem Spiegel als Gegenüber projiziert. Das Gesicht ist also phänomenologisch auf ein Gegenüber angewiesen, um in Erscheinung zu treten. In dieser Beschreibung ereignet sich also die Prosopon-Einheit in Begegnung: Sie ist, indem sie sich ereignet, und sie ereignet sich, indem sie jemandem begegnet. Dies bestätigt nochmals die obige Beobachtung, dass sich bei Nestorius offenbar die Einheit Christi außerhalb der göttlichen Natur vollzieht. Sie vollzieht sich nämlich bereits außerhalb des Gesichts als Entität. Denn das Gesicht ist phänomenologisch immer schon ein extravertierter Gegenstand: Es tritt nur in Begegnung auf. Ist also das Gesicht die Einheit der Naturen, so ereignet sich die Einheit außerhalb dieses Gegenstandes „Gesicht“, weil dieser Gegenstand als Phänomen immer schon „außerhalb seiner selbst“ ist. Die Begegnung des Gesichts kann nicht von seiner Gegenständlichkeit abstrahiert werden.
Mit dieser Darstellung erledigt sich zugleich das Problem, dass die Einheit der beiden Naturen nur eine scheinbare sei. Denn das Wesen eines Gesichts ist phänomenologisch in seiner Erscheinung zu finden. Seine Erscheinung ist wesentlich. Sieht man dagegen von der Begegnung des Gesichts ab, so kann man allenfalls unwesentliche Eigenschaften von ihm bestimmen (zum Beispiel die Hautfarbe) oder solche, die es nicht hinreichend bestimmen (zum Beispiel dass es ein materieller Gegenstand ist, dass es schwer ist o.ä.). Ob es sich phänomenologisch bei diesen Eigenschaften wirklich um Eigenschaften des Gesichts handelt, lässt sich aber wiederum nicht belegen, solange man sich nicht auf die Begegnungssituation des Gesichts rückbezieht: Die Hautfarbe ist nicht bestimmbar, solange das Gesicht niemandem begegnet. Und ob ein Gesicht wirklich „materiell“ ist und nicht vielmehr geistig, kann ohne Begegnungssituation bestritten werden, ganz zu schweigen von der phänomenologisch sogar zweifelhaften Behauptung, dass das Gesicht „schwer“ sei. Das Gesicht hat nur unter der abstrakten Voraussetzung ein Gewicht, dass es ein materieller Gegenstand ist. Aber phänomenologisch erscheint das Gewicht des Gesichts nirgends. Allenfalls geistig ist es gewichtig, nämlich in der Begegnung.
Im Gesicht fällt also die Differenz zwischen Wesen und Erscheinung: Das Gesicht ist wesentlich Erscheinung, ohne dabei „nur“ Schein zu sein. Bestimmt man die Einheit Christi über die Einheit seines Gesichts, so beschreibt man das Wesen der Erscheinung und gibt ihr eine theologisch wesentliche Bedeutung. Die Einheit Christi ist also nicht „nur“ Erscheinung, sondern sie ist überhaupt nur wesentlich, weil sie Erscheinung ist. Das Wesen der Einheit Christi ist Erscheinung. Sie ist ein Geschehen „pro nobis“, nämlich für die Menschen, die dem Gesicht Christi begegnen. Vielleicht hat Nestorius das gemeint, wenn er zwischen Geburt und Menschwerdung unterschied und daran erinnert, „daß dieselben heiligen Väter im Zusammenhang mit dem Heilsplan und dem Heilswirken (oikonomia) Gottes nicht von einer Geburt, sondern von einer Menschwerdung sprechen“ (230). Das Wort Menschwerdung heißt griechisch „Enanthropesis“, was wiederum „einen Menschen annehmen“ heißen kann. Nestorius sucht nach einem Modell der Beziehungsaufnahme anstelle einer objektiven Einheit auf der Ebene der Gegenständlichkeit. Zudem vollzieht sich diese Annahme eines Menschen „im Zusammenhang mit dem Heilsplan und dem Heilswirken“, also im Zusammenhang mit der Geschichte Gottes mit den Menschen. Sowohl das griechische Wort oikonomia, das ebenso „Tätigkeit“ oder „Wirken“ heißen kann, als auch dynamis (Kraft, Macht; hier irritierend mit „Heilsplan“ übersetzt) haben prozesshafte Bedeutungen. Sie sind, was sie sind, im Vollzug im Hinblick auf ein Gegenüber. Nestorius’ christologisches Modell besitzt also einige Anzeichen dafür, dass er eine dynamische Erklärung sucht, anstatt die Lösung auf der Ebene ontologischer Kategorien zu finden. Dennoch verliert er ontologische Kategorien nicht aus dem Blick, wie die Verklammerung von Wesen und Erscheinung im Gesicht zeigt. Nestorius deutet das Phänomen des Gesichts in seiner Wesenheit an, übersteigt allerdings dabei die klassische Ontologie seiner Zeit, die das Wesen einer Entität immer nur in ihr selbst zu finden wusste.
Ist dieser Verdacht berechtigt, dass Nestorius eine Abneigung gegen begriffssystematische Lösungen hat, um ein historisch kontingentes Ereignis zu beschreiben, dann könnte auch das zweite Werkzeug rehabilitiert werden. Das Gemeinsame von Gottheit und Menschheit sind weder einfach nur die Bezeichnungen oder Namensgebungen, noch die allgemeinen Gemeinsamkeiten der Naturen. Die Einheit über eine solche Schnittmenge zu erweisen, widerspricht nämlich Nestorius’ Heuristik der Prosoponeinheit. Als das Gemeinsame kann dann vielmehr gelten, was sich in der Begegnung mit dem Gesicht Christi überhaupt erst herausstellt, das Gemeinsame im Begegnungsereignis. Im Prosopon erscheint die Einheit Christi, des eingeborenen Sohnes. Die gemeinsamen Eigenschaften der Naturen lassen sich von hier aus erst retrospektiv bestimmen, nämlich unter Voraussetzung der erschienenen Einheit in Christus. Wenn Nestorius Christus als „Name“ bestimmt, so muss es sich nicht um eine willkürliche Namensbestimmung handeln. Sie kann vielmehr reagieren auf das Phänomen, das sich im Gesicht Christi bildet. Der Name Christus würde dann nur dieses Phänomen benennen.
Lässt sich auch das erste Werkzeug rehabilitieren? Ich habe die Gefahr beschrieben, dass Christus durch die Differenz von Gottheit und Gott zu einem Nebengott werden kann, der nur in einem geringeren Grad Gottheit ist als die göttliche Natur. Durch die hier durchgeführte phänomenologische Darstellung kann man auch ein anderes Bild entwerfen: Da unter den klassischen ontologischen Kategorien die Einheit der beiden Naturen in Christus nicht darstellbar ist, wechselt Nestorius die Perspektive: Die Gottheit wird für die Beschreibung der Einheit in Christus nicht zugrunde gelegt, da sie eine Abstraktion darstellt. Vielmehr wird phänomenologisch die Einheit zugrunde gelegt, die erst retrospektiv die Differenzierung der göttlichen und menschlichen Natur vornehmen lässt. Es lässt sich also nicht ontologisch die Einheit Christi als eine Zusammensetzung zweier gegensätzlicher Naturen bestimmen. Vielmehr wird genau umgekehrt die erschienene Einheit im Gesicht Christi erfahren und ausgehend von ihr die Differenz der beiden Naturen retrospektiv bestimmt. Christus ist dann deswegen kein Nebengott, weil es keine Gottheit an sich gibt, ohne dass sie sich personifiziert. Die Gottheit ist immer schon göttliche Natur in Gott. So zitiert Nestorius das Nicaenum und fügt dabei den Naturbegriff hinzu: Christus ist der „aus Gott Vater der Natur nach gezeugte eingeborene Sohn“ (228f.). Es entspricht also das Sohnsein der göttlichen Natur, so dass es eine solche nicht unabhängig von ihrer Personifizierung gibt.
Mit der phänomenologischen Interpretation entgeht Nestorius den Schwächen und Aporien, denen er bei einer ontologischen Interpretation ausgesetzt wäre. Ob er wirklich eine solche phänomenologische Intuition hatte, lässt sich allerdings bei dem schmalen Quellenbestand nicht ermitteln. Dieser lässt eine solche Interpretation zu, die wiederum eine leistungsstarke Erklärungskraft für das christologische Problem bietet: Das Wesen der Einheit Christi liegt in seiner Erscheinung und damit außerhalb seiner selbst, ohne dabei aber etwas Drittes oder eine doketistische Gestalt oder ein Mischwesen zu werden. Die beiden Naturen widersprechen sich, aber es ist kein Widerspruch, dass in einem Gesicht beides zugleich erscheint, ohne dass es sich in dieser Erscheinung voneinander abgrenzen lässt.
Zwei Rückfragen bringen dieses Erklärungsmodell dennoch ins Schwanken. Beide Fragen haben etwas miteinander zu tun. Wenn Prosopon wirklich Gesicht bedeuten und die Einheit Christi in seiner facialen Erscheinung begründet sein soll, stellt sich zum einen die Frage, warum Christus nicht von allen Menschen erkannt wurden, die ihm begegneten. Woran haben die Jünger oder die ersten Christen die Einheit Christi gesehen, wenn offenbar andere in ihm einen Gotteslästerer oder Menschen ohne Würde gesehen haben? Müsste nicht die Einheit des Gesichts beide Naturen als Evidenz erscheinen lassen und nicht nur als Möglichkeit?
Zum zweiten stellt sich die Frage, wie Glaubende heute die Einheit Christi erfahren können, obwohl sie ihn nicht mehr sehen und ihn nicht mehr „nach dem Fleisch kennen“ (2.Kor.5,16). Das Problem besteht nicht darin, dass unter diesen Umständen die Einheit Christi ein bloßes Postulat bleiben würde. Vielmehr würde sie nicht mehr bestehen, sobald sie nicht mehr erscheinen würde. Denn wenn zutrifft, dass das Wesen der Einheit Christi ausschließlich in der Erscheinung seines Gesichts gegeben ist, dann ist dieses Wesen nicht mehr realisiert, sobald es nicht mehr erscheint.
Auf das zweite Problem könnte immerhin phänomenologisch reagiert werden, indem das Gesicht immer die Erfahrung der Gottheit in sich schließt. Emanuel Levinas hat das Gesicht als Erfahrung des Unendlichen beschrieben, das sich nicht aus eigenen Vorstellungen extrapolieren lässt. Um die Erfahrung des Unendlichen zu machen und den Gedanken des Unendlichen zu denken, muss es im Gesicht des Anderen begegnen.[15] Levinas beschrieb über das Phänomen des Gesichts den Anderen als messianischen Menschen.[16] Da Nestorius Christus als Name für dieses Ereignis einsetzt, ließe sich seine Christologie prinzipiell auf alle Menschen übertragen. Will man die Exklusivität Christi wahren, so könnte man diese Struktur der Begegnung mit Christus bezeichnen. Christus wäre dann zwar nicht mehr ein Mensch, aber doch in einem Menschen. Das verträgt sich mit der Beobachtung, dass Nestorius auch den Namen „Gott“ auf Mose, Kyrus und andere biblische Figuren gelten lassen kann.
Auf die erste Frage, warum Christus zu Lebzeiten nicht von jedermann erkannt wurde, könnte man als Antwort vorschlagen, dass zwar jeder die Einheit aus Gottheit und Menschheit erkannt hatte, aber etliche Zeitgenossen diese Einheit geleugnet hatten. Hierfür ließen sich in der Tat biblische Zitate anführen, etwa Jesu Wort über die Unvergebbarkeit der Sünde gegen den heiligen Geist (Mt.12,31–32) oder auch sein Gespräch mit Nikodemus, in dem Jesus die Erfahrbarkeit des Evangeliums unterstreicht (Joh.3,11–12). Eine solche These, dass alle Zeitgenossen eigentlich Christus erkannt hatten, wäre allerdings spekulativ, wenn sie nicht über eine allgemeine Struktur der Christusbegegnung untermauert wird. Erst eine solche allgemeine Struktur gibt die Antwort auf die zweite Frage.
Ausgehend von der schmalen Quellenlage des Nestorius lässt sich daher eine Christologie entfalten, die eine erfahrungsbetonte Lösung auf das Problem der zwei Naturen in Christus bietet. Grillmeier betont, dass Nestorius das Erfordernis höher einschätzte als andere seiner Zeit, eine Lösung auf das Problem der substanzialen Einheit von geistigen Wesen zu finden.[17] Eine solche Lösung scheint Nestorius nicht den klassischen ontologischen Kategorien zuzutrauen. Damit war er in der Problemwahrnehmung seiner Zeit voraus – und vielleicht auch in der Lösung.
Cyrill von Alexandrien – Untereinander angeordnete Naturen
Daß Christus einer ist; in: Des heiligen KirchenlehrersCyrill von Alexandrien ausgewählte Schriften (hg. Otto Bardenhewer); München 1935, 111–204.
Zweiter und Dritter Brief des Cyrill an Nestorius; in: P-Th. Camelot: Ephesus und Chalcedon. Geschichte der ökumenischen Konzilien Bd. II; Mainz 1963, 225–228, 233–241, im Folgenden B abgekürzt
Die Übersetzung von Bardenhewer ist ausgesprochen ungenau, vor allem im Hinblick auf die zentralen Begriffe. So kommt in der Übersetzung der Personenbegriff vor, wenn er im griechischen Original fehlt, und umgekehrt. Der Hypostasenbegriff wird im Original der Schrift „Quod unus Christus sit“ fast ausschließlich benutzt, um die Gegenposition des Nestorius darzustellen. Dagegen wird der Ausdruck „Prosopon“ von Cyrill auch konstruktiv eingesetzt. Bardenhewers Übersetzung erweist sich damit als hochgradig interpretativ.
Ebenso ist es mit dem Begriff der Ähnlichkeit. In Bardenhewers Übersetzung ist der Logos einem Menschen nur „ähnlich“. Im Original kann das griechische Wort „Homoioma“ oder „Homoiosis“ aber auch „Gleichheit“ und „homoios“ „gleich“ heißen.
Es wird daher empfohlen, bei der näheren Beschäftigung den griechischen Text mit der Übersetzung zu vergleichen.[18]
In Cyrill von Alexandrien hat Nestorius einen erbitterten Widersacher gefunden, der politisch geschickt taktierte und daher auch in der christologischen Streitfrage beim Konzil in Ephesus im Jahr 431 den Sieg über Nestorius errungen hatte. Interpreten unterstreichen in der Regel, dass Cyrills Sieg diesem politischen Geschick geschuldet war und weniger seiner theologischen Stärke. Angeblich hatte er keine ordentliche Schulbildung.[19] Theologiegeschichtlich war sein Erfolg übrigens nicht nachhaltig: Allgemein wird das Konzil von Chalcedon von 451 als Korrektur betrachtet, die wieder ein Gleichgewicht zwischen der antiochenischen und alexandrinischen Position herstellte.[20] Grillmeier schätzt Cyrills Beitrag an der Bekenntnisbildung von Chalcedon sogar als gering ein.[21] Gleichwohl hat der zweite Brief Cyrills an Nestorius für die katholische Dogmenbildung höchsten kanonischen Rang[22], und in Lehrbüchern findet man die Formulierung, Cyrills Position sei in Chalcedon als orthodox akzeptiert worden.[23]
Cyrill betonte die Einheit Christi so stark, dass es ihm den Vorwurf einbrachte, die göttliche und die menschliche Natur zu einer Natur zu verschmelzen. Wir haben also hier zu prüfen, ob dieser Einwand ihn trifft oder ob Cyrill die Einheit Christi darstellen kann, ohne aus ihm etwas Drittes neben Mensch und Gott zu machen. Dabei war Cyrill nicht immer terminologisch scharf. Er konnte davon sprechen, dass Christus eine Natur hatte, und an anderen Stellen, dass er aus zwei Naturen sei.[24] Dann wiederum sprach er davon, dass die Einheit Christi in seiner Personalität bestehe (118, 149, an dieser zweiten Stelle benutzt Cyrill den griechischen Begriff Prosopon).
Dreh- und Angelpunkt seines christologischen Modells ist der Begriff der Natur. Cyrill scheint die christologische Problematik auf der Ebene eines differenzierten Naturbegriffs lösen zu wollen. Nach meinem Eindruck ist dieser Ansatz bisher nicht ausreichend gewürdigt worden. Aber wenn Cyrill oftmals den Naturbegriff unterschiedlich verwendet, so scheint dies daran zu liegen, dass er sich jeweils auf Unterschiedliches bezieht. Die Natur (griechisch physis) ist die Kategorie des Wesens einer Sache und oft vom Wesensbegriff (ousia) nicht zu unterscheiden. Denn es ist die Natur, die einen Gegenstand zu dem macht, was er ist. Nun kann aber nicht nur von der Natur eines Gegenstandes gesprochen werden, sondern auch von der Natur einer Art oder einer Gattung. Damit koexistieren Naturen auf unterschiedlichen ontologischen Ebenen. Cyrill kann also von der göttlichen Natur (117 und öfter) sprechen und sie von der Natur des Sohnes Gottes unterscheiden, obwohl auch der Sohn göttlicher Natur ist. Cyrill schreibt von der zweiten trinitarischen Sohn, dem göttlichen Logos (Wort), dass „das eingeborene Wort Gottes Gott war und der Natur nach aus Gott stammte“ (117f.). „Der Leib, der den Tod gekostet hat, war nicht irgendeines andern, sondern vielmehr dessen Leib, der der Natur nach Sohn war“ (125). Ganz deutlich unternimmt Cyrill also eine Differenzierung zwischen der Natur Gottes und der Natur des Sohnes. Obwohl der Sohn göttlicher Natur ist, hat er zugleich eine andere Natur als Gott der Vater. Denn sonst könnten beide nicht unterschieden werden. Cyrill benutzt also den Naturbegriff unterschiedlich, je nachdem auf welcher ontologischen Ebene sich der Gegenstand befindet, über den er spricht.
Zu den Voraussetzungen dieses Ansatzes gehört also, dass der Ausdruck „Gott“ ein Artbegriff ist, der drei Einzeldinge umfasst, nämlich Vater, Sohn und Heiligen Geist. Art und Einzelding haben zwar in manchen Hinsichten die gleichen Eigenschaften, unterscheiden sich aber doch auch voneinander hinsichtlich einziger Eigenschaften. Vergleichen wird Cyrills Argumentation mit der Differenz von „Frau“ und „Mensch“. Alle Frauen sind Menschen, aber nicht alle Menschen sind Frauen. Der Ausdruck „Mensch“ bezeichnet die Art, die aus Frauen und Männern besteht, während Frauen und Männer die Einzeldinge dieser Art darstellen. Logisch gilt nun, dass alles, was von der Art gesagt werden kann, auch vom Einzelding gesagt werden kann: Wenn der Mensch sterblich ist, so ist die Frau auch sterblich. Ebenso ist es, wenn man „Gott“ als Artbegriff versteht und die trinitarischen Personen in ihn einordnet: Wenn Gott unwandelbar ist, so ist auch der Sohn unwandelbar. Dasselbe gilt von dem Verhältnis der Einzeldinge zueinander, wenn sie über das Verhältnis zur Art bestimmt werden: Wenn Gott der Artbegriff ist, dann sind Vater und Sohn auch Gott. Dann ist der Sohn des Vaters auch Sohn Gottes, weil der Vater (genau wie der Sohn) Gott ist.
Anders ist es aber, wenn umgekehrt von einem der Einzeldinge gesprochen wird: Wenn Gott der Sohn vom Vater gezeugt ist, so ist damit nicht die Natur Gottes gezeugt, sondern eben nur die Natur des Sohnes. Dennoch schließen sich die Natur des Sohnes und die Natur Gottes nicht aus. Denn wenn die Natur Gottes Vater oder Sohn oder Geist ist, dann ist auch die Natur des Sohnes Vater oder Sohn oder Geist. Vergleichen wir dieses Verhältnis wieder mit der Beziehung aller Frauen zur Art Mensch: Wenn ein Lebewesen zur Art Mensch gehört, dann ist es entweder eine Frau oder ein Mann. Zur Natur des Menschen gehört es also, Frau oder Mann zu sein. Oben haben wir schon gesagt, dass alles, was von der Art ausgesagt werden kann, auch vom Einzelding ausgesagt werden kann. Folglich gehört es auch zur Natur einer Frau, dass sie eine Frau ist oder ein Mann. Das klingt zwar merkwürdig und scheint intuitiv wenig einleuchtend zu sein, erfüllt aber das logische Gesetz der sogenannten Addition[25]. In anderen Alltagssituationen ist aber diese Disjunktion durchaus üblich. Der Satz „Ich werde Marie am Dienstag oder am Mittwoch besuchen“ ist wahr, wenn ich Marie am Mittwoch besuche. Er bleibt auch wahr, nachdem ich sie am Mittwoch besucht habe. Das heißt also, dass die Disjunktion „am Dienstag oder Mittwoch“ auch dann wahr ist, wenn nur eine von beiden Optionen gezogen wird. Ebenso kann man von Frauen aussagen, dass sie Frauen oder Männer sind. Und ebenso kann man dann von Gott dem Sohn sagen, dass er Vater oder Sohn oder Geist ist. Wenn also zur Natur Gottes gehört, Vater oder Sohn oder Geist zu sein, dann kann dasselbe also auch vom Sohn ausgesagt werden. Deshalb erfüllt die Natur des Sohnes alles, was von der Natur Gottes ausgesagt werden kann – und zwar obwohl der Sohn zugleich eine eigene Natur hat, nämlich die Natur des Sohnes. Für Gott trifft nicht zu, dass er die Natur des Sohnes hat, weil auch der Vater und der Geist mit ihrer je eigenen Natur die Natur Gottes besitzen.
Welche spezifische Eigenschaft hat nun der Sohn, die der Vater und der Geist nicht haben? Entscheidend scheint für Cyrill die Eigenschaft zu sein, der Eingeborene zu sein: „Es wäre sehr verfehlt und ein Zeichen krankhaften und weit abirrenden Geistes, zu glauben, die unaussprechliche Wesenheit des Eingeborenen sei eine Frucht des Fleisches gewesen. Er war vielmehr als Gott gleichewig mit dem zeugenden Vater und aus ihm der Natur nach in unaussprechlicher Weise geboren“ (116).[26] Zur Natur des Sohnes gehört also alles, was er von Ewigkeit her besitzt, nicht erst durch die Vereinigung mit der menschlichen Natur. „Der Eingeborene war also der Natur nach nicht uns gleich, ist aber dann, wie es heißt, uns gleich, das ist Mensch geworden“ (128). Die Einheit des Menschgewordenen darf dabei nicht zu einer Änderung der Natur führen, und auch die Personeneinheit, die hypostatische Union, die Cyrill vorschlägt (B 226, B 235, B 241), darf der Natur des Sohnes nicht äußerlich bleiben. Das heißt, dass Personalität zur Natur des Sohnes gehört. Der Logos ist auch nach der Menschwerdung natürlich geblieben (148, 152). Folglich muss es an der besonderen Natur des Sohnes liegen, die Einheit mit der menschlichen Natur zu bilden. Dies leistet die menschliche Natur über das Geborensein. Wenn nämlich zur Natur des Sohnes gehört, der Eingeborene zu sein (116), dann ändert sich nichts an ihm, wenn er nun auch als Mensch von Maria geboren wird. Sie ist daher zu Recht Gottesgebärerin (theotokos) zu nennen (118). Christus hat nicht eine Natur nach der Fleischwerdung, sondern in der Menschwerdung ist er Gott geblieben und auch alles, was ihm der Natur nach zukam (142, 152).
Christus ändert also seine Natur als Sohn Gottes nicht, wenn er geboren wird. Denn das Geborensein ist eine Eigenschaft seiner Natur als Sohn Gottes. Geborensein gehört zwar nicht zur Natur Gottes, aber eben zur zweiten Hypostase der Trinität. Damit scheint Cyrill auch die Frage beantworten zu wollen, wie Christus darüber hinaus auch Mensch werden kann, obwohl er die Natur des Sohnes Gottes besitzt. Er ist Mensch, weil es zu seiner Natur gehört, geboren zu sein. Also kann er offenbar auch als Mensch geboren werden. Folgt man dieser Argumentation, so hätte Christus seiner Natur nach auch als Tier geboren werden können. Nicht als was er geboren wird, ist seiner Natur inhärent, sondern dass er geboren wird.
Spricht Cyrill dagegen vom Menschsein Christi, so schwächt er die Einheit hier ab: Der Sohn Gottes hat die menschliche Natur „angenommen“ (145), er ist erschien in menschlicher „Hülle“ (118; im Griechischen steht „Schema“, was „Form“ oder „Gestalt“ heißen kann). Die Personeneinheit der beiden Naturen wird über die spezifische Natur des Sohnes organisiert, ohne dass sie aber die Eigenschaften der menschlichen Natur besitzt. Cyrill vertritt also keine „Mia Physis“-Lehre, also keine Lehre, wonach die göttliche und menschliche Natur zu einer Natur verschmolzen oder die menschliche in der göttlichen Natur integriert worden sei. Cyrill stand öfter unter dem Verdacht, eine solche Lehre vertreten zu haben, und auch Monophysiten haben sich auf Cyrill berufen.[27] Sehr wohl aber hat Cyrill die Einheit der beiden Naturen über den Naturbegriff bestimmen wollen, nämlich über die spezifische Natur des Sohnes. Damit lässt sich die Gefahr abwehren, dass die Personeneinheit eine unwesentliche Einheit wird, weil die Person dann aus der Natur ausgenommen werden müsste. Es bleiben zwei Naturen, aber es liegt an der Natur des Sohnes, dass sie eine Einheit werden. Die Einheit wird über die Eigenschaft des Geborenseins organisiert, die der zweiten Hypostase gemäß ihrer besonderen Natur zukommt.
Die Personeneinheit ist deswegen möglich, weil die menschliche Natur Christi offenbar keine Personalität hat. Damit baut Cyrill eine Implikation der klassischen Anthropologie seiner Zeit um, die die Personalität der Natur zurechnet. Um sich von Nestorius abzugrenzen, betont er, dass Christus nicht in zwei Personen getrennt werden dürfe (174) und dass es keine Verschiedenheit der Personen gebe (142). Es werde auch in der Einigung der Naturen kein zweites Prosopon hinzugefügt (B 226). Anstelle einer Mia-Physis-Lehre vertritt Cyrill also eher eine Mia-Hypostasis-Lehre[28], ohne allerdings darin terminologisch explizit zu sein. Wie ist dieser Umbau gerechtfertigt außer über eine theologisch geschuldete Willkür? Wenn doch jeder Mensch aufgrund seiner Natur eine Personalität besitzt, so kann sie bei Christus nicht fehlen, ohne dass seine menschliche Natur defizitär wäre. Er wäre dann doch nicht wahrer Mensch, sondern hätte nur menschliche Gestalt. In diesem Fall droht ein Doketismus. Nestorius konnte das Problem dadurch lösen, dass die göttliche und die menschliche Personalität im Phänomen des Gesichts ununterscheidbar werden. Dadurch war Christus zwar aufgrund seiner Natur zwei Personen, die aber phänomenologisch reduziert werden konnten. Cyrills Vorschlag läuft dagegen darauf hinaus, dass der menschlichen Natur nichts fehlt, wenn sie nicht selbst die Personalität ausprägt. Sie übernimmt vielmehr die Personalität der Hypostase des Sohnes. Der Sohn Gottes ist ja aufgrund seiner Natur der Eingeborene und kann daher auch in Maria geboren werden, ohne seine Natur zu verändern. Die Person des Sohnes wird daher auch von Maria geboren, weil er seiner Natur nach der Eingeborene ist. Somit fehlt der menschlichen Natur nichts, weil sie durch die Geburt eine Personalität besitzt.
Der Sohn Gottes teilt daher mit dem Menschen die Eigenschaft des Geborenseins und kann deshalb auch Mensch werden. Nicht aber wird er menschliche Natur. Die menschliche Natur bleibt ihm äußerlich. Wie aber verhält sich die menschliche Natur zur Natur des Sohnes?
Kommentar und Weiterführung
Oben hatte ich festgestellt, dass sich die Natur des Sohnes zur göttlichen Natur verhält wie ein Einzelding zu seiner Art. Nehmen wir nun dasselbe an im Verhältnis des Sohnes Gottes zur menschlichen Natur: Auch die menschliche Natur ist ja ein Artbegriff. Ist der Sohn Gottes ein Einzelding, das zur Art der menschlichen Natur gehört? Ich habe oben festgestellt, dass alles, was von der Art ausgesagt werden kann, auch von allen Einzeldingen dieser Art ausgesagt werden kann. Somit müsste alles, was von der menschlichen Natur ausgesagt werden kann, auch von der Natur des Sohnes Gottes ausgesagt werden können, wenn denn der Sohn Gottes wirklich Mensch geworden ist. Dann nämlich wäre er ein Einzelding der Art der menschlichen Natur. Cyrill scheint dies zuzugestehen, allerdings erst vom Zeitpunkt der Menschwerdung an: Dass Christus gehungert oder geschlafen habe, das könne dem göttlichen Wort nicht zugeschrieben werden, „bevor es in die Entäußerung hinabgestiegen war“ (175). „Dem menschgewordenen und entäußerten Worte aber vermögen sie keinerlei Schimpf einzutragen“ (ebd.). Denn er hat sie „sich selbst“ zugerechnet (ebd.[29]). Ansonsten bleibt Cyrill aber zögerlich und drückt abgeschwächt aus, dass Christus mit menschlichem Fleisch „umkleidet“ gewesen sei (187), so dass die menschliche Natur ihm äußerlich bleibt. Er war zwar „zusammen“ Gott und Mensch (ebd.[30]), aber so, „daß die Menschwerdung ihm unbestritten die Möglichkeit gibt, dem Fleische nach zu leiden, der Gottheit nach aber nicht zu leiden“ (ebd.).