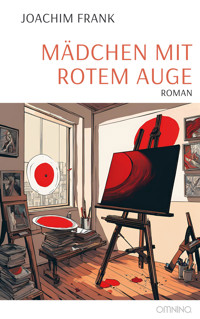8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Verhältnis der Öffentlichkeit, aber auch vieler Katholiken zu ihrer Kirche schwankt zwischen Euphorie und Depression. Nicht nur Hans Küng fragt: »Ist die Kirche noch zu retten?« Der Theologe und Journalist Joachim Frank sucht in ›Wie kurieren wir die Kirche?‹ nach Antworten auf die Krise. Sein Ziel ist eine lebendige, den Menschen zugewandte Kirche im 21. Jahrhundert. Welchen Veränderungsbedarf hat die Kirche wirklich? Welche Chancen und auch welche Risiken liegen in kommenden Reformen? Frank identifiziert Themen, die für das katholische Leben in Deutschland künftig von zentraler Bedeutung sein werden. Jedem Themenfeld ist ein Kapitel gewidmet, in dem Frank auch prominente Kirchenvertreter und engagierte Christen zu Wort kommen lässt. Eingeführt wird ›Wie kurieren wir die Kirche?‹ von einem Vorwort des Herausgebers des Bandes, Alfred Neven DuMont. Mit Beiträgen u.a. von Margot Käßmann, Navid Kermani, Heribert Prantl und Annette Schavan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
WIE KURIERENWIR DIEKIRCHE?
KATHOLISCH SEINIM 21.JAHRHUNDERT
HERAUSGEGEBEN VON
eBook 2013
© 2013 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8761-3
www.dumont-buchverlag.de
Vorwort
Nach den letzten Jahren im Pontifikat Benedikts XVI., die mir als eine Phase der Beharrung, ja manchen als eine Rückwärtsbewegung erschienen, ist mit der Wahl von Papst Franziskus ein Gefühl des Aufbruchs aufgekommen. Wir dürfen hoffen! Die Bescheidenheit des Pontifex Maximus hat bereits breite Bevölkerungsschichten und des Klerus’ beeindruckt und Erwartungen geweckt. Aber wie wird das Zentrum der Macht – der Vatikan, die Kurie – darauf reagieren? Nach den Umtrieben, von denen wir erst vor Kurzem durch »Vatileaks« und das von Benedikt in Auftrag gegebene Dossier dreier Kardinäle erfahren haben. Wird Franziskus die Probleme meistern können? Wer den Kern einer Krankheit nicht erfasst, wird am Schluss bei allem guten Willen scheitern. Noch wissen wir nur einiges darüber, was Franziskus vorhat. Aber ich denke, gerade jetzt können die Katholiken, denen an der Zukunft ihrer Kirche liegt, jede Form von Rückhalt und Rückenwind gebrauchen.
Jedes Leben kann nur überdauern durch einen neuen Keimling. Die katholische Kirche hat sich in vielen Aspekten auf ihr großes Erbe besonnen. Aber wenn sie nicht fähig ist, erneut einen Sprung nach vorne in die Gegenwart und Zukunft zu machen, werden wir erleben, dass sie an ihren Gliedern erstarrt. Wir brauchen keine neue Kirche, wir brauchen eine jüngere Kirche, und wir spüren, wie die Zeit uns davonläuft. Die Erneuerung kann nur durch die Menschen in der Kirche kommen. Sie muss von uns kommen. Aber wir sollten von vorne anfangen. Die zentrale Frage nach Gott: Braucht der westliche Mensch Gott? Hat er ihn nicht schon verloren? Und: Braucht die Kirche Gott? Aber dann auch die Frage: Braucht der Mensch die Kirche?
Am nächsten sind wir Jesus Christus, dem Erlöser. Das Neue Testament ist die Grundlage. Es stellt uns Jesus in Wort und Tat vor. Wir finden ihn wieder in jeder heiligen Messe, in der Liturgie. Aber Gott, von dem Friedrich Nietzsche gesagt hat, dass er tot sei? Das ist etwas anderes, darüber hinaus. Gott ist der Allmächtige, der, wenn wir glauben, unser Leben bestimmt. Und in dessen Hand wir uns – wenn wir glauben dürfen – begeben.
Die Fragen nach Anfang und Ende stellen sich im Licht des Glaubens anders. Dann aber das Unbehagen: Gibt die heutige Kirche diesen unbedingten Fragen der Menschheit spürbar und deutlich genug Raum – etwa in ihren Ritualen? Ich frage mich, ob sie es sich nicht zu leicht macht. Wann vernahm man zuletzt den Donnerhall, den Blitz, der die Menschen zutiefst erschüttert? Haben wir uns nicht mit der Kirche, ob nun in ihr aktiv oder nicht, zu wohlig eingerichtet? Muss erst eine äußere Bedrohung, eine Menschheitskatastrophe wie der Zweite Weltkrieg kommen, dass wir in unserem Grundgefüge zutiefst erschüttert werden? Diese Frage bleibt für mich die entscheidende. Der Mensch kann guten Gewissens sagen: »Ich brauche keinen Gott.« Er wird deshalb kein schlechter Mensch, nicht einmal ein schlechterer Mensch, verglichen mit einem Gläubigen. Aber denjenigen, der Gott sucht, darf man ihn auf seinem Wege allein lassen?
Damit stellen sich eine Reihe von Fragen. Eine davon gilt dem Zölibat. Das Thema wird von den Kirchenoberen mehr hinter vorgehaltener Hand diskutiert. In der Öffentlichkeit der Kirche spielt es eine viel größere Rolle, als manche uns glauben machen. Aber ich wage es auszusprechen, dass die Mehrheit der Menschen eine Aufhebung der Zölibatspflicht begrüßen würde. Damit würde den heutigen Geistlichen die Möglichkeit eröffnet, frei zu entscheiden, ob sie allein leben möchten oder mit Familie. Ist dieser Sprung in die Zukunft nicht überfällig? Warum stürzen wir viele junge Geistliche in Gewissensnöte, die nicht selten zum Austritt aus dem Priesteramt führen? Sollten wir nicht die Hürden zum Priesteramt niedriger legen, um mehr jungen Menschen den Zugang zu erleichtern – in einer Zeit, wo wir unter akutem Priestermangel weltweit leiden? Sollte sich die Kirche nicht jetzt zu einer Reform verstehen, statt erst in hundert Jahren, wenn es zu spät ist?
Die Kirche tut sich heute sehr schwer damit, Menschen für das geistliche Amt an sich zu ziehen. Gesellschaft und Kultur haben sich in den 2000Jahren seit dem Anfang des Christentums unendlich verwandelt, der Mensch ist vielfach durch ein Nadelöhr geschlüpft. In der Moderne – zumindest in der westlichen Welt, aber ähnlich doch auch in der Zweiten und Dritten Welt – ist er sich nach Karl Marx und Sigmund Freud seiner Eigenschaften und seines Wesens bis in die letzten Poren seiner Natur bewusst geworden. Warum sollte ein katholischer Priester heute seine Männlichkeit, seine Sexualität nicht leben dürfen? Durch den Missbrauchsskandal haben wir noch einmal neu die Gefahren erkannt, die aus einem aufgestauten Umgang mit der Sexualität, aus Verdrängung, Unterdrückung und Tabuisierung rühren. Jedes Kind, jeder Jugendliche, an dem sich ein Geistlicher vergangen hat, ist hier eine lebendige Anklage gegen die Kirche.
Die katholische Kirche scheint gefangen zu sein im geschichtlichen Rahmen ihrer Entstehung: der Zeit des Neuen Testamtens, als Palästina unter römischer Besatzung stand, wo allerorten in der Hierarchie das Patriarchat herrschte. Selbstverständlich, vor diesem Hintergrund scharte Jesus damals zwölf Jünger um sich. Aber Maria? War sie nur für die Mutterliebe da? Und was war mit Maria Magdalena? Würde in der heutigen Gesellschaft Jesus wieder Jünger um sich scharen wie damals seine engsten zwölf Gefolgsleute, würden sie sich heute nicht ganz selbstverständlich zusammenfinden aus Männern und aus Frauen?
Ein anderes grundlegendes Problem ist der Ausschluss der Frauen vom Priesteramt in der katholischen Kirche. Auch diese Frage bewegt seit Langem die Gemüter. Die Rolle der Frau hat sich gesellschaftlich in den vergangenen hundert Jahren bahnbrechend verändert. Ja, Emanzipation und Gleichberechtigung haben, so kann man ohne Übertreibung sagen, die Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Frauen standen und stehen führenden Nationen vor, ob in Brasilien, Argentinien, Australien, Indien, Großbritannien oder Deutschland. Alle nehmen das für selbstverständlich, niemand lehnt sich dagegen auf. Im öffentlichen Leben drängen Frauen allerorten nach oben. Und in den Ländern und Kulturen, in denen die bestimmende Rolle der Frau noch auf das Privatleben beschränkt und sie dort für das wichtigste Gut – die Familie und die Kinder – verantwortlich ist, bricht die matriarchale Struktur von innen nach außen, zur Öffentlichkeit, auf.
Warum sollte die Kirche hier abseits stehen? Wie sollen das junge Menschen von heute noch verstehen? Katholische Priesterinnen wären ein unglaublich kraftvolles Signal der Kirche in die Welt. Und vor allem würden sie junge Menschen wieder in die Kirchen ziehen und Personenschichten ansprechen, die heute abseits stehen. Mir fällt bei der Gelegenheit Mutter Teresa ein. Ein Verwandter meiner Frau, ein Geistlicher, war lange Zeit Sekretär der Nonne aus Kalkutta. Er begleitete sie regelmäßig auf ihren Besuchen im Vatikan, wo sie mit dem Papst auf Augenhöhe verkehrte. Dieser Geistliche hat mir einmal gesagt, es mute ihn merkwürdig an, dass diese heilige Frau, ein leuchtendes Vorbild im Glauben und im christlichen Dienst der Nächstenliebe, eines kleinen Priesters bedurfte, um die Messe zu feiern und die Kommunion zu spenden, während sie selbst zurückstehen musste, nur weil sie eine Frau war. Eine groteske Situation.
Papst Franziskus hat uns die Augen dafür geöffnet, dass unsere Kirche nicht nur in der westlichen Welt beheimatet ist, sondern dass sie eine Weltkirche ist, die nicht nur neue Impulse gesetzt, sondern weite Bevölkerungsschichten der Kirche zugeführt hat. Wir sollten lernen, wie sehr die römisch-katholische Kirche aus ihren Gliedern sich zu kräftigen vermag. Und Paulus sagt: Es gibt nicht mehr Sklaven und Freie, Juden und Griechen, Mann und Frau, sondern alle sind eins in Christus in ihrer Würde.
Noch mehr ist zu tun. Die vom Konzil vorgenommene Öffnung zu den anderen Religionen und zur säkularen Welt gilt es neu zu beleben. Der Dienst an den Armen, den Papst Franziskus so beeindruckend predigt, sollte nicht nur ein Markenzeichen der Kirche von morgen sein, sondern auch Vorbild für uns alle. Der Schutz der Frau vor Diskriminierung, Gewalt und Krankheiten, vor allem in den unterentwickelten Ländern, muss mit allen Möglichkeiten betrieben werden. Die Liste lässt sich fortsetzen.
Wie vielfältig sich die Fragen nach der Zukunft für die katholische Kirche stellen, dafür möchte dieses Buch Darstellung und Hinweis sein. Mit einem Bild aus dem Neuen Testament betrachtet es die Kirche als ein »geistiges Haus aus lebendigen Steinen« (1. Petrusbrief 2,5). Und wie auf jeder Baustelle gibt es für die verschiedenen Gewerke am Zukunftsbau Kirche ausgewiesene, kundige Handwerker. Wir haben zwei Dutzend Frauen und Männer versammelt, die im Raum der katholischen Kirche tätig oder ihr in eigener Weise verbunden sind. Sie sind gleichsam unsere lebendigen Steine. Auf sie kann unsere Kirche bauen. Jeder steht für Zukunftsthemen: Bischöfe und Ordensleute, Priester und Laien, Professoren und Praktiker, Politiker, Unternehmer, Künstler und Journalisten. Sie geben in persönlichen Interviews Auskunft über ihre Erfahrungen und entwickeln Vorschläge für die Zukunft. In seinen Beiträgen greift der Autor ihre Ausführungen auf, und so lässt dieses Buch – wie wir hoffen – aus der Fülle der Perspektiven einen facettenreichen Bauplan für die mögliche Kirche von morgen entstehen.
Nichts kann über Nacht geschehen. Aber wir sollten erkennen, was zu tun ist, um morgen zu handeln.
Alfred Neven DuMont
Teil I:
Kirche aus lebendigen Steinen – Das Mauerwerk sanieren
Die Kirche und die Frauen
Auf dem nationalen Eucharistischen Kongress in Köln Anfang Juni 2013 sprach der emeritierte Kurienkardinal Walter Kasper vor mehreren Hundert Geistlichen über die Kirche in der Krise. Er unterschied dabei »Wesentliches, Zentrales und Fundamentales« von Nebenfragen und »Nebenkriegsschauplätzen«. Zu ihnen zählte Kasper die »Fragen, an denen man sich derzeit in der öffentlichen Diskussion oft festbeißt«.
Kasper variierte eine These, die dem Leser in diesem Buch ausführlicher im Kapitel über Gebet und Spiritualität begegnen wird: Die Kirchenkrise ist eine Gotteskrise. Genau darum bedürfe es dringend eines Themenwechsels. Zur Illustration bediente sich der Kardinal aus Rom einer bemerkenswert martialischen Sprache: »Von außen gesehen und nach der öffentlichen Wirkung beurteilt, ist die gegenwärtige kirchliche Landschaft ein ideologischer Drahtverhau mit vielen Grabenkämpfen, ein Stellungskrieg, in dem sich nur wenig bewegt.«
Auf den ersten Blick scheint Kaspers Beobachtung zu stimmen. Ob einer katholisch ist und bleibt, das entscheidet sich nicht an diesem oder jenem Papst, an Bischofsernennungen, liturgischen Details »und auch nicht an Diakoninnen«. Aber Kasper bedient sich hier des immer gleichen Tricks, der für innerkirchliche Diskussionen allzu typisch geworden ist: Er spielt den Glauben an Gott und Jesus Christus aus gegen das Erscheinungsbild der Glaubensgemeinschaft. Er bezieht selbst Stellungen in dem Grabenkrieg, den er doch eigentlich beklagt.
Entsprechend gefährlich ist es, den Kopf aus dem Schützengraben herauszuheben. Aber auf keinem anderen Themenfeld wäre das für die katholische Kirche so wichtig wie in der Frage nach ihrem künftigen Umgang mit den Frauen.
Die Dringlichkeit haben die deutschen Bischöfe durchaus erkannt. Schon 2005 ließen sie erheben, welchen Anteil Frauen an leitenden Ämtern in den Generalvikariaten und Ordinariaten haben, den Herzkammern der kirchlichen Verwaltung: Im Topmanagement auf der oberen Ebene – direkt unterhalb des Bischofs angesiedelt und mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet – waren es damals ganze fünf Prozent, in der darunterliegenden mittleren Leitungsebene 13Prozent. Das hat sich in den folgenden acht Jahren erkennbar geändert: Auf der oberen Leitungsebene hat sich der Frauenanteil mehr als verdoppelt: Im Jahr 2013 waren von 220Stellen 28 (knapp 13Prozent) weiblich besetzt. Auf der mittleren Ebene nahmen Frauen 85 von 442Stellen (gut 19Prozent) ein. Das ist der Wert, den die Bischöfe besonders gern nennen, wenn sie auf die mangelnde Repräsentation der weiblichen Gläubigen in den kirchlichen Strukturen angesprochen werden.
Im Vergleich mit der deutschen Wirtschaft etwa steht die katholische Kirche auch gar nicht so schlecht da: Nach einer BDI-Umfrage lag der Anteil der Frauen in den 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen im Juni 2013 bei 7,4Prozent. 19 der 30Dax-Firmen hatten keinen einzigen weiblichen Vorstand vorzuweisen. Immerhin hat sich der Frauenanteil in den Chefetagen in nur gut zwei Jahren mehr als verdreifacht. Und in den Aufsichtsräten der Konzerne ist inzwischen jedes fünfte Mitglied eine Frau.
Doch ist in der katholischen Kirche das Gefälle größer, weil die zentralen Führungspositionen Klerikern vorbehalten sind. Frauen sind es, die das kirchliche Leben in Gemeinden und Verbänden tragen. Sie geben der Kirche ein weibliches Gesicht – auch nach außen. Wenn es aber ans Entscheiden und Bestimmen geht, dann tritt die Männerkirche hervor, genauer gesagt: die Klerikerkirche. Jeder Kirchenbesuch, jede Gottesdienstübertragung im Fernsehen vermittelt dieses Bild: Es sind Männer, die das Sagen haben. Erst kommen die Bischöfe, die Priester – und dann kommt lange nichts. Die Zahlenverhältnisse in den Bistumsverwaltungen spiegeln diesen Eindruck aus der Liturgie wider. Von den schon genannten 220 wichtigsten Führungsstellen, in denen Bischöfe und Generalvikare als die eigentlichen Chefs noch nicht einmal enthalten sind, war fast die Hälfte (108) mit Priestern besetzt, ein gutes weiteres Drittel dann mit männlichen Laien.
»Die Kirche kann es sich nicht leisten, auf die Kompetenzen und Charismen von Frauen zu verzichten«, stellen die deutschen Bischöfe fest. Sie erkennen auch die »positiven Folgen für Leben und Dienst der Kirche« an, wenn sie verstärkt Frauen in die Leitung holt. Und sie sprechen von Enttäuschungen kirchlich engagierter Frauen, dass das immer noch zu wenig geschieht. Als Folge davon haben sich die Bischöfe zu einem Fünf-Jahres-Programm verpflichtet, mit dem sie den Anteil von Frauen in Leitungsämtern »deutlich erhöhen« wollen.
Einen ersten kleinen Boom habe es schon 2011/2012 gegeben – zeitgleich mit dem Bemühen um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals und den »Gesprächs- und Dialogprozessen«, die seitdem auf Bundesebene sowie in vielen deutschen Bistümern in Gang gekommen sind. Dieses Zusammentreffen ist kein Zufall. Denn auf die Frage, was sich in der Kirche ändern muss, bekommen die Bischöfe regelmäßig, und oftmals ganz und gar unkriegerisch, zu hören: die Rolle der Frau.
In der Wir-haben-verstanden-Rhetorik, die von Wertschätzung, Anerkennung und Dankbarkeit für das Engagement von Katholikinnen in ihrer Kirche nur so sprudelt, gibt es freilich einen kleinen Halbsatz, an dem das eigentliche Problem hängt. Die Selbstverpflichtung, den Frauenanteil zu erhöhen, bezieht sich nur auf Leitungspositionen, »die die Weihe nicht voraussetzen«.
Damit bleibt die Initiative der Bischöfe auf halber Strecke stecken. Der Vorbehalt der geistlichen Ämter – Bischof, Priester, Diakon – bleibt unangetastet. Der Mut oder der gemeinsame Wille reichen nicht einmal bis zu einem Prüfauftrag, ob die Weihe den Frauen wirklich ein für alle Mal versagt bleiben müsse, wie es Johannes Paul II. im Apostolischen Schreiben »Ordinatio sacerdotalis« verfügte. Der Papst rückte 1994 die zentrale Aussage, dass die Kirche nicht befugt sei, von einer auf Jesus und die Urkirche zurückgehenden Praxis abzuweichen, haarscharf in die Nähe einer unfehlbaren Entscheidung des päpstlichen Lehramts, ohne freilich den letzten Schritt einer feierlichen Dogmatisierung zu gehen. Verbindlich, aber nicht letztverbindlich. So ist das letzte Wort nicht gesprochen. Wie es überhaupt als seltsamer Anachronismus erscheint, allein die bloße Diskussion über eine strittige Frage par ordre du mufti unterbinden zu wollen.
Trotzdem hat die autoritative Entscheidung aus Rom Folgen bis heute. Jungen Theologen, die dem Ausschluss der Frauen von den Weiheämtern widersprechen, kann der Knick ihrer akademischen Karriere drohen, bevor diese recht begonnen hat. »Wie hältst du’s mit der Priesterin?« – diese katholische Gretchenfrage ist zur Stolperfalle für vermeintliche Irrlehrer geworden.
Darum wundert es nicht, dass die deutschen Bischöfe nicht an dieses Thema rühren. Frauen fördern und in die Verantwortung nehmen – das wollen sie schon. Ihnen aber die geistliche Ausstattung und die sakramentale Kompetenz zugestehen – das auf keinen Fall.
Als Ausflucht aus diesem Dilemma zeichnen sich Versuche ab, für Frauen ein eigenes Dienstamt zu konzipieren: ein »Gemeinde-Diakonat« ohne Weihe, aber doch mit Beauftragung und eigener Segnung. Für einen solchen Weg hat sich nun ausgerechnet Kardinal Kasper starkgemacht, der – entgegen seiner Kölner Brandrede wider die leidigen »Nebenfragen« – die Stellung der Frau samt ihrer amtlichen Repräsentation sehr wohl als eine zentrale Herausforderung für die Kirche zu charakterisieren weiß.
Das Ziel ist klar: Aus frühkirchlichen Vorbildern gewonnen und damit »in der Tradition« stehend, soll ein Amt sui generis beidem Genüge tun: die Frauen in der Kirche aufzuwerten – und zugleich an ihrem Ausschluss von den Weiheämtern festzuhalten. Doch ein »Zwischen-Zwischenzustand« für die Frauen, wie die Kirchenrechtlerin Sabine Demel das vorgeschlagene Amt einer katholischen Diakonisse oder Gemeindediakonin süffisant nennt, geht an der eigentlichen Aufgabe vorbei, vor der die katholische Kirche steht.
Wieder und entscheidend geht es um ihre Glaubwürdigkeit. Sie muss in Lehre und Praxis zeigen, dass ihre Botschaft es wert ist, vernommen und angenommen zu werden. Die Bibel spricht an zentralen Stellen über die gottgewollte gleiche Würde der Geschlechter. Das Beispiel Jesu setzt die Maßstäbe, die kirchliche Lehre und Praxis aus Prinzip nicht unterschreiten dürfen. Die Kirche aber macht mit ihrer Theologie der Gottesebenbildlichkeit und der Gleichwertigkeit von Mann und Frau ausgerechnet dort nicht ernst, wo unmittelbar ihr inneres Gefüge betroffen ist.
Es gab Zeiten, in denen die Kirche für Frauen emanzipatorische Kraft hatte. Kirchliche Schulen waren für Mädchen oft die einzige Möglichkeit, überhaupt etwas zu lernen. Aber inzwischen ist die katholische Kirche ins Hintertreffen geraten. Ihre Praxis nach innen widerspricht ihrer Botschaft nach außen: Gleichwertigkeit der Geschlechter aufgrund des Glaubens. Sie zieht sich dabei hinter fragwürdige Argumente zurück.
Sollte nur ein männlicher Priester an Christi statt handeln können, weil Christus ein Mann war? In einer Logik, die das Geschlechtsmerkmal »männlich« absolut setzt, müsste das auch für viele prägende Umstände im Leben Jesu gelten: für die Herkunft aus dem Judentum etwa mit allen praktischen Folgen, angefangen bei der Beschneidung. Doch schon die Urkirche erklärte, dass die Beschneidung keine Voraussetzung für die Nachfolge Christi sei, sondern dass auch die »Unbeschnittenen« – in biblischer Sprache: die »Heiden« – Christen werden können.
Sollte die Kirche Frauen nicht weihen dürfen, weil sie das niemals getan habe? Die neuere historische Forschung liefert eine Fülle von Gegenindizien. So kannte das Konzil von Chalcedon (451) den Stand der Diakonin, für die das Ordinationsalter auf 40Jahre heraufgesetzt wurde.* [* Kanon 15 lautet in lateinischer Fassung: »Diaconissam non ordinandam ante annum quadragesimum …«. Außerdem wird ihr eine Eheschließung nach Empfang der Ordination bei Androhung des Ausschlusses aus der Kirche untersagt.]
Verbirgt sich endlich hinter dem Ruf nach gleichberechtigtem Zugang der Frauen zu den kirchlichen Ämtern vielleicht doch eine Frage von Macht, weil christlicher Dienst nicht die Weihe voraussetzt? Dies ist der wohl verräterischste aller Einwände. Redet die Männerkirche über die Weihe, heißt es, das Priestertum sei keine Frage der Macht, sondern des Dienstes. Sagen Frauen, sie wollten Priesterin werden, um sich so in Dienst nehmen zu lassen, wird ihnen Machtstreben unterstellt. Diese Doppelbödigkeit trägt nicht. Sie entlarvt. Und wenn Katholikinnen wie Elisabeth Rathgeb »in kritischer Loyalität« zu ihrer Kirche die Stimme erheben, dann setzt ihre Kritik genau hier an.
Bleibt der Seitenblick auf christliche Konfessionen, die einen anderen Weg gehen als die katholische. Kardinal Walter Kasper ließ sich den Vergleich nicht entgehen, als er in Köln die wichtigen Themen von den unwichtigen schied – unter letzteren auch der Zugang von Katholikinnen zu den Weiheämtern: Wären diese »gängigen, seit 40Jahren bekannten Postulate so entscheidend für die Zukunft der Kirche, wie sie dargestellt werden, dann müsste es den evangelischen Freunden prächtig gehen«. Das sei aber erkennbar nicht der Fall. Wiederum stimmt der Befund des Kardinals – und geht doch fehl. Denn er erfasst nur einen Teil der kirchlichen Wirklichkeit. Alle christlichen Kirchen haben die gleiche Aufgabe: Menschen dazu zu befähigen und zu ermutigen, den Glauben und die Spiritualität des Christentums als persönlichen Schatz zu erkennen, aus dem Glauben an Gott zu leben und diesen Glauben weiterzugeben. Was wäre dies anderes als die von Kasper aufgerufene »Gottesfrage«? Auch die gesellschaftspolitischen und sozialen Themen sind für alle Konfessionen gleich: Wie positionieren sich Christen in der Gesellschaft? Wie verschaffen sie ihren Überzeugungen Gehör und Verständnis? Das ist schwierig genug. Die katholische Kirche aber behindert sich zusätzlich, indem sie die Zeichen der Zeit innerkirchlich nur ungenügend beachtet.
Papst Johannes XXIII. rechnete die »Teilnahme der Frau am öffentlichen Leben« schon 1963 zu den wesentlichen Signaturen der Gegenwart. Seine Enzyklika »Pacem in terris« atmet den Geist des Fortschritts und des Optimismus. Der Papst sieht die christlich geprägten Gesellschaften in einer Vorreiterrolle für die Emanzipation. Sollte es für die katholische Kirche tatsächlich bedeutungslos sein, wenn sie selbst sich 50Jahre später Errungenschaften verschließt, die anderswo längst Gültigkeit haben?
Gewiss, die »Zeichen der Zeit« müssen nicht nur erkannt, sondern auch verstanden und verinnerlicht werden. Ob Frauen am Altar von den katholischen Ortskirchen weltweit gleichermaßen begrüßt würden, ist fraglich. In Teilen Afrikas etwa dürften es Diakoninnen oder Priesterinnen aufgrund der soziokulturellen Stellung der Frau insgesamt schwer haben. Sich auf solche Widerstände zu berufen, nur um nichts ändern zu müssen, wäre falsch. Warum sollte die katholische Kirche nicht in einem guten Sinne Avantgarde sein?
Freilich gehört es auch zur Weisheit katholischer Inkulturation, die Menschen nicht zu überfordern. Sinnvoll sind darum regionale Unterschiede. Dafür gibt es ein Modell in der Ämterstruktur der Kirche selbst. Bei der Neueinführung des ständigen Diakonats auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil blieb es den Ortskirchen überlassen, ob sie Männer – unverheiratete und verheiratete – für diesen Dienst weihen. Nur in Amerika und Europa machten die regionalen Bischofskonferenzen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Der Anteil ihrer ständigen Diakone lag 2011 im Weltmaßstab bei mehr als 97Prozent. Die Gesamtzahl ist in zehn Jahren von 29000 auf 41000 gestiegen – wiederum vor allem in Europa und Amerika, während ständige Diakone auf den anderen Kontinenten eine kaum wahrnehmbare Gruppe geblieben sind.
Es hat die Einheit der Kirche nicht gefährdet, dass es in der einen Region ganz offiziell verheiratete katholische Geistliche gibt, in der anderen nicht. Auf dieser Erfahrung kann die Kirche auch mit Blick auf Frauen in den Ämtern aufbauen. Eine »Kirche der unterschiedlichen Geschwindigkeiten« ist ein attraktiver Gedanke. Sie muss es nur wollen.
»Der Verlust der Frauen ist eine Katastrophe«
Elisabeth Rathgeb leitet das Seelsorgeamt der Diözese Innsbruck
Frau Rathgeb, Ihr Bischof, Manfred Scheuer, hat sie 2004 mit der Leitung des Seelsorgeamtes in der Diözese betraut. Sie waren damit in Österreich die erste Frau in einem solchen Leitungsjob. Erst seit 2010 haben Sie eine Kollegin in Wien. Böse gefragt: Gab es für Ihren Job denn in ganz Innsbruck keinen Priester mehr?
So böse ist das gar nicht, sondern ziemlich genau das Argument des Bischofs, als er mit der Idee zu mir kam, ich könnte das Amt übernehmen: »Wenn ich einen Priester nehme, reiße ich ein Loch in der Gemeindeleitung.«
Wer sagt, dass das nicht böse ist? Willkommen im Lückenbüßerinnen-Dasein!
Klar, ich hätte das aus der Defizit-Perspektive betrachten und mich ärgern können. Ich habe damals aber beschlossen zu sagen: »So ist die Lage. Sie ist deine Chance. Lass sie nicht verstreichen!« Hätte ich abgesagt, hätte ich nie wieder etwas Kritisches über die Rolle der Frau in der Kirche sagen können. Dabei weiß ich: Ausgerechnet dazu die nächsten 30Jahre meines Berufslebens schweigen zu müssen, nein, das hätte ich nicht ausgehalten. Also bin ich das Risiko eingegangen! Das klare Bekenntnis des Bischofs zu einer Frau in Führungsfunktion hat mir sehr geholfen. Aber sicher, ich geriet alsbald in Situationen, dass ein männlicher Kollege in einer Sitzung sinnierte: »Das ist schon komisch, dass wir jetzt nicht mehr unter uns sind.« – »Ja«, habe ich da zu ihm gesagt, »für mich ist es auch komisch, dass ich jetzt unter euch bin. Aber dann klären wir das, und heute Abend trinken wir alle zusammen ein Glas Wein.«
Es ist doch typisch, Frauen dort einzusetzen, wo kein männliches Personal – und in der katholischen Kirche noch spezifischer: kein Priester – mehr verfügbar ist, ohne Grundlegendes ändern zu wollen. Lassen sich Frauen darauf ein, tragen sie zur Aufrechterhaltung tradierter Strukturen bei.
Wenn ich als Frau Gleichberechtigung erreichen will, muss ich hineingehen in vorgegebene Strukturen, die natürlich bislang von Männern geprägt waren. Wie sollten sie auch anders geprägt sein? Es gab ja eben keine Frauen. Nur so aber verändere ich Rollen und kann einen neuen Stil prägen. Von den Erkenntnissen der Organisationsentwicklung her bin ich überzeugt: Ich kann von innen mehr verändern als durch Zurufe von außen, wo mir keine Struktur und keine Statuten helfen, wo ich keinen Sitzungsverlauf und keine Abstimmung durch Mitreden beeinflussen kann. Damit sage ich nichts gegen den kritischen Blick von außen. Aber ich selbst gehe lieber den praktischen Weg, den »Marsch durch die Institutionen«. Und nach 25Jahren Erfahrung in Politik und Kirche kann ich sagen: Es verändert sich tatsächlich etwas, wenn Frauen in Leitungsgremien einziehen.
Was denn?
Vor allem die Beziehungs- und Kommunikationskultur. Meine größte Stolperfalle war die Idee, es gehe in der Zusammenarbeit um partnerschaftliches Miteinander und um den Erfolg des großen Ganzen. Ich habe aber erleben müssen, dass Männer ganz, ganz anders gepolt sind, auch solche, die sehr reflektiert und diskussionsfähig sind. Wenn es hart auf hart geht, treten auf einmal Revierdenken, Selbstbehauptungs- und Eroberungsstrategien zutage. Ganz knallhart. Komme ich da mit meinem Ansatz von Partnerschaft, Beziehung, Miteinander daher, finde ich mich schnell marginalisiert und vereinnahmt wieder – weil mein Verhalten offensichtlich als Unterlegenheit und Schwäche interpretiert wird. Das hat mich viel vorsichtiger gemacht im Bezug auf Angebote zu Miteinander und Kooperation. In meiner Arbeit als Organisationsentwicklerin habe ich einmal Erfahrungen aus Papua-Neuguinea analysiert, einer ausgesprochen männerdominierten Gesellschaft. Die Männer dort saßen den ganzen Tag am Straßenrand. Was sie denn dort täten, habe ich gefragt. Die Antwort, auf Pidgin-Englisch, lautete: »Talk-talk!« Das heißt: Palaver! Die Männer reden, und die Frauen machen inzwischen die Arbeit. Das lässt sich auf Gremien übertragen: Männer definieren ihr Revier über Redezeit, »Talk-Talk« – egal, ob sie etwas zu sagen haben oder nicht. Und redet einer weniger als die anderen, gilt das als Mangel an Rang oder Kompetenz. Also achte ich als einzige Frau in Runden mit lauter Männern auf deren durchschnittliche Redezeit – und rede dann genauso lang. So etwas mag banal wirken. Es gehört aber zur Prägung von Strukturen. Strukturen, die ich allerdings für veränderbar halte.
Was Sie beschreiben, hätten Sie in der Führung jedes x-beliebigen Unternehmens erleben können. Gibt es auch katholische Spezialitäten?
Vieles läuft in der Kirche tatsächlich wie im Firmenmanagement. Allerdings gibt es nirgends sonst die Decke aus Panzerglas namens »Priesterweihe«, die keine Frau auf ihrem Karriereweg durchstoßen kann. Da ist in der Leitungsverantwortung eine absolute Grenze, nicht nur eine relative. Keine Selbstverpflichtung, keine Quote dieser Welt kann daran derzeit etwas ändern. Das wirkt mental enorm zurück auf die Beziehung von Männern und Frauen in kirchlichen Leitungsämtern.
Wären Sie geweiht, wenn das in der katholischen Kirche möglich wäre?
Das habe ich für mich nie in dieser Weise durchgespielt. Weil ich mir in meinen Lebens- und Berufsentscheidungen die »Existenz aus dem Defizit« ersparen wollte: »Wenn ich könnte, dann wäre ich gern … Aber ich kann ja nicht.« Nein, ich suche Orte, an denen ich meine Fähigkeiten einbringen und entfalten kann. Wenn die Weihe für Frauen möglich werden sollte, dann – ja, dann würde ich es mir ernsthaft überlegen.
Sie erwarten das noch für die verbleibende Zeitspanne Ihrer eigenen Berufstätigkeit?
Vor zehn, zwanzig Jahren hätte ich Ihre Frage optimistischer beantwortet als heute. 1989, am Ende meines Studiums, sind wir mit unserem Geschichtsprofessor in die DDR gefahren. Im Juli war das. Überall hingen die Jubelplakate zum 40-jährigen Bestehen der Republik. Und alle, die sich getraut haben, mit uns zu sprechen, waren überzeugt: Wenn sich hier überhaupt etwas ändert, dann nur mit einem furchtbaren Blutzoll. Vier Monate später ist die Mauer gefallen, ohne einen einzigen Schuss. Diese Kontrasterfahrung hat mich ungeheuer fasziniert und mit Hoffnung für die Kirche erfüllt. Heute sage ich mir: Die Zyklen in der Kirche dauern eben doch nicht 40Jahre wie in der DDR. Darum habe ich mich schon in der Endphase des Pontifikates von Johannes Paul II. und erst recht in den acht Jahren unter Benedikt XVI. damit abgefunden, dass sich die Frage nach der Weihe für Frauen in meinem Berufsleben nicht mehr stellen wird. Vielleicht kann ich es ja noch als Pensionistin im Schaukelstuhl verfolgen (lacht).
Sie haben sich mit den Verhältnissen arrangiert?
Für mich persönlich. Aber ich sehe mich in der Verantwortung für andere Frauen meines Alters, die sich zu einem geistlichen Amt in der Kirche berufen fühlen, und auch für die Jüngeren nach mir. Ich kenne solche Frauen und weiß, wie sehr sie darunter leiden, ihrer Berufung nicht folgen zu können. Nicht zuletzt für sie muss ich Partei nehmen und das Wort ergreifen – als engagierte Katholikin wie als Leiterin des Seelsorgeamtes.
Was sagen Sie, wenn Sie das Wort ergreifen?
Dass der Ausschluss der Frauen von den Weiheämtern eine gravierende Ungerechtigkeit ist, die beseitigt werden muss. Nicht weil das »Gender-Mainstreaming« es so will, sondern weil es die ureigenste Botschaft unseres Glaubens betrifft.
Das kirchliche Lehramt sieht das bekanntlich anders. Papst Franziskus hat Ende Juli 2013 ja noch einmal bekräftigt, dass Johannes Paul II. »diese Tür geschlossen« hat.
Ich weiß. Nun ist die päpstliche Entscheidung von 1994 zwar eine »verbindliche«, aber keine »letztverbindliche«. Dafür hat sie auch zu viele dogmatische Fehler. Die Kirche täte gut daran, die ganze Frage neu zu diskutieren und dabei alles an biblischen und theologischen Befunden aufzunehmen, was die vergangenen 30Jahre Forschungsarbeit ergeben haben.
Wer das in Deutschland sagt, der kann in bestimmten Bistümern einen Job als Religionslehrer, als Professor abschreiben oder sogar – wie der Kölner Theologe Georg Schwikart – die eigene Zulassung zur Weihe vergessen. Ist der Heilige Geist in Österreich ein milderes Lüftchen?
Auch bei uns sind die Adressen im Vatikan bekannt, an die man Beschwerdebriefe richten kann. Aber es hilft ja nichts: Ich kann dort nicht schweigen, wo ich die Zukunft der Kirche und die Weitergabe ihrer Botschaft gefährdet sehe. Das gehört für mich zu jener »kritischen Loyalität«, von der Karl Rahner spricht. Dafür kann ich mich auch auf geltendes kirchliches Recht berufen.
Sie meinen Canon 212, Paragraf 3 des kirchlichen Gesetzbuches CIC, wo es heißt, die Gläubigen hätten »das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, den geistlichen Hirten mitzuteilen«.
Meine Meinung zum Weiheamt für Frauen steht zweifellos in Spannung zu aktuellen Positionen des Lehramtes. Aber die Kirchengeschichte zeigt, wie viele »letztverbindliche und unabänderliche« Lehrentscheidungen bereits revidiert worden sind. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht vom »sensus fidelium«, dem gemeinsamen Glaubenssinn der Getauften, der in kirchliches Handeln und Entscheiden einzubeziehen ist. Nimmt man das ernst, können auch lehramtliche Entscheidungen zur Disposition stehen, ohne dass deshalb in der Kirche »alles über den Haufen geworfen« werden müsste. Die Kirche ist jedenfalls gut beraten, die Stimme der Gläubigen zu hören und nicht sofort mit Sanktionen zu reagieren, sondern nach den theologischen und gesellschaftlichen Dringlichkeiten zu fragen, die hier sichtbar werden. Denn wegen der ablehnenden Haltung der Kirche zur Weihe von Diakoninnen und Priesterinnen höre ich gerade von jungen Frauen, sogar schon von Schülerinnen: »Eine solche Institution ist für mich nicht akzeptabel, und ich will mich erst recht nicht in ihr engagieren oder gar beruflich für sie tätig sein.«
Das kommt in einer Studie des Wiener Pastoraltheologen Paul Zulehner über den Glauben der Frauen sehr deutlich zum Ausdruck: Die katholische Kirche verliert insbesondere die jungen, gebildeten Frauen unter vierzig.
In Österreich ist bereits jede Dritte dieser Gruppe aus der Kirche ausgetreten. Ein zweites Drittel steht davor, ist – wie Zulehner das formuliert – im »Austritts-Standby«. Somit ist überhaupt nur noch ein Drittel dieser Frauen für die Kirche erreichbar. Das ist ein alarmierender Befund. Verliert die Kirche nämlich die Frauen, die einerseits gesellschaftlich und politisch in Führungspositionen kommen und die andererseits in der Familie entscheidend verantwortlich sind für die religiöse Sozialisation der Kinder – dann ist das eine mindestens so große Katastrophe wie der Verlust der Arbeiterschaft im 19.Jahrhundert. Wenn nicht die größere Katastrophe. Eine Kirchenleitung aber, die in solch einer Lage dasitzt, mit den Schultern zuckt und sagt, »nix zu machen«, hat ein wesentliches Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Sie fungieren durch ihr Amt selbst als die denkbar beste Argumentationshilfe der Bischöfe, die sagen: »Bitteschön, wir sind doch dabei, Frauen in die Führung der Kirche zu holen und ihnen Verantwortung zu geben. Das geht offenkundig auch ohne Weihe.«
Die Gefahr, als Feigenblatt herhalten zu müssen, ist mir bewusst. Mir wird es auch bisweilen vorgeworfen, dass ich eine Art nützlicher Idiotin sei. Ich kann das noch nicht einmal komplett von der Hand weisen. Wenn die Amtskirche nur auf der Schiene führe, Frauen zu befördern und damit die Weihefrage von der Agenda zu nehmen, dann wäre es fatal, auch für mich und mein Wirken. Aber wiederum glaube ich, dass sich die Gesamtdiskussion verändern wird. In dem Maße nämlich, in dem Frauen in Führungsgremien mitreden und dort die Argumente gegen die Zulassung von Frauen zu den Ämtern hinterfragen.
Sie meinen, irgendwas davon wird schon hängen bleiben?
Ich glaube, dass es einfach auch die persönliche Bewusstseinsbildung braucht, damit Männer in kirchlichen Führungsetagen erkennen oder wenigstens ahnen: Wir können so nicht mehr weitermachen. Was heute jede Studentin im ersten Semester als offenkundig unterkomplex oder gar falsch erkennt, das können wir nicht länger unverdrossen wiederholen oder es gar stur bis in die Höhen lehramtlicher Dokumente transportieren. Wenn ich höre, Jesus habe eben nur Männer zu Aposteln berufen, ist das biblisch und historisch einfach nur Schwachsinn. Maria Magdalena ist nach den Zeugnissen der Schrift und der Urkirche »Apostola apostolorum«: Sie ist Zeugin von Leben, Tod und Auferstehung Jesu, was klassisch die Definition des Apostels ist. Noch schlimmer wird es, wenn der Zwölferkreis mit den »zwölf Aposteln« gleichgesetzt wird, die Jesus um sich versammelt habe und die ja nun sämtlich Männer gewesen seien. Wo bleibt da zum Beispiel der Apostel Paulus? Also, das passt alles hinten und vorn nicht. Darüber können Sie heute in jedem einigermaßen aufgeweckten Pfarrgemeinderat diskutieren. Die Menschen wissen das. Am meisten aber wird sich die Diskussion verändern, wenn Frauen in Führungsrollen akzeptiert werden und durch Kompetenz punkten können. Denn dann wird vielen dämmern: »Oh, das geht ja!« Manchmal finde ich es geradezu belustigend, dass einige Argumente gegen die Weihe von Frauen bis aufs i-Tüpfelchen dieselben sind, die vor 100Jahren gegen das Wahlrecht der Frauen eingewandt wurden und die im Schweizer Kanton Appenzell bis 1986 getragen haben. Was war das für ein Bewusstseinswandel! Ich begrüße sehr die Vorstöße des Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode, in einem ersten Schritt das Diakonenamt für Frauen zu öffnen. Zumindest von ihm habe ich bislang nicht gehört, dass es dafür wieder bestimmte Einschränkungen oder ein anders definiertes Amt geben müsse.
Eigentlich bestätigen Sie jetzt aber die Sorge, dass mit der Öffnung des Diakonenamts für Frauen die Dämme brächen, die dann noch gegen eine Zulassung zur Priesterweihe stünden.
Genau das gilt es ja offenzulegen: die Ängste, die hinter den Versuchen stehen, die Priesterweihe der Frauen zu einem Ding der Unmöglichkeit zu erklären. Wenn wir über diese Ängste sprechen, können wir uns die theologischen Finten und Umwege sparen, die immer schräg bis hanebüchen bleiben. Auf die Frage, was die Gegner der Weihe für Frauen sagen, wenn sie unter sich sind, hat mir ein guter Bekannter – selbst geweihter Priester und habilitierter Theologe – einmal geantwortet: »Aber wo kommen wir denn dann hin? Dann geht es so wie bei den Ministrantinnen, und es gibt bald überhaupt keine Männer mehr im Priesterberuf.« Aus solchen Sätzen spricht die große Sorge, sich selbst behaupten zu können, die Angst vor Konkurrenz. Alles sehr menschlich, sehr verständlich. Aber doch kein hinreichendes Argument, Dinge aufrechtzuerhalten, die nach 2000Jahren Kirchengeschichte dringend zu verändern sind.
Welche heilsame Wirkung für die Kirche versprechen Sie sich davon?
Jeder von uns weiß, wenn er nach einer Krankheit auf Kur geht, geht es um zweierlei: die Folgen einer körperlichen Beeinträchtigung zu beheben oder wenigstens zu mindern; das ist das eine. Das andere ist aber für den Kurerfolg genauso wichtig: die Pflege der Seele. Das Gleiche gilt auch für die Kirche: Sie braucht die Kur an Körper und Seele. Mit »Körper« meine ich das Organisationsgefüge der Kirche, ihre Strukturen. Dahin gehört für mich die Frauenfrage. Mit »Seele« meine ich Spiritualität, Leben aus der Kraft des Glaubens. Und eine »seelische Kur« ist genauso wichtig: Wie gelingt es uns, den Schatz an Erfahrungen unserer spirituellen Tradition neu zu heben und zum Leuchten zu bringen? Auch da lässt die Kirche viel Potenzial ungenutzt, das Frauen einzubringen hätten. In existenziellen Krisen und Notsituationen wie etwa einem Schwangerschaftskonflikt fällt es Frauen einfach schwerer, sich Männern anzuvertrauen. Eine männerdominierte Kirche hinterlässt in der Seelsorge für Frauen, aber auch für Männer große Brachlandschaften.
Die Kirche und die Jugend
Frühjahr 2013. Anruf im Düsseldorfer Jugendhaus, dem Sitz des »Bunds der Deutschen Katholischen Jugend« BDKJ. In ihm sind 16Organisationen zusammengeschlossen, die gemeinsam auf 660000 Mitglieder im Alter von 7 bis 28Jahren kommen. Ob sich in solch einem Reservoir wohl welche finden, die schon einen prominenten Namen haben? Bekannte junge Katholiken, die für ein Buch über die Zukunft der Kirche von ihrem Glauben sprechen möchten, ihrem Bild von der Kirche heute und von Wunschbildern für die Zukunft? »Tja«, sagt BDKJ-Sprecher Michael Kreuzfelder, »da muss ich mal nachdenken. Das ist gar nicht so einfach. Auf Anhieb fällt mir nicht gleich ein passender Name ein.« Weil der Sprecher aber ausnehmend hilfsbereit ist, dauert es mit dem Rückruf nicht allzu lange: »Also, es gibt da ein Geschwisterpaar aus Aachen, Jasmin und René Schwiers, beide um die dreißig. Sie ist Schauspielerin, er Musiker. Beide sind seit Ewigkeiten aktiv im Vorstand der J-GCL Aachen. Ich glaube, die würden gut passen.«
J-GCL? Das Abkürzungsungetüm steht für einen noch sperrigeren Namen: die »Jugendverbände der Gemeinschaft Christlichen Lebens GCL«, eine Gründung der Jesuiten mit mehr als 450-jähriger Tradition, früher bekannt als »Marianische Congregation«. Auch kein Titel mit jugendlichem Fluidum.
Nachfrage also bei den J-GCL Aachen. Jasmin und René Schwiers? Ja, klar, die arbeiten hier mit. Kurze Zeit später nimmt die Managerin der beiden Kontakt auf. Und: Der freundliche BDKJ-Sprecher hatte recht. Jasmin und René Schwiers sind interessiert an einem Gespräch, ihnen gefällt die Idee des Buchs. Aber, druckst die Managerin herum, es gebe da eine Sache, über die sich die beiden wunderten und die sie zögern lasse: »Die sind doch überhaupt nicht katholisch.« Übrigens auch nie gewesen. »Deshalb fragen sich Jasmin und René schon, ob sie trotzdem in Frage kommen.«
Gerade deshalb. In einer Zeit, in der die katholische Kirche – wie es im Kommentar des BDKJ zur Sinus-Jugendstudie 2012 heißt – für Jugendliche immer seltener eine Rolle spielt, sind junge Erwachsene in der Kirche aktiv, die ihr noch nicht einmal angehören. Wie kommen sie dazu? Vorstand in einem Verband zu sein, das bedeutet: Sitzungen, Tagesordnungen, Protokolle, Diskussionen übers Geld. Lange Abende, die sich unterhaltsamer gestalten ließen. Auf dem klassischen Weg katholischer Sozialisation können Jasmin und René Schwiers nicht dorthin gelangt sein: Sie haben nie an der Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung teilgenommen, waren keine Messdiener oder Pfarrjugendleiter, sind auch nicht durch den charismatischen Kaplan ihrer Gemeinde – wenn diese denn noch einen gehabt hätte – fürs Engagement in der Kirche »angefixt« worden.
Aber sie haben trotzdem eine prägende Erfahrung mit der Kirche gemacht: die Teilnahme an den »Werkwochen«, einem musisch-kreativen Feriengebot in der Bleiberger Fabrik in Aachen, das auf den 1996 verstorbenen Jesuitenpater Erich Lennartz zurückgeht und seit 1965 existiert. Seit 1997 liegt die kirchliche Trägerschaft bei den J-GCL. Die Internet-Seiten (www.werkwochen.de) überfallen den Besucher nicht damit. Aber sie verschweigen oder verstecken es auch nicht. Ein auf Erich Lennartz zurückgehender programmatischer Text über den »spielenden Menschen« zum Beispiel steht an zentraler Stelle. »Wir Menschen sind in christlicher Sicht nicht nur zum Arbeiten, sondern Spielen erschaffen worden«, heißt es da. Freude, Muße, Spielen machten den Sinn des Lebens aus. »Wir sind immer weniger Ebenbilder Gottes, weil wir nur selten oder überhaupt nicht spielen.« »Erst die Arbeit, dann das Spiel«, das beschreibe die vom Menschen verdorbene, unheile Welt. Darum gelte es, die Reihenfolge umzudrehen: »Erst das Spiel als Sinndeutung unseres Lebens und dann die soweit notwendige Arbeit.«
Seltsam, wie solche Gedanken – ganz im emotional-erregten Geist und Tonfall der 60er Jahre gehalten – nach fünf Jahrzehnten unter veränderten Bedingungen wieder den Nerv einer jungen Generation »pragmatischer Egotaktiker« (Shell-Jugendstudie) treffen: Sie wachsen mit straff durchgetakteten Bildungsgängen auf. Sie wissen, dass sie effizient und gut organisiert sein müssen, um etwas zu erreichen – und sie wollen auch etwas erreichen, sind leistungsbereit und zupackend. Zu den Standard-Erfahrungen dieser Generation gehört auch, dass angestammte Sicherheiten wenig wert sind; dass sie sich – anders als ihre Eltern – immer wieder neu erfinden müssen. Milieu-Untersuchungen wie die Sinus-Jugendstudie zeichnen das Bild einer grundsätzlich optimistischen Jugend, die bereit ist, diese Herausforderungen anzunehmen und das eigene Leben aktiv zu gestalten. Bedrohlich wirkt demgegenüber die Vorstellung, »abzurutschen« und den Boden unter den Füßen zu verlieren. Für die mehr als zwei Millionen junger Menschen unter 18Jahren, die von Armut bedroht sind, ist das nicht nur ein Szenario, sondern tägliche Realität.
Es ist Aufgabe und Chance der Kirche, sich dieser Generation als verlässliche und zugleich diskrete Begleiterin anzubieten. In den Sozialformen einer auf Liturgie und Gottesdienst hin zentrierten Kleriker-Kirche wird das aber nicht gelingen, weil die Jugendlichen hier immer seltener und in immer geringerer Zahl anzutreffen sind. Demoskopen liefern den Befund, dass nur noch etwa fünf Prozent der 16- bis 29-Jährigen sich selbst als »kirchentreu« bezeichnen. Weniger als zehn Prozent der katholischen Jugendlichen sagen, sie fühlten sich ihrer Kirche eng verbunden. Da »Verbundenheit« zumindest traditionell mit Kirchgang und Gottesdienstbesuch assoziiert wird, genügt am Sonntagmorgen ein Blick in die Bänke einer normalen deutschen Pfarrkirche, um die Selbstbeschreibung der Jugendlichen bestätigt zu finden.
Entgegen mancher kirchlicher Selbstbeschwichtigung, es komme nicht auf Quantität, sondern auf Qualität an, spielen Zahlen gerade für junge Menschen sehr wohl eine Rolle: Sie fühlen sich dort wohl, wo sie nicht allein sind, wo sie auf Gleichgesinnte treffen. Weltjugendtage funktionieren übrigens genau nach diesem Grundsatz. Nirgends war das so deutlich spürbar wie auf dem Weltjugendtag 2005. Die Begeisterung für Papst Johannes Paul II., der vier Monate vor dem Kölner Event gestorben war, übertrug sich bruchlos auf seinen Nachfolger Benedikt XVI. Schon das ist ein sprechendes Indiz für einen Kollektiv-Mechanismus, der abgelöst von der Person greift.
Was der Papst den 400000 Jugendlichen zu sagen hatte, die in der Nacht vor dem Abschlussgottesdienst auf freiem Feld campierten, waren schöne und wohlgesetzte Worte über die Anbetung, das Vorbild der Heiligen und das Geheimnis der Eucharistie. Aber sie verhallten buchstäblich auf der riesigen Fläche dieses katholischen Zeltlagers. Ergriffen waren die Teilnehmer von der Atmosphäre, vom Kerzenschein, vom gemeinsamen Gesang, auch von der Präsenz des »Heiligen Vaters« auf dem taghell erleuchteten Altarhügel. Und vielleicht auch davon, wie wenig Benedikt ihnen in all den Tagen seines Aufenthaltes in Köln auferlegt hatte. Keine Verbote, keine Moralpredigt. Stattdessen der offene, werbende Gestus der Einladung: »Seid völlig überzeugt davon: Christus nimmt nichts weg von dem, was ihr an Schönem und Großem in euch habt, sondern zur Ehre Gottes, zum Glück der Menschen und zum Heil der Welt führt er alles zur Vollendung.«* [* Ansprache des Papstes auf dem Rheinschiff bei der Willkommensfeier mit Jugendlichen am 18.August 2005.]
Mit dieser Überzeugung, von der Benedikt XVI. spricht, müsste die Kirche zuallererst für sich selbst ernst machen. Religionssoziologen beschreiben die Hauptschwierigkeit kirchlichen Bemühens um die junge Generation weniger als Inhaltsproblem. Nicht Abstoßung und aggressive Abgrenzung gegenüber der Kirche überwiegen. Vielmehr ist sie in der Wahrnehmung der Jugendlichen als Lebensraum nicht existent. Die wenigsten kennen überhaupt noch etwas von der katholischen Kirche, was für sie nicht museal, folkloristisch oder verschroben konnotiert wäre. Mit Gott, Religion und Glaube dagegen kann ein überraschend hoher Prozentsatz der Jugendlichen etwas anfangen, und selbst der Kirche als solcher gilt großes Wohlwollen – allerdings nur einer idealtypisch denkbaren, für die Jugendlichen aber so nicht erlebbaren Kirche. Zwei Drittel sagen, die Kirche habe keine Antwort auf die Fragen, die sie bewegen. Der Religionspädagoge Matthias Sellmann schließt daraus, Jugendliche könnten eine Kirche gut finden, obwohl sie am jugendlichen Leben vorbeiagiert.
Die erste Empfehlung, um in der Wahrnehmung junger Menschen nicht nur als Ahnung, als bloße Möglichkeit aufzutauchen, klingt paradox: Die Kirche muss sich zurücknehmen. Sie muss sich von der irrigen Vorstellung verabschieden, das bestimmende Moment im Leben der Menschen zu sein. Es sei der größte Fehler der katholischen Kirche, sagte jüngst eine deutsche Spitzenpolitikerin, »immer noch so zu tun, als gäbe es nur sie«. Das Christentum ist eine Zugabe im Leben, ein Ferment. Wo die Kirche mehr sein wollte, hat sie von jeher ihr Guthabenkonto überzogen. Das »Soll« im Seelenhaushalt der Menschen konnte sie sich über Jahrhunderte nur leisten, weil sie es mit ihren Gnadenmitteln, den Sakramenten, auszugleichen versprach. Heute wollen die Menschen aber keine Dauerschuldner mehr sein. Sie wollen ihr Lebenskonto ins »Haben« bringen – und der Gnadenschatz der Kirche scheint ihnen dafür nicht mehr notwendig zu sein.
Das gilt besonders für junge Menschen, die sich bei den unterschiedlichsten Anbietern bedienen und mit deren Warenkörben experimentieren. Nicht unverbindlich, aber punktuell. Nicht gleichgültig, aber freibleibend. »Wer heute ergriffen im Taizé-Gottesdienst auf dem Kirchentag Halleluja singt, kann morgen atheistische Theorien vertreten und in zwei Monaten wiederum ehrenamtlich und engagiert in einer kirchlichen Gruppe mitarbeiten und Glauben ganz wichtig finden – und während der ganzen Zeit eben nicht immer genau wissen, was er/sie glauben soll und ob Gott ein Mann, eine Frau, ein Prinzip oder eine Illusion ist.« Das einverständig-milde Lächeln der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) bei dieser Skizzierung ihrer Klientel mag dem Ordnungssinn der katholischen Kirche abgehen. Aber es passt zu dem, was aus Begegnungen wie der mit den Geschwistern Schwiers und ihrem Werkwochen-Engagement zu lernen ist: Eine »junge Kirche« muss jungen Menschen bieten, was sie sich wünschen – nicht umgekehrt.
Ich wünsche mir Kirche als ein Angebot, das ich nicht ausschlagen möchte«
Jasmin Schwiers ist Schauspielerin.
René Schwiers ist Musiker.
Jasmin, René, Sie sind beide Künstler von Beruf, verbringen viel Zeit mit Dreharbeiten, Reisen, Auftritten und Konzerten. Es war gar nicht so leicht, sich zu dritt zu verabreden. Trotz vieler Termine in Ihren Kalendern engagieren Sie sich seit Jahren in einem katholischen Jugendverband. Was ist Ihnen daran wichtig?
René Schwiers: Wir sind aktiv bei den »musisch-kreativen Werkwochen«. Das ist ein Freizeitangebot der katholischen Kirche für Kinder und Jugendliche in den Schulferien. Als ich zehn Jahre alt war und meine Schwester sieben, haben Nachbarskinder uns auf die Werkwochen aufmerksam gemacht, eine Art Camp mit Kursen und Workshops in allen möglichen künstlerischen Sparten …
Jasmin Schwiers: … Malen, Holzarbeiten, Musik, Theater. Unsere Eltern fanden das gut und haben uns angemeldet. Es war okay für sie, dass der Träger ein katholischer Verband ist. Es hat aber für meine Eltern nicht die ausschlaggebende Rolle gespielt.
RS: Und für uns Kinder erst recht nicht. Klar, zum Abschluss gab’s immer eine Messe. Aber zunächst ging es uns einfach nur um Ferienspaß und Kreativität. Wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt, einen fast schon familiären Freundeskreis gefunden und sind seitdem eigentlich in allen Ferien hingegangen. Irgendwann stellte unsere Mutter fest, dass der Werkwochen-Gründer, der Jesuit Erich Lennartz, einmal ihr Religionslehrer gewesen war. Dadurch ist auch persönlich etwas der Funke übergesprungen, und meine Eltern hatten umso mehr das Gefühl: Unsere Kinder sind in guten Händen. Als wir älter wurden und uns als Betreuer engagierten, haben wir dann auch die Verbandsstruktur kennengelernt.
Sie sitzen bis heute im Vorstand der »J-GCL« in Aachen. Das ist der Jugendzweig der »Gemeinschaft Christlichen Lebens«, eines Verbandes in jesuitischer Tradition.
RS: Als Teilnehmer an den Werkwochen haben wir so tolle Zeiten erlebt und so viel für unser Leben mitgenommen, dass wir davon etwas zurückgeben möchten, solange es irgendwie geht. Zum Glück können wir uns die Zeit dafür immer noch nehmen.
JS: Das ist schon zeitintensiv mit Vorstandssitzungen, Etatplänen und allem möglichen organisatorischen Kram. Aber ich habe nie das Gefühl, »Was bin ich doch für ein Gutmensch!« Oder »Hey, ich mach jetzt mal wieder ein bisschen Charity!« Für mich steckt ganz, ganz viel Herzblut in dieser Arbeit. Ich kann gar nicht anders.
Was hat Sie so begeistert?
JS: Ich verdanke den Werkwochen meinen Zugang zum Theaterspielen.
RS: Bei mir war es so, dass ich auch schon vorher Musik gemacht hatte. Aber in den Werkwochen konnte ich alle möglichen Instrumente ausprobieren, meine Vorlieben oder Talente entdecken und ausleben. Einmal haben wir eine Band zusammengestellt, ein anderes Mal ein Musical einstudiert und auf die Bühne gebracht. Das sind Dinge, an denen ich unglaublich gewachsen bin und die mir am Ende auch Mut gemacht haben, zu sagen: »Hey, ich versuche es mit der Musik jetzt auch mal über das Hobby hinaus.«
JS: Zur Feier der 500. Werkwoche hatten wir uns ein Dreivierteljahr Zeit für ein eigenes Theaterstück genommen. Aber es war niemand da, der es geschrieben hätte. Da habe ich mich selbst hingesetzt und später auch Regie geführt. Ich will jetzt gar nicht »auf Autorin machen«, sondern nur sagen: Ich bin an meine Grenzen und sogar darüber hinaus gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich schreiben kann, weil mir das eigentlich nicht sonderlich liegt. Es war dieses Moment, etwas zu wagen, sich etwas zuzumuten und zuzutrauen. Am Ende war ich so glücklich, wie toll es geworden ist. Das sind Erfahrungen fürs Leben, die unbezahlbar sind. Ich weiß nicht, wo wir heute stünden, wenn wir nicht in den Werkwochen auf diese spielerische Weise angefangen hätten, uns selbst zu vertrauen und kreativ über die eigenen Grenzen zu gehen.
Und jetzt möchten Sie das Unbezahlbare vergelten?
JS: Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir diesen Schatz behüten und bewahren möchten, indem wir ihn weitertragen. Pater Lennartz hat sinngemäß zu uns gesagt: »Man soll seine Zeit nicht verschwenden. Nimm sie dir vielmehr, um etwas zu schaffen. Denn das ist das Göttliche in jedem Menschen: die Fähigkeit etwas zu erschaffen. Und verlerne nie zu spielen, denn das Kindliche in uns ist gleichzeitig auch das Göttliche.« Das haben wir wirklich verinnerlicht und geben es auch so an die Kinder von heute weiter. Nicht immer so explizit wie Pater Lennartz, aber in seinem Geist: Probier dich aus! Werde kreativ! Schaff selber etwas! »Der spielende Mensch«, das ist auch ein Begriff, der mir von Pater Lennartz in Erinnerung geblieben ist. Genau das ist die wichtigste Message der Werkwochen: Zum christlichen Bild vom Menschen gehört das Spielerische, Kreative. Wobei das Angebot der Werkwochen offen für alle ist: Katholiken, Evangelische, Muslime, Konfessionslose. Pater Lennartz hat es nie interessiert, welches von den vielen kleinen blonden Mädchen in den Werkwochen katholisch war und welches nicht. Dieser Spirit ist bis heute etwas, womit ich mich voll identifizieren kann – eine sehr offene Art, Kirche zu leben.
Unter katholischem Dach. Obwohl Sie beide selbst nicht konfessionell gebunden sind. Das macht neugierig!
JS: Ehrlich gesagt, wir haben uns gefragt, was daran interessant sein sollte.
Na ja, kennen Sie sonst noch viele Leute in Ihrem Alter oder jünger, die in der katholischen Kirche aktiv sind?
RS: Wir sind aktiv bei einem Angebot der katholischen Kirche. Aber das ist ja nicht identisch mit dem Raum der Kirche insgesamt. Die christliche Erziehung – biblische Geschichten, Kindergottesdienste – gehört zu unserem Background. Wir kommen aus einer neuapostolischen Familie. Aber wir haben irgendwann den Zugang verloren. Nicht zu Gott, wohl aber zur Kirche.
JS: Nicht dass wir uns aktiv abgewandt hätten. Wir stehen nicht abwehrend oder in einer Antihaltung zur Kirche.
RS: Nein, überhaupt nicht! Das war ein schleichender Prozess im Jugendalter mit 16, 17Jahren, dass wir am Wochenende mit Freunden ausgehen und sonntags lieber lange ausschlafen wollten, als morgens in die Kirche zu gehen.
JS: Für mich kam hinzu, dass ich keine notwendige Beziehung zwischen meinem Glauben an Gott und der Kirche sehe, womöglich auch noch einer speziellen Konfession. Zum Beispiel haben mein Mann, der Katholik ist, und ich zwar kirchlich geheiratet, aber ohne konfessionelle Bindung.
Was heißt »ohne konfessionelle Bindung«?
JS: Mein Onkel ist neuapostolischer Geistlicher. Er hat mit uns einen Wortgottesdienst in der evangelischen »Kulturkirche« im Kölner Stadtteil Nippes gefeiert, die ich als Ort der offenen, zwanglosen Begegnung von Kunst, Kultur und Kirche besonders mag. Ganz frei. Ich sage gern: Gott war eingeladen. Und ich bin sicher, er war auch da. Aber wir haben ihn nicht in ein konfessionelles Korsett gezwängt. Genauso möchte ich mich auch in der Kirche bewegen können – mit dem Gefühl: Ich muss hier nicht in irgendwas reinpassen, sondern darf mich ausbreiten, so wie ich bin.
Warum haben Sie überhaupt kirchlich geheiratet?
JS: Weil meinem Mann und mir Spiritualität und christliche Werte wichtig sind.
RS: So geht es mir auch. Aber dafür brauche ich nicht jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Das ginge beruflich auch gar nicht. Okay, eine blöde Ausrede, weil ja vieles eine Frage der Prioritäten ist. Aber die Sachzwänge sind schon auch da: Termine, Konzerte, Reisen …
JS: Ich gebe aber auch zu: Ich habe einfach nicht das Bedürfnis.
Was bedeutet für Sie »Spiritualität«?
JS: Das Wissen, es gibt etwas außerhalb von uns, etwas Transzendentes. Aber ganz sicher auch die Art, miteinander umzugehen.
RS: Wenn ich die Regeln der Zehn Gebote für mich herunterbreche, kann ich damit schon ganz gut durchs Leben kommen. Was für mich beim Thema »Spiritualität« noch eine wichtige Rolle spielt, ist die Gemeinschaft. Ich bin immer fasziniert und gerührt von unseren Abschlussgottesdiensten in der Werkwoche, die wir selbst vorbereiten und gestalten – mit Texten, Liedern, Bildern, einer eigens gemalten Decke auf dem Altar, um den wir uns im Kreis auf den Boden setzen. Eine halbe Stunde Zeit, innezuhalten, auf die Erlebnisse der Werkwoche zurückzuschauen, miteinander das zu bedenken, was uns bewegt hat. Was da für eine dichte Atmosphäre entsteht!
JS: Es ist eine ganz nahbare, spürbare Art, Glauben und Kirche zu leben. Und Gott ist dabei. Davon bin ich fest überzeugt. Für uns Betreuer ist aber auch Pater Lennartz, der inzwischen verstorben ist, in solchen Momenten anwesend – mit seinem Charisma, seiner Ausstrahlung, mit der er die Werkwochen und uns selbst so entscheidend geprägt hat.
Ist die Abschlussmesse der einzige explizit christliche Akzent während der Werkwochen?
RS: Wir bieten jeden Abend eine Meditation an. Das eröffnet Räume für die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen: Nicht als ein Muss, sondern ganz zwanglos. Die Kinder nehmen das sehr unterschiedlich wahr. Manche stellen erst am Ende einer Werkwoche fest, dass das Ganze irgendwas mit Kirche zu tun hat, wenn es nämlich heißt: »So, und nachher ist dann die Messe.« Andere fordern uns geradezu als Seelsorger.
Sie sehen sich selbst als Seelsorger?
RS: Auf jeden Fall.
JS: Die Eltern vertrauen uns das Wichtigste und Wertvollste an, was sie haben: ihre Kinder. Da tragen wir eine immense Verantwortung, der wir bestmöglich gerecht werden wollen. Wir sind Vorbild und Autorität, wir möchten den Kindern in der Werkwoche mit Offenheit und Empathie begegnen, sodass sie mit all ihren Anliegen zu uns kommen können. Was ist das anderes als »Seelsorge«?
RS: Einmal hatte ich ein Erlebnis, das mir sehr nahegegangen ist. Ein Junge kam zu mir und sagte: »Mein Vater ist vor Kurzem gestorben. Wieso erlaubt Gott das?« In so einer Situation kann man ja nicht ausweichen oder weglaufen. Ich habe zwei, drei Stunden mit dem Jungen dagesessen. Was ich genau gesagt habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, es hat ihm allein schon gutgetan, jemanden zu haben, der einfach zuhört.
JS: Die kirchliche Bindung ist so etwas wie die Wurzel des Baumes Werkwoche. Wir Betreuer sind der Stamm, der die Baumkrone trägt. Was man dort nachher als Blüten und als Früchte sieht, das sind die Kurse, die Kreativarbeiten der Kinder, das sind Fröhlichkeit und Gemeinschaft. Aber am Ende der Woche besinnen wir uns noch einmal ganz gezielt auf die Wurzel, von der ich glaube: Ohne sie ginge das Ganze nicht.
Ihre Erfahrungen mit der katholischen Kirche sind durch Pater Lennartz sehr persönlich und sehr positiv besetzt. Haben Sie auch Negativ-Bilder von der Kirche?
RS: Nichts, was mich konkret abschrecken würde.
JS: Also, mich schon!
RS: Moment! Klar, die Reizthemen kenne ich auch: Sexualmoral, Kondome, Umgang mit Schwulen und Lesben, Zölibat, Frauen … Und das meiste davon sehe ich anders als die katholische Kirche. Aber ich sehe kein Bedürfnis und keine Notwendigkeit, ganz persönlich in diese Debatten einzusteigen. Meine Haltung ist die eines Beobachters in freundlicher Distanz. Mich interessieren kirchliche Themen, ohne dass sie mich persönlich allzu sehr betreffen oder bewegen. Weil ich meine eigene Spiritualität gefunden habe – mit starken katholischen Einflüssen, weil die Werkwochen eben eine katholische Veranstaltung sind.
JS: