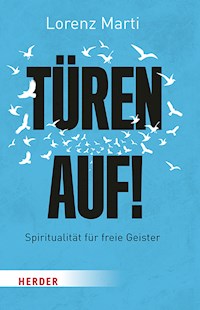Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Auf spielerische Weise verbindet Lorenz Marti Zeugnisse der Mystik mit ganz alltäglichen Erfahrungen und fragt nach der praktischen Bedeutung spiritueller Weisheiten. Er verteilt keine Rezepte und empfiehlt keine Übungen, präsentiert keine Theorien – er beobachtet, stellt Fragen, und nimmt seine Leser mit – mitten ins Herz des Alltäglichen. Spiritualität kann beim Schnüren der Schuhe beginnen, frühmorgens, wenn die Zeit knapp ist und der Stress groß, und plötzlich ein Schuhbändel reißt. Der Ort, an dem wir die großen Fragen des Lebens reflektieren und meditieren, ist immer dort, wo wir uns gerade befinden. In der Küche, im Büro, am Hauptbahnhof. Beim Zähneputzen, beim Schreiben, beim Einkauf im Supermarkt. Das Geheimnis des Lebens verbirgt sich nicht an besonders heiligen Orten. Wenn es ein Versteck hat, dann ist es das ganz Gewöhnliche, oft Übersehene, kaum Beachtete. Wir alle können Mystikerinnen und Mystiker sein, wenn wir die Tiefenschichten des Lebens entdecken und ergründen, die uns üblicherweise verschlossen bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lorenz Marti
Wie schnürt ein Mystiker seine Schuhe?
Die großen Fragen und der tägliche Kleinkram
Neuausgabe 2018
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2004
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Alina Kovalchuk, goir – shutterstock
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-81156-2
ISBN (Buch) 978-3-451-06969-7
Für Corina
Ohne sie wäre dieses Buch nie zustande gekommen
Inhalt
Einstimmung
1 Unruhiges Herz und offene Weite
Das unruhige Herz
Ich geh, weiß nit wohin …
Der weglose Weg
Die Wolken sind nicht der Himmel
Wüstenwanderungen
Drei Fragen an Bodhidharma
2 Immer ganz am Anfang
Vom Nichtwissen – zum Nichtwissen
Mit Augustinus am Meer
Ganz am Anfang
Von Kaisern und Kindern
Ohne ein Warum
3 Die Schönheit der kleinen Dinge
Die Botschaft des Stammlers
Eine Liebeserklärung an das Gewöhnliche
Geschirr spülen
Die Tür, meine Lehrerin
Das Mysterium im Hauptbahnhof
Staub saugen mit Bruder Laurentius
4 Ein Blick in den Spiegel
Drei Brüder
Ein Wächter am Fluss
Hirsekorn und Himmelsgewölbe
Sich (k)ein Denkmal setzen
Maharshis Experiment
Ein seltsamer Besuch
5 In jedem Teich der eine Mond
Von Du zu Du
Mystik in der Warteschlange
Das Netz des Indra
Fuß und Hand und Auge
Tanzen statt klettern
6 Aus der Dunkelheit zum Licht
Ein verregneter Sonntagnachmittag
Ein dürres Holz im Wüstensand
Ungereinigtes säen
Sei einfach!
Vom alten und vom neuen Menschen
Die fünf Plagen
7 Neue Horizonte
Sechzehnhundert Gedanken in einem Bus
Der Affengeist
Türhüter des Herzens
Vier Schritte
Die Welt als Spiegel
Schlamm, Dreck und ein Wunder
Jenseits des Denkens
8 Die Kunst des Seins
Nichts hinzufügen, aber vieles weglassen
Ein Blick in den Terminkalender
Kleine Erleuchtung im Bahnhofscafe
Vier Weisungen
Ungeduld, Ärger und etwas Zen
Verweilen vor dem Geheimnis
Spaziermeditieren
Meine ganz persönliche Vigil
Siebzig Jahre Mönch und kein bisschen ruhig
9 Das rechte Maß
Zu viel Gepäck
Ein Asket im Palast
Eine heitere Gelöstheit
Das rechte Maß
Mit Franziskus und Dominikus im Intercity
Zwei Asketen in der Stadt
10 Der grundlose Grund
Das große Ja
Mund und Ohren spülen
Was weißt du? Nichts
Eine überhelle Dunkelheit
Verborgen in einer Wolke
Einfach nur das
Ausklang
Eine kleine Personengalerie
Einstimmung
Es ist Morgen. Ich muss gehen. Die Zeit drängt. Hastig schnüre ich meine Schuhe. Ob ich wohl noch rechtzeitig zum Bahnhof komme? Ein Schuhbändel reißt. Ausgerechnet jetzt, wo ich so knapp dran bin. Ich suche einen neuen, führe diesen mit zittrigen Fingern durch die Ösen und ziehe ihn straff an. Der Schuh sitzt. Ich verlasse das Haus.
Eine banale Geschichte, wie es im Verlaufe eines Tages unzählige gibt. Eine Nebensächlichkeit, scheinbar ohne Bedeutung. Es muss halt sein, das Schnüren der Schuhe ebenso wie der ganze übrige tägliche Kleinkram, der immer zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
Kleinkram?
Von einem Schüler des berühmten jüdischen Wanderpredigers Maggid von Mesritsch ist der Satz überliefert: „Ich bin nicht zum Maggid gegangen, um bei ihm die Torah zu studieren, sondern um zu beobachten, wie er seine Schuhe schnürt.“
Und plötzlich verlangsamt sich der ganze Film. Der berühmte Weise schnürt die Schuhe. Ein Schüler schaut zu. Keiner spricht ein Wort. Wie in Zeitlupe nimmt der Schüler jede Bewegung des Meisters wahr. Er schaut genau hin, damit ihm nichts entgeht. Er lässt sich berühren von dem, was er sieht. Ihn interessiert nicht die abstrakte Lehre, sondern das konkrete Leben. Er sucht die Begegnung mit einem Menschen, der lebt, was er lehrt. Auf dem Weg über die Praxis hofft er einiges zu erfahren über das, was diesen Maggid bewegt und trägt. Und wer weiß: Vielleicht erfährt er beim Schnüren der Schuhe mehr über das Geheimnis des Lebens als beim Studium einer heiligen Schrift.
Wie schnürt ein Mystiker seine Schuhe? Der Schüler verrät es nicht. Die Frage bleibt offen. Gerne hätte ich selber dem Maggid einmal zugeschaut. Wahrscheinlich hätte ich gar nichts Besonderes festgestellt. Mystiker und Mystikerinnen sind Menschen wie du und ich. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie Tiefenschichten des Lebens entdecken und ergründen, die uns üblicherweise verschlossen bleiben. Diese Erkundungsreisen ins Innere des Daseins mögen sich im Alltag auf unterschiedliche Weise auswirken. Ich kann mir vorstellen, dass einige Mystiker ihre Schuhe mit einer hohen Aufmerksamkeit und Ruhe schnüren und diese kleine Verrichtung als Übung auf dem inneren Weg verstehen. Andere wiederum werden wie ich die Sache möglichst schnell hinter sich bringen. Von den ersten kann ich lernen, mit den zweiten fühle ich mich verbunden. Die ersten gehen mir voraus, die zweiten sind mir nahe.
Es gibt viele große Theorien über Gott und die Welt. Doch am Ende kommt es immer darauf an, wie ich mit den ganz praktischen Anforderungen des ganz gewöhnlichen Alltags umgehe. Der Ort, an dem die großen Fragen des Lebens zu reflektieren und zu meditieren sind, ist immer da, wo ich gerade bin. Und sei es beim ungeduldigen Schnüren der Schuhe.
Da möchte ich beginnen. Nicht mit dem Anspruch, mich ändern oder „verbessern“ zu müssen. Aber mit dem Wunsch, den Dingen auf den Grund zu gehen. Klarheit zu gewinnen. Das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden zu können. Dem Eigentlichen, was immer das auch ist, auf die Spur zu kommen.
Spiritualität ist für mich nur dann von Bedeutung, wenn sie etwas mit dem ganz konkret gelebten Leben zu tun hat. Wenn sie den Alltag weit und tief macht, wenn sie ihn durchlüftet und belebt. Von seinen hebräischen Wurzeln her verbinden sich im Wort Spiritualität die Begriffe Geist, Weite und Wind. Der Wind weht, wo er will. Er lässt sich nicht planen, nicht organisieren, nicht beherrschen. Seine Kraft bewegt, stößt festgefügte Ordnungen um, schafft Raum für Neues.
Habe ich damit schon zu viel gesagt? Ach, wie wenig weiß ich doch über diesen Wind. Er ist immer wieder so überraschend anders, als ich meine. Trotzdem möchte ich seinem Geheimnis etwas näher kommen. Tastend, suchend und immer wieder fragend. Und wenn ich zwischendurch eine Antwort gebe, dann ist diese bestimmt wiederum fragwürdig, einer weiteren Frage würdig. Antworten schließen ab, Fragen öffnen Tore. „Fragen“, sagt Martin Heidegger, „ist die Frömmigkeit des Denkens.“
In dem Sinne habe ich dieses Buch geschrieben. Ich verstehe die Texte als eine Sammlung von Skizzen und Entwürfen. Sie alle sind nicht abgeschlossen, sondern offen, entwicklungsfähig – und vorübergehend. Ein kleiner Windstoß nur, und alles sieht womöglich wieder ganz anders aus.
Dann heißt es: Aufstehen, in aller Ruhe die Schuhe schnüren, das Haus der Gewohnheiten verlassen und mich erneut auf den Weg machen.
Schwanden bei Bern, im Winter 2003
Lorenz Marti
1 Unruhiges Herz und offene Weite
Wanderungen auf den Pfaden der Religion
„Wohin denn gehen wir?
Immer nach Hause.“
Novalis
Das unruhige Herz
Es muss mehr geben als die eigene kleine Welt, in der ich mich bewege. Etwas Großes, Weites, Grenzenloses. Es muss mehr geben als das dauernde Wechselspiel von Schmerz und Freude, Glück und Unglück, Licht und Finsternis. Etwas Bleibendes, Beständiges, Ewiges. Es muss mehr geben als mein einzelnes, isoliertes Dasein als verletzliches und sterbliches Wesen. Etwas Ganzes, Tragendes, Allumfassendes. Es muss so etwas geben wie einen großen Zusammenhang, in den mein kleines Leben eingebettet ist.
Es muss mehr geben. Die Sehnsucht brennt. Die Welt ist dafür „eine Nummer zu klein geraten“ (Kurt Tucholsky). Zwar gibt es scheinbar viele Möglichkeiten, diese Sehnsucht ihrer Erfüllung entgegenzuführen, ganze Wirtschaftszweige mit ihren überzogenen Glücksversprechungen leben davon. Doch so viel ich auch kaufe und besitze – dahinter lauert eine gähnende Leere. Es bleibt ein innerer Durst, der durch nichts Äußeres gestillt werden kann.
„Was suchst du eigentlich?“, frage ich mich manchmal, wenn ich, getrieben von einer dumpfen Kauflust, durch die Einkaufszentren der Stadt hetze. Was suche ich? Wirklich einen neuen Pullover (ich habe doch schon etliche) – oder das Glückserlebnis, das ich mir von ihm erhoffe (wo ich doch weiß, dass es nie lange anhält)?
Was suchst du eigentlich?, fragt Augustinus, der große Kirchenlehrer der Antike. Sein Rat: „Suche, was du suchst, aber nicht dort, wo du es suchst.“ So kann es geschehen, dass ich den schönen Pullover ins Regal zurücklege, und etwas enttäuscht, aber leichten Schrittes davonziehe.
Zwar bin ich immer noch naiv genug, mich von äußeren Verlockungen blenden und verführen zu lassen. Doch der Riss bleibt, die Spannung zwischen dem, was ist, und dem, was ich ersehne. Wenn ich meinen Wünschen und Begierden auf den Grund gehe, entdecke ich ein manchmal fast schmerzhaftes Verlangen. Nur vordergründig richtet es sich auf äußere Dinge. Es geht tiefer. Es ist das Verlangen, das enge Gehäuse meines Daseins zu überschreiten auf etwas Größeres hin. Die Sehnsucht nach einem Glück, das von keinen äußeren Bedingungen abhängig ist. Die Sehnsucht nach Transzendenz.
Augustinus spricht vom „unruhigen Herz“, das den Menschen vorantreibe: „Das unruhige Herz ist die Wurzel der Pilgerschaft. Im Menschen lebt eine Sehnsucht, die ihn hinaustreibt aus dem Einerlei des Alltags. Im Grunde seines Herzens sucht er ruhelos den ganz Anderen, und alle Wege, zu denen der Mensch aufbricht, zeigen ihm an, dass sein ganzes Leben ein Weg ist, ein Pilgerweg zu Gott.“
Was auch immer ich suche, dahinter steht mein unruhiges Herz. Es will nicht einen neuen Pullover. Es will mehr. Viel mehr. Es will alles.
Das unruhige Herz treibt mich an, immer wieder aufzubrechen und weiterzuziehen auf einem Weg, der sich im Unendlichen verliert.
Manchmal denke ich, dass es schön wäre, irgendwo anzukommen. Aber von der Mystik lerne ich, dass jeder Schritt auf diesem Weg seine Bedeutung hat, ja dass der Weg selber in einem gewissen Sinne bereits das Ziel ist.
Was mein unruhiges Herz sucht, ist mir womöglich näher, als ich mir selber bin.
Ich geh, weiß nit wohin …
Der Weg, den ich gehe, ist keine gerade Straße. Schon eher ein verschlungener, holpriger Pfad mit vielen Windungen, Höhen und Tiefen. Ich weiß nicht, woher er kommt, und ich weiß nicht, wohin er führt. Mein Weg ist über weite Strecken ein Rätsel. Das Leben an sich ist ein Rätsel. Und auch ich selber bin mir oft genug ein Rätsel. Ich gehe, weil ich nicht anders kann als gehen. Aber ich weiß nicht, wer da eigentlich geht, noch wohin er geht.
Ein mittelalterlicher Dichter drückt diese Erfahrung mit drei Zeilen aus – und kommt dann in Zeile vier zu einer überraschenden Entdeckung:
„Ich geh, weiß nit wohin,
ich komm, weiß nit woher,
ich bin, ich weiß nicht, was,
mich wundert, dass ich fröhlich bin.“
Mit diesem unbekannten Wanderer auf dem unbekannten Pfad kann ich mich recht gut identifizieren. Mit einem entscheidenden Unterschied allerdings: Mir fehlt dessen grundlose Fröhlichkeit. Ich bin eher selten fröhlich, und wenn, dann meistens aus einem konkreten Anlass. Die Fröhlichkeit des Wanderers hat aber keine äußere Ursache. Die Ungewissheiten, denen er ausgesetzt ist, würden auch eher zur Sorge Anlass geben. Er aber ist fröhlich. Ohne Grund. Einfach so. Und das erstaunt ihn selbst. Er wundert sich.
Es ist dies offensichtlich eine andere Art von Fröhlichkeit, als sie in unserer Spaßkultur gepflegt wird. Eine Fröhlichkeit, welche die dunklen Seiten des Lebens nicht fürchtet. Eine Fröhlichkeit, die unabhängig bleibt von den rasch wechselnden äußeren Umständen. Leise und unaufdringlich begleitet sie den Wanderer auf seinem Weg, ob nun die Sonne scheint oder ob es regnet und stürmt.
Ich stelle mir vor, dass der fröhliche Wanderer ohne Gepäck unterwegs ist. All seinen Ballast hat er abgeworfen, seine Pläne und Absichten aufgegeben. Leichten Schrittes zieht er dahin, um sich von dem überraschen zu lassen, was auf ihn zukommt. Damit idealisiere ich ihn natürlich, und der Kontrast zu meinem manchmal schweren und sorgenvollen Gang wird umso deutlicher. Doch ich entdecke dabei auch, warum mir dessen Leichtigkeit fehlt: Ich schleppe viel zu viel Ballast mit mir herum. Geschichten aus der Vergangenheit etwa, von denen ich mich nicht lösen kann und die wie Bleigewichte an meinen Füßen hängen. „Wirf sie ab“, höre ich den unbekannten Wanderer rufen, „vergiss deine Geschichten und lebe jetzt!“
Anders als dieser Wanderer trage ich auch viele Sorgen und Ängste, Hoffnungen und Wünsche mit mir. Unter ihrem Gewicht versuche ich zu bestimmen, wohin die Reise gehen soll. Nun verläuft aber der Weg nicht immer nach meinen Vorstellungen. Die Wirklichkeit ist oft anders, als ich sie gerne hätte. Und wieder vernehme ich die Stimme des fröhlichen Wanderers: „Wirf deine Vorstellungen weg, überlasse dich dem Weg und seinen Geheimnissen!“
Die Christen der ersten Jahrhunderte nannten sich „Leute des Weges“. Später wurden sie sesshaft, was dieser Religion keineswegs gut getan hat. Diese „Leute des Weges“ sind neu zu entdecken: Das Leben als Wanderschaft, als Pilgerreise. Das Woher und Wohin ist dabei weniger wichtig als die Bewegung, das Unterwegssein.
Ein alter Pilgerspruch für „Leute des Weges“ lautet:
„Man muss wie Pilger wandeln,
frei, bloß und wahrlich leer,
viel sammeln, halten, handeln
macht unseren Gang nur schwer.
Wer will, der trag sich tot.
Wir reisen abgeschieden,
mit wenigem zufrieden;
wir brauchens nur zur Not.“
Der weglose Weg
Es gibt Wegstrecken, die liegen gut sichtbar vor den Füßen. Sie erlauben einen weiten Blick nach vorn, was die Orientierung erleichtert. Manchmal verschwindet der Weg aber auch hinter einer Kurve oder einem Hügel. Oder er versteckt sich im Gestrüpp oder in einem Wald. Und manchmal scheint er sich einfach aufzulösen, ohne dass eine Fortsetzung erkennbar wäre. Es gibt keine Spur und keine Markierungen mehr. Die Wanderschaft führt ins Ungewisse, jeder Schritt ist ein Wagnis. Die Mystik spricht vom weglosen Weg. Er bietet keine Führung und keine Sicherheit. Er entsteht im Gehen und verliert sich gleich wieder.
Ich mag das nicht. Mir erscheint das zu unsicher. Ich brauche festen Boden unter den Füßen. Einen sicheren Grund. Orientierung. Verlässlichkeit. Sicherheit. Halt.
Und ich bin nicht allein damit. Die Suche nach Sicherheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Sie hat den Fortschritt in Wissenschaft und Technik vorangetrieben, sie hat aber auch Katastrophen und Kriege ausgelöst. Heute zeigen sich die Grenzen des Machbaren immer deutlicher, und wesentlich sicherer ist das Leben trotz aller Fortschritte nicht geworden.
Der weglose Weg. Gelegentlich führt er über das Wasser. Unmögliches wird verlangt. Der Schritt in die Leere. Das Vertrauen auf eine Kraft, die größer ist als alles, was der Verstand sich denken kann.
Eine alte Geschichte erzählt davon. Da verlässt Petrus auf dem sturmgepeitschten See Genezareth das schaukelnde Boot und tritt auf das offene Wasser hinaus. Zögernd und ängstlich geht er auf seinen Meister zu, der ihm entgegenkommt. Vorsichtig setzt er einen Fuß vor den anderen, immer den Meister vor Augen. An ihm kann er sich orientieren, an ihm kann er sich festhalten, ihm vertraut er. Doch dann erschreckt ihn ein starker Windstoß. Er kommt ins Wanken, verliert den Meister aus dem Blick und starrt auf die Wellen, die sich bedrohlich hoch auftürmen. Er weiß nicht, wie ihm geschieht, er ist verwirrt und verängstigt und beginnt zu sinken. In letzter Minute rettet ihn sein Meister.
Ich bin nicht so mutig wie Petrus. Doch ab und zu zwingen mich die Umstände, mein sicheres Boot zu verlassen und auf das Wasser hinauszutreten. Ich schaffe das ja auch, vielleicht einen, zwei oder drei Schritte. Aber bei der kleinsten Erschütterung beginne ich zu wanken, verliere die Orientierung und weiß nicht mehr weiter. Die Frage lautet dann: Wohin geht meine Aufmerksamkeit? Starre ich auf die Wellen, die mich bedrohen und erschüttern – oder sehe ich weiter?
Eine etwas andere Version dieser Geschichte kennt die buddhistische Tradition: Da wird von einem Jünger erzählt, der voller Begeisterung über einen rauschenden Fluss geht, um am anderen Ufer einer Predigt Buddhas zuzuhören. In der Mitte des Flusses wird ihm schlagartig bewusst, welch großer Gefahr er sich aussetzt. Er gerät in Panik und beginnt zu sinken, die Fluten drohen ihn zu verschlingen. Doch dann besinnt er sich erneut auf Buddha, was ihm augenblicklich Ruhe verschafft. Er kann sich aus eigenen Kräften aufraffen und geht weiter, ans andere Ufer.
Eine Übergangskrise, wie sie das Leben in unzähligen Variationen bereit hält. Der Mann wird in der Flussmitte von seiner Angst überfallen. Das Alte trägt nicht mehr, das Neue ist noch nicht da. Der Buddha-Jünger bewältigt diese Krise, indem er sich nicht auf die Gefahr fixiert, sondern sich auf das besinnt, was ihn zu tragen vermag. Was trägt mich über den Fluss des Lebens?
Einen ganz anderen Verlauf nimmt diese Geschichte bei einem indischen Meister, dem zu Ohren gekommen ist, dass der dümmste unter seinen Schülern zu Fuß über den Fluss gegangen sei. Er kann es kaum glauben, doch der Schüler bestätigt das Gerücht: „Ja, ich bin über den Fluss gewandert. Und das verdanke ich dir: Ich habe bei jedem Schritt übers Wasser deinen heiligen Namen angerufen, und das hat mich getragen.“ Der Meister ist verblüfft und beginnt zu grübeln, welch wunderbare Kraft wohl in seinem Namen verborgen sein mag, dass sogar ein dummer Schüler damit übers Wasser gehen kann. Er muss es gleich selber ausprobieren, geht an den Fluss und setzt ohne zu zögern den Fuß auf das Wasser. Dazu ruft er mit frommer Inbrunst: „Ich, ich, ich ...“ Und versinkt in den Fluten.
Wie gut kenne ich diese Geschichte: Wenn ich um mich kreise, gehe ich unter. Das „Ich, ich, ich“ trägt nicht. Das Ego eröffnet keine Perspektive. Zu einem erfüllten Leben, so lehren die spirituellen Traditionen, gehört der Schritt über das Ego hinaus, die Hingabe an etwas Größeres. Ich muss mich dabei nicht aus dem Auge verlieren. Aber ich muss aufhören, nur mich zu sehen.
Die Wolken sind nicht der Himmel
Mein Weltbild, ich gestehe es, ist ein egozentrisches: Ich sehe mich als Mittelpunkt und meine in meiner Verblendung, alles drehe sich nur um mich. Da ist mit Dringlichkeit meine ganz persönliche kopernikanische Wende angesagt. Denn solange ich mich selber als Mittelpunkt verstehe, verfehle ich die wahre Mitte.
Vor vielen hundert Jahren, so wird erzählt, malte ein König eine schwarze Linie an die Wand und bat dann seine Weisen zu sich: „Seht ihr eine Möglichkeit, diese Linie zu verkleinern, ohne dass ihr sie berührt?“ Die Weisen waren verwirrt. Lange dachten sie nach, aber sie fanden keine Lösung. Bis schließlich einer hervortrat, den Pinsel in die Hand nahm und über die Linie des Königs eine zweite, wesentlich längere Linie zeichnete. Ohne dass er die Linie des Königs berührt hätte, wurde diese sichtbar kleiner.
Das ist die kopernikanische Wende, die ich meine: Wenn ich feststelle, dass ich mich zu wichtig nehme, muss ich mich nicht absichtlich klein machen. Aber ich muss wissen, dass es etwas Größeres gibt als mich. Ich muss die große Linie entdecken.
Darum geht es in der Religion. Religion ist Grenzüberschreitung. Sie eröffnet neue Horizonte. Sie führt in die Weite. Sie verweist auf den Himmel über mir. Dieser Himmel ist der unendliche, unverrückbare Hintergrund alles Seienden. Wolken kommen und gehen, Gestirne ziehen vorbei, der Himmel aber bleibt, leuchtend, ruhig und klar.
Von der Mystik lerne ich: Der Himmel ist nicht nur über mir, sondern auch in mir. Der tibetische Lama Sogyal Rinpoche sieht in ihm ein Bild für die „wahre Natur“ des Menschen, für sein innerstes Wesen. Oft wird er aber verdeckt durch die Wolken des verwirrten Geistes. Wer ihn dann von unten betrachtet, hält diese Wolken für die einzige Wirklichkeit. Wer aber in ein Flugzeug steigt und die Wolkendecke durchbricht, entdeckt die grenzenlose Weite des klaren, blauen Himmels. Die Wolken sind aus dieser Perspektive bloß noch kleine, unbedeutende Gebilde, die keinen Bestand und keine große Bedeutung haben. Sogyal Rinpoche: „Wir sollten uns immer zu erinnern versuchen, dass die Wolken nicht der Himmel sind.“ Wolken entstehen und lösen sich wieder auf. Ihre Formen und Farben ändern sich. In ihrer Unbeständigkeit und Vergänglichkeit sind sie ein Sinnbild für das Leben selbst. Sie sind aber nicht mit dem Himmel gleichzusetzen. Die Wolken sind am Himmel, aber sie sind nicht der Himmel.
In seiner unendlichen Größe und Klarheit verweist der Himmel auf jene transzendente Dimension, welche das Auf und Ab der Zeiten überdauert. Er zeigt, dass es Wichtigeres und Größeres gibt als die eigenen kleinen Sorgen und Probleme. Er lädt mich ein, mich in seine Weite hinein zu verlieren, um mich neu zu finden. Er bildet die große Linie über der kleinen Linie meines Lebens.
Und zugleich versuche ich, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Keine Himmelsschwärmerei, keine Himmelsstürmerei. Hier auf dieser Erde ist mein Platz, und nirgendwo sonst.
So gehe ich meine Wege im Bewusstsein des großen Himmelszeltes, das sich über mir ausspannt – und im Wissen, dass dieser Himmel sich auch in mir spiegelt. Und allmählich beginne ich zu verstehen: Ich bin nicht der Mittelpunkt. Die Welt dreht sich nicht um mich. Es gibt Dimensionen, die mich weit übersteigen. Das macht mich nicht klein, aber bescheiden. Meine persönliche Geschichte ist Teil einer unendlichen Geschichte. Ein Mosaikstein in einem Bild ohne Grenzen.
Wüstenwanderungen
Viele Religionen haben ihren Ursprung in der Wüste. Und sie wissen vieles über Erfahrungen in der Einöde zu berichten. Die Wüste ist eine ganz eigene Welt, eine Landschaft von bizarrer Schönheit. Hier berühren sich die Extreme: Leben und Tod, Untergang und Rettung, Verdammung und Erlösung, tiefste Verzweiflung und höchstes Glück.
Fern von den Zentren und Zwängen der Zivilisation eröffnet die Wüste endlos weite Räume, in denen der Mensch sich verlieren kann und neu finden muss. In dieser kargen Randzone des Daseins fallen alle Masken und Verkleidungen ab. Zurück bleibt der nackte Mensch, ganz auf sich allein gestellt. Die Wüste hält ihm den Spiegel hin: Das bist du, wenn alles Äußere wegfällt.
Als das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion des römischen Reiches wurde und seine spirituelle Kraft zu verlieren drohte, zogen etliche Männer und Frauen in die ägyptische Wüste, um als Einsiedler in der Dürre die ursprüngliche Quelle neu zu entdecken. „Die Wüste ist rein und sie reinigt“, erklärte einer von ihnen. Diese Wüstenväter und Wüstenmütter entwickelten eine Spiritualität, die dieser Klarheit entsprach. Von weither kamen die Menschen, um von ihnen zu lernen. Und umgekehrt lernten die Wüstenmönche von ihren Besuchern. Als ein Eremit einmal im Zorn einen Schüler vor die Tür gesetzt hatte, blieb dieser dort sitzen, bis der Eremit ihn entdeckte und zu ihm sprach: „Ich habe dir Unrecht getan. Von jetzt an bist du der Lehrer und ich bin dein Schüler.“
In der Wüste sind Hunger und Durst allgegenwärtig. Die glühende Hitze des Tages zehrt aus, ebenso die Kälte der Nacht. Nahrung und Wasser sind oft schwer zu finden. Hunger und Durst sind zwei alte Bilder für die Sehnsucht des Menschen nach einem ganzen, erfüllten und beglückenden Leben. Die amtlich verwalteten Religionen haben sich oft darauf beschränkt, Speisekarten zu verteilen und das Wasser als H2O-Verbindung zu analysieren. Doch davon wird niemand satt, und kein Durst wird gelöscht. Wer hungert und dürstet, muss essen und trinken. Wo gibt es Nahrung, wo frisches Wasser?
Und zur Wüste gehört auch, dass wilde Tiere über jene herzufallen drohen, die sich in die Wildnis vorwagen – oder sich in sie verirrt haben. Die alten Mönche reden von Dämonen. Diese haben verschiedene Namen. Sie heißen Langeweile, Leere, Ungeduld, Überdruss, Enttäuschung, Wut, Trauer, Depression, Angst. Viele Geschichten aus der Bibel und aus der Überlieferung der Wüstenväter berichten davon. Und sie versprechen: Wer mit den Dämonen ringt, wird früher oder später auch den Engeln begegnen. Mehr noch: Es kann sein, dass sich im unheimlichen Gewand eines Dämons ein Engel versteckt hält.