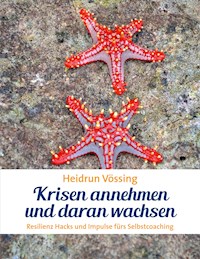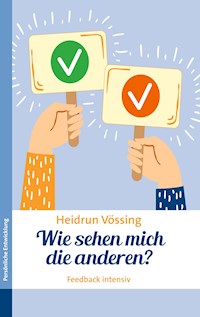
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie sehen mich die anderen? Wie wir von anderen gesehen werden, entscheidet darüber, wie wir ankommen. Unsere Wirkung auf andere beeinflusst die Beziehungen zu anderen Menschen sowie unsere persönliche und berufliche Entwicklung. Erst wenn wir uns unserer Wirkung bewusst sind, können wir wählen, ob wir so oder anders wirken wollen und an den gewünschten Veränderungen arbeiten. Dieses Buch unterstützt Sie dabei, sich Ihrer Wirkung bewusst zu werden und diese zielorientiert zu verändern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Feedback – was ist das?
Was ist Feedback und was ist es nicht?
Wozu Feedback?
Gelungenes Feedback
Feedback-Varianten
Zusammengefasst: Feedback – was ist das?
Menschliches Verhalten und die Wirkung auf andere
Vier Verhaltensstile – Wie wirkt was?
Selbstbild – Stärken erkennen
Fremdbild – Schwächen schwächen
Entwicklungsfelder und Lernaufgaben:Neues Verhalten einüben und verstärken
Zusammengefasst:Menschliches Verhalten und die Wirkung auf andere
Was sonst noch wirkt
Status
Sympathie
Charisma
Zusammengefasst: Was sonst noch wirkt
Wie wollen Sie wirken?
Ziele – mein positives Selbstbild
Resonanzphänomene – warum Gefühle ansteckend sind und was Sie für eine positive Ausstrahlung tun können
Die innere Einstellung macht’s – Wirkung entsteht im Kopf
Zusammengefasst: Wie wollen Sie wirken?
Zum Schluss
Literatur
Einleitung
Die Idee zu diesem Buch ist im Zusammenhang mit dem Seminar „Wie sehen mich die anderen?“ entstanden. Seit 2008 habe ich dieses Thema in meinem Portfolio. Zum einen leite ich dieses Seminar in Zusammenarbeit mit dem Institut für Management-Entwicklung seit vielen Jahren als Offenes Seminar, an dem Personen aus unterschiedlichen Unternehmen teilnehmen. Zum anderen habe ich es auch als Inhouse-Veranstaltung für zahlreiche Unternehmen wie beispielsweise die Generali Versicherung durchgeführt. In diesem Zeitraum habe ich mit ca. 1500 Teilnehmenden zusammengearbeitet und diesen Personen sehr individualisiertes Feedback gegeben. Es ist immer noch eines meiner Lieblingsseminare, weil es voller Überraschungen steckt. Für mich ist dieses Seminar wie eine Wundertüte, und ich freue mich immer wieder darauf, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten kennenzulernen.
Eine für alle Beteiligten spannende und aufregende Situation, die neugierig macht. Gerade die Anfangssituation ist magisch, da unser Bild vom anderen oft in den ersten Sekunden des Kennenlernens entsteht.
Es handelt sich meist um sehr heterogene Gruppen, bestehend aus lauter Individuen und echten „menschlichen Marken“, auch wenn es ein Inhouse-Seminar ist. Und dennoch verbindet die einzelnen Menschen dieser heterogenen Gruppe ein gemeinsames Anliegen. Sie wollen die Frage „Wie sehen mich die anderen?“ für sich beantworten und möchten herausfinden, wie sie auf andere wirken. Sie wollen Feedback erhalten und dies gerade von Menschen, die sie zum ersten Mal treffen und die sie nicht kennen. Dieses Seminar stößt auf eine große Resonanz, denn viele große und namhafte Unternehmen ermöglichen den Mitarbeitenden und Führungskräften die Teilnahme.
Offensichtlich liegt ein großer Nutzen darin, in einem dafür geeigneten Rahmen und mit professioneller Unterstützung etwas über das Fremdbild zu erfahren.
Dieser Nutzen wird noch deutlicher, wenn man den Aspekt der Wirkung auf andere in den Mittelpunkt stellt, und ich mich frage, wie ich auf andere wirke. Dadurch kommt mir eine aktivere Rolle zu. Darauf, wie andere mich sehen, habe ich recht wenig Einfluss. Wenn aber das Thema Wirkung auf andere ins Spiel kommt, dann habe ich mehr Einfluss, denn an meiner Wirkung kann ich etwas verändern. Zudem beeinflusst die Art und Weise, wie wir auf andere wirken, so viele Lebensbereiche. Sie beeinflusst das Fremdbild, die Qualität unserer Beziehungen und unseren beruflichen Erfolg.
Und gerade der erste Eindruck ist entscheidend. Der größte Anteil unseres Verhaltens ist jedoch unbewusst und so haben wir oft keine Idee davon, dass eine bestimmte Verhaltensweise negativ wirken könnte, gerade weil wir uns doch aus gutem Grund und mit bester Absicht so verhalten. Erst wenn wir uns durch die Rückmeldungen anderer bewusst machen, wie wir auf andere wirken, haben wir die Chance zu wählen, ob wir so oder anders wirken wollen.
Erst dann haben wir Wahlmöglichkeiten, können unseren Handlungsspielraum erweitern und uns persönlich weiterentwickeln.
Mit meinem Buch und meinem Seminar möchte ich Sie auf eine Reise einladen, bei der Sie sich Ihrer Wirkung auf andere Schritt für Schritt bewusst werden und diese – wenn Sie das möchten – gezielt verändern können.
1. Feedback – was ist das?
„Jeder meint, dass seine Wirklichkeit
die wirkliche Wirklichkeit ist.“
Paul Watzlawick
Das Wort Feedback ist modern und in der heutigen Zeit in aller Munde. Es gibt mittlerweise zahlreiche Bücher zum Thema Feedback und es gibt kaum einen Text zum Thema Kommunikation, Führung oder Weiterbildung, indem es nicht vorkommt. Die Generation meiner Eltern kann wahrscheinlich wenig mit dem Wort anfangen. Auch heute gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Feedback eigentlich ist. Ist es nur ein anderes Wort für Lob oder Kritik? Vor kurzem beschwerte ich mich per Mail bei einer großen Direktbank über die schlechte telefonische Erreichbarkeit und den schlechten Kundenservice. Prompt kam eine Mail mit den einleitenden Worten „Vielen Dank für Ihr Feedback…“ zurück. Ich hatte aus meiner Sicht aber gar kein Feedback gegeben, sondern ich hatte mich beschwert. Und wie sieht es mit Buch-, Hotel- oder Seminarbewertungen im Internet aus. Ist das Feedback? Oder ist es gerade kein Feedback, weil es eben eine Bewertung ist? Wenn ich meiner Kollegin sage, dass es mich stört wenn sie so laut telefoniert, ist das dann ein Feedback? Im allerweitesten Sinne vielleicht ja. Benutzt man das Wort Feedback jedoch als sozialwissenschaftlichen Fachbegriff, dann ist dies alles kein Feedback.
In der heutigen Arbeitswelt, in der Unternehmen mit gravierenden Veränderungen zu tun haben und agile Arbeitsformen eine immer wichtigere Rolle spielen, kommt Feedback eine besondere Bedeutung zu. Eine funktionierende Zusammenarbeit auf Augenhöhe in selbstverantwortlichen Teams und flachen Hierarchien ist ohne sich abzustimmen, sich auszutauschen, gegenseitiges Verstehen und Feedback nicht machbar. Das ist nicht immer einfach. Agile Arbeitsformen brauchen andere Formen der Kommunikation oder des miteinander Redens. Einige Personalverantwortliche haben das erkannt, sie schaffen Strukturen durch die Feedback regelmäßig gegeben und auch eingefordert wird. Dieses Feedback kann sich beispielsweise auf die Art der Zusammenarbeit oder den Abschluss von Projekten beziehen, und somit ist es ein wichtiges Instrument zur Reflexion (vgl. Pötzsch 2019).
Und es bleibt festzuhalten, dass nicht überall wo Feedback draufsteht auch Feedback drin ist. Denn aus fachlicher Sicht ist es notwendig zwischen Feedback und Beurteilung zu unterscheiden, auch wenn die Begriffe häufig synonym verwendet werden. Echtes Feedback ist eben keine Beurteilung und somit im Rahmen einer hierarchischen Beziehung, d.h. von der Führungskraft zum Mitarbeiter, nicht möglich.
Was ist Feedback und was ist es nicht?
Der Begriff Feedback ist im Ursprung ein technischer Begriff und stammt aus der Kybernetik, der Lehre von Regelungsprozessen. Er beschreibt die Rückkoppelung oder die „Rückfütterung“ von Informationen. Diese Rückkoppelung von Informationen bezieht sich im technischen Bereich auf Ist- und Sollwerte (vgl. Fengler 2017).
Auf die zwischenmenschliche Kommunikation lässt sich der technische Feedbackbegriff nur sehr begrenzt übertragen. Hier geht es zwar auch um die Rückkoppelung von Informationen, aber hier gibt es keine objektiven Ist- und Sollwerte.
Hier bedeutet Feedback zunächst die Rückmeldung an eine Person in Bezug darauf, wie deren Verhalten von der anderen Person wahrgenommen, erlebt und verstanden wird. Und dies ist nun mal subjektiv und nicht objektiv. Das, was auf den einen vielleicht sehr selbstbewusst wirkt, findet jemand anders arrogant. Der Grat zwischen diesen beiden unterschiedlichen Wirkungen kann sehr schmal sein.
Feedback im weiten Sinne findet im täglichen Miteinander sowohl im Beruf als auch im Privatleben ständig statt – mal ist es erwünscht und mal unerwünscht.
Manchmal sind die Rückmeldungen bewusst oder unbewusst. Bisweilen kleiden wir unser Feedback in Worte, häufiger erfolgt es jedoch nonverbal oder körpersprachlich. Ein kritischer Blick oder ein freundliches, zustimmendes Nicken ist auch ein Feedback. Feedback ist allgegenwärtig und der Begriff hat sich sowohl als Fachbegriff als auch in der alltäglichen Kommunikation fest etabliert.
Ein Blick in die Geschichte der Sozialpsychologie zeigt uns, wie Kollegen des Sozialpsychologen Kurt Lewin ungeplant auf das Feedback-Prinzip stießen. Bei einem Seminar, das 1946 in den USA stattfand, schlug Kurt Lewin vor, dass Trainer und Wissenschaftler ihre gruppendynamischen Prozessbeobachtungen jenseits des Seminarinhaltes zusammenfassen und auf Tonband aufnehmen sollten. Dies galt auch für das beobachtete Verhalten des Gruppenleiters und der Gruppenmitglieder. Am Abend nach dem Seminar konnten alle sich diese auf Band aufgenommen Analysen und Interpretationen anhören, was bei den Beteiligten auf großes Interesse stieß. Die Teilnehmenden sagten, dass sie daraus wichtige Erkenntnisse über ihr eigenes Verhalten gewonnen hätten. Dem Trainingsstab wurde sehr schnell klar, dass sie somit ein machtvolles Instrument gefunden hatten, dass den Beteiligten dabei half, ihr Verhalten und vor allen Dingen die Reaktionen anderer Menschen auf sie selbst besser zu verstehen. Wenige Jahre später entstanden daraus gruppendynamische Laboratorien, in denen das menschliche Verhalten in Gruppen untersucht wurde. In den 50er Jahren fanden die ersten gruppendynamischen Seminare in Europa statt (vgl. Fengler 2017).
Vereinfacht gesagt ist das Feedback-Prinzip als Methode dadurch entstanden, dass eine Gruppe von Menschen sich darüber unterhält, was sie bei einer anderen Gruppe von Menschen beobachtet hat und diese Informationen anschließend teilt.
So unterschiedlich Feedback in der Form auch sein kann, die folgende Definition beschreibt die Gemeinsamkeit aller Feedbackprozesse.
Feedback ist eine Informationsrückkoppelung zwischen zwei oder mehreren Personen über die Wirkung von Verhalten, und dieser Prozess ist zirkulär. Das bedeutet, dass Menschen sich wechselseitig beeinflussen. Nicht nur das Verhalten an sich erzeugt eine Wirkung, sondern das Feedback zu diesem Verhalten erzeugt ebenfalls eine Wirkung.
Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawik hat in den 1960er Jahren ein wichtiges Grundaxiom menschlicher Kommunikation formuliert: Man kann nicht nicht kommunizieren, da jedes Verhalten Kommunikation ist.
Wenn beispielsweise jemand wortlos den Raum verlässt, ist auch das Kommunikation, obwohl diese Person nichts gesagt hat. Kommunikation schließt auch die nonverbalen oder körpersprachlichen Anteile ein. Wenn wir dieses Grundaxiom erweitern, dann lautet es: Man kann nicht nicht wirken.
Denn alles, was wir sagen oder tun, erzeugt bei anderen Menschen eine Wirkung. Und zu dieser Wirkung bekommen wir ein Feedback –häufig auch spontan und ungebeten.
Wenn wir jedoch im Rahmen von professioneller Kommunikation von Feedback als Methode sprechen, dann meinen wir damit eine bewusste und sprachliche Rückmeldung zu unserem Verhalten. Und hier kommt es gerade dann zu Missverständnissen, wenn Kritik als Feedback verkleidet daherkommt. Das sogenannte Feedback ist dann eine Mogelpackung. Das Wort Kritik hört sich ja schon unangenehm an und Feedback klingt irgendwie neutraler und freundlicher. „Kritik funktioniert nicht“, sagt der Motivationsexperte Reinhard Sprenger, denn so „konstruktiv“ Kritik auch immer daherkommen mag, letztendlich tut Kritik weh und sie verletzt. Bei dem, was Sie getan haben und wie Sie sich verhalten haben, hatten Sie ja selbst die besten Absichten. Und nach wie vor halten Sie Ihr Verhalten für sinnvoll und in der jeweiligen Situation für die beste Wahl. Wenn dem nicht so gewesen wäre, hätten Sie sich ja anders verhalten. Und nun kommt jemand anders daher und sagt: „Das ist nicht o.k. Sie haben etwas falsch gemacht.“ Mit welchem Recht darf er das? (vgl. Sprenger 2015).
Kritik tut deshalb weh, weil ein wichtiges psychisches Grundbedürfnis – das Bedürfnis nach Selbstwerterhalt oder Selbstwerterhöhung – verletzt wird. Dieses psychische Grundbedürfnis haben alle Menschen und dessen Verletzung bringt unser Selbstwertgefühl ins Wanken. Kritik ist auch deshalb so verletzend, weil uns in diesem Moment nicht bewusst ist, dass jede Beurteilung selbstbezüglich ist. Sie sagt wahrscheinlich mehr über den Beurteiler und seine Maßstäbe aus als über den Beurteilten. In jeder Beurteilung spiegeln sich die Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster derjenigen Person wider, die beurteilt. Diese Person kann streng genommen also nur Aussagen darüber machen, wie sie Sie erlebt und nicht wie Sie sind. Kritik also unterscheidet zwischen richtig und falsch, ist bewertend, legt Bewertungsmaßstäbe zugrunde und ist vorgeblich objektiv.
Echtes Feedback im ursprünglichen Sinne des sozialwissenschaftlichen Begriffes hingegen ist etwas anderes. Im Feedback treffen wir Aussagen darüber, wie wir das Verhalten eines anderen erleben, aber nicht darüber, wie ein anderer ist. Das macht einen großen Unterschied. Feedback zu geben bedeutet zu sagen: „So erlebe ich dich und dein Verhalten.“ Es bedeutet nicht zu sagen: „Du sollst dich ändern.“ Feedback bedeutet auch nicht dem anderen zu sagen, was man von ihm will. Echtes Feedback ist also keinesfalls die Aufforderung, Ihr Verhalten nach den Vorstellungen der anderen Person zu richten.
Daraus folgt für mich der Schluss: