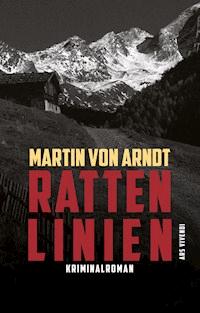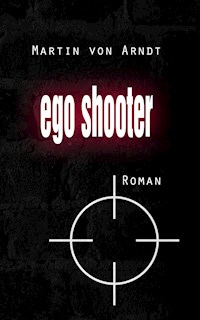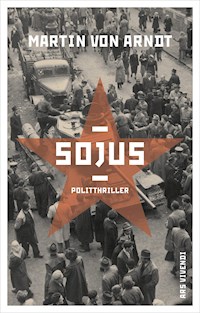Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Bonn, 1961: Agent Dan Vanuzzi wird vom französischen Auslandsnachrichtendienst angeheuert, zwei in der BRD untergetauchte Mitglieder der algerischen Befreiungsarmee aufzuspüren. Der Algerienkrieg tobt mittlerweile seit sieben Jahren, und den beiden werden Kriegsverbrechen an französischen Soldaten zur Last gelegt. Um sie zu fangen, muss Vanuzzi seine ganze Kraft und Erfahrung aus zwanzig Jahren Geheimdienst aufbieten. Doch schon nach kurzer Zeit wird klar, dass niemand der ist, der er zu sein scheint. Vanuzzi kontaktiert seinen alten Gefährten Rosenberg, der als Mossad-Agent in der BRD den ehemaligen KZ-Kommandanten Arthur Florstedt aufspüren und nach Israel entführen soll. Rosenberg wird dabei mit seinem eigenen Trauma konfrontiert, der Ermordung seiner Familie im KZ und seinem eigenen Überleben. Vanuzzi und Rosenberg versuchen sich gegenseitig zu helfen und begeben sich in die Abgründe der Geschichte... Ein explosiver Spionageroman um die Traumata Frankreichs und Deutschlands: die koloniale Vergangenheit und der Holocaust.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARTIN VON ARNDT
WIE WIR TÖTEN, WIE WIR STERBEN
POLITTHRILLER
Gesund. Rückstandsfrei. Klimapositiv.
ars vivendi verlag schützt das Klima und intakte Ökosysteme durch den Druck dieses Buches beim Ökopionier gugler*, dem weltweit ersten zertifizierten Anbieter für Cradle to Cradle Certified™ Druckprodukte.
• Dieses Buch enthält nur gesunde Substanzen und kann daher – anders als herkömmlich gedruckte Bücher – zu 100 % wiederverwertet werden.
• Alle CO2-Emissionen, die beim Druck dieses Buches entstanden sind, wurden zu 110 % kompensiert. In der Produktion kam ausschließlich Ökostrom zum Einsatz.
• Das Cradle to Cradle Certified™-Zertifikat bestätigt das. © gugler.at
Originalausgabe
1. Auflage November 2021
© 2021 by ars vivendi verlag
GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Satz: ars vivendi
eISBN 978-3-7472-0330-9
WIE WIR TÖTEN,
WIE WIR STERBEN
Inhalt
ERSTER TEIL: WIE WIR TÖTEN
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
ZWEITER TEIL: WIE WIR STERBEN
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
EPILOG
GLOSSAR
ZITATE
GANZ HERZLICHEN DANK AN …
ERSTER TEIL
WIE WIR TÖTEN
»Wir wollen, dass die Algerier freier, brüderlicher,gleicher werden – kurz: französischer.«Max Lejeune, sozialistischer Verteidigungsminister Frankreichs, 1956
1
Spätherbst 1961
Im Alter von sechs Jahren zwang ihn sein Vater dazu, Bleiche zu trinken. Nicht so viel, dass er sich die Speiseröhre dauerhaft verätzt hätte – gerade genug, dass er zwei Tage lang Bauchkrämpfe hatte und sich so oft übergab, bis er Sternchen sah, sogar als er aufgehört hatte, sich zu übergeben.
Vielleicht hatte ihn sein Vater davon abhalten wollen, zum Säufer zu werden wie alle anderen Männer in der Familie. Oder er wollte, dass seine Kinder niemandem blindes Vertrauen entgegenbrachten, nicht mal dem eigenen Vater. Oder, und das war am wahrscheinlichsten, er hatte rein gar nichts damit bezweckt, weil der Vater ständig Blödsinn mit seinen Jungs trieb, wenn die Mutter kein Auge auf sie hatte.
Jetzt fühlte sich seine Magengrube wieder so an, als hätte man ihm Bleiche eingeflößt. Die Attacke war unerwartet, der Schlag hatte ihn mit einer Geschwindigkeit und Härte getroffen, wie er sie nie zuvor erlebt hatte. Es war, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggerissen, alles Blut schien sich aus seinen Beinen zurückzuziehen. Er krümmte sich, würgte, taumelte rückwärts. Er sah, wie der Angreifer abermals auf ihn zustürmte, er musste zwei, drei Schritte zur Seite tun, sonst würde ihn der andere endgültig fertigmachen. Er wich im Krebsgang aus, ihm war unbeschreiblich schlecht, es hörte gar nicht mehr auf. Der Angreifer fokussierte ihn, Entschlossenheit in den Augen. Oder Blutgier.
Er atmete dreimal durch, so tief es ging. Seine Beine hatten die bleierne Schwere verloren, der andere würde es jetzt nicht mehr so leicht haben, ihn zu überrumpeln. Dann traf ihn ein Schlag auf das rechte Ohr. Es blitzte in ihm auf, als ob etwas in seinem Hirn geplatzt wäre, und er ging zu Boden. Schwärze breitete sich von der Brust bis zu den Haarspitzen über seinen Kopf, er hörte seinen eigenen rasselnden Atem, spürte das Herz bis in die Schläfen klopfen. Unter ihm war eine Lache aus Schweiß, die ihn am Boden festzukleben schien. Er hörte die Stimme seines Angreifers, aber er verstand die Worte nicht, sie kamen aus weiter Ferne, waren von einem überlauten Echo verzerrt oder langten rückwärts bei ihm an.
Dann merkte er, dass es nicht sein Angreifer war, der sprach.
»Drei – vier …«
Sein Kopf strebte nach oben, er machte den Nacken lang, aber seine Arme und Beine hatten vergessen, dass sie sich am Aufstehen beteiligen mussten, und er wusste ums Verrecken nicht, wie er ihnen klarmachen sollte –
»Fünf …« Er rollte sich auf die Seite, sein Oberkörper klebte nun nicht mehr am Boden und er konnte ihn aufrichten. »Sechs …«
Er stellte ein Bein auf, dann das andere, drückte sich mit aller Kraft in die Vertikale. Die Worte waren verstummt, dafür hörte er jetzt das Geschrei der Halle. Ein hundertstimmiger Chor begann etwas zu skandieren, das nach »Auf–die–Knie–auf–die–Knie« klang.
Er brachte die Fäuste mühsam vors Gesicht, sie hielten Schläge ab, die eher spielerisch kamen. Endlich ertönte der Gong.
Auf dem Weg in seine Ecke musste er sich mühevoll ausbalancieren, ließ sich auf das Polster fallen, spürte, wie ihm der Sekundant Blut aus dem Gesicht wischte und Wasser in den Mund spritzte. Er war unendlich dankbar für die Flüssigkeit, auch wenn er das meiste wieder ausspuckte.
In der kleinen Halle in Hamburg saßen die Zuschauer gedrängt. Es roch nach zu vielen erregten Menschen, zusammengepfercht auf zu engem Raum. Blaue Rauchfäden aus Zigaretten vermischten sich mit dem dicken grauen Qualm der Zigarren und zogen in Schwaden zum Ring hinauf. In den ersten drei Reihen Typen mit gemusterten Sakkos und bunten Hemden, die bis zum Bauchnabel aufgeknöpft waren. Alles Milieu, dachte er, Luden, die ihre Goldketten und Goldzähne spazieren führten. Dahinter erkannte er Kleinbürger in schäbigen blauen oder grauen Anzügen. Das zurückgekämmte Haar strotzte vor Brillantine, die das Deckenlicht reflektierte. Dazwischen junge Männer in Matrosenanzügen, die bei jedem Schwinger mitgingen und fast von den Stühlen fielen. Die meisten waren besoffen, sie gingen erst zu den Boxkämpfen und versumpften dann auf der Reeperbahn, bis ihr Landurlaub vorbei war.
Sein Sekundant musste etwas zu ihm gesagt haben, aber er hatte nicht darauf geachtet. Er stellte sich vor, er wäre jetzt da unten, inmitten dieser Männermeute, in einem Dunst aus Bier und Schweinebraten, aus Schweiß, Tabak und ungewaschenen Klamotten. Und er ließ den Gedanken an sich vorüberziehen, was all diese mittelalten Überlebenskünstler da unten vor zwanzig Jahren gemacht hatten – ob sie in Polen und Russland jüdische Frauen und Kinder in die von ihnen selbst ausgehobenen Gräben geschossen hatten. Es war nicht gut, darüber nachzudenken. Schluck deinen Stolz runter, er macht dich nicht satt, hatte sein Vater immer gesagt. Also schluckte Vanuzzi seinen Stolz runter und begann, sich in der für die Pause verbleibenden Zeit den bisherigen Kampf zu vergegenwärtigen.
Sein Gegner war ein verdammter Rechtsausleger. Vanuzzi hatte schnell begriffen, dass der gewohnt war, gegen Linksausleger gut auszusehen. Mit jeder im Uhrzeigersinn ausgeführten Bewegung drohte Vanuzzi, in die Schlaghand des Deutschen zu laufen. Mehrmals hatte der Southpaw ihm schon linke Haken verpasst, die gesessen, ihn aber nicht ausgeknockt hatten. Aber da Vanuzzis rechte Augenbraue aufgeplatzt und das Auge darunter angeschwollen war, hatte er Mühe, die Schlaghand des anderen rechtzeitig zu sehen. Vor einer Minute wäre das beinahe schiefgegangen.
Im Infight war Vanuzzi dem Deutschen überlegen, doch seine Uppercuts hatten bislang keinen Erfolg erzielt. Mittlerweile hielt ihn der Kerl auf größerer Distanz – Kunststück!, er war fast zehn Zentimeter größer als Vanuzzi, ein Hüne von zwei Metern Körperlänge.
Es war nicht sein erster Kampf in den letzten Monaten – aber der erste, dessen Ausgang tatsächlich offen war. Bei den anderen hatte ihm irgendeiner dieser schmierigen Typen wenige Stunden vorher gesagt: »Du gehst runter, Ami, aber nicht vor Runde vier, kapiert?«
8–9–2. Acht Siege, neun Niederlagen, zwei Unentschieden. Seine Bilanz musste ausgeglichen sein, sonst wäre mit den Wetten auf ihn kein Geld zu verdienen gewesen. Mit seinem italienisch klingenden Namen hätte er hier gar nicht erst aufzutauchen brauchen, also hatte er sich einen echten Ami-Namen verpasst: Ted Jackson. Das Publikum, das vermutlich aus Leuten bestand, die immer noch an die Überlegenheit der arischen Rasse glaubten, wollte sehen, wie sein teutonischer Held den verdammten Besatzer vermöbelte. Doch das passierte nur hin und wieder, wenn die mit der Brillantine im Haar ihre Wetten im Vorfeld entsprechend platziert hatten.
Beinahe fünfzig Minuten ging dieser Kampf bereits – lange genug für Vanuzzi, um den Southpaw zu studieren. Und als eine Handbewegung des Ringrichters die beiden Kontrahenten wieder in die Mitte rief, glaubte er, endlich die Lücke in der Verteidigung des Deutschen gefunden zu haben. Ödön, Vanuzzis Sekundant, klatschte ihm zweimal aufmunternd mit den Handflächen auf die Trapezmuskeln. Sofort begannen die Boxer, einander zu belauern, tauschten einige harmlose Jabs aus. Der Deutsche, der zuvor so siegessicher gewesen war, schien durch die Pause aus dem Rhythmus gekommen zu sein. Seine Schläge wurden langsamer, verrieten sich durch eine vorangehende Bewegung in der Schultermuskulatur.
Es war Zeit!
Zwei, drei weitere Jabs, dann setzte Vanuzzi einen Cross, der den Deutschen schwanken und direkt in seinen Powerpunch rennen ließ, einen rechten Haken. Sein Gegner ging auf die Bretter, der Ringrichter schickte Vanuzzi in die neutrale Ecke. Der Deutsche versuchte, sich wieder zu fangen, krabbelte im Kreis, während der Ringrichter zählte und das Publikum johlte, buhte und pfiff. Dann war es vorbei. Vanuzzi spürte, wie eine Hand nach seinem verschwitzten rechten Arm griff, abglitt, noch einmal fester zugriff, um ihn in die Höhe zu befördern. Er stand da, den Arm gereckt, pumpte unentwegt und schaute mit so verengtem Blickwinkel Richtung Publikum, dass er den Ringrichter an seiner Seite kaum erkannte.
Vanuzzi drehte eine Ehrenrunde, trollte sich dann zu seinem Sekundanten. Die beiden verließen den Ring und strebten dem Umkleideraum zu. In weniger als fünf Minuten würde der nächste Kampf beginnen.
Die Umkleide der Boxhalle war eine ehemalige Waschküche. Sie roch nach Schimmel, der die Wände in abstrakten Mustern bedeckte, nach Chlor und Urin. Kaum einer der Boxer ging zum Pinkeln vor die Tür, sie benutzten einfach die beiden Waschbecken, in denen sich nachfolgende Kämpfer ihre Gesichter wuschen. Der Harngeruch ging nicht mehr weg, so viel Lauge sie auch in die Leitungen kippten.
Vanuzzi ließ sich auf eine wacklige Holzbank fallen, die unter seinem Gewicht ächzte. Sein getrübter Blick fiel auf die gegenüberliegende Wand, auf eine Ankündigung aus dem vergangenen Jahr. Eine englische Musikgruppe namens The Beatles trat allabendlich in einem Stripclub auf der Großen Freiheit auf. Es klang nicht nach Jazz, und so verlor Vanuzzi umgehend das Interesse.
Ödön zog ihm schweigend die Handschuhe ab und versorgte seine Wunden. Der junge Mann ließ sich immer wieder zu diesen Freundschaftsdiensten überreden. »Wer soll mich sonst nach den Kämpfen zurückbringen? Mit verklebten Augen kann ich nicht Auto fahren«, erklärte Vanuzzi jedes Mal, und Ödön gab jedes Mal nach, obwohl er das Boxen verachtete. Vanuzzi konnte es ihm nicht verdenken. Er selbst hatte für diese Gladiatorenkämpfe in der Hamburger und Kölner Unterwelt nichts übrig. Aber er brauchte das Geld. Es war zuletzt eine mehr oder weniger sichere Einkommensquelle gewesen. Die einzige.
Vanuzzi hustete, winzige Tröpfchen Blut landeten auf seinen nackten Oberschenkeln.
Dann ging die Tür auf, und ein Mann trat ein, den er hier noch nie gesehen hatte. Anfang vierzig, gelocktes hellbraunes Haar, Bartschatten, der Mund ein Strich.
»Zutritt nur für Boxer und Betreuer«, schnauzte Ödön.
Der Mann reagierte nicht, trat direkt vor Vanuzzi hin und sagte: »Wohin sind die Wildgänse gezogen?«
Vanuzzi betrachtete ihn skeptisch. Teures Jackett, bis obenhin geschlossenes Hemd und Krawatte – der gehörte eindeutig nicht zur Klientel hier. Außerdem stimmte etwas an seinem Deutsch nicht.
»Die Wildgänse sind nicht gezogen. Sie sind hier und dort und überall.«
»Eine Sekunde nach der Geburt, eine Sekunde vor dem Tod.«
Vanuzzi nickte, schickte Ödön mit einem Blick aus dem Raum und warf sich ein Unterhemd über. Er hasste es, mit bloßem Oberkörper Verhandlungen führen zu müssen.
Der Mann zog eine Packung filterlose Gauloises Caporal und hielt Vanuzzi eine hin.
»Lungentorpedo. Aber Sie können das ab.«
Er gab Vanuzzi Feuer, steckte sich selbst eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug.
»Also?«, fragte Vanuzzi.
»Nennen Sie mich Sélestat.«
»Nennen Sie mich Jackson.«
Sélestat lachte.
»Sie glauben, dass ich das mit den beschissenen Wildgänsen weiß und dann nicht mal Ihren wirklichen Namen kenne, Vanuzzi?«
Sie maßen einander.
»Gruß von Monty. Aber das dürfte klar sein, oder?«
»Was haben Sie für mich, Sélestat?«
»Sie sind ein Kämpfer, Vanuzzi. Aber sind Sie auch ein Jäger?«
»Kommt auf das Wild an.«
»Zwei kriminelle Elemente, die großen Schaden angerichtet haben und noch größeren Schaden anrichten werden, wenn man sie lässt. Es wäre gut, wenn jemand sie für uns findet und stellt. Nicht, weil wir es selbst nicht könnten … aber es gäbe – gewisse Verwicklungen, wenn wir es tun, und die müssen wir vermeiden.«
»Wer ist ›wir‹?«
»Erst die Antwort, dann die Details.«
»Antwort gibt’s erst, wenn ich weiß, für wen ich arbeite.«
»Sie können hier«, Sélestat führte die Arme weit auseinander und beschrieb einen Kreis, »als mittelmäßiger Boxer weitertingeln oder für uns arbeiten. Ihre Entscheidung.«
Vanuzzi fixierte den anderen.
»Wir zahlen allerdings besser als die hier.«
Sélestat hatte das starke französische Kraut hastig aufgeraucht und schnipste den Zigarettenstummel in ein Waschbecken.
»Natürlich müssen Sie sich erst einmal bei Ihrem Case Officer rückversichern, ob alles seine Richtigkeit hat. Ich bitte sogar darum, Vanuzzi.«
»Wie kann ich Sie kontaktieren?«
»Gar nicht. Wir treffen uns übermorgen, wenn Sie wieder bei Kräften sind. Dreiundzwanzig Uhr. Merken Sie sich den Ort, der in diesem Brief steht. Da finden Sie auch die Summe, die wir für Sie springen lassen. Ich bin überzeugt, dass dies Ihre Entscheidung beschleunigt.«
Er drückte Vanuzzi einen Umschlag in die Hand und wandte sich zum Gehen. Dann drehte er sich noch einmal um und sagte: »Übrigens: Sie sollten mehr auf Ihre Deckung achten. Ist Ihre große Schwäche, Vanuzzi!«
Er sah, wie der andere aus der Tür verschwand. Dann fanden seine Augen wieder das Plakat aus dem letzten Jahr. The Beatles. Was für ein dämlicher Name! Damit würden es die Jungs nie zu etwas bringen.
2
Der bestirnte Himmel über ihm und das Gaspedal unter ihm. Sein Taunus 15M hatte zigtausend Kilometer auf dem Tacho und so einiges mitgemacht, dennoch lief der Motor, ohne zu mucken. Als er ihn gekauft hatte, hatte Ödön ihn ausgelacht, ob’s nicht vielleicht etwas sportlicher gehe. Vanuzzi hatte abgewinkt. Einen Sportwagen musste man sich leisten können, außerdem wäre der viel zu auffällig gewesen. Vanuzzi wollte ein amerikanisches Fabrikat fahren, eines, an dessen Ersatzteile er mühelos herankam und das zugleich verlässlich war. Er hatte den Wagen selbst frisiert, sodass er, wenn es hart auf hart kam, auch mal hundertsechzig Sachen machte. Damit gab es nur wenige Autos in diesem Land, die ihn abhängen konnten.
Vanuzzi war wieder einmal auf der Autobahn von Köln nach Bonn unterwegs. »Diplomatenrennbahn« nannte man sie ironisch – seit Gründung der Bundesrepublik tobten sich auf ihr vorwiegend die nationale und internationale Politik und das Diplomatische Corps aus. Vielmehr: deren Chauffeure. Früher hatte Vanuzzi diese Strecke drei- bis viermal die Woche zurückgelegt, um seinen Case Officer in Bonn zu treffen. Mittlerweile gab es kaum mehr eine Notwendigkeit dafür.
Er war jetzt im zehnten Jahr »unabhängiger Informationsbeschaffer«, wie er sich selbst nannte. Hatte all diese Jahre dem britischen Auslandsnachrichtendienst MI6 zugearbeitet, aber keinen Volltreffer mehr gelandet, seit er 1956 wichtige Dokumente aus dem kommunistischen Ungarn geschmuggelt hatte. Alle interessanten – und daher lukrativen – Geschichten hatte die CIA abgegriffen. Es war ein Teufelskreis: Je weniger Erfolg, desto weniger verwertbare neue Infos, je weniger Infos, desto weniger Chancen auf Erfolg. Das MI6 ließ ihn am ausgestreckten Arm verhungern, und das war nicht bildlich gesprochen.
Seit drei Jahren hielt er sich vor allem mit Boxen über Wasser. Es waren Showkämpfe, weit davon entfernt, professionell organisiert zu sein, sonst hätte er auch nicht mithalten können. Das Gros seiner Gegner waren Männer, die ihren Zenit vor mehr als zehn Jahren überschritten hatten und nichts anderes konnten oder wollten als boxen. Doch keiner von ihnen war vierundfünfzig Jahre alt wie Vanuzzi. Noch konnte er durch Erfahrung und Schlaghärte ausgleichen, was ihm an Schnelligkeit, Reflexen und Kondition allmählich zu fehlen begann. Aber das Training musste immer umfangreicher werden, um den Status quo seiner Möglichkeiten zu erhalten, und die Blessuren brauchten ewig, bis sie ausheilten. Wenn er ehrlich mit sich selbst war, gab er sich keine zwei Jahre, bis sie ihn ausrangierten. Die Kämpfe mussten, wegen der Wetten, mit denen die Veranstalter gutes Geld verdienten, einigermaßen realistisch wirken; doch die Zocker, Luden hin oder her, würden riechen, dass etwas faul sein musste, wenn ein Mann wie er einen fünfzehn Jahre Jüngeren nach fünf Runden ausknockte.
Hin und wieder war er als Trainer eingesprungen, um ein paar Mark dazuzuverdienen. Aber seit er massive Schulden bei einem der Veranstalter hatte, reichte auch das nicht mehr. Und Schulden hatte er, weil … normalerweise hatte er kein Problem damit, wenn man ihm sagte, dass der Kampf nach fünf oder sechs Runden für ihn zu Ende sei. Und meist hatte er auch keines damit, gegen einen Deutschen zu verlieren – er schluckte seinen Stolz runter. Aber an diesem Tag war sein Gegner ein ehemaliger SS-Mann gewesen. Er hatte ihn an der ausgebrannten Blutgruppentätowierung am Oberarm erkannt. Etwas in ihm war an diesem Tag ausgerastet. Der Deutsche war ein Bulle, hatte gut und gern zehn Kilo mehr auf den Rippen. Fett, nicht Muskeln. Dadurch war er langsam. Zugleich überheblich und siegessicher, weil auch er wusste, wie der Kampf ausgehen würde. Vanuzzi hatte sich fünf Runden lang ans Drehbuch gehalten. Als er auch in der sechsten Runde keine Anstalten machte, in die behäbigen Schwinger seines Gegners zu rennen, zischte ihm der Deutsche ein ums andere Mal zwischen den lädierten Zähnen etwas zu. Nicht, dass er ihn wirklich verstanden hätte, doch glaubte er das Wort »Drecksjude« herausgehört zu haben. In Runde sieben war die SS sichtlich am Ende, schwitzte, dass bei jedem Schlag die Tropfen spritzten, keuchte pfeifend und hielt mühsam die Fäuste zur Deckung. Vanuzzi machte Schluss. Er ließ seinen Gegner in eine Gerade laufen, von der er sich nicht mehr erholte. Nach dem Kampf hatten sie ihn zu acht am Hinterausgang abgepasst und zusammengeschlagen. Sie hatten ihm nur deshalb nicht alle Knochen gebrochen, weil sie ihn für weitere Kämpfe brauchten und er ihnen versichert hatte, dass er ihre verlorenen Wetteinsätze einschließlich des verlorenen Gewinns mit Zins und Zinseszins zurückzahlen würde.
Doch wie …?!
Vanuzzi brauchte Geld. Viel Geld. Und er brauchte es dringend. Die Summe, die Sélestat in den »Brief« geschrieben hatte, war so groß, dass er auf einen Schlag nicht nur seine Schulden zurückzahlen konnte, er würde damit auch sich und Ödön die nächsten zwei Jahre durchbringen. Da Ödön gerade mal wieder seinen Job verloren hatte, war das auch bitter nötig.
Sie waren noch letzte Nacht aus Hamburg ins Ruhrgebiet zurückgekehrt.
Sélestat hatte Ödön vom ersten Augenblick an missfallen. Kaum war der Franzose gegangen, war Ödön wieder zurückgekehrt und hatte mit zusammengebissenen Zähnen gefragt: »Was war ’n das für ein Typ?«
»Einer, der mir Tipps für meine Defense geben wollte.«
Wie immer, wenn er auswärts kämpfte und danach längere Rückfahrten vor sich hatte, hatte ihn Ödön chauffiert, und wie immer hatte Vanuzzi die Fahrt komplett verschlafen, auch wenn sein Tagesrhythmus normalerweise ein anderer war und er nachts erst auf Touren kam. Die Kämpfe machten ihn so fertig, dass er, sobald das Adrenalin abgeflaut war, schlief wie ein Stein. Gegen Mittag hatte er Monty ein Telegramm geschickt, das dieser umgehend beantwortet und Vanuzzi um zwanzig Uhr in den Kurpark von Bad Godesberg bestellt hatte. Ein viel besuchter, dazu warmer Ort, Restaurant oder Kneipe, wie es bei früheren Treffen üblich gewesen war, wäre Vanuzzi allerdings lieber gewesen.
Er stellte sein Auto in der Nähe des Kurparks ab. Vanuzzi war mehr als eine halbe Stunde zu früh dran. Monty war Pünktlichkeitsfanatiker, hasste es, wenn seine Leute mehr als fünf Minuten zu spät zu Treffen kamen. Aber er hasste es noch mehr, wenn sie zu früh dran waren. Monty musste die Situation kontrollieren, musste derjenige sein, der bereits vor Ort war.
Vanuzzi drehte den Innenspiegel seines Wagens zu sich her und sah sich ins Gesicht. Er hatte Cuts an Unterlippe und Augenbraue, ein Auge war ein wenig geschwollen, aber nicht dramatisch. Nach anderen Kämpfen hatte er schlimmer ausgesehen.
Er wirkte noch immer deutlich jünger als seine Jahre. Das dunkelblonde, kurze Haar hatte erst wenige Silbersträhnen. Wässrig-graue Augen, die tief im Kopf steckten, und ein schmaler Mund mit je einer perfekt symmetrisch stehenden Falte rechts und links verliehen ihm mehr das Aussehen eines norwegischen Wintersportlers als das des italienischstämmigen Chicagoer Straßenkinds, das die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre zufällig nach Deutschland gespült hatten.
Ein schönes Curriculum Vitae: ein Chicago-Mobster, der zu Prohibitionszeiten kanadischen Alkohol schmuggelt. Er meldet sich zur US Army, als die dringend Leute braucht und deshalb keine strenge Musterung vornimmt. Heuert beim US-Heeresnachrichtendienst CIC an, übernimmt heikle Missionen in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Italien und Deutschland. Lässt sich vom Mossad als Doppelagent rekrutieren und wechselt nach einem Alleingang nach Israel. Er legt sich in Tel Aviv einmal zu oft mit seinen Vorgesetzten an und steht plötzlich allein da. Seitdem arbeitete er auf eigene Faust.
Vanuzzi warf einen letzten Blick in den Innenspiegel, drehte ihn wieder zurück.
Was hielt ihn eigentlich so jung? Seine Jobs konnten es nicht sein.
Vielleicht der Umstand, dass er sich so ruhelos und unstet fühlte wie mit Mitte Zwanzig? Oder dass etwas in ihm dieses Leben, wie es seit ein paar Jahren lief, gründlich satt hatte und sich nach etwas ganz anderem sehnte? Sich sehnte nach etwas, das wirklich zählte … aber Vanuzzi hatte keinen Schimmer, was wirklich zählte und wie er der Antwort auf diese Frage überhaupt näherkommen sollte.
Er verwarf den Gedanken, schnappte sich die dunkelbraune Fliegerjacke aus Leder, die er seit Jahren trug, sobald die Temperaturen unter zehn Grad fielen, verschloss das Auto und ging Richtung Kurpark. Es war dunkel, Lampen erhellten nur notdürftig die Wege. Er sah den Lehne an Lehne stehenden Parkbänken entgegen und entdeckte Monty, Zeitung lesend, auf einer von ihnen.
Montgomery Cuthred Hanson, seit zehn Jahren Vanuzzis Case Officer, der Mann, der ihn zum MI6 gebracht hatte, war das Abziehbild eines Engländers: Er trug sogar im Sommer Melone und Handschuhe, dazu Harris-Tweed-Dreiteiler, die er sich, wie er nicht müde wurde zu betonen, aus Hawick schicken ließ. Auch seinen Regenschirm betrachtete er – eingedenk des nicht besonders regnerischen Wetters in Bonn – als Zeichen der Distinktion. Mittelgroß, früh ergraut, glattrasiert, ging von ihm bei jeder Bewegung ein Hauch seines Eau de Toilette von Floris London aus, das Vanuzzi kräftig in der Nase kitzelte.
Vanuzzi ging einige Schritte in Montys Rücken an der Bank vorbei, streckte sich und blickte in den Himmel. Mit Ausnahme des Großen Wagens konnte er keine Sterne entdecken. Dann hörte er das Umblättern von Zeitungsseiten, schlenderte zurück und setzte sich Rücken an Rücken mit seinem Case Officer.
»Ich weiß wirklich nicht, was Sie gegen Restaurants haben, Monty.«
»Dies ist kein offizieller Fall, schon gar keiner von uns. Es ist besser, wenn meine Kollegen nichts mitbekommen, sonst tratschen sie bloß.«
Wieder raschelte es, wahrscheinlich faltete der Brite seine Gazette.
»Man sieht kaum die Hand vor Augen, das mit der Zeitung ist albern.«
»Ich komme immer um diese Zeit hierher und tue so, als würde ich lesen. Dann muss ich nicht mit den Leuten reden. Sobald die einen englischen Akzent hören, fangen sie an, sich zu rechtfertigen, was sie im Krieg getan oder nicht getan haben. Aber niemand quatscht einen Irren an, der im Dunkeln Zeitung liest.«
»Keeping a low profile geht trotzdem anders.«
»Ich wäge ab zwischen meinem Seelenfrieden und der richtigen Haltung zu meinem Job. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem mir mein Seelenfriede wichtiger wird. Warten Sie zehn Jahre, Dan, dann geht’s Ihnen auch so.«
Vanuzzi schnaubte amüsiert. Monty tat immer noch so, als ob er der wesentlich Ältere und Lebenserfahrenere wäre, dabei trennten sie kaum drei Jahre.
»Ein Franzose, eins fünfundsiebzig, hellbraune Locken –«
»Sélestat. Ich habe ihm gesagt, wie er Sie erreichen kann.«
»Vermutlich Résistancekämpfer, die haben als Nom de guerre oft die Stadt genommen, aus der sie stammen. Wo auch immer dieses Sélestat liegt.«
»Im Elsass.«
Das erklärte allerdings das schleppende, kehlige Deutsch des Mannes.
»Wie heißt er wirklich?«
»Thierry. Den Nachnamen weiß ich nicht.«
»Monty …?«
»Ich habe ihn vergessen. Vielleicht habe ich ihn auch nie gewusst. Er war immer Sélestat. Arbeitet für den französischen Auslandsgeheimdienst.«
»SDECE? Im Krieg haben sich eure Dienste gegenseitig beharkt. Ich wusste gar nicht, dass Briten und Franzosen seit Neuestem Liebesheiraten eingehen.«
»Das tun sie auch nicht. Franzmänner sind paranoid, sie glauben, dass die Queen ihnen höchstpersönlich die Kolonien wegnehmen möchte. Sie vergessen, dass auch wir kaum mehr Land in Afrika besitzen. Was für eine Schande!«
»Ja, früher war einfach alles besser. Zurück zu Sélestat –«
»Ich möchte es Goodwill nennen, Dan. Seht her, ihr Franzosen, wir helfen euch, die Kolonien zu behalten, und schicken euch sogar unsere Leute dafür.«
»Wie haben Sie sich kennengelernt?«
»1940, in Dünkirchen. Die Nazis hatten uns eingekesselt, wir wären alle verreckt oder in Kriegsgefangenschaft gekommen – und dann auch verreckt, nur bedeutend langsamer. Ich ganz sicher. Ich hatte einen Granatsplitter im Bein, es drohte, brandig zu werden. Ich lag bewegungsunfähig am Strand, als Air Force und Navy uns rausholen kamen. Allein hätte ich es nicht aufs Schiff geschafft.«
»Sélestat hat Ihnen geholfen?«
»Hmhm. Und dann habe ich ihm geholfen. Es war Order ergangen, dass nur britische Soldaten herausgeholt würden. Also habe ich ihn kurzerhand in die Uniform eines toten Kameraden gesteckt und erzählt, dass er taubstumm sei. Sein Englisch war grauenhaft, es hätte ihn verraten. Er ist bis ins Krankenhaus nicht von meiner Seite gewichen.«
»Allein wäre er auch aufgeflogen.«
»Trotzdem verdanke ich ihm wohl mein Leben. – Na, sind Sie jetzt gerührt, Dan?«
Vanuzzi lachte.
»Sie sind ihm also noch etwas schuldig, Monty?«
»Wie gesagt: Goodwill. Aber es hat auch damit zu tun, dass das Vereinigte Königreich mit Sorge auf die Ereignisse in Algerien blickt.«
»Algerien?«
»Er hat Ihnen nicht gesagt, worum es geht?«
»So weit sind wir nicht gekommen.«
Monty atmete hörbar aus. Dann sagte er: »Ich bin altmodisch, Dan, ein Verfechter der britischen Kolonialpolitik. Wenn Frankreich einknickt, wird auch das Empire unwiderruflich zerbrechen. Wir können unseren Eingeborenen nicht gut erklären, warum ihre Nachbarn plötzlich unabhängig sind, sie selbst aber Untertanen der britischen Krone bleiben. Verlieren wir nach Indien auch noch die afrikanischen Kolonien – nun, es gibt Kreise in meinem Land, die warten nur auf eine solche Gelegenheit, um zu putschen.«
»Sie denken, diese Unabhängigkeitsbewegung ist ein Virus, das sich ausbreitet?«
»Der FLN findet immer mehr Nachahmer in unseren Kronkolonien. Er ist mir an und für sich schon ein Gräuel.«
»FLN. Das sind die algerischen Separatisten?«
»Front de libération nationale. Eine kommunistische Kaderpartei. Sie wird von Moskau dirigiert. Überhaupt scheinen mir dieser Tage alle Algerier Kommunisten zu sein.«
Vanuzzi schwieg.
»Ich erinnere mich noch, als Sie ’56 aus Ungarn zurückkamen, Dan. Der Hass in Ihren Augen … die Sowjets hatten gute Freunde von Ihnen erschossen. Wenn Sie noch immer die kommunistische Weltrevolution aufhalten möchten –«
»Whoa, whoa, geht’s noch ein bisschen größer?«
»Wenn Sie ein Hühnchen mit den Sowjets rupfen wollen: Dies ist die perfekte Gelegenheit dafür. Es wird nur wichtig sein, dass Sie die Leute, die Sie jagen, in Frankreich übergeben, nicht in der BRD. Sélestat soll Ihnen erklären, warum. Sie müssen sich beizeiten um gute Pässe kümmern, Dan, für sich selbst und Ihre algerischen ›Gäste‹.«
»Okay, das hab ich hinterm Ohr. Sollte ich weitere Fragen haben –«
»Werde ich Ihnen ganz sicher nicht weiterhelfen können. Ich weiß nichts von Algerien und will davon auch nichts wissen. – Weidmannsheil!«
Von einer nahe gelegenen Kapelle drang Glockenklang herüber. Vanuzzi hörte Monty aufstehen, hörte, wie der die Zeitung in den Mülleimer warf. Dann sah er dem Briten hinterher, der schwerfällig in der Tiefe des Parks verschwand.
3
Es war Wochen her, seit er zuletzt die Sonne gesehen hatte. Was nicht nur an Vanuzzis verschobenem Tag-Nacht-Rhythmus lag. Rauch und Industrienebel breiteten sich so dicht über und in den Straßen von Essen aus, dass man kaum dreißig Meter weit sehen konnte. Angeblich hatte der Smog seit Herbstbeginn schon zwanzig Menschen getötet. Wo er wohnte, schien alles zu kulminieren: Wenn die Kokerei, die nur wenige Straßen weiter lag, Koks drückte, hüllten riesige Rauchschwaden das Haus ein. Von Chicago war er so einiges gewöhnt, aber das hatte ihn doch nicht auf das Leben im Ruhrgebiet vorbereitet.
Sélestat hatte einen Treffpunkt in Köln gewählt. Im piefigen katholischen Bonn wäre um dreiundzwanzig Uhr wahrscheinlich auch nichts mehr offen gewesen. Chez René, der Name ließ auf nichts Gutes schließen. Von außen sah er verrammelt aus, zwei kleine Fenster an der Vorderfront waren so abgeklebt, dass man nicht hineinsehen konnte. Vanuzzi rechnete mit einem Gorilla als Einlasskontrolle. Er atmete vorsorglich tief durch, um nicht gleich zu explodieren; er konnte es auf den Tod nicht ausstehen, von Männern betatscht zu werden. Doch zu seiner Überraschung betrat er den Laden ohne Musterung.
Nikotinschwaden und Musik. Vanuzzi erreichte eine Plattform oberhalb einer kleinen Treppe, die ins eigentliche Lokal führte. Es war schwach beleuchtet und gut gefüllt, vorwiegend Männer in Anzug und Krawatte, wahrscheinlich Geschäftsleute, die für ein paar Stunden vergessen wollten, dass sie seit zwanzig Jahren verheiratet waren. Rechts befand sich eine kleine Bühne, auf der sich eine junge Frau in Schulmädchenuniform mit einem Teddybär in der Hand zu rauchigen Saxophonklängen bewegte. Vanuzzi verdrehte die Augen. Wahnsinnig originell! Früher oder später landete man bei jedem Fall in einem Nachtclub und wurde vom Barmann oder den Mädchen ausgenommen. Er hatte nur zehn Mark bei sich, sein letztes Geld, dafür bekam man hier vermutlich gerade mal ein Glas Leitungswasser. Ohne Eis.
Vanuzzi suchte von seiner erhöhten Position das Publikum nach einem bekannten Gesicht ab, fand keines, ging die Treppe hinab und sah noch einmal in jede Nische. Er schlenderte zum Tresen. Der Barmann, kräftig, mit Schnurrbart und mehr als einmal gebrochener Nase, musterte ihn von oben bis unten mit abschätzigem Blick.
»Was darf’s sein?«
»Ich warte auf jemanden.«
»Sie müssen etwas bestellen.«
»Ich warte auf jemanden.«
»Sie müssen –«
»Kölsch.«
»Gibt’s hier nicht.«
»Irgendein Bier. Klein. Hell.«
Der Barmann griff nach einem Gläschen und drehte sich zum Zapfhahn. Vanuzzi sah zur Bühne hinüber. Das Mädchen war beim letzten Knopf ihrer Bluse angekommen. In dem Tempo würde es wahrscheinlich zwei Stunden dauern, bis sie endlich nackt abtreten konnte.
Das Bier war eiskalt. Vanuzzi nahm lediglich einen winzigen Schluck, doch er genügte, das Gesöff um die Hälfte zu verringern. Als er sich wieder zur Treppe umdrehte, sah er den Franzosen auf der Plattform, neben ihm einen zweiten Mann. Er war größer als Sélestat, ein paar Jahre älter, der Kopf schien direkt in den Oberkörper überzugehen, Halbglatze, hervorstehende Augenwülste, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt. Da kommt der Pudel mit seinem Rottweiler, dachte Vanuzzi.
Sélestat hatte ihn gesehen, trat direkt auf ihn zu.
»Vanuzzi! Was macht Ihre Deckung?«
»Monty grüßt zurück.«
»Dann freue ich mich, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen. Obwohl Sie eher Einzelgänger sind. – Das ist mein Mitarbeiter, sein Name ist Faucon.«
»Faucon. Aber natürlich.«
Wo in Frankreich lag dieses Kaff nun wieder?
»Monsieur Faucon spricht ein wenig Deutsch, er war nach dem Krieg hier stationiert … er kann uns verstehen, wenn wir langsam schwetze.«
Schwetze? Vanuzzi sprach die deutsche Sprache jetzt schon so lange, er hatte längst begonnen, in ihr zu denken, in ihr zu träumen, Selbstgespräche in ihr zu führen. Und doch überraschte sie ihn immer wieder.
Sélestat machte Zeichen, ihm zu folgen. Er steuerte eine kleine, etwas abseits vom Geschehen befindliche Nische an, die gerade frei geworden war. Der Franzose bestellte Rotwein, Vanuzzi knurrte, dass er sich als eingeladen betrachte. Faucons Augenschlitze wurden schmaler, doch Sélestat lachte.
»Naturellement.«
»Erzählen Sie!«
»Gleich zur Sache, das ist gut. – Was wissen Sie über Algerien, Vanuzzi?«
»Nur, dass ihr Franzosen da seit sieben Jahren Krieg führt.«
Sélestat sah ihn mit kritischem Blick an.
»Das ist kein Krieg! Ein Krieg kann nur zwischen souveränen Staaten geführt werden. Algerien ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des französischen Mutterlands. Genau wie die Bretagne.«
»Allerdings treten euch die Bretonen nicht in die Eier.«
»Weil die Bretonen zivilisiert sind im Gegensatz zu den Arabern. Wir haben es lange mit Vernunft probiert. Der Entwicklungsschub, den Algerien durch unsere Kolonisierung bekommen hat, ist superb. Wir haben ihnen Recht und Ordnung, Bildung und Kultur gebracht, und alles, was wir dafür bekommen, ist Terror und Gewalt.«
»Na, ein bisschen wird es sich für euch gelohnt haben, sonst wärt ihr längst raus.«
»Mir gefällt dein Gequatsche nicht, Vanizzi!«, dröhnte Faucons Bassstimme dazwischen.
»Der Name ist ›Vanuzzi‹. Und für das Gequatsche kann ich nichts. Ich bin aus Chicago, da redet man so.«
Er sah, wie Sélestat dem Rottweiler einen herrischen Blick zusandte, dann sprach der Pudel weiter.
»Jedenfalls haben auch die Sozialisten vor einiger Zeit verstanden, dass unsere zivilisatorische Mission scheitern wird, wenn wir den algerischen Terrorismus nicht mit Stumpf und Stiel ausrotten. Also musste die Armee ins Land. Sie setzt die Polizeiarbeit fort – mit den Methoden, die der FLN versteht.«
»Und was für Methoden sind das?«
»Informationsgewinnung. Aktionen und Strategien des FLN vorwegnehmen.«
»Folter.«
»Unsere Leute foltern nur, wenn Eile geboten ist. Wenn ein Anschlag droht, wenn ein Menschenleben gegen zwanzig zählt. Wenn wir uns weigern, einen Schuldigen zu foltern und dadurch den Tod eines Unschuldigen verhindern – wie sollen wir den Eltern des Getöteten in die Augen schauen?! – Sie waren im Krieg, Vanuzzi, wenn Ihre Jungs auf SS-Leute getroffen sind, haben Sie sie auch nicht zum Kaffee eingeladen.«
»Kaffee war meist aus.«
»Mir gefällt auch deine Visage nicht, Vanizzi!«
Diesmal reagierte auch Sélestat genervt.
»Wenn Sie das nicht verstehen«, sagte Sélestat in schärferem Ton, »dann verstehen Sie hoffentlich die Worte Ihres ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt: Kolonialkonflikte sind immer unbarmherzige Rassenkriege, die außerhalb der Regeln der internationalen Moral stehen. Die völkerrechtlichen Vereinbarungen zur Kriegsführung besitzen keine Gültigkeit, weil der Gegner als unzivilisierter Barbar die Regeln der zivilisierten Kriegsführung gar nicht kapiert.«
»Good old Teddy! Ist allerdings ein bisschen her, dass er das sagte.«
»Ich stamme aus dem Elsass. Als es 1871 an die Deutschen ging, hat sich ein Teil meiner Familie in Algerien ein neues Leben aufgebaut. Sie haben das Land rechtmäßig erworben, sie haben geschuftet und die Gegend urbar gemacht. Für die Araber war es Wüste, aber heute, wo es gutes Land ist, wollen sie es zurückhaben … ich war oft zu Besuch, ich kenne die Verhältnisse. Glauben Sie mir, Vanuzzi: Die Araber sind nichts als eine dreckige Rasse! Unser Fehler war von Anfang an, dass wir sie wie Menschen behandelt haben. Sie taugen nichts. Du kannst ihnen nicht vertrauen. Sie widersetzen sich jeglichem sozialen Fortschritt. Und wenn wir ihnen etwas beibringen, dient es nur dazu, uns übers Ohr zu hauen.«
Vanuzzi verbiss sich einen Kommentar. Obwohl ihm die Worte bekannt vorkamen – als Jude hatte er sie mehr als einmal gehört, nur waren immer er und seine Glaubensbrüder damit gemeint gewesen.
Sélestat kippte den letzten Schluck Rotwein, der sich in seinem Glas befand, schenkte sich und den anderen nach und sagte dann: »Vielleicht haben Sie davon gehört, dass de Gaulle kürzlich über ein Referendum zur Unabhängigkeit Algeriens abstimmen ließ. Meine Familie da unten fühlt sich von ihm verraten und verkauft. Und ich kann sie verstehen. Weil wir den Sieg schon vor Augen hatten.«
»Ist das so?«
»Wenn de Gaulle den Terroristen nicht permanent Zugeständnisse gemacht hätte, wäre Algerien längst befriedet. Noch ist es nicht zu spät. Auf keinen Fall dürfen wir das Land herschenken, wie wir Indochina hergeschenkt haben, sonst wären all die jungen Soldaten dort sinnlos gefallen. – Aber es geht dabei nicht nur um Frankreich.«
»Sondern?«
»Um den Einfluss der Kommunisten in der Region. Wenn Algerien dem FLN in die Hände fällt, wird ganz Nordafrika kommunistisch. Wenn Nordafrika kommunistisch ist, nehmen die Sowjets Europa von zwei Seiten in die Zange. Nasser, der Staatspräsident von Ägypten, ist schon Moskaus Schoßhündchen. Er heizt den Konflikt in Algerien an. Unsere Jungs führen einen Krieg für die ganze freie Welt!«
»Ich dachte, es ist gar kein Krieg.«
»Eigentlich gefällt mir an dir gar nichts, Vanizzi.«
»Mach Männchen!«
»Was hast du gesagt?«
Faucon war hochgeschnellt, sah Vanuzzi drohend an. Trotz ihrer Randposition im Raum hatten sich einige Köpfe zu ihnen umgedreht.
»Wollt ihr beiden vielleicht mal vor die Tür?«
Sélestat sah abwechselnd von Vanuzzi zu Faucon. Der zischte ein paar französische Worte zwischen den Zähnen, zog seinen Mantel über und verließ den Club.
»Sie sollten vorsichtig sein, Vanuzzi. Faucon ist ein besserer Kämpfer als Sie. Im Krieg hat er deutschen Soldaten mit bloßer Hand den Garaus gemacht.«
»Schon gut, Sélestat, wir haben alle unsere Heldengeschichten aus dem Krieg. Zu den Fakten: Um wen geht es?«
Sélestat zog ein maschinengeschriebenes Blatt und ein Foto hervor, auf dem zwei Männer in Sonntagsgarderobe posierten. Der Ältere mit Vollbart, gut aussehender Südländer mit melancholischem Blick, der Jüngere mit eng stehenden Augen, kleiner Nase, auf der Stirn ein liegendes Dreieck aus Muttermalen.
»Das sind die beiden: Youssef Ben Kemali und Saïd Djefel. Schon mal gehört?«
»Nein, woher denn?«
»Würden Sie etwas mehr als den Sportteil in der Zeitung lesen, wären Ihnen die Namen ein Begriff.«
»Mehr als den Sportteil, muss ich mir aufschreiben. – Warum sind sie in der BRD untergetaucht?«
»Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das wissen müssen.«
»Ich bin mir sehr sicher, dass ich das wissen muss.«
»Also gut. Seit drei Jahren ist Charles de Gaulle Ministerpräsident. Für die meisten Franzosen ist er ein Kriegsheld. Er hat den Arabern Honig ums Maul geschmiert, daraufhin sind viele von ihnen in sein Lager abgewandert, weil sie dem FLN nicht mehr zugetraut haben, das Land in die Unabhängigkeit zu führen. Der FLN musste reagieren, also hat er Algerien für unabhängig erklärt.«
»Algerien ist unabhängig?«
»Wäre ja noch schöner! Außer Ägypten und ein paar anderen arabischen Staaten hat niemand diese Farce anerkannt. Aber um das Ganze offiziell zu machen, hat der FLN ein Schattenkabinett präsentiert, künftige Regierungsleute, Männer in Anzügen. Um der Welt zu signalisieren, dass man keine Verbrecherbande ist.«
»Djefel und Ben Kemali waren Teil des Schattenkabinetts.«
»Nur Ben Kemali. Djefel ist sein Mitarbeiter.«
»Um zu erfahren, was diese Regierung plant, würden Sie sie gern mal in die Mangel nehmen, klar. Aber was machen die in der BRD?«
»Sind hier abgetaucht. Weil sie, wie alle von der ALN, Kriegsverbrecher sind, und Deutschland selten ausliefert.«
Als er Vanuzzis fragenden Blick sah, schob Sélestat hinterher: »Armée de libération nationale, der bewaffnete Arm des FLN. Wissen Sie, was die mit gefangenen französischen Soldaten machen? Sie stechen ihnen die Augen aus. Wenn sie ihre Messer nicht schmutzig machen wollen, nehmen sie Schraubenzieher. Dann schlagen sie die Hände ab. Am Ende ziehen sie ihnen die Axt über den Schädel und lassen die Leichen liegen, als Abschreckung für andere.«
»Ich verstehe.«
»Tun Sie das, Vanuzzi? Tun Sie das wirklich …? Ich habe im letzten Krieg manches gesehen: die Nazis in Dünkirchen, die Ruinen von Oradour … aber so etwas habe ich nicht erlebt. Denken Sie an die Worte Ihres Präsidenten: Unzivilisierte Barbaren kapieren –«
»Weshalb ich? Mit dem SDECE hatte ich noch nie zu tun.«
»Wir brauchen jemanden, der nicht direkt mit uns in Verbindung gebracht werden kann. Unsere Leute haben in der BRD schon einmal viel Wind gemacht, das ist noch nicht lange her. Diesmal will man im Élysée-Palast keine Demarche der westdeutschen Regierung riskieren. Die Beziehungen unserer Länder sind zarte Pflänzchen … außerdem könnten uns die Deutschen bei den Amis verpetzen, weil wir alliierte Statuten verletzen.«
»Ich arbeite auf eigene Rechnung, also deutet nichts Richtung Paris, okay. Aber warum muss ich Ben Kemali und Djefel in Frankreich übergeben, und nicht hier?«
»Weil wir dann sagen können, dass wir sie bei uns geschnappt haben. In Frankreich liegen Haftbefehle gegen sie vor.«
Vanuzzi grinste. Auch wenn er Sélestat etwas suspekt und Faucon zum Kotzen fand, hatte die Sache begonnen, sein Jagdfieber zu wecken. »Wo soll ich ansetzen?«
»Was ich Ihnen gegeben habe, ist alles, was Sie von uns erwarten können.«
»Das ist nicht besonders viel. Die BRD ist zwar nicht groß, aber groß genug, um …«
»Muss ich Ihnen Ihre Arbeit erklären? Oder habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Die Crémerie weiß von nichts. Wir haben uns nie gesehen, wir haben nie miteinander gesprochen. Das ist Ihr Job, Vanuzzi. Machen Sie was Schönes draus!« Sélestat stand auf, legte einen Zettel über die Vorgehensweise zur Kontaktaufnahme, einen Briefumschlag mit einer Anzahlung und einen Hundertmarkschein für die Bedienung auf den Tisch. Dann ging er ohne zu grüßen zum Ausgang.
Vanuzzi überschlug Sélestats Geld, tauschte den Hunderter gegen einen Fünfziger aus dem Umschlag und bezahlte. Als er einen letzten Blick zur Bühne warf, war dort gerade ein neues Mädchen damit beschäftigt, sich umständlich ihres Mieders zu entledigen.
Vanuzzi trat hinaus in die Nacht und atmete die Luft tief ein. Sie roch nach Chrysanthemen, verbranntem Holz und frischem Teer.
4
Vor fünf Jahren waren Vanuzzi und Ödön mit brisanten Unterlagen für den MI6 aus dem brennenden Ungarn entkommen. Danach mussten sie sich eine neue Heimatbasis schaffen. Ödön war schon nach zwei Wochen krank vor Heimweh. Er hing Tag und Nacht vor dem Radio, las jede Zeitung, die ihm unter die Finger kam, immer in der Hoffnung, irgendwann doch gute Nachrichten aus Budapest zu finden. Vergeblich. Die Sowjets zertraten den revolutionären Widerstand im Land und zementierten ihre Herrschaft. Vanuzzi nahm Ödön das Radio weg und sorgte dafür, dass er keine Zeitungen mehr zu Gesicht bekam. Der junge Mann hatte immer mehr Gewicht verloren, drohte zugleich, apathisch zu werden. Dennoch drängte er darauf, in Österreich zu bleiben, wohin sie zunächst geflohen waren. Falls die Revolution in Ungarn eines Tages einen zweiten Anlauf nehmen würde, wäre Ödön schneller wieder in seinem Heimatland gewesen. Doch Vanuzzi hatte ihm klargemacht, dass Österreich, seiner Neutralität wegen, für Agenten uninteressant geworden war: »Wenn du Kühlschränke verkaufen willst, ziehst du auch nicht an den Nordpol!« Und da Ödön in ihm immer noch so etwas wie seinen »Ausbilder«, wahrscheinlich auch einen Ersatzvater sah, war er ihm 1957 widerwillig in die BRD gefolgt. Für Leute wie Vanuzzi der europäische Hotspot. Der MI6 hatte dafür gesorgt, dass sie problemlos Papiere bekommen hatten. Kurzzeitig hatte er darüber nachgedacht, nach Westberlin zu gehen … spätestens heute war er froh, sich dagegen entschieden zu haben. Es war keine drei Monate her, dass die DDR begonnen hatte, die Stadt mit einer Mauer, Sperranlagen und Todesstreifen abzuriegeln. Beinahe jeden Tag hörte Vanuzzi von Republikflüchtlingen, die erschossen worden waren, und am Checkpoint Charlie hatten sich schussbereite amerikanische und sowjetische Panzer gegenübergestanden. Westberlin war eine Insel geworden, vielleicht sogar eine tödliche Falle.
Monty Hanson, der 1957 frisch in Bonn akkreditiert war, hatte Vanuzzi damals vorgeschlagen, in seiner Nähe zu bleiben. Im großbürgerlichen Bonn hatten sich Vanuzzi und Ödön allerdings keine Wohnung leisten können, deshalb waren sie nach Köln ausgewichen und in einem Ledigenheim untergekommen. Hatten sich das Zimmer mit zwei weiteren Ungarn-Flüchtlingen geteilt. Das ganze Jahr über mussten sie ihre Lebensmittel in Zeitungen verpacken und auf den äußeren Fensterbänken lagern, weil es keine andere Möglichkeit gab, sie zu kühlen. »So viel zum Thema Kühlschränke verkaufen«, hatte Ödön gemurrt. Doch wenigstens hatte er wieder ein wenig Gewicht zugelegt.
Anfangs schien das Ledigenheim für Vanuzzi die perfekte Tarnung, auch wenn er alles, was nicht zu dieser Camouflage passte, in einem Bankschließfach verstecken musste. Nach zwei Jahren wurde er nachlässiger, begann, seine Waffe in seine Nachttischschublade zu legen und diese nicht immer abzuschließen. Als einer ihrer Zimmerkameraden offenbar auf der Suche nach Geld war, stieß er zufällig auf die Pistole. Am selben Abend nahm er Vanuzzi beiseite und sagte ihm, dass ein Ungar schweige wie ein Grab, aber nur, wenn man von Zeit zu Zeit ein paar Mark aufs Grab lege. Der verblüffte Vanuzzi ließ sich zunächst darauf ein, bis die Forderungen immer unverschämter wurden. Ödön, der einen Job als Schreinergehilfe in Köln gefunden hatte, blieb im Ledigenheim, und Vanuzzi, dem der MI6 eine winzige Wohnung beschafft hatte, packte seine Siebensachen und zog weiter. Seitdem lebte er in Essen, konnte in der Masse der italienischen Gastarbeiter untertauchen, ein Gesicht unter vielen in einer Stadt mit über siebenhunderttausend Einwohnern.
Die ihm manchmal, besonders an den Wochenenden, im Vergleich zu Chicago vorkam wie ein Dorf, das aus den Nähten geplatzt war. Und über dem stets der Geruch von faulen Eiern lag.
Vanuzzi hatte sich die Dossiers seiner Zielpersonen durchgelesen. Sie waren knapp gehalten. Beide wurden vom SDECE für ein Massaker in der Nähe des Ouarsenis-Gebirgsmassivs verantwortlich gemacht, bei dem mehr als dreihundert französische Soldaten bestialisch getötet worden waren. Ben Kemali hatte Englisch und Rechtswissenschaft studiert. Er war Anfang vierzig, hatte Frau und zwei Kinder. Djefel war zehn Jahre jünger, ohne eigene Familie. In Algerien schien er so etwas wie Ben Kemalis rechte Hand gewesen zu sein. Sie waren gebildet, hatten sich beim FLN schnell einen Namen gemacht und waren in der Hierarchie aufgestiegen. Seit Frankreich den Krieg in Algerien verschärfte, waren immer mehr hochrangige FLN-Leute festgenommen worden. Ben Kemali und Djefel schien die Flucht in letzter Minute gelungen zu sein. Immerhin hatte der SDECE die Stationen, die sie über Italien und die Schweiz genommen hatten, nachverfolgen können, bis sich in der BRD ihre Spuren verloren. Man ging davon aus, dass sie irgendwo in Nordrhein-Westfalen untergekommen waren, weil hier die algerische Gemeinschaft am größten war. Dennoch, das war immer noch viel zu wenig. Vanuzzi hatte nicht einen echten Anhaltspunkt. Und Monty hatte nur zu deutlich gemacht, dass er ihm nicht helfen würde. Also musste er damit beginnen, ganz kleine Brötchen zu backen.