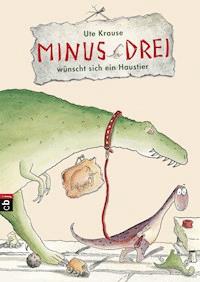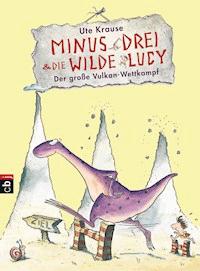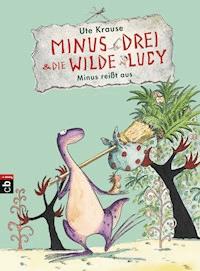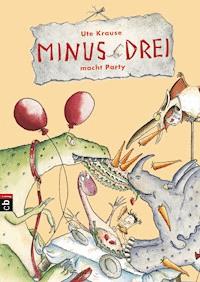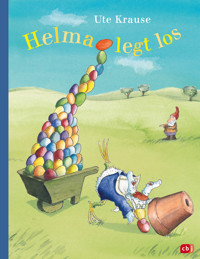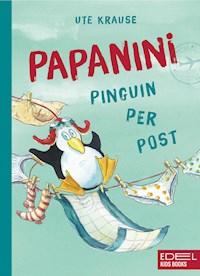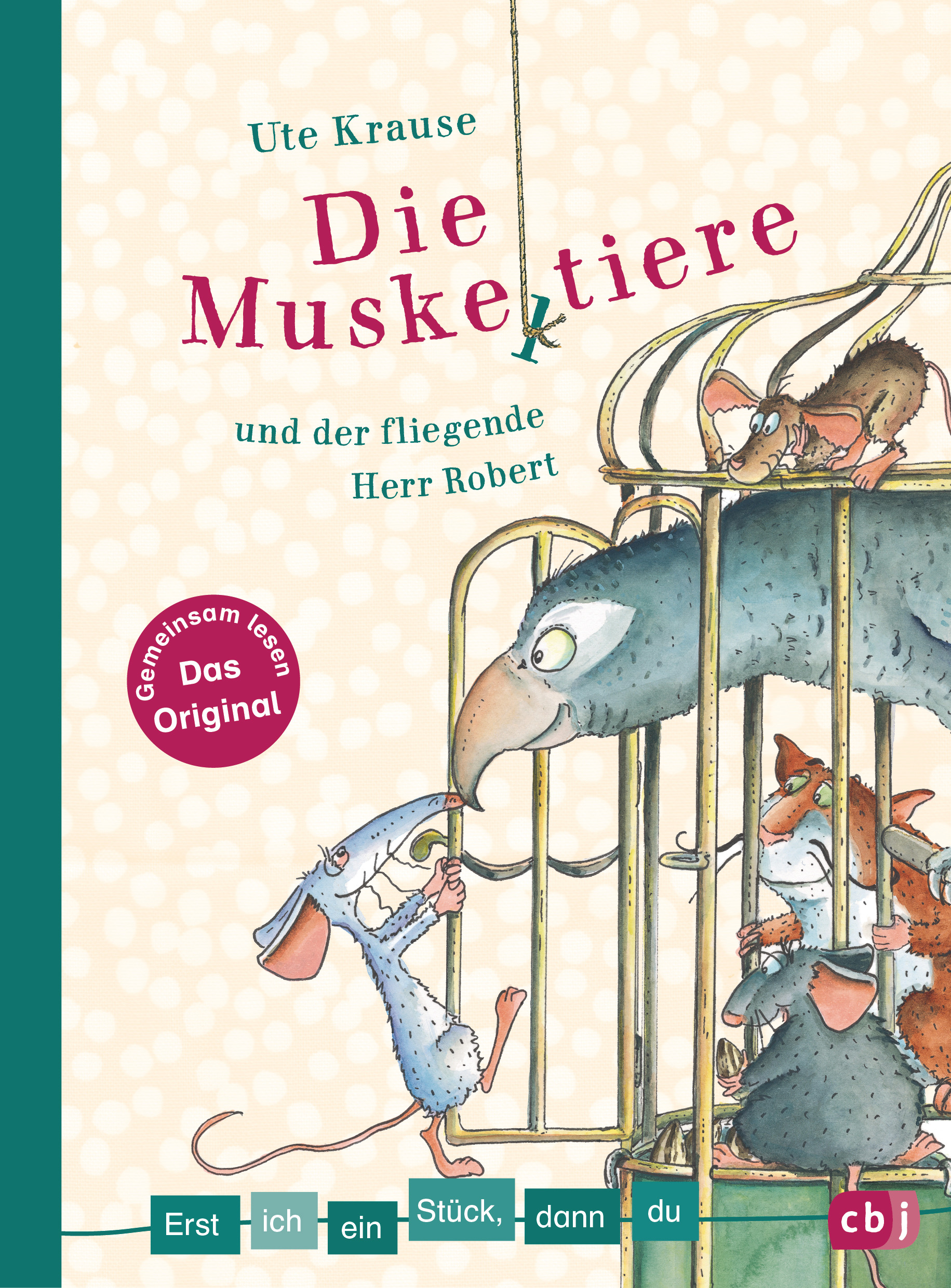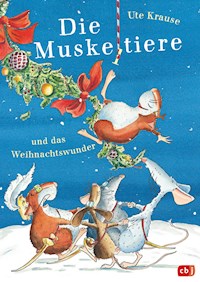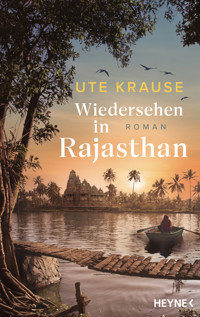
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über den Weg durchs Unglück zum Glück
Hamburg 1999: Nach dem Tod ihrer Mutter reist Paula nach Rajasthan, wo sie als Kind einige Jahre gelebt hat. Dort lernte sie damals die Familie Khandal kennen, bei der sie, anders als in ihrer Familie, Wärme und Geborgenheit erfahren hat. Doch Paulas Mutter und Gesa Khandal beendeten die Freundschaft plötzlich. Nun will Paula herausfinden, was aus den Khandals geworden ist, denn der Bruch hat in ihrem Leben Spuren hinterlassen.
Indien 1935: Gesa zieht als Ehefrau von Ravi, in den sie sich in Berlin verliebte, nach Rajasthan. Schon bald muss sie erfahren, dass Ravi ein Geheimnis hütet, das ihr Leben ins Wanken bringt. Dennoch lernt sie, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und freundet sich mit Paulas Familie an.
So unterschiedlich die Leben der beiden Frauen auch sind, so tief sind sie doch auf rätselhafte Weise miteinander verbunden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Die beiden Jahre in Kota waren ein wichtiger Teil von Paulas Leben gewesen, vielleicht überhaupt der wichtigste, denn dort war sie glücklich gewesen. Die Mutter hatte bis zuletzt nicht darüber sprechen wollen, warum sie damals die Freundschaft mit Gesa von heute auf morgen beendet hatte. Oder hatte Gesa sie beendet?
Gesa – sie hatte Ewigkeiten nicht mehr an sie gedacht, aber jetzt war sie unvermittelt wieder da: Ihre hochgewachsene Gestalt im weißen Sari, ihr aufrechter, wiegender Gang, mit dem sie der Welt stolz entgegengetreten war. Es breitete sich Wehmut und zugleich Wärme in ihr aus und vorübergehend wurde sie wieder zu der zwölfjährigen Paula.
Sie meinte alles zu sehen: Wie sie die Raj Bhawan Road hinaufläuft, durch die sonnengefleckten Schatten der alten Banyan bäume – hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Sie hatte alles an der Banyanbaumallee geliebt – die von den ausufernden Kronen wie mächtige Taue zu Boden hängenden Wurzeln, die windschiefen Teebuden, die sich dazwischen duckten, Licht und Schatten.
Komisch, dass ausgerechnet diese Szene so leuchtend und klar in ihr weiterlebte, obwohl es sich doch nur um den kurzen Weg zwischen dem Haus von Gesa und dem der Familie handelte!
Dreißig Jahre waren seitdem vergangen, fast ein halbes Leben.«
Ein ergreifender Roman über die innere Freiheit, das anzunehmen, was das Leben einem schenkt.
Über die Autorin
Ute Krause, 1960 geboren, wuchs in der Türkei, Nigeria, Indien und den USA auf. An der Berliner Kunsthochschule studierte sie Visuelle Kommunikation, in München Film und Fernsehspiel. Sie ist als Schriftstellerin, Illustratorin, Drehbuchautorin und Regisseurin erfolgreich. Ihre Bilder- und Kinderbücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und für das Fernsehen verfilmt. Ute Krause wurde u. a. von der Stiftung Buchkunst und mit dem Ver.di-Literaturpreis ausgezeichnet und für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
UTE KRAUSE
Wiedersehen in Rajasthan
Roman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Ute Krause
Copyright © 2025 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München [email protected]
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Michael Kumpfmüller
Umschlaggestaltung: zero-media.net unter Verwendung von Gettyimages (Dinodia Photo/Corbis Documentary) und FinePic®
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32652-4V001
www.heyne.de
TEIL I Aufbruch
»Man hat nie Angst vor dem Unbekannten; man hat Angst, dass das Bekannte zu Ende geht.«
Krishnamurti
Paula,Hamburg, November 1998
Der Himmel trug ein schamloses Frühlingsblau, das zu der Jahreszeit überhaupt nicht passte, schon gar nicht zu einem Novembertag an der Elbe.
Für Paula gehörte dieses Blau zu den indischen Winterhimmeln, durchzogen vom Duft morgendlicher Holzfeuer und erfüllt mit dem Kreischen grüner Papageien. Auf keinen Fall jedoch gehörte es in den lichtarmen Norden, weshalb ihr Blick immer wieder erfreut und verblüfft nach oben wanderte.
Auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg hatte es in Strömen geregnet und war erst aufgeklart, als sie von der Max-Brauer-Allee in die Elbchaussee einbog.
Hatte sich da oben jemand zu ihrer Begrüßung etwas Besonderes einfallen lassen?
Seit dem Tod der Mutter ging ihr Blick immer mal wieder hinauf, wenn sie an sie dachte. Dabei war sie gewiss nicht gläubig, es handelte sich eher um eine alte Gewohnheit aus Kindertagen, die begonnen hatte, als sie an der Hand ihrer Großmutter regelmäßig den Friedhof besuchte.
Oni, wie Paula ihre Großmutter liebevoll nannte, war eine leidenschaftliche Friedhofsgängerin gewesen, um dort ihre Zwiegespräche mit Opa Hermännchen zu führen.
»Der Opa ist im Himmel«, hatte sie der kleinen Paula erklärt, während sie schnaufend Stiefmütterchen um sein Grab herum pflanzte. »Von dort hat er einen guten Überblick und passt auf, dass wir keine Dummheiten machen.«
»Auch auf mich?«
»Ja, was denkst denn du! Natürlich.«
»Passt er denn für immer und ewig auf uns auf?«
»Ja, für immer und ewig.«
Der Gedanke war Paula damals sehr wichtig gewesen und hatte sie mit einem wohligen Gefühl in der Magengegend erfüllt, weshalb sie den Himmel immer wieder nach ihm absuchte, als könnte sie den Himmels-Großvater irgendwann winkend hinter einer Wolke entdecken.
Ihre Sehnsucht nach seinem behütenden Blick war so groß gewesen, dass sie sich noch heute gut daran erinnerte; dabei war sie ihm nie begegnet, kannte nur die Fotos, die bei Oni hingen, denn Hermännchen war kurz vor Paulas Geburt gestorben.
Hier und da blitzte die Elbe verheißungsvoll zwischen Bäumen und Häusern, Paula hatte den Anblick schon als Jugendliche geliebt, war hier oft neben den plätschernden Wellen hergelaufen, um die Unordnung in ihrem Kopf wieder in Ordnung zu bringen, denn Unordnung hatte dort lange geherrscht, bis sie einige Jahre verschwunden war.
Und nun war sie wieder da.
Sie passierte weiß getünchte hochherrschaftliche Häuser, die halb verborgen hinter üppigem Grün zu sehen waren, ehrwürdige Villen im gregorianischen Stil oder englische Landhäuser, bei denen fast alles weiß war, auch Torpfosten und Gartenmauern. Dahinter lugten wie mit Nagelschere und Lineal beschnittene Hecken hervor – eine Atmosphäre gediegener Eleganz, die mit Paulas Leben wenig zu tun hatte, weshalb sie alles neidlos bewunderte.
Oni hatte die Bewohner der Elbchaussee als Pfeffersäcke bezeichnet, und als Kind hatte Paula sich vorgestellt, dass große, mit Pfeffer gefüllte Säcke die Treppen hinauf- und hinabwankten und im Salon bei klassischer Musik Tee tranken.
Sie war mindestens eine Stunde zu früh, weil sie wegen der vielen Baustellen auf der ehemaligen Transitstrecke schon gegen acht losgefahren war, weshalb sie zuerst überlegte, einen kleinen Strandspaziergang zu machen, dann aber doch in die Straße nach Ottensen einbog und kurz entschlossen Richtung Friedhof fuhr.
Sie brauchte nicht lange zu suchen, bis sie das Grab der Mutter fand. Vor einem halben Jahr, kurz nach ihrem Tod, war sie zum ersten und einzigen Mal dort gewesen.
Hanne Marion Jansen – 29.3.1935 bis 8.4.1998 – Unvergessen!, stand auf dem Grabstein aus dunklem, poliertem Marmor.
Den Text hatte Clara mit dem Vater verfasst; die frischen, orangefarbenen Gerbera waren sicherlich auch von ihnen.
Setzen wollte sie sich trotz des schönen Wetters nicht, obwohl in der Nähe eine Bank war; auch nach andächtig Stehen war ihr nicht zumute, weshalb sie eine Weile vor dem Grab hin und her ging und sonst niemanden weiter sah. Kurz fürchtete sie, die Schwester oder der Vater könnten plötzlich zwischen den Bäumen auftauchen, obwohl sie doch wusste, dass Clara zu dieser Uhrzeit in der Kanzlei und der Vater in seiner Hohenfelder Wohnung vor dem Fernseher saß.
Es war ihr Vater, der sie damals im April im Büro angerufen hatte, um ihr mitzuteilen, dass die Mutter gestorben sei.
»Sie ist ganz friedlich eingeschlafen, irgendwann nachts«, hatte er in fast sachlichem Ton gesagt; dass er mit Morphium nachgeholfen hatte, erfuhr sie erst später.
In ihren letzten Wochen hatte die Mutter immer wieder gebettelt, jemand möge mit ihr in die Schweiz fahren, was Clara mit der Begründung abgelehnt hatte, man mache sich damit strafbar. Als Paula widersprechen wollte, fiel sie ihr sofort ins Wort – als Juristin wisse sie schließlich Bescheid.
Kurz danach hatte die Mutter aufgehört zu essen, und als Paula sie zum letzten Mal sah, war sie bereits derart abgemagert, dass klar war, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb.
Aber daran wollte sie jetzt nicht denken, lieber dachte sie an die Wochen davor, als die Mutter noch aufrecht im Sessel saß. An einem dieser Nachmittage hatte Paula sich in ihrem Beisein das Album mit den Fotos aus Indien angesehen. Warum dachte sie ausgerechnet jetzt daran? Sie blickte hinauf zwischen die kahlen Äste der Birken – es musste an diesem Himmelblau liegen.
Anfangs hatte sie nur flüchtig geblättert, sah die Eltern, wie sie mal einzeln, mal zu zweit vor Tempeln und Palästen posierten, dann Clara und sie auf einem Elefanten, bis sie bei einem Schwarz-Weiß-Bild hängen blieb: Einem Porträt der Mutter als junge Frau, die dem Fotografen (wahrscheinlich dem Vater) in einem leichten Sommerkleid jung und keck entgegenstrahlte. Neben ihr standen der kleine Conrad und die achtjährige Clara, und dahinter konnte man den mit Bougainvillea bewachsenen Bungalow erkennen, die Blüten ein tiefes Karminrot, wie sich Paula erinnerte.
Der Blick der Mutter hatte sich verdüstert, als sie ihr das Foto zeigte.
»Diese Welt gibt es nicht mehr.«
Sie hatte das Album mit einem Ruck von sich geschoben, und einen Monat später war sie tot.
»Ich komme, so schnell ich kann«, hatte Paula dem Vater sagen wollen, doch der hatte den Hörer bereits an Clara weitergereicht. Nach ein paar wenigen Worten über die anstehenden Aufgaben, bat sie die Schwester, die Beerdigung nicht auf den siebzehnten April zu legen, denn da müsse sie zu einem wichtigen Termin; sie habe nach langer Suche endlich eine passende Bürogemeinschaft gefunden, und am siebzehnten würde die Vertragsunterzeichnung sein. Außerdem müsse sie noch am selben Tag nach Amberg, um ihren ersten Auftrag als selbstständige Architektin anzutreten – den Umbau einer alten Orangerie in eine moderne Stadtvilla.
Nach dem Telefonat war sie schnellstmöglich nach Hamburg gefahren, doch als sie am Nachmittag in der elterlichen Wohnung eintraf, war die Mutter bereits abgeholt worden; Clara sei wie immer sehr effizient gewesen, hatte ihr der Vater voller Lob für die Schwester mitgeteilt, die Einladungen zur Beerdigung seien ebenfalls in Auftrag gegeben.
»Und wann wird die sein?«
»Am siebzehnten April.«
Paula hatte ungläubig zur Schwester geblickt.
»Es ging nicht anders«, erwiderte die, ohne Paula anzusehen. »Das Streichquartett, das sich Mutter gewünscht hat, kann leider nur am siebzehnten.«
»Ich kann ein anderes besorgen.«
»Das Quartett war ihr ausdrücklicher Wunsch.«
»Was ist dir wichtiger – das Streichquartett oder dass wir als Familie zusammen sind?«
»Ich sagte ja bereits: Es war ihr Wunsch.« Clara hatte ungeduldig mit der Hand durch die Luft gewischt, so wie sie es wahrscheinlich mit ihren Angestellten tat. »Es ist alles arrangiert. Verschieb einfach deine Termine.«
Als Paula protestieren wollte, war die Schwester abrupt aufgestanden. »I will not have it, no discussion«, sagte sie und verließ das Zimmer. So wie früher, wenn die Geschwister miteinander redeten, war sie ins Englische verfallen, als würde sie damit ihrem Nein besonderen Nachdruck verleihen.
Es war nicht zu fassen.
Sie musste erst einmal ein Stückchen gehen, bevor sie in ihr Hotel zurückkehrte, denn Claras Ton, die Art, wie sie mit ihr gesprochen hatte, erinnerten sie auf unangenehmste Weise an die Mutter, wenn sie Paula zu verstehen gab, dass ihre Wünsche mal wieder völlig maßlos waren.
Mit vierundvierzig war sie natürlich kein Kind mehr, dennoch hinterließ das Gespräch ein Gefühl von Hilflosigkeit, wie sie es damals so oft empfunden hatte. Sie hasste dieses Gefühl und dass es in der Welt der Eltern und Clara bis heute keinen Raum für Diskussionen gab, sondern alles so zu sein hatte, wie sie es für sich beschlossen hatten – es gab immer nur ja oder nein, schwarz oder weiß.
Mit diesen Gedanken rannte sie inzwischen. Sie hatte ohne Nachzudenken den Weg zur Alster eingeschlagen, wo der Abendhimmel ausgebreitet über dem See lag; nun atmete sie mehrmals tief durch, den Blick auf den Horizont gerichtet, wo Wasser und Himmel im Dunst verschmolzen.
»Hören Sie auf die Zwischentöne und nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidungen«, hörte sie plötzlich die Stimme von Frau Marx und nickte überrascht einem fernen Segelboot zu, auf dem die Therapeutin in ihren Gedanken Platz genommen hatte.
»Du wirst es bereuen«, sagte Conrad, als sie ihm bei einem Abendessen einige Tage später ihren Entschluss mitteilte, was sie aber keine Sekunde glaubte.
Sie hatte nach dem Vorfall mit Clara noch mal das Gespräch mit dem Vater gesucht, hatte ihm gesagt, dass sie bei der Beerdigung nicht dabei sein könne, wenn es bei dem Termin bleibe, worauf er nur mit den Schultern gezuckt hatte.
»Das ist allein deine Entscheidung.«
Paula hatte ohne ein Wort die Wohnung verlassen.
Es war ihm gleichgültig, was sie machte, und war das nicht genauso schlimm wie früher seine Wutanfälle? Früher hatte er sie angebrüllt und kurzerhand aus dem Zimmer geworfen, und jetzt war sie ihm nicht mal das wert.
Sie hätte die Tür hinter sich zuknallen sollen, als sie ging, fiel ihr im Nachhinein ein, aber da war sie längst wieder in Berlin.
Sie trat noch mal ans Grab, die Hände übereinander gefaltet.
Und nein, sie hatte ihre Entscheidung bis heute nicht bereut, es war richtig gewesen, für sich zu handeln, und es war richtig, dass sie endlich aufhörte, es den anderen recht zu machen.
Der Wind wehte die Schläge einer Kirchturmuhr herüber, Zeit zu gehen. Ihr Blick fiel noch einmal auf den Grabstein, wo unter Unvergessen! noch ein weiteres Wort eingraviert war, sehr klein, weshalb es Paula bis zu diesem Moment nicht aufgefallen war.
Kshama stand da noch geschrieben.
Das war natürlich Hindi, aber wieso hatte der Vater ein Wort auf Hindi hinzufügen lassen?
Bislang hatte Paula geglaubt, dass sie in der Familie die Einzige war, die die Sprache halbwegs beherrschte – und nun ausgerechnet Kshama?
Sie wusste, Kshama bedeutete Vergebung. Aber wer sollte da wem Vergebung gewähren?
Clara zufolge hatte die Mutter ihre Beerdigung über Wochen bis ins Kleinste geplant, und demnach wäre es dann wohl sie, die da um Verzeihung bat.
Aber wen? Den Vater? Ihre Kinder? Oder jemand ganz anderen?
Die Kirchglocken verstummten, und Paulas Blick fiel auf ihre Armbanduhr. Sie hatte die Zeit fast vergessen, nun musste sie sich beeilen und kam gerade noch rechtzeitig zu ihrem Termin mit ihren neuen Auftraggebern. Die beiden hatten ein altes Fischerhäuschen gekauft, das nach Paulas Plänen in Kürze renoviert und umgebaut werden sollte. Man kannte sich bislang nur vom Telefon, es gab ein paar erste Entwürfe, aber jetzt sollten Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die beiden erwarteten sie schon, man stellte sich einander vor, wärmte sich ein wenig auf, denn bei Hausangelegenheiten musste man sich vertrauen.
Martin und Bernie, aha.
Letzterer arbeitete als Steward auf Kreuzfahrtschiffen und war mindestens zwanzig Jahre jünger als Martin, der irgendwas beim Theater machte oder gemacht hatte und die ganze Sache finanzierte.
Die neuen Pläne, die Paula als Ausdruck mitgebracht hatte und nun auf dem staubigen Fußboden im Erdgeschoss ausbreitete, würden die beiden hoffentlich überzeugen. Sie beugten sich aufmerksam zu ihr herab, während sie erklärte, wie sie die Essenz des Alten wahren und gleichzeitig nach dem Stand von heute die Bedürfnisse und Wünsche der beiden umsetzen würde.
Im Erdgeschoss sollten alle nicht tragenden Wände herausgenommen werden, damit überall genug Licht reinkam; im hinteren Teil sollte eine amerikanische Küche Platz finden, während der Wohnraum sich nach vorn zur Terrasse hin erstrecken würde.
Nach gut einer Stunde waren sie mit allem durch, und die beiden waren sichtlich angetan.
»Ob wir bis Ostern einziehen können?«, wollte Bernie wissen.
»Im Prinzip ja, wenn der Statiker keine Einwände hat, dann sollte das zu schaffen sein.«
»Dann holen Sie ihn gleich ins Boot«, sagte Martin und überreichte ihr fast feierlich die Schlüssel, worauf die beiden noch einmal lächelten und nickten und dann Händchen haltend durchs Haus gingen.
Paula rollte sorgfältig die Pläne zusammen und blickte ihnen nach. So vertraut war es zwischen Max und ihr auch einmal gewesen, zumindest in den ersten Jahren, aber daran wollte sie jetzt nicht denken.
Er schrieb ihr weiterhin Nachrichten, auf die sie nun schon länger nicht mehr antwortete, weil ihr der Kontakt nicht guttat. Wiederholt schrieb er, dass sie ihm fehle, und gab gleichzeitig drucksend zu, sich weiterhin mit dieser Britta zu treffen, er könne einfach nicht anders.
Na gut, aber sie konnte eben auch nicht anders. Sie hatte genug von dem ganzen Hin und Her, sie musste sich endgültig von ihm lösen, was klang, als wäre das eine Kleinigkeit, dabei waren die Wochen und Monate nach der Trennung mit die schlimmsten ihres Lebens gewesen.
»Vergessen Sie nicht: Sie waren zehn Jahre zusammen, davon verabschiedet man sich nicht so leicht. Vor allem nicht mit Ihrer Geschichte«, hatte ihre Therapeutin, Frau Marx, gleich in der ersten Sitzung gesagt und zur Geduld gemahnt.
Aber Geduldigsein fiel Paula schwer, sie fühlte sich leer und führte zwei grundverschiedene Leben: Nach außen das der Geschäftsfrau, die ihre Dinge so gut es ging regelte, nach Innen das einer Zitternden, die am Rande eines Abgrundes zu balancieren glaubte.
Sie war dankbar für die Struktur, die ihr die Arbeit gab, und sie war dankbar für die professionelle Geduld von Frau Marx, die sie in winzigen Schritten von dem wegführte, was Paula das namenlose Grauen nannte und für das sie keine Erklärung, sondern nur ein diffuses Gefühl hatte.
Als Martin und Bernie sich eine halbe Stunde später verabschiedeten und hinter den Büschen Richtung Straße verschwanden, kehrte Paula noch einmal in das Haus zurück, um zu überlegen, wo der Container aufgestellt werden sollte. Jatzek und seine Crew würden bei der Entkernung und später bei der Renovierung alles den schmalen Gehweg zur Straße hinauf- beziehungsweise hinunterschleppen müssen, deshalb musste jeder Schritt sorgfältig geplant sein.
Sie streifte durch die leeren Räume. Hatte sie in allem die jeweils beste Entscheidung getroffen?
Das Haus hatte einem alten Mann gehört und war, den Tapeten nach zu urteilen, seit mindestens fünfundzwanzig Jahren nicht mehr renoviert worden. Aber es war ein Kleinod, und Paula war fest entschlossen, die ihm innewohnende Schönheit wieder herauszukitzeln.
Sie öffnete die obere Balkontür, genoss die leichte Brise und schaute auf den Fluss und den dahinterliegenden Freihafen. Das Quietschen und Dröhnen der Kräne hallte bis zu ihr herüber, zwei Frachtschiffe zogen gemächlich vorbei und hinterließen in der Sonne weiß glitzernde Wellen.
Was für eine Aussicht!
Vor allem deshalb mussten Martin und Bernie das Haus gekauft haben, denn eigentlich war es zu klein für zwei. Es würde eine Herausforderung sein, so etwas wie Privatsphäre für beide zu schaffen, aber sie hatte zum Glück schon ein paar Ideen.
Wie es wohl wäre, hier zu leben und jeden Morgen den strömenden Fluss zu begrüßen?
Hatte Gesa nicht einmal davon erzählt?
Sie musste als Kind ganz in der Nähe gewohnt haben, jedenfalls schien Paula jetzt, als habe sie damals von Oevelgönne gesprochen.
Ihr Vater war Kapitän gewesen und hatte deshalb bestimmt ein großes Haus aus Stein besessen, wie jene, deren Dächer man zwischen den Baumwipfeln weiter unten am Ufer erkennen konnte – nicht nur so eine bescheidene Kate wie diese hier.
Ja, irgendwo hier in der Nähe hatte Gesa wahrscheinlich gelebt, bevor sie nach Indien gezogen und die Freundin ihrer Mutter geworden war.
Ihre Mutter, ja.
Mit welcher Wucht sie an jenem Nachmittag das Fotoalbum von Indien zugeschlagen hatte!
Diese Welt gibt es nicht mehr!
Dabei waren die beiden Jahre in Kota ein wichtiger Teil ihres und Paulas Leben gewesen, für Paula vielleicht überhaupt der wichtigste, denn dort war sie glücklich gewesen, am Anfang nicht, aber dann umso glücklicher.
Die Mutter hatte bis zuletzt nicht darüber sprechen wollen, warum sie damals die Freundschaft mit Gesa von heute auf morgen beendet hatte.
Oder hatte Gesa sie beendet?
Gesa – in Gedanken zog Paula den Namen in die Länge. Sie hatte Ewigkeiten nicht mehr an sie gedacht, aber jetzt war sie unvermittelt wieder da: Ihre hochgewachsene Gestalt im weißen Sari, ihr aufrechter, wiegender Gang, mit dem sie der Welt stolz entgegengetreten war. Es breitete sich Wehmut und zugleich Wärme in ihr aus, wenn sie so an sie dachte, und vorübergehend wurde sie wieder zu der zwölfjährigen Paula, die sie damals gewesen war.
Sie meinte alles zu sehen – wie sie in einem zu kurzen Baumwollkleidchen über den von roten Betelnuss-Flecken übersäten Asphalt die Raj Bhawan Road hinaufläuft oder besser – hinauffliegt, wie ihre Flipflops dabei klatschen, während sie durch die sonnengefleckten Schatten der alten Banyanbäume geht – hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Klatsch-klatsch-klatsch. Die Engländer hatten sie einst so pflanzen lassen, und sie hatte alles an der Banyanbaumallee geliebt – die von den ausufernden Kronen wie mächtige Taue zu Boden hängenden Wurzeln, die windschiefen, hellblau gestrichenen Teebuden, die sich dazwischen duckten, Licht und Schatten.
Komisch, dass ausgerechnet diese Szene so leuchtend und klar in ihr weiterlebte, obwohl es sich doch nur um den kurzen Weg zwischen dem Haus von Gesa und dem der Familie handelte!
Es war herrlich, sich zu erinnern. Bloß nicht aufhören damit, sagte sie sich und spürte wieder die drückende Hitze, die jeden Winkel der endlos langen Sommertage ausfüllte; sie sah die Rikscha-Fahrer, die seit eh und je bei Tag und Nacht mit einem Glas Tee auf ihren Fahrzeugen vor den Buden lümmelten, hatte noch einmal das Gefühl der Verheißung, mit dem sie das quietschende Tor wieder und wieder geöffnet hatte, um dann auf das weiß getünchte, zweigeschossige Haus der Khandals zuzugehen. Dreißig Jahre waren seitdem vergangen, fast ein halbes Leben, doch der Blick, den sie darauf hatte, war bis heute der einer Zwölfjährigen geblieben.
Eingefrorene Zeit.
Erst in der Abenddämmerung fuhr sie zurück nach Berlin und fühlte sich irgendwie beseelt. Sie hatte Jatzek am Telefon gesagt, dass sie loslegen könnten, am besten schon vorgestern, wie sie hinzufügte, was Jatzek mit einem fröhlichen »Schön, schön, Frau Paula« guthieß.
Freude klopfte leise bei ihr an, und dass sie das wieder spüren konnte, war neu. Jatzek wollte den Container bestellen, und der Statiker würde gleich in den nächsten Tagen kommen; sie hatte wahrlich gute Leute an ihrer Seite, die sie seit Langem kannte und auf die sie sich verlassen konnte. Nach ihrem Weggang von Max Freyhus Architekten hatten sie sich von selbst bei ihr gemeldet und erklärt, sie würden gerne weiter mit ihr arbeiten. Und so war das Häuschen in Ovelgönne schon ihr zweiter Auftrag innerhalb eines halben Jahres. Dank einer Empfehlung gab es eine weitere Anfrage, was hieß, dass sich ihre Selbstständigkeit allmählich herumsprach.
Es hatte Mut gekostet, den Schritt zu wagen, aber sie hatte es keine Minute bereut. Max hatte prophezeit, dass sie angesichts des Überangebots von Architekten kein halbes Jahr durchhalten würde. Er hatte sich getäuscht, dabei waren seine Unkenrufe leicht zu durchschauen gewesen – er hatte nicht nur seine beste Mitarbeiterin verloren, sondern nun zusätzlich eine neue Konkurrentin.
Als sie die Firma gründeten, war Max Freyhus Architekten unter seinem Namen im Handelsregister eingetragen worden, das nötige Kapital hatten seine Eltern zur Verfügung gestellt, aber alles Weitere war von Anfang auch Paulas Geschäft – sie hatte Anträge ausgefüllt, Entwürfe gemacht, die Kalkulation. Nur die Kundengespräche führte er allein, weil er glaubte, ein Auftritt zu zweit könnte potenzielle Auftraggeber verunsichern. Er hatte ihr für irgendeinen Tag X eine Teilhabe in Aussicht gestellt und sie damit bei der Stange gehalten, doch als es zur Trennung kam, war davon nicht mehr die Rede. Er hatte versucht, sie mit einer großzügigen Gehaltserhöhung zu halten, trotzdem blieb sie bei ihrem finanziell riskanten Entschluss, erkämpfte sich eine bescheidene Abfindung, mit der sich immerhin die Bürokosten fürs Erste bestreiten ließen. Sie hatte herausgeholt, was herauszuholen war, hatte Nein gesagt und sich durchgesetzt, was sie in Berufsdingen schon immer gut gekonnt hatte.
Ein Jahr der Umbrüche, der seelischen Berg- und Talfahrten lag nun hinter ihr – erst die Krebsdiagnose der Mutter, dann das Ende der Beziehung mit Max. Sie hatte sich viel vorgemacht, was Max betraf, und begann zu lernen, genauer hinzuschauen und sich zu fragen, was sie eigentlich wollte, nicht nur im Hinblick auf den anderen, sondern für sich selbst.
Sie hatte noch immer keine richtige Antwort darauf gefunden, begann aber zu begreifen, dass sie für das egoistische Gebaren von Max eine Mitverantwortung trug, weil sie es widerspruchslos zugelassen hatte.
Es war ein Versehen gewesen, dass er damals die SMS statt an Britta an sie geschickt hatte; ein dummer Zufall oder ein Freudscher Ausrutscher, für den sie inzwischen fast dankbar war, denn so hatte sie plötzlich die Möglichkeit, auch ihrerseits eine Entscheidung zu treffen und nicht nur unwissendes Opfer zu sein.
Es war bereits dunkel, als sie einen Parkplatz in der Nähe ihrer Wohnung fand. Oben brannte Licht, was hieß, dass ihre Mitbewohnerin Penny zu Hause war.
Paula hatte sich die Wohnung nach dem Auszug von Max nicht leisten können und bei einer Freundin glücklicherweise Penny kennengelernt. Paula mochte die quirlige Britin, die freiberuflich für den Guardian und Timeout schrieb, auf Anhieb, und als die erwähnte, dass sie auf Zimmersuche sei, hatte Paula sie ohne nachzudenken aufgenommen.
Vier Monate war das inzwischen her, und sie hatte ihre Entscheidung keine Sekunde bereut.
Penny erwartete sie bereits mit einer Käse-Platte und einem Glas Rotwein, mit dem sie auf Paulas neuen Auftrag anstießen.
Penny war wie ein Duracell-Häschen von morgens bis abends in Bewegung, rauchte, plapperte gern, nahm Dinge ernst und zugleich nicht, was der eine oder andere gewiss anstrengend fand, aber nicht Paula, für die Pennys fröhlich optimistische Art genau das Richtige war. Penny hörte gut zu, auch jetzt wollte sie alles wissen: Was genau da auf dem Friedhof gewesen war, die Sache mit Paulas Vater und Paulas Schwester, worauf sie plötzlich in Indien landeten, wo Paulas Vater als Entwicklungshelfer gearbeitet hatte. Zum ersten Mal erzählte ihr Paula davon.
»It sounds wonderful. Kota heißt die Stadt? Warum bist du nicht schon längst wieder dort gewesen?«
Das lag leider schon wieder an Max, der sich für Indien nicht im Geringsten interessierte und behauptete, die Armut und das ganze Elend dort nicht ertragen zu können, und außerdem keine Lust hatte, mit irgendeiner schrecklichen Krankheit nach Hause zu kommen.
»Wegen dieses Kerls bist du nicht hin?« Penny mochte es nicht glauben.
»Nicht nur.«
»Aber du warst nie wieder dort?«
»Nein.«
»Dann fahr hin. Jetzt, wo du ihn los bist, kannst du das doch nachholen.«
Paula lächelte und schüttelte den Kopf. »Was soll ich da jetzt noch? Bedenke, dass das alles dreißig Jahre zurückliegt. Eine verdammt lange Zeit. Ich kenne dort niemandem mehr.«
»Das glaube ich nicht. Warst du da nicht auf der Schule?«
Ja, war sie natürlich, aber trotzdem.
Und weil Penny sie immer noch forschend anblickte, stand sie auf und räumte das Geschirr in die Spüle.
»Außerdem kann ich es mir im Moment nicht leisten, irgendwo hinzufahren, weder zeitlich noch finanziell.«
Sie warf ihr ein Handtuch zu.
»Du darfst abtrocknen.«
Später, als sie im Bett lag, ging sie den Tag in Gedanken noch einmal durch.
Es war ein guter Tag gewesen und so wie sie es im Moment am liebsten mochte – ereignisreich und voll, sodass sie kaum Zeit gehabt hatte zu grübeln.
Arbeitstierchen hatte Max sie früher halbwegs liebevoll genannt. Er hatte von Anfang an bewundert, wie hartnäckig sie an Sachen dranblieb, Entwürfe überarbeitete und nochmal überarbeitete, bis sie endlich zufrieden war.
Zugleich war er eifersüchtig. »Deine Arbeit ist dir wichtiger als ich«, hatte er nicht nur einmal zu ihr gesagt, und dass ihm ihr Elan und Ideenreichtum nicht geheuer seien. Aber lag das nicht auch daran, dass er sich nie hatte durchbeißen müssen und schon deshalb weniger Energie besaß?
Am Ende stand er finanziell trotzdem viel besser da als sie, er hatte einfach andere Startbedingungen gehabt. Letztlich war er ein verwöhntes, verzogenes Kind, dem in den Schoß gelegt wurde, was andere sich mühsam erarbeiten mussten. Hatte sein Vater, ein wohlhabender Gynäkologe, Max nicht sogar die ersten Kunden besorgt? Max hatte das ganz normal gefunden, aber das war eben sein Problem und vielleicht der Grund, warum er sich nie richtig über seine Erfolge freuen konnte.
»Beruf Sohn. Den Typus kenn ich«, hatte Penny mal gesagt und damit nicht unrecht gehabt.
Seine Eltern fanden alles großartig, was er tat, und also fanden sie auch seine neue Freundin Paula großartig, ohne sich wirklich weiter für sie zu interessieren.
Max’ Vater, ein hochgewachsener und gut aussehender Mann, trug teure Anzüge und Sakkos und bewegte sich wie Max mit einer lässigen Selbstverständlichkeit, die Blicke auf sich zog – auf der Straße, in Restaurants, wo in Kürze die Kellner an seinen Tisch eilten und nach seinen Wünschen fragten. Er roch förmlich nach Geld und war daran gewöhnt, dass die Dinge nach seinen Vorstellungen liefen, weshalb er schnell beleidigt reagierte, wenn es mal nicht so war und er sich zurückgesetzt fühlte. Eine Eigenschaft, die auch an Max zu bemerken war, dessen Mutter wenig zu sagen hatte und immer lieber nachgab und beschwichtigte, wie Paula es all die Jahre auch bei Max getan hatte.
Ihr gegenüber waren Dr. Freyhus und seine Frau stets großzügig gewesen, schenkten Paula Dinge, die sie sich selbst nie geleistet hätte, und luden sie und Max in teure Restaurants ein. Auch die Kosten für gemeinsame Urlaube übernahmen sie, was für Max ganz selbstverständlich war, für Paula aber nicht. Sie versuchte ihre Großzügigkeit zu erwidern, indem sie für sie kochte und ihrerseits kleine Geschenke machte. Doch nach der Trennung hatte der Vater nur ein einziges Mal angerufen, um sich für Max zu entschuldigen, danach hatten er und seine Frau nie wieder von sich hören lassen.
Erstaunlich, wie schnell man aus dem Leben von Menschen verschwand, die einem über viele Jahre etwas bedeutet hatten, dachte sie, aber darin hatte sie ja Erfahrung.
Trotzdem, war es nicht an der Zeit, das alles endgültig hinter sich zu lassen und zu der abenteuerlustigen Frau zu werden, die doch gewiss irgendwo noch in ihr schlummerte? Auf einmal dachte sie wieder an Gesa, an den Blick vom Balkon in Ovelgönne, der zugleich Fernweh und Aufbruchsgefühle in ihr weckte.
Penny hatte recht, sie musste noch einmal nach Kota zurück und anknüpfen an eine Zeit, in der noch alles offen und voller Geheimnisse gewesen war.
Gesa,MS Mauretania auf dem Weg nach Bombay, Juni 1935
Der schwere faulige Geruch von Überreifem und Vergorenem kündigte die Stadt schon an, bevor sie zu sehen war. Es roch nach Fisch, nach vergammeltem Obst und nach Motoröl. Und der Gestank wurde stärker, je näher das Schiff dem Festland kam.
Bombay – was für ein ehrwürdiger alter Name, dachte Gesa. Sie stand an der Reling, das Gesicht dem Wind zugewandt, trotz des Babys auf ihrem Arm in sehr gerader Haltung.
Sie hatte zur Feier des Tages das grüne Kleid mit den weißen Punkten angezogen, das bei jedem Windstoß ihre Waden umschmeichelte. Schon seit über einer Stunde hielt sie Ausschau, und nun endlich erblickte sie die ersten Konturen, die sich zwischen Himmel und Meer abzeichneten. Mit wachsender Erregung beobachtete sie, wie sie schärfer wurden und schließlich feste Formen annahmen.
Gesa drückte Ashok, ihren Ashok, fest an sich und rieb die Wange an seinem Schopf. Er gluckste und streckte ihr ein Händchen entgegen. Zärtlich küsste sie seine winzigen Finger, froh, dass sie ihn mit an Deck genommen hatte, froh, dass er bei ihr war, denn in den letzten Tagen war eine leise Unruhe in ihr gewachsen. Endgültig, raunte eine Stimme in ihr. Jetzt ist es endgültig. Und wenn schon, gab die andere Stimme zurück, und die Abenteurerin in ihr befahl der Zweiflerin zu schweigen. Gleich würde sie Ravi wiedersehen, und das nach fast einem Jahr!
Ein neuer Lebensabschnitt würde beginnen, dabei hatte das neue Leben in diesem Niemandsland aus Meer und Wolken längst angefangen. Nach und nach war in diesen letzten Wochen auf See ein leises Glückgefühl bei ihr eingezogen. »So-wie-es-ist-ist-es-schön«, hatte das Glück gesagt und: »Ewig-könnte-ich-so-weiterreisen.« Nun aber näherte sich die Reise ihrem Ende. Was Ravi wohl zu Ashok sagen wurde? Und zu ihr?
Sie versuchte sich an sein Gesicht zu erinnern und stellte fest, dass ihre Erinnerung dem Foto ähnelte, das sie zum Abschied hatten machen lassen. Sein Gesicht halb dem Betrachter zugewandt, halb im Schatten, die Hand zwischen die Knöpfe der Jacke mit dem Stehkragen geschoben, der Blick stolz und ernst. Sie waren dafür extra zu einem Fotostudio in der Bleibtreustraße gefahren. Den Abzug hatte Gesa später entzweigerissen und Ravi die Hälfte mit ihr darauf in die Hand gedrückt; die andere Hälfte hatte sie eingesteckt.
»Wenn wir uns wiedersehen, fügen wir sie wieder zusammen«, sagte sie damals, was Ravis Freund Aziz ebenso schön wie richtig fand, und anschließend bestand er darauf, den Fotografen zu bezahlen.
»Mein kleines Abschiedsgeschenk an euch zwei Turteltauben und als Erinnerung an unsere wunderbaren Tage in Berlin.« Er saß in jenen Tagen schon auf gepackten Koffern, während Ravi noch ein bisschen bleiben würde.
Gesa lächelte, wenn sie an die Szene zurückdachte. Sie waren noch in ihr Stammlokal, das Hindustan House in der Uhlandstraße, gegangen, wo es immer so herrlich nach exotischen Gewürzen duftete. Nachdem sie Ravi kennenlernte, hatte sie dort zum ersten Mal indische Gerichte gekostet und war begeistert gewesen. Außerdem bekam sie Einblicke in eine ihr unbekannte Welt, denn Aziz’ Freunde, die sich dort regelmäßig trafen, waren alle Mitglieder der indischen Unabhängigkeitsbewegung.
Sie hatten einen eigenen Tisch im Hinterzimmer, der nur für sie reserviert war. Gesa gegenüber gaben sie sich anfangs zurückhaltend, doch Aziz sorgte schnell dafür, dass die Männer sie Bibi nannten, was jüngere Schwester bedeutete, und sie als solche akzeptierten; und weil Gesa so aufmerksam zuhörte und ganz bestimmt kein Spitzel war, war das Eis bald gebrochen. Bei Dals und Currys erfuhr sie vom Kampf gegen die englischen Besatzer, von denen die Inder im eigenen Land wie Menschen zweiter Klasse behandelt wurden, und sie war überrascht zu hören, dass die Unabhängigkeitsbewegung bis vor Kurzem sogar von der deutschen Regierung unterstützt wurde.
Fasziniert lauschte sie den heftigen Diskussionen über die richtigen Kampfmethoden, friedliche und weniger friedliche, hörte zum ersten Mal den Namen Gandhi, dessen Anhänger friedlich demonstrierten und trotzdem im Gefängnis landeten.
Manchmal verfielen die Männer im Eifer in ihre Heimatsprache, Hindi oder Punjabi, deren fremden, mal singenden, mal harten Klängen sie neugierig lauschte. Aziz hatte ihr erzählt, dass es in Indien über hundertzwanzig Sprachen gab und fast zwanzigtausend Dialekte.
»Aber warum sprecht ihr dann Englisch miteinander? Du hast doch selbst gesagt, das sei die Sprache der Kolonialherren.«
»Da hast du einen wunden Punkt getroffen,«, hatte Aziz lachend erwidert. »Aber es ist die einzige Sprache, die alle verstehen. Und außerdem gibt es so keinen Streit darüber, welche Sprache die Hauptsprache in unserem Land sein soll.«
Berlin-Bombay, wer hätte das je für möglich gehalten?
Gesa schaute über die Wellen und dachte an ihre letzten gemeinsamen Wochen mit Ravi, an die sie jetzt endlich anknüpfen würde, dabei waren sie ein großes Durcheinander gewesen, überschattet von ihrer Furcht, ihn nie wiederzusehen – bis dann alles plötzlich ganz anders gekommen war. Komisch, wie doch die Dinge von einem Augenblick auf den nächsten aus den Fugen geraten konnten. Für eine Weile floss das Leben träge dahin, und dann, von einem Moment auf den anderen, wurden die Weichen ganz neu gestellt – so wie sie es sich insgeheim gewünscht hatte.
Denn wann immer Ravi sein märchenhaftes Land beschrieb, sehnte sie sich sofort dorthin – weg von den grauen, feuchten Wintern in Berlin oder Hamburg, weg von der Eintönigkeit ihres Alltags, den sie sich ohne ihn gar nicht mehr vorstellen wollte.
In Berlin war sie ja überhaupt nur gewesen, weil sie sich um eine alleinstehende Tante kümmerte, die sich wegen ihrer Schmerzen in der Hüfte kaum noch bewegen konnte. Aber was, dachte sie damals, wenn die Schmerzen verschwänden und sie keinen Vorwand mehr hätte, weiter in Berlin bei Ravi zu bleiben?
Noch während sie nach einem Ausweg sann, war sie plötzlich schwanger geworden – die Schicksalsgöttinnen oder wer immer, hatten sie erhört, wenn auch ganz anders, als sie es sich ausgemalt hatte.
Es war Friedel, die Haushälterin, gewesen, die es bei einem Besuch in Ovelgönne herausfand.
Gesa hatte vorgehabt, nur ein paar Tage nach Hause zurückzukehren, um Friedels Geburtstag mit ihr zu feiern. Sie war seit vier Monaten nicht mehr dort gewesen, und Friedel, die sich über ihren Besuch freute, hatte gleich angeboten, zwei Winterkleider von Gesa auszubessern.
Und dann war es geschehen – Friedel hatte soeben den ausgelassenen Saum von einem Kleid abgesteckt, da stutzte sie. Gesa würde den Moment nie vergessen. Ein lauer Wind hatte die Vorhänge im Zimmer gebauscht, und die alte Haushälterin kniete vor ihr, mit Stecknadeln zwischen den Lippen, aufgereiht wie komische, bunte Zähne. Plötzlich aber hielt sie inne, strich mit der Hand prüfend über Gesas Bauch und hob ihr Kleid an. Das war für Gesa so unerwartet, dass sie verblüfft einen Schritt zurückwich. Dann sah sie den vor Entsetzen geweiteten Blick von Friedel.
Anfangs begriff sie überhaupt nichts, außer dass Friedel ganz blass geworden war. Ihre Hände zitterten, als sie Gesa an den Schultern packte.
»Was hast du getan, Kind?«
»Was denn getan?«
»Wer war das?«
Und weil Gesa noch immer nicht begriff: »Du bist schwanger, verdammt noch mal, weißt du, was das bedeutet?«
Gesa hatte keine Ahnung, was das hieß, so wie sie von all diesen Dingen keine Ahnung gehabt hatte, denn es hatte ihr niemand je etwas erklärt oder erzählt. Doch nun verstand sie, warum sich ihr Körper in letzter Zeit verändert hatte.
Die Haushälterin hatte sofort Gesas ältere Geschwister Nils und Inken einbestellt, wodurch alles nur noch schlimmer wurde. Es sei ein Skandal, brüllte Nils, als sie irgendwann von Ravi erzählte, und eine große Schande für die Familie. Ein Kind von einem Schwarzen!
Er bestand darauf, dass sie in ein Entbindungsheim im Harz fuhr, um dort ihren Bastard zu bekommen und ihn anschließend zur Adoption freizugeben. Auch Inken war außer sich. Gesa brächte nur Unheil über die Familie, erst der Tod der Mutter und nun das.
Im ersten Moment verstand Gesa die Worte der Schwester nicht, aber dann doch: Weil die Mutter bei ihrer Geburt gestorben war, trug sie die Schuld daran, dass sie keine Familie mehr waren. Der Vater war nach ihrer Geburt immer seltener nach Hause gekommen – höchstens ein paar Tage über Weihnachten, was früher, als die Mutter noch lebte, angeblich ganz anders gewesen war.
»Das Haus erinnert ihn zu sehr an sie«, hatte Friedel einmal erklärt und ihr behutsam über den Kopf gestrichen, als sie als Kind nachfragte, warum sie ihn so selten zu sehen bekam.
Auch Nils und Inken kamen kaum zu Besuch. Sie waren um einiges älter als Gesa und wollten und konnten sich um die kleine Schwester nicht kümmern, dafür war im Auftrag des Vaters Friedel zuständig.
Als kleines Mädchen hatte Gesa über Familie nicht nachgedacht; die Dinge waren, wie sie eben waren. Erst mit zwölf im Internat begann sie zu begreifen, dass sie anders als alle anderen keine Familie hatte und nie haben würde. Wenn die Mädchen mit ihren Eltern und Geschwistern zusammensaßen, beobachtete sie sie neugierig und fragte sich manchmal, wie es wohl wäre, so wie sie zu leben. Nun endlich würde auch sie mit Ashok und Ravi eine eigene Familie haben, und das schon in ein paar wenigen Stunden.
Das dachte sie.
Sie hielt sich mit einer Hand an der Reling fest, während der Monsunwind die grauen Wellen um sie herum immer heftiger aufwühlte.
Wie es wohl zwischen ihr und Ravi sein würde?
Seit seiner Abreise im vorletzten Winter hatte sich in Deutschland vieles verändert. Die Aufmärsche der Nazis, ihre Fackelzüge und hässlichen Parolen waren Teil des Alltags geworden, und mit Sorge hatten sie und Friedel beobachtet, wie von Tag zu Tag alles schlimmer wurde. Studenten hatten in aller Öffentlichkeit Bücher von Gesas Lieblingsautoren verbrannt, in den Zeitungen wurde gegen Juden gehetzt, während immer mehr Leute in Hitlers Partei eintraten, auch ihr Bruder Nils, der sie mit Eiseskälte wissen ließ, dass sie in Deutschland mit einem schwarzen Kind eh nichts zu suchen habe.
Und jetzt war sie fast am Ziel und wusste zugleich, dass sie seit jenem schicksalhaften Nachmittag im Sommer 1934 alles richtig gemacht hatte. Obwohl sie nach Friedels hässlichen Worten völlig durcheinander gewesen war, hatte sie gleich bei Aziz, der ein Telefon besaß, angerufen und ihm gesagt, sie müsse baldmöglichst mit Ravi sprechen, es sei dringend.
Noch während sie auf seinen Rückruf wartete, hatte sie einen Entschluss gefasst. Die Leitung knackte und rauschte, als er sich endlich meldete, und als sie erzählte, was geschehen war und was sie tun würde, musste sie das eine oder andere wiederholen, weil er nicht verstand oder glaubte, nicht zu verstehen.
»Bist du sicher? Was sagt deine Familie?« Seine Stimme hatte leicht gezittert. »Du … du bist doch erst sechzehn. Dein Leben fängt gerade erst an, und ich muss in ein paar Wochen zurück.«
»Ja, ich bin sicher.« Ihre Stimme war fest. »Also, wenn du mich willst … dann gehe ich mit dir nach Indien …«
»Ich dich wollen? Natürlich will ich dich!« Sie merkte, dass er vor allem überrascht war; richtig überzeugt hatte er nicht geklungen.
An jenem Abend betrank er sich mit seinem Freund Aziz, wie er ihr später erzählte, rief zu später Stunde ein zweites Mal an und fragte, ob sie wirklich ganz, ganz sicher sei.
»Ja, ganz sicher.«
Was gab es denn schon, das sie in Deutschland hielt?
Nichts.
Sie würde den herrlichen Blick auf die Elbe vermissen, aber das war’s dann schon, erklärte sie ihm.
Als sie ihrem Vater telegrafierte, der irgendwo vor der Ostküste Afrikas mit seinem Frachter ankerte, und um sein Einverständnis zur Hochzeit bat, erhob er keine Einwände.
Dem Vater sei seit dem Tod der Mutter sowieso alles egal, war Inkens einziger Kommentar dazu, also sei es auch keine Überraschung, wenn er sich nicht darum scherte, dass sich seine Tochter von einem dahergelaufenen Bananenfresser hatte ein Kind machen lassen, was Rassenschande war.
Drei Wochen später fuhr Gesa zurück nach Berlin, wo in der indischen Botschaft die Trauung stattfinden sollte, zu der von der Familie niemand kam. Allein Friedel in ihrem besten Sonntagskleid und dem übergroßen Hut mit den blauen Stoffblumen wollte sie begleiten, Ravi kam mit Aziz.
Gesas Finger zitterten, als sie dem Beamten die Papiere und das Telegramm ihres Vaters reichte und stockend erklärte, dass ihre Mutter nicht mehr am Leben sei und Friedel ihre Stelle vertrete.
Der Beamte warf einen kurzen Blick auf Gesas Bauch, der sich schon wölbte, und begann, ohne weitere Fragen zu stellen, mit der Trauung. Zu viert gingen sie danach in ein Lokal um die Ecke und stießen auf eine glückliche Zukunft an.
Ein paar Wochen später bezog Ravi ein Hotel in der Nähe des Hamburger Hafens, von wo aus er in See stechen würde. Aziz, der bereits auf dem Weg nach Indien war, hatte eine Flasche Champagner für sie dagelassen, und Gesa und Ravi hatten im Hotelzimmerbett damit angestoßen.
Der Alkohol machte sie leicht und schwebend, und in diesem Zustand begleitete sie Ravi zum Passagierschiffshafen, wo sein Dampfschiff schon Rauchschwaden ausstieß. Die widerstreitenden Gefühle, die sie noch wenige Tage zuvor beunruhigt hatten, waren jetzt, da sie an seiner Seite dahinging, verschwunden. Sie hatten sich im Hotel zum Abschied noch einmal geliebt, das war tröstlich gewesen, auch wenn es den Abschied nicht leichter machte.
Als sie die Gangway erreichten, hätte sie ihn gerne noch einmal geküsst, wagte es jedoch nicht, weil ihnen bereits neugierige Blicke zugeworfen wurden, außerdem war Ravi, der von Natur aus eher schüchtern war, jegliche öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung unangenehm.
»Schreib mir«, sagte sie. »Ich will alles über dein Leben in Kota wissen, damit ich mir vorstellen kann, wie es sein wird.«
»Ja, natürlich.« Seine Augen blickten sanft und voller Wärme. »Ich hole euch dann beide in Bombay ab. Du wirst sehen, es wird alles gut.«
Und dann war er fort.
In den darauffolgenden Monaten war Gesa vor allem damit beschäftigt, sehnsüchtig auf seine Briefe zu warten, die auch regelmäßig eintrafen, tatsächlich schrieb er jede Woche.
Friedel hatte von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass sie ihren Entschluss für töricht hielt und Gesa für dickköpfig.
»Was weißt du überhaupt von ihm und seinem Leben dort in diesem Indien?«, fragte sie missmutig, wenn sie Gesa dabei ertappte, wie sie fleißig englische Vokabeln mit einem alten Schulbuch lernte. »Nur das, was er dir erzählt.«
»Du willst doch bloß, dass ich für immer hierbleibe«, gab sie zurück, und erst, als Friedel sich abwandte, fügte sie entschuldigend hinzu: »Aber er ist doch nun mal mein Mann, und wir bekommen ein Kind. Was soll ich denn tun?«
Worauf Friedel ratlos die Schultern zuckte.
Die Geburt war das Schmerzhafteste, das sie je erlebt hatte. Bei den ersten Wehen versuchte sie an Ravi zu denken – an sein Lächeln, seine Augen, sein schönes Gesicht und seine weichen Hände. Nur seinetwegen ertrug sie das alles.
Doch irgendwann überrollten sie die Wehen in immer kürzeren Abständen, sie spürte nur noch Friedels Finger, hörte ihre beruhigende Stimme, und als sie schon dachte, der Schmerz würde sie zerreißen, war es fast schon vorbei. Eine halbe Ewigkeit später hielt sie ihren Sohn im Arm, berührte seine Wangen, die winzigen Finger und war der glücklichste Mensch auf der Welt.
Sie schickte Ravi ein Telegramm. Es ist ein wunderschöner Junge, schrieb sie, und Ravi telegrafierte umgehend zurück, dass sie ihn Ashok nennen solle. Den Geschwistern schrieb sie ebenfalls, rechnete aber nicht mit einer Antwort.
Ravis Brief, der seinem Telegramm folgte und erst vier Wochen später eintraf, war voller Vorfreude auf sie und das Kind.
Er schrieb von einem großen Fluss, an dem ein Staudamm entstehen würde, an dem er mitarbeitete; von den Affen im Baum vor seinem Bürofenster, die ihm das Essen stahlen, wenn er es auf dem Sims stehen ließ, und er schrieb von Holi, dem bevorstehenden Frühlingsfest, in dem sich die Menschen mit bunten Farben bewarfen. Ravi konnte wunderbar erzählen, und Gesa konnte es kaum erwarten, all das, was so fremd und verheißungsvoll klang, mit eigenen Augen zu sehen. Doch sie musste sich gedulden, denn Friedel hatte darauf bestanden, dass Ashok die weite Reise erst antrat, wenn er kräftig genug war, um mit den Keimen in Indien fertigzuwerden.
»Die Kindersterblichkeit ist dort sehr hoch«, mahnte sie, und Gesa fragte sich, ob Friedel den Vorwand nur nutzte, um sie noch ein wenig länger bei sich zu behalten, denn auch Friedel hatte längst ihr Herz an den kleinen Ashok verloren, und so widersprach sie nicht und brach erst ein gutes halbes Jahr später auf.
Friedel begleitete sie nach Bremerhaven und schwieg fast die ganze Bahnfahrt über. Dabei wusste auch sie, dass es so besser war. Die Stimmung im Land hatte sich immer weiter aufgeheizt, sogar im Radio wurde der Ruf nach der reinen deutschen Rasse verkündet. Wie sollte es da eine Zukunft für Ashok geben?
Als sie sich am Pier verabschiedeten, küsste Friedel das Baby auf die Stirn und umarmte Gesa so fest, dass kein Zweifel mehr bestand, dass sie sie beide am liebsten dabehalten hätte. Friedel zeigte selten Gefühle, aber jetzt liefen ihr Tränen über die Wangen. Sie bat um Post, darum, dass Gesa ja gut auf sich und Ashok aufpasse, und ließ ihre Hand kaum los, als sie die Gangway hochging.
Noch als das Schiff längst abgelegt hatte, sah Gesa die schmale, dunkle Gestalt am Kai stehen. Sogar im Sommer trug sie gedeckte Farben. Das graue Haar straff zum Dutt gebunden, blickte sie reglos dem Schiff nach.
Während ihre Gestalt immer kleiner wurde, dachte Gesa, wie schade es doch war, dass sie Friedel noch nie in bunten Kleidern gesehen hatte, und auf einmal hatte sie einen Kloß im Hals. Sie hatte die längste Zeit geglaubt, Friedel kümmere sich vor allem aus Geldgründen um sie, aber darin hatte sie sich getäuscht und bereute, dass sie das erst jetzt, im Moment ihres Abschiedes, erkannte.
Fräulein Schweizer, eine Bekannte von Friedel, die in Südindien eine Missionsschule leiten würde, teilte auf der Reise die Kabine mit ihr und half mit Ashok.
»Eine feine Christin. Und oh, sie hängt so an Ihnen«, sagte sie, wenn sie von Friedel sprachen, und ließ keine Gelegenheit aus, sie in den höchsten Tönen zu loben. Gesa hatte jedes Mal Schuldgefühle und fragte sich, was Fräulein Schweizer damit bezweckte. Hätte sie Friedel bitten sollen, mit nach Indien zu kommen? Aber nein, sie hätte abgelehnt, und Gesa hätte sie in ihrer neu gewonnenen Freiheit nicht dabeihaben wollen.
Von ihrem Vater, der zurzeit wegen Schiffsreparaturen in Windhoek vor Anker lag, hatte sie sich mit einem Brief verabschiedet. Er hatte sofort telegrafiert und ihr alles Gute für ihr neues Leben gewünscht, fragte sogar nach dem Namen der Stadt, in die sie ziehen würde, und schloss »mit den allerbesten Grüßen und Wünschen von Deinem Vater.«
Ravi,Bombay, Juni 1935, am selben Tag
Ravi hatte kaum geschlafen. Der Nachtzug war sehr voll gewesen, aber das war nicht der Hauptgrund, denn natürlich fragte er sich, wie alles wohl werden würde, wenn er Gesa erst mal nach Hause brachte, von allen anderen Dingen, die zu regeln waren, ganz zu schweigen.
Gleich nach seiner Ankunft am Morgen hatte er das Hotel gebucht, das ihm Aziz empfohlen hatte. Es war sauber, preiswert und lag in der Nähe des Bahnhofs.
Danach ging er auf den Basar und kaufte für Gesa und das Kind ein: für Ashok ein winziges Kurta-Hemd und Hosen, alles in Weiß, und für Gesa Saris in verschiedenen Farben, die ihren blassen Teint zur Geltung bringen würden, dazu Unterröcke und Blusen.
Es fühlte sich ein bisschen seltsam an, als einziger Mann zwischen lauter Müttern auf Kissen zu hocken, die die Mitgift ihrer Töchter zusammenstellten und darauf warteten, dass der Verkäufer bunt leuchtende Stoffe vor ihnen ausbreitete, mit denen sie selten auf Anhieb einverstanden waren.
Als er zum Hotel zurückkehrte, hatte er noch zwei Stunden. Er rasierte sich, kämmte die Haare mit Kokospomade zurück und zog eines der blütenweißen, gestärkten Kurtas mit Stehkragen an, die seine Frau vor der Abreise hatte bügeln lassen.
Doch an Madhavi wollte er jetzt lieber nicht denken. Sie hatte ihn kaum angeschaut, als er sich verabschiedete, sondern sich der Sitte folgend vor ihm niedergekniet und seine Füße berührt. Schon in der Morgendämmerung hatte er den stechenden Duft von Weihrauch gerochen, als er auf dem Weg zum Bad an ihrem Zimmer vorbeiging, hatte ihr einförmiges Gemurmel gehört, mit dem sie bei den Göttern seine sichere Heimkehr erbat, was er alles nicht wollte.
Ob sie ahnte, warum er nach Bombay gefahren war? Erzählt hatte er es nur den Eltern, die ihn zur Ehe mit ihr gezwungen hatten, um eben das zu verhindern, was ihm nun mit Gesa geschehen war.
Er würde noch ein wenig die Augen schließen und seine Gedanken schweifen lassen, bevor er sich zum Hafen aufmachte, streckte sich auf dem Bett aus, wobei er penibel darauf achtete, Hemd und Hose nicht zu zerknittern.
Dass er eines Tages hier in Bombay auf seine deutsche Frau warten würde, hätte er sich vor fünf Jahren nicht träumen lassen. Er lächelte versonnen, der Deckenventilator fächelte ihm eine angenehme Brise zu, und er schloss die Augen. Komisch, auf welch undurchschaubare Wege einen das Schicksal führte.
Er dachte an seinen letzten Schultag, an dem er zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen hatte, aus der dann alles Weitere folgte.
Er war völlig ahnungslos gewesen, als er wenige Tage nach dem Abschlussexamen an der SaintAnthony School For Boys in das Büro von Pater Francis gerufen wurde. Noch heute konnte er es kaum glauben: Er hatte von allen Schülern die höchste Punktzahl erreicht, weshalb ihm der Maharadscha von Kota ein vierjähriges Stipendium in Deutschland anbot.
»Es ist eine große Anerkennung für uns alle«, hatte Pater Francis dem zitternden Ravi erklärt, der in respektvoller Habachtstellung die Fersen aneinanderschlug, die Arme steif an den Körper drückte und sich fragte, ob er sich vielleicht verhört hatte.
Alles, selbst die Schiffspassage, würde der Fürst bezahlen und ihm nach abgeschlossenem Studium eine Anstellung garantieren, fuhr der Pater fort.
»Die einzige Bedingung ist, dass du in Berlin an der Königlich-Technischen Hochschule Ingenieurswissenschaften studierst und dich verpflichtest, am großen Staudammprojekt mitzuarbeiten.«
Ravi senkte bescheiden den Kopf.
»Yes, Sir«, murmelte er mit leuchtenden Augen. Vom Staudamm-Projekt, dem neusten Steckenpferd des Maharadschas, hatte man in Kota schon gehört, und von der Ingenieurskunst der Deutschen auch.
Seine Eltern nahmen die Neuigkeiten mit gemischten Gefühlen auf. Einerseits bedeutete das Stipendium, dass ihr Sohn für einige Jahre ins Land der Unreinen zog, andererseits fiel der Glanz dieser Auszeichnung auch auf sie, mal abgesehen davon, dass man das großzügige Geschenk des Fürsten unmöglich ausschlagen konnte, denn das wäre einer Majestätsbeleidigung gleichgekommen.
Und so war Ravis Vater noch am selben Tag in Pater Francis’ Büro erschienen, um das Angebot offiziell anzunehmen.
Ravi glaubte auf Wolke sieben zu schweben. Neben den Priestern war der Maharadscha den Göttern bekanntlich am allernächsten, und nun hatte er von seinen Höhen hinabgeblickt und ihn, Ravi, auserwählt.
War das zu glauben?
Wie alle Einwohner Kotas hatte Ravi den Fürsten bislang nur aus der Ferne sehen dürfen – wenn er zu öffentlichen Zeremonien oder zu religiösen Feiern auf seiner Elefantenkuh durch die Stadt ritt oder mit seinem dunkelgrünen Rolls-Royce mit Goldapplikationen zur Jagd fuhr.
Sein Bildnis – immer das gleiche – hing in sämtlichen Geschäften neben denen der tanzenden Götter und Göttinnen und lächelte einem huldvoll zwischen Obst und Gemüse, Waschpulver und Darmreinigungsmitteln zu. In jeder Schule, jedem Postamt, dem örtlichen Krankenhaus, wo Ravis Vater als Arzt praktizierte, und in allen Behörden wachte er über seine Untertanen, weshalb ihn jeder zu kennen glaubte, ohne ihm je begegnet zu sein.
Sein goldgerahmtes Bild hing auch in Ravis Klassenzimmer, und er hatte jede Menge Gelegenheiten gehabt, sein Antlitz zu studieren.
Der Fürst besaß die edel gebogene Nase und die geschwungenen Augenbrauen eines Rajput-Prinzen, trug eine reich bestickte goldene Jacke, einen prächtigen silbernen Turban, der von einem Smaragd und einer Pfauenfeder gekrönt wurde, dazu einen mächtigen Schnauzbart, der an den Enden nach oben gezwirbelt war.
Gütig und unnahbar blickte er auf seine Untertanen. Er war der Vater aller Väter, jemand, der nie alterte, sondern immer der Gleiche wie auf dem Farbdruck in Ravis Klassenzimmer blieb, für alle Ewigkeit vierzig Jahre alt.
Seit den großen Neuigkeiten sprach man im Hause Khandal über den Maharadscha Kota wie über einen besonders liebenswürdigen Onkel, und Mrs. Khandal sorgte dafür, dass die ganze Nachbarschaft in der Raj Bhawan Road in Kürze davon erfuhr, den Fahrer Krishna und zwei Dienerinnen, die vor Stolz platzten, eingeschlossen.
»Ich wusste immer, dass aus dir etwas ganz Besonderes wird!«, rief seine alte Amme Lakshmi-Bhai bei jeder Gelegenheit und drückte ihm den nächsten Kuss auf die Schläfe.
Ravi freute sich über so viel Aufmerksamkeit, zugleich machte sie ihn verlegen, zumal er das Ganze fürs Erste gar nicht richtig glauben konnte.
Was, wenn jemand sich verrechnet hatte und die Wahrheit irgendwann aufflog?
Er hatte die letzten Schuljahre meist im Zimmer seiner Mutter verbracht, wo sie ihn mit Ladhu seinen Lieblingssüßigkeiten, versorgte, während er für die Prüfungen büffelte. Nie wäre er auf die Idee gekommen, etwas anderes zu wollen als das, was andere, vor allem die Eltern, von ihm verlangten. Er war ein höflicher, stiller Junge, der selten aufgefallen war; nun aber zog er neugierige Blicke auf sich, wenn er den kurzen Weg zum Betelnuss-Geschäft zurücklegte.
Dass der Allerhöchste ihn für seinen Fleiß und Lerneifer belohnt hatte, sprach sich bald auch unter den Müttern und Tanten heiratswilliger Mädchen herum, mit dem Ergebnis, dass sich alle um eine Einladung zu einem Teekränzchen bei Mrs. Khandal bemühten, die die unverhoffte Prominenz ihres Sohnes sichtlich genoss.
Die Eltern hatten eine einzige Bedingung an die Annahme des Stipendiums geknüpft: Ravi musste heiraten, bevor er ins Land der Unreinen aufbrach, um so den Versuchungen zu widerstehen, denen ein junger Mann dort ausgeliefert sein würde.
Und Ravi stimmte zu – schließlich winkten vier Jahre Europa als Belohnung, was aus seiner Sicht eine Glück verheißende Ewigkeit war! Außerdem würde er als verheirateter Mann endlich jene unaussprechlichen Erfahrungen machen dürfen, die ihm bislang verwehrt gewesen waren.
Einer seiner Schulfreunde hatte manchmal Hefte mit Fotos amerikanischer Schauspielerinnen in die Schule geschmuggelt. Für fünf Paisa durften Ravi und seine Freunde in den Pausen einen kurzen Blick auf die halb nackten Schönheiten werfen. Als ein Pater Wind davon bekam, wurde der Freund von heute auf morgen suspendiert und alle anderen noch einmal eindringlich vor gewissen Tätigkeiten gewarnt, die angeblich nicht nur wahnsinnig, sondern auch debil machten, was Ravi eine Reihe von Albträumen bescherte.
Aber jetzt würde er ja heiraten; die Suche nach einer passenden Braut hatte schon begonnen, eine Suche, die in den Händen seiner Eltern lag – bei Tee und Gebäck wurden die infrage kommenden Kandidatinnen vorgestellt; ihre Zahl war in einer Kleinstadt wie Kota zwar begrenzt, was jedoch nicht hieß, dass die Eltern nicht die Richtige fanden: Ihre Wahl fiel auf ein Mädchen aus der Nachbarstadt, das zwar knapp vier Jahre älter war als er, mit zweiundzwanzig aber gerade noch im heiratsfähigen Alter.
Sie stammte, und das war Bedingung, aus der gleichen Kaste, einer guten Brahmanen-Familie, und seine Eltern scheuten keine Kosten, um beider Horoskope vom Hofastrologen des Maharadschas berechnen zu lassen.
Da die Konstellationen der Sterne passten, einigten sich die Familien in kürzester Zeit auf die Mitgift und einen Termin, und so wurde wenige Tage vor Ravis Abreise mit zweihundert geladenen Gästen Hochzeit gefeiert.
Bei der siebenmaligen Umrundung des Feuers bekam er seine Braut zum ersten Mal zu sehen, und ihre weichen Formen gefielen ihm. Das Gesicht, das hinter einem Schleier verborgen war, sah er erst in der Hochzeitsnacht, als er das gemeinsame Schlafzimmer in seinem Elternhaus betrat.
Madhavi.
Ihr dichtes Haar war wie eine schwarze Sonne auf dem Kissen ausgebreitet gewesen, daran erinnerte er sich noch, und daran, wie sie in ihrem roten Hochzeitssari stocksteif auf dem Bett lag, den Blick starr zur Decke gerichtet.
Ravi, der sich anderes erhofft hatte, versuchte, mit ihr zu reden, und hob irgendwann vorsichtig ihren Rock an. Schließlich war es die einzige Nacht, die sie miteinander vor seiner Abreise haben würden, doch sie fing so heftig zu weinen an, dass er von ihr abließ.
Nach seiner Rückkehr aus Deutschland hatte sich Madhavi weniger abweisend gezeigt, sondern lud ihn im Gegenteil immer wieder in ihr Zimmer ein, nur war jetzt sein Interesse an ihr erloschen. Morgens, wenn er aus seinem Raum trat, fing sein Vater ihn ab und fragte, warum er seinen ehelichen Pflichten nicht nachkam, und ermahnte ihn dazu.
Auch die Mutter jammerte: »Soll ich ohne Enkelsohn sterben?«
Zu diesem Zeitpunkt hatte er von Gesa noch mit keinem Wort erzählt, er hatte einfach den Mut nicht gehabt und war, obwohl er sich wie ein Verräter fühlte, Madhavis Einladungen ein paarmal halbherzig gefolgt.
Unterdessen zählte er heimlich die Tage bis zu Gesas Ankunft, schrieb ihr in den Abendstunden am Schreibtisch seines Büros lange bunt schillernde Briefe und sehnte sich; dabei stellte er sich vor, wie sie im verregneten Hamburg am Fenster mit Blick auf die Elbe seine Liebeserklärungen las. Von dem Projekt, die rote Wüste unterhalb der Stadt fruchtbar zu machen, hatte er ihr schon berichtet und nicht verschwiegen, welch große Aufgabe das auch für ihn bedeutete, denn damit die Wüste keine Wüste mehr war, musste zuerst der Fluss umgeleitet werden, und das erforderte umfangreiche Berechnungen, für die niemand anders als er zuständig sei. Allerdings verschwieg er, dass er nur einer von fünfzehn Ingenieuren war und seine Aufgabe vor allem darin bestand, das bereits Errechnete zu überprüfen.
Er beschrieb, wie er Tag für Tag zum Fluss mit den im Wasser treibenden Sumpfkrokodilen ritt, um dort die Vorbereitungen für den Bau zu überwachen; er schrieb, wie der Maharadscha von Zeit zu Zeit auf seiner Elefantenkuh Sati in Begleitung seines Hofstaats vorbeikam, um sich über die Baufortschritte zu erkundigen.
Er schrieb ihr nicht, dass er hauptsächlich im Büro saß und den Maharadscha seit seiner Rückkehr aus Deutschland nur einmal aus weiter Ferne erblickt hatte, als ihm der oberste Ingenieur die von Ravi gebrachten Pläne und Berechnungen zeigte.
Stattdessen schrieb er: »Du wirst ihn kennenlernen. Er ist sehr offen für alles Moderne, vor allem, wenn es aus Europa kommt. Ich habe auch die Bekanntschaft des British Residents Mr. Goodroy gemacht. Er wohnt mit seiner Frau im Raj Bhawan, das nur einen Steinwurf entfernt am Ende unserer Straße liegt. Er war sehr zuvorkommend. Ich denke, du wirst sie beide mögen. Seine Frau soll eine echte Dame von Welt sein, die den Vizekönig persönlich kennt.«
Was er nicht schrieb, war, dass er die Goodroys nur einmal in ihrem Automobil hatte vorbeifahren sehen, bevor sie durch die Tore des Raj Bhawan verschwanden; der Maharadscha hatte ihnen nämlich den kleinen Palast am Fluss zur Verfügung gestellt, der diskret hinter hohen Mauern und einer von Buschwerk und Bäumen gesäumten Allee verborgen lag.
Natürlich schrieb er auch nicht von der Reaktion seiner Eltern, als er ihnen – ein halbes Jahr nach Ashoks Geburt – von seiner deutschen Frau erzählte. Wie er befürchtet hatte, waren beide außer sich gewesen.
Seine Mutter war in Tränen ausgebrochen. »Beta, was hast du uns nur angetan!«
Sein Vater hatte sich erhoben und scharf mit dem Gehstock gegen das Tischbein geschlagen.
»Willst du deine Eltern ins Grab bringen? Nach allem, was