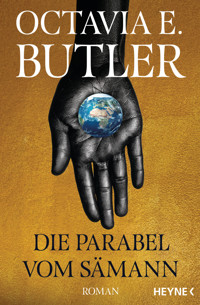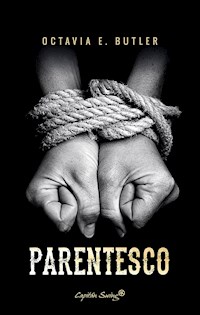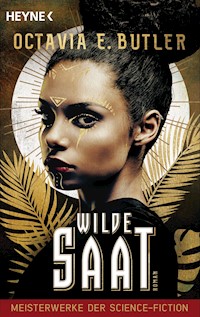
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Doro ist ein Unsterblicher, der seit der Zeit der Pharaonen auf unserer Welt ist. Er beherrscht die Fähigkeit, menschliche Körper zu übernehmen, so meisterhaft, dass er nicht getötet werden kann. Seit tausend Jahren greift Doro immer wieder in die Geschicke eines kleinen afrikanischen Dorfes ein. Er entscheidet, wer mit wem Kinder zeugen darf, um so einen perfekten Menschen zu züchten. Doch eines Tages verwüsten Sklavenhändler sein Dorf und nehmen Doros »Kinder« mit in die Neue Welt. Als der Unsterbliche ihnen hinterherreist, macht er eine unglaubliche Entdeckung: Anyanwu, eine Gestaltwandlerin und Heilerin und ebenso unsterblich wie er. Sie könnte der Schlüssel zu Doros Plänen sein – doch Anyanwu hat ihre eigenen Pläne, und so beginnt ein Kampf zwischen zwei Halbgöttern, der die Zukunft der gesamten Menschheit für immer verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Doro ist ein Unsterblicher, der die Fähigkeit, menschliche Körper zu übernehmen, meisterhaft beherrscht. Seit tausend Jahren greift er immer wieder in die Geschicke eines kleinen afrikanischen Dorfes ein, um einen perfekten Menschen zu züchten. Doch eines Tages verwüsten Sklavenhändler sein Dorf und nehmen Doros »Kinder« mit in die Neue Welt. Als der Unsterbliche ihnen hinterherreist, macht er eine unglaubliche Entdeckung: Es gibt noch eine zweite Unsterbliche! Anyanwu ist eine Gestaltwandlerin und Heilerin, und sie könnte der Schlüssel zu Doros Zuchtvorhaben sein. Doch die kluge Anyanwu hat ihre eigenen Pläne, und so beginnt ein Jahrhunderte währender Kampf zwischen zwei Halbgöttern, der die Zukunft der gesamten Menschheit für immer verändern wird.
Die Autorin
Octavia Estelle Butler (22. Juni 1947 – 24. Februar 2006) wurde in Pasadena, Kalifornien, geboren. Nach ihrem Universitätsabschluss schlug sie sich mit Gelegenheitsjobs durch, ehe sie 1976 ihren ersten Roman Patternmaster veröffentlichte. Er ist der Auftakt einer lose zusammenhängenden Serie, zu der auch Wilde Saat gehört. Ihren Durchbruch hatte sie mit dem Roman Kindred, der bis heute zu den Klassikern der Afroamerikanischen Literatur zählt. In ihrem mehrfach mit dem Hugo und dem Nebula Award ausgezeichneten Werk wie der Xenogenesis-Trilogie geht es immer wieder um Genderfragen und kulturelle Identität. Sie lebte und arbeitete bis zu ihrem Tod in Seattle, Washington.
OCTAVIA E. BUTLER
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Will Platten
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
WILD SEED
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe 08/2021
Redaktion: Ralf-Oliver Dürr
Copyright © 1980 by Octavia E. Butler
Published by Arrangement with the John Mark Zadnikand Ernestine Walker Living Trust
Copyright © der deutschsprachigen Übersetzungby Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © 2021 dieser Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,unter Verwendung von Shutterstock.com (LStockStudio, Dolka)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-26520-5V001
www.diezukunft.de
Für Arthur Guy, Ernestine Walkerund Phyllis White fürs Zuhören
BUCH EINS
Der Bund
1690
I
Doro entdeckte die Frau durch einen Zufall. Er wollte wissen, was von einem seiner Zuchtdörfer übrig geblieben war. Das Dorf war ein freundlicher, von einer Lehmmauer umgebener Ort inmitten einer weiten, mit Baumgruppen durchsetzten Ebene. Noch bevor Doro das Dorf erreichte, erkannte er, dass die Bewohner verschwunden waren. Die Sklavenhändler waren ihm zuvorgekommen. Mit ihren Gewehren und ihrer Habgier hatten sie in wenigen Stunden das Werk von tausend Jahren vernichtet. Die Dorfbewohner, die sie nicht verschleppt hatten, waren auf die grausamste Weise hingemetzelt worden. Doro fand menschliche Knochen, Haare und ausgedörrte Fleischfetzen, die die Aasfresser übrig gelassen hatten. Er stand vor einem winzigen Skelett – den Gebeinen eines Kindes – und fragte sich, wo man die Überlebenden der Katastrophe hingebracht haben mochte. In welches Land oder in welche Kolonie der Neuen Welt? Wie weit würde er reisen müssen, um die Reste dieses einst so gesunden und blühenden Stammes ausfindig zu machen?
Schließlich riss er sich los vom Anblick der zerstörten und verkohlten Behausungen. Zorn und Bitterkeit erfüllten sein Herz. Ihm war nicht bewusst, wohin er sich wandte, und es kümmerte ihn auch nicht. Seine Gedanken galten anderen Dingen als dem Weg, den er eingeschlagen hatte. Es war eine Sache seines Stolzes, dass er sein Eigentum beschützte. Er war für die Menschen verantwortlich gewesen. Nicht so sehr für die Einzelnen wie für das Gemeinwesen als Ganzes. Sie gaben ihm ihre Treue, ihren Gehorsam, und er beschützte sie.
Er hatte versagt.
So, wie er gekommen war, machte er sich auf den Weg: allein, ohne Waffen, ohne Vorräte. Immer genau nach Südwesten. Er durchquerte die Savanne und später das große Waldgebiet. Er starb zahlreiche Tode durch Entbehrung und Krankheit, durch wilde Tiere und die Feindseligkeit der Menschen. Dies war ein raues Land. Dennoch behielt er unbeirrbar die Richtung nach Südwesten bei. Er entfernte sich dabei immer weiter von jenem Teil der Küste, an dem sein Schiff auf ihn wartete. Nach einer Weile stellte er fest, dass es nicht mehr der Zorn über den Verlust seines Zuchtdorfes war, der ihn vorwärtstrieb. Es war etwas Neues, ein Impuls, eine Art von innerem Sog, der sein Tun bestimmte. Es wäre ihm ein Leichtes gewesen, sich diesem Zwang zu widersetzen, aber er unterließ es. Er ahnte, dass bald etwas geschehen würde. Etwas wartete auf ihn, wartete in unmittelbarer Nähe. Auf solche Ahnungen konnte er sich verlassen.
Seit vielen Hundert Jahren war er nicht mehr so weit nach Westen gekommen. Und aus diesem Grund konnte er sicher sein: Was und wen auch immer er finden mochte, es würde neu für ihn sein – neu und über alle Maßen bedeutsam. Ungeduldig beschleunigte er seine Schritte.
Die Ahnung wurde intensiver, deutlicher. Sie wandelte sich zu einer Art von Signal, das er normalerweise nur bei Menschen erwartete, die er kannte – Menschen wie die verschleppten Dorfbewohner, deren Fährte er folgte, damit man sie nicht zwang, ihr Blut mit fremdem zu vermischen und minderwertige Nachkommen zu zeugen. Doro hielt die Richtung nach Südwesten bei und näherte sich langsam seinem Ziel.
Anyanwus Ohren und Augen waren weit zuverlässiger als die anderer Menschen. Sie hatte ihre Sinne bewusst geschärft, nachdem sie zum ersten Mal von Männern bedroht worden war, die ihr plötzlich mit gezückten Macheten gegenüberstanden und über deren Absichten kein Zweifel bestand. Siebenmal hatte sie töten müssen an diesem grauenvollen Tag – sieben entsetzte Männer, die noch hätten leben können. Und um ein Haar wäre sie selbst umgekommen, nur weil es den anderen gelungen war, sich ihr unbemerkt zu nähern. Nein, nie wieder durfte das geschehen!
In diesem Augenblick zum Beispiel war sie sich des einsamen Störenfrieds sehr genau bewusst, der ganz in ihrer Nähe durch die Büsche streifte. Er hielt sich vor ihr verborgen, bewegte sich lautlos wie Rauch. Dennoch hörte sie ihn, und ihre Ohren folgten jedem seiner Schritte.
Ohne sich etwas anmerken zu lassen, setzte sie ihren Gang durch den Garten fort. Solange sie den Standort des Störenfrieds kannte, hatte sie keine Furcht vor ihm. Vielleicht verließ ihn der Mut, und er schlich sich wieder davon. Sie war jetzt im rückwärtigen Teil des Gartens angelangt. Hohes Unkraut trennte sie von dem Eindringling. Das Unkraut wuchs in ihren Kürbisbeeten und zwischen ihren Heilpflanzen. Es waren fremdartige Pflanzen, die den Menschen ihres Volkes unbekannt waren. Nur sie allein pflanzte sie an, benutzte sie als Medizin gegen Krankheiten und Wunden, mit denen die Leute zu ihr kamen. Oft genug bedurfte es einer solchen Behandlung gar nicht, doch das behielt sie für sich. Die Leute glaubten an die heilende Kraft ihrer Kräuter, und deren Anwendung brachte ihnen Erleichterung bei Krankheit und Schmerzen. Sie liebten es, den Nachbarn von diesen Wunderkräutern zu erzählen, was Anyanwu ihnen ausdrücklich erlaubt hatte. Sie war eine Art Orakel. Eine Frau, durch die eine Gottheit sprach. Fremde zahlten hohe Preise für ihre Dienste. Die Einnahmen kamen ihrem Volk zugute, genauso wie ihr selbst. Und so sollte es sein. Ihre Leute mussten wissen, dass Anyanwus Gegenwart ihnen Nutzen brachte, dass sie aber auch allen Grund hatten, ihre Fähigkeiten zu fürchten. Auf diese Weise blieb der Abstand zwischen ihr und den anderen gewahrt. Sie war sicher vor ihnen, und das Volk war sicher vor ihr. Die meiste Zeit jedenfalls. Doch hin und wieder geschah es, dass der eine oder andere seine Furcht überwand und glaubte, ihrem langen Leben ein Ende setzen zu müssen.
Der Eindringling kam näher, ließ sich allerdings immer noch nicht sehen. Kein Mensch mit ehrlichen Absichten näherte sich einem derart verstohlen. Wer war dieser Mann? Ein Dieb? Ein Mörder? Jemand, der sie für den Tod eines Verwandten oder irgendein anderes Missgeschick verantwortlich machte? Während ihrer zahlreichen Jugendperioden hatte man ihr oft die Schuld für alle möglichen Arten von Ungemach und Unheil zugeschrieben. Um sie der Hexerei zu überführen, hatte man ihr sogar Gift gegeben.
Bereitwillig hatte sie diese Prüfungen über sich ergehen lassen, denn sie wusste, dass sie unschuldig war. Zumindest war sie sicher, dass kein gewöhnlicher Mensch mit seinen unzureichenden Kenntnissen über Gifte und fremdartige Pflanzen ihr gefährlich werden konnte. Sie wusste mehr über Gifte und hatte in ihrem langen Leben mehr davon eingenommen, als einer ihrer Leute es sich vorstellen konnte. Jedes Mal bestand sie diese Prüfungen, ohne Schaden davonzutragen, und ihre Widersacher sahen sich der Lächerlichkeit preisgegeben und standen als Lügner da. Immer dann, wenn Anyanwu das Alter einer Erwachsenen erreicht hatte, hörte man damit auf, sie zu beschuldigen. Aber der Gedanke, dass sie eine Hexe sein könne, saß in den Köpfen ihrer Leute fest. Immer wieder versuchte man, Beweise gegen sie in die Hände zu bekommen und sie zu töten ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Prüfungen, denen man sie unterzog.
Der Eindringling schien sie schließlich lange genug beobachtet zu haben. Er trat auf den schmalen Pfad und zeigte sich ihr in aller Offenheit. Sie schaute auf, als bemerke sie ihn zum ersten Mal.
Er war ein Fremder, ein gut aussehender Mann, größer und breitschultriger als die meisten Männer, die sie kannte. Seine Haut besaß die gleiche dunkle Tönung wie die ihre. Sein Gesicht war schön, mit breiten, kräftig ausgeprägten Wangenknochen. Ein feines Lächeln spielte um den vollen Mund. Er ist jung – noch keine dreißig, dachte sie. Ganz gewiss zu jung, um irgendeine Bedrohung für sie darzustellen. Dennoch, etwas an ihm beunruhigte sie. Vielleicht die Tatsache, dass er ihr nach seiner heimlichen Annäherung so unversehens und offen gegenübertrat.
Wer war er?
Was wollte er von ihr?
Als er sich ihr auf Hörweite genähert hatte, sprach er zu ihr, und seine Worte ließen sie verwirrt die Stirn runzeln. Es waren fremdartige Worte, völlig unverständlich für sie und doch von einer seltsamen Vertrautheit, so als gehörten sie zu einer Sprache, die sie verlernt zu haben schien.
Ihre Haltung straffte sich in dem Bemühen, eine ungewohnte Nervosität vor ihm zu verbergen.
»Wer bist du?«, fragte sie.
Während sie sprach, hob er ein wenig den Kopf, zum Zeichen, dass er ihr zuhörte.
»Wie können wir uns verständigen?«, fragte sie. »Du musst von sehr weit her kommen, deine Aussprache ist so ungewöhnlich.«
»Von sehr weit«, sagte er in ihrer eigenen Sprache. Die einzelnen Worte kamen klar und deutlich, jedoch mit einem Dialekt, der sie an die Zeit ihrer frühesten Jugend erinnerte. Damals hatten die Leute eine solche Aussprache gehabt. Anyanwu hatte sie nie gemocht. Alles daran wirkte abstoßend auf sie.
»So kann ich dich verstehen«, erklärte sie. »Ich erinnere mich wieder. Es ist lange her, seit ich deine Sprache zum letzten Mal gesprochen habe.« Er kam näher und sah sie forschend an. Schließlich lächelte er und schüttelte den Kopf. »Du bist nicht nur eine alte Frau«, stellte er fest. »Vielleicht bist du auch überhaupt noch nicht alt.«
Überrascht wich sie einen Schritt zurück. Wieso wusste er über ihr Alter Bescheid? Ohne sie zu kennen! Ohne mehr von ihr zu wissen als das, was er sah, und das, was er gehört hatte! »Ich bin alt«, widersprach sie voller Zorn, hinter dem sich ihre Furcht verbarg. »Ich könnte die Mutter deiner Mutter sein.« Sie hätte noch weiter in die Vergangenheit gehen können, doch sie schwieg. »Wer bist du?«, fragte sie.
»Ich könnte der Vater deiner Mutter sein!«, antwortete er.
Sie wich einen weiteren Schritt zurück, aber es gelang ihr, die wachsende Furcht unter Kontrolle zu bringen. Dieser Mann war nicht das, was er nach außen hin zu sein schien. Man hätte seine Worte als scherzhaft gemeinten Unsinn auffassen können. Stattdessen versteckte sich hinter ihnen eine Wahrheit, so bedeutend oder unbedeutend wie die Wahrheit hinter ihren eigenen Worten.
»Bleib stehen!«, sagte er. »Ich will dir nichts tun!«
»Wer bist du?«, wiederholte sie ihre Frage.
»Doro.«
»Doro?« Ihre Lippen formten die unbekannten Silben ein zweites Mal.
»Ist das ein Name?«
»Es ist mein Name. In der Sprache meines Volkes bezeichnet er den Osten, die Himmelsrichtung, in der die Sonne aufgeht.«
Sie bedeckte mit einer Hand ihr Gesicht. »Das ist eine List«, sagte sie. »Jemand macht sich lustig über mich.«
»Das solltest du besser wissen. Wann ist es jemandem das letzte Mal gelungen, dich zu überlisten und dir Angst einzuflößen?«
Soweit sie sich erinnern konnte, seit vielen Jahren nicht mehr. Er hatte recht. Aber die Namen! Ihre Übereinstimmung war wie ein Omen. »Weißt du, wer ich bin?«, wollte sie wissen. »Bist du gezielt hergekommen oder …«
»Ich bin wegen dir hier. Ich wusste nichts von dir, nur dass du etwas Außergewöhnliches bist und dass ich dich hier finden würde. Das Bewusstsein von deiner Existenz ließ mich ein großes Stück von meinem Weg abweichen.«
»Bewusstsein?«
»Ich hatte eine Ahnung … Außergewöhnliche Menschen wie du ziehen mich an. Sie rufen mich, sogar über eine große Entfernung hinweg.«
»Ich habe dich nicht gerufen.«
»Du bist da, und du bist anders. Das genügt, mich anzuziehen. Und nun sag mir, wer du bist!«
»Du musst der einzige Mann in diesem Land sein, der noch nicht von mir gehört hat. Ich bin Anyanwu.«
Er wiederholte ihren Namen und blickte zum Himmel. Er hatte verstanden.
Ihr Name bedeutete Sonne. Er nickte.
»Unsere Völker lebten vor langer Zeit und durch große Entfernungen voneinander getrennt, Anyanwu, und dennoch gaben sie uns die richtigen Namen.«
»Als sei es unsere Bestimmung, einander zu begegnen. Doro, wer ist dein Volk?«
»Zu meiner Zeit nannte man sie die Kush. Ihr Land liegt weit im Osten. Ich wurde bei ihnen geboren. Aber sie sind schon lange nicht mehr mein Volk. Seit ich sie das letzte Mal sah, ist sehr viel Zeit vergangen. Ja, es ist lange her. Vielleicht zwölfmal so lang, wie dein Leben währt. Jetzt sind die mein Volk, die mir Treue versprechen.«
»Und du glaubst, mein Alter zu kennen«, sagte sie. »Nicht einmal mein eigenes Volk weiß die Zahl meiner Jahre.«
»Du bist zweifellos von Stadt zu Stadt gezogen, damit sie es vergessen sollten.« Er blickte in die Runde und sah einen umgestürzten Baum in der Nähe. Er ging darauf zu und setzte sich. Anyanwu folgte ihm fast gegen ihren Willen. So sehr dieser Mann sie verwirrte und ihr Angst einflößte, so sehr faszinierte er sie. Schon lange war es her, dass sich in ihrem Leben etwas ereignete, das neu für sie war, das sich nicht schon viele Male zuvor ereignet hatte. Wieder sprach er.
»Ich tue nichts, um mein Alter zu verheimlichen«, sagte er. »Doch viele meiner Leute sind zu der Einsicht gekommen, dass es angenehmer ist, mein Alter zu vergessen. Denn sie können mich weder töten noch werden, was ich bin.«
Sie trat näher und schaute auf ihn herab. Es war ganz offensichtlich, dass er ihr klarmachen wollte, wie ähnlich sie einander waren. Sie glichen sich in Bezug auf ihr Alter und ihre Macht. In ihrem ganzen Leben war sie nie einem Menschen begegnet, der so war wie sie. Schon lange hatte sie es aufgegeben, danach zu suchen. Sie hatte ihre Einsamkeit und Einzigartigkeit angenommen. Doch nun …
»Sprich weiter«, sagte sie. »Du hast mir vieles zu sagen.«
Er hatte sie nicht aus den Augen gelassen. Er hatte ihr ins Gesicht gesehen mit einer Neugier, die die meisten Menschen vor ihr zu verbergen suchten. Die Leute sagten, ihre Augen glichen denen eines Kindes – das Weiße der Augäpfel sei zu weiß und das Dunkel der Pupille zu dunkel und zu klar. Kein Erwachsener und gewiss keine alte Frau habe solche Augen. Und sie mieden ihren Blick. Doros Augen dagegen hatten nichts Besonderes, aber er schaute sie an, wie es Kinder tun. Er kannte keine Furcht und wohl auch keine Scham.
Es erschreckte sie, als er ihre Hand nahm und sie neben sich auf den Baumstamm zog. Sie hätte seinen Griff mit Leichtigkeit abschütteln können, aber sie tat es nicht. »Ich habe heute einen sehr weiten Weg zurückgelegt«, berichtete er. »Dieser Körper braucht Ruhe, wenn er mir noch weiter dienen soll.«
Sie dachte über seine Worte nach. Dieser Körper braucht Ruhe. Welch ungewohnte Art zu sprechen er hatte!
»Das letzte Mal war ich vor etwa dreihundert Jahren in dieser Gegend«, fuhr er fort. »Ich war auf der Suche nach einer Gruppe meines Volkes, die sich verirrt hatte. Aber sie wurden getötet, bevor ich sie fand. Dein Volk lebte damals noch nicht hier, und du warst zu dieser Zeit noch nicht geboren. Ich weiß das, weil deine Andersartigkeit mich damals nicht rief. Ich glaube jedoch, meine Leute haben sich während der kurzen Zeit ihres Aufenthalts mit den damaligen Bewohnern vermischt. Und du bist die Frucht dieser Verbindung.«
»Du willst damit sagen, die Menschen deines Volkes seien meine Vorfahren?«
»Ja.« Forschend blickte er sie an, so als suche er nach einer Ähnlichkeit zwischen ihr und sich selbst. Er würde sie nicht finden. Das Gesicht, das er sah, war nicht ihr wirkliches Gesicht.
»Dein Volk hat den Niger überschritten.« Er zögerte, krauste die Stirn und nannte den Fluss bei seinem richtigen Namen: »Den Orumili. Als ich sie das letzte Mal sah, lebten sie auf der anderen Seite in Benin.«
»Aber das geschah vor langer Zeit«, sagte sie. »Die Kinder, die damals geboren wurden, sind inzwischen Greise oder schon gestorben. Es waren die Dörfer Ado und Idu, die vor der Überquerung von Benin geknechtet wurden. Dann erhoben wir uns gegen die Unterdrücker, überschritten den Fluss und eroberten Onitsha. Wir wollten endlich frei sein, unsere eigenen Herren.«
»Und was geschah mit dem Volk der Oze, die vor euch hier lebten?«
»Einige flohen, die Zurückgebliebenen wurden unsere Sklaven.«
»Ihr machtet also das Gleiche mit ihnen wie Benin mit euch. Ihr habt die Menschen aus ihrer Stadt vertrieben – oder sie zu euren Sklaven gemacht.«
Anyanwu blickte zur Seite. Ihre Stimme klang verstockt. »Es ist besser, der Herr zu sein als der Sklave!« Dieser Satz stammte von ihrem Ehemann zur Zeit des Auszugs. Er war ein großer Mann geworden – Herr eines riesigen Hauswesens mit vielen Frauen, Kindern und Sklaven. Anyanwu kannte jedoch auch die andere Seite. Zweimal in ihrem Leben war sie selbst eine Sklavin gewesen. Sie konnte diesem Zustand nur entfliehen, indem sie ihre Identität wechselte und in einer anderen Stadt einen neuen Ehemann fand. Sie wusste, die einen waren die Herren, die anderen die Sklaven. Es war immer so gewesen unter den Menschen. Aber ihre eigene Erfahrung hatte sie gelehrt, die Sklaverei zu hassen. Es war ihr damals sogar schwergefallen, eine gute Ehefrau zu sein, denn eine Ehefrau musste stets den Nacken beugen und sich dem Mann unterwerfen. Ihr jetziges Leben als Priesterin gefiel ihr. Sie verkündete den Menschen den Willen der Gottheit. Man fürchtete sie und gehorchte ihr. Auf diese Weise war sie selbst eine Herrin geworden. »Manchmal ist es notwendig, über andere zu herrschen, wenn man verhindern will, dass man selbst zum Sklaven wird«, erwiderte sie leise.
»Ja«, stimmte er zu.
Anyanwu zwang sich, ihre Aufmerksamkeit den Dingen zuzuwenden, die er mit seinen Worten berührt hatte. Ihrem Alter zum Beispiel. Er hatte recht. Sie war etwa dreihundert Jahre alt – etwas, das niemand aus ihrem Volk geglaubt haben würde. Und noch etwas anderes hatte er gesagt – etwas, das früheste Kindheitserinnerungen in ihr wachgerufen hatte. Hier und da hatte sie als junges Mädchen Gesprächsfetzen aufgefangen. Die Sklaven erzählten sich, dass ihr Vater keine Kinder zeugen könne, und sie, Anyanwu, sei nicht nur die Tochter eines anderen Mannes, sondern eines durchziehenden Fremden. Als sie ihre Mutter danach fragte, hatte diese sie geschlagen. Es war das erste und einzige Mal, dass ihre Mutter sie gestraft hatte. Von diesem Zeitpunkt an wusste Anyanwu, dass die Geschichten der Sklaven der Wahrheit entsprachen. Aber so sehr sie auch insgeheim forschte, es war ihr nie gelungen, etwas über diesen Fremden zu erfahren. Später interessierte es sie nicht mehr, denn der Mann ihrer Mutter erkannte sie als seine Tochter an und war gut zu ihr. Dennoch fragte sie sich hin und wieder, ob die Menschen seines Volkes ihr ähnlich waren.
»Sind sie alle tot – meine Verwandten?«, fragte sie Doro.
»Ja.«
»Dann waren sie nicht so wie ich.«
»Vielleicht wären sie nach vielen Generationen so geworden. Du bist nicht nur ihr Nachkomme. Deine Onitsha-Verwandten galten auch nach den Vorstellungen ihres eigenen Volkes als ungewöhnlich und mit seltsamen Fähigkeiten ausgestattet.«
Anyanwu nickte vor sich hin. Sie erinnerte sich an die seltsamen Dinge, die mit ihrer Mutter zusammenhingen. Obgleich die Gerüchte über sie nicht verstummten, besaß sie Ansehen und Einfluss. Ihr Ehemann war Mitglied eines hochgeachteten Stammes, der für seine magischen Kräfte und seherischen Fähigkeiten berühmt war. Doch in ihrem Haus gab die Mutter den Ton an. Ihre prophetischen Träume erfüllten sich mit verblüffender Genauigkeit. Sie bereitete Arzneien, die Krankheiten heilten und Unbill von den Menschen fernhielten. Auf dem Markt konnte es keine Händlerin mit ihr aufnehmen. Niemand verstand die Kunst des Feilschens so gut wie sie. Es schien so, als lese sie die geheimsten Gedanken in den Köpfen ihrer Kundinnen. Und im Laufe der Jahre wurde sie sehr wohlhabend.
Man erzählte, dass Angehörige des Stammes, zu dem Anyanwu durch den Mann ihrer Mutter gehörte, über die Gabe verfügten, ihre Gestalt zu verändern und nach Wunsch bestimmte Tierformen anzunehmen. Anyanwu hatte nie etwas davon bemerkt. Die übersinnlichen Kräfte ihrer Mutter dagegen waren ihr nicht verborgen geblieben, und es hatte sich zwischen ihnen eine derart tiefe Bindung entwickelt, wie sie normalerweise bei Mutter und Tochter nicht möglich ist. Sie und ihre Mutter verband eine Gleichförmigkeit des Denkens und Fühlens, die über das gewohnte Maß weit hinausging, und sie waren beide bemüht, dies geheim zu halten. Wenn Anyanwu Schmerzen hatte, spürte die Mutter ihre Qualen, mochte sie sich auch an einem noch so weit entfernten Ort aufhalten. Sie packte dann sofort ihre Waren zusammen und eilte nach Hause. Zu ihren eigenen Kindern und ihren drei Männern hatte Anyanwu nie eine solch enge Beziehung gehabt. Und jahrelang hatte sie in ihrem eigenen Stamm, im Stamm ihrer Mutter und anderswo nach Menschen gesucht, die auch nur eine Spur jener Fähigkeit besaßen, die ihre Andersartigkeit am deutlichsten zum Ausdruck brachte: die Fähigkeit, ihre Gestalt zu wechseln. Auf der Suche danach waren ihr haarsträubende Geschichten zu Ohren gekommen, aber sie war nie auf jemanden gestoßen, der diese Fähigkeit tatsächlich besaß. Sollte sie etwa jetzt einem solchen Menschen begegnet sein? Sie blickte Doro an. Was empfand sie in seiner Nähe? Noch wusste sie nichts von ihm, und dennoch erinnerte sie etwas an ihm an ihre Mutter.
»Bist du ein Verwandter von mir?«, fragte sie.
»Nein«, erwiderte er. »Aber deine Verwandten haben mir ihre Treue geschenkt. Und das ist nicht wenig.«
»Ist das der Grund für dein Kommen – dass meine Andersartigkeit dich anzog?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich kam hierher, um herauszufinden, wer du bist.«
Sie runzelte die Stirn, plötzlich voller Argwohn. »Ich bin ich. Du siehst mich doch!«
»So, wie du mich siehst. Bildest du dir ein, alles sehen zu können?«
Sie antwortete nicht.
»Eine Lüge beleidigt mich, Anyanwu. Und was ich jetzt von dir sehe, ist eine Lüge. Zeig mir, wer du wirklich bist!«
»Du siehst, was du sehen willst.«
»Hast du Angst, es mir zu zeigen?«
»Nein.« Es war keine Angst in ihr. Aber was war es dann? Ein Leben lang hatte sie sich getarnt, hatte sich den Zwang auferlegt, ihre Fähigkeiten vor anderen zu verbergen. Was sie davon zeigte, waren nicht mehr als bloße Kunststücke und Tricks. Sie hatte nie zugelassen, dass ihre Leute oder sonst ein Mensch das volle Ausmaß ihrer Macht erkannten. Es sei denn, ihr Leben war in Gefahr, und Notwehr zwang sie zu handeln. Und nun sollte sie diese Gewohnheit plötzlich aufgeben, nur weil ein Fremder auftauchte, der das von ihr verlangte? Er hatte viele Worte gemacht, aber was hatte er ihr tatsächlich über sich gesagt? Nichts.
»Kann meine Tarnung eine Lüge sein, während die deine es nicht ist?«, fragte sie.
»Meine Tarnung ist eine Lüge«, sagte er.
»Dann zeig mir zuerst, wer du bist. Zeig, dass du mir vertraust, so wie du von mir verlangst, dass ich dir vertraue!«
»Ich vertraue dir, Anyanwu. Doch das Wissen über mich würde dich nur in Angst und Schrecken versetzen.«
»In deinen Augen bin ich also noch ein Kind«, sagte sie verärgert. »Bist du meine Mutter, die mich vor den Wahrheiten der Erwachsenen beschützen muss?«
Er blieb ruhig. »Die meisten meiner Leute sind dankbar, dass ich sie vor meiner Wahrheit beschütze.«
»Das behauptest du. Ich habe bisher noch nichts von deiner Wahrheit gesehen.«
Doro erhob sich. Auch Anyanwu stand auf und sah ihn an. Ihr kleiner, vertrockneter Körper wurde vom Schatten des seinen völlig bedeckt. Sie war etwas mehr als halb so groß wie er, aber das machte ihr nichts aus. Sie war es gewohnt, Menschen gegenüberzustehen, die größer waren als sie. Sie zwang ihnen entweder ihren Willen mit Worten auf oder unterwarf sie sich mit physischer Kraft. Sie hätte die Größe eines jeden Mannes annehmen können, doch sie zog es vor, die Leute durch ihre kleine Gestalt zu täuschen. Fremde hielten sie deswegen oft für harmlos oder ein streitsüchtiger Wichtigtuer machte den Fehler, sie zu unterschätzen.
Doro starrte auf sie nieder. »Manchmal wird man nur durch Schaden klug. Ein Kind muss sich verbrennen, bevor es sich vor dem Feuer in Acht nimmt«, sagte er. »Komm mit mir zu einem deiner Dörfer, Anyanwu. Dort werde ich dir das zeigen, was du glaubst, sehen zu müssen.«
»Was hast du vor?«, fragte sie misstrauisch.
»Ich lasse dich jemanden auswählen – einen Feind oder irgendein nutzloses Mitglied deines Volkes, das den anderen nur im Wege steht. Diesen Menschen werde ich töten!«
»Töten!«
»Ich töte, Anyanwu. Das ist der einzige Weg, mir meine Jugend und Lebenskraft zu erhalten. Und es ist die einzige Möglichkeit, dir zu zeigen, wer ich bin. Ich töte einen Menschen und trage seinen Körper wie ein Kleid!« Er holte tief Luft. »Dies hier ist nicht der Körper, mit dem ich geboren wurde. Es ist auch nicht der zehnte, nicht der hundertste, nicht der tausendste, den ich angelegt habe. Deine Fähigkeiten scheinen sanfter Natur zu sein. Meine sind es nicht.«
»Du bist ein Geist«, schrie sie in panischem Entsetzen.
»Ich sagte dir schon, du seist ein Kind. Merkst du nicht, wie du dich selbst in Angst und Schrecken versetzt?«
Er war wie ein Ogbanje, ein kindhafter Geistteufel, den eine Frau immer neu gebar, damit er nach der Geburt wieder starb und ihr Schmerzen und Qualen bereitete. Eine Frau, die von einem Ogbanje heimgesucht wurde, konnte viele Male niederkommen und besaß doch weder Sohn noch Tochter. Aber dieser Doro war ein erwachsener Mann. Er konnte nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren, um aufs Neue von ihr geboren zu werden. Ihm lag nichts an dem Körper eines Neugeborenen. Er zog es vor, die Körper ausgewachsener Männer zu besitzen.
»Du bist ein Geist!«, behauptete Anyanwu hartnäckig. Ihre Stimme klang schrill vor Angst, während ein Teil ihres Verstandes sich verwundert fragte, weshalb sie seinen Worten so selbstverständlich glaubte. Sie selbst kannte eine ganze Menge Tricks. Lügen, die den Leuten das Blut in den Adern gefrieren ließen. Warum reagierte sie jetzt wie der unwissendste Fremdling, den man zu ihr führte und der sie für das Orakel der Gottheit hielt? Warum glaubte sie ihm, und warum zitterte sie vor Angst? Es war ganz einfach. Sie hatte erkannt, dass dieser Mann noch viel andersartiger war als sie selbst. Dieser Mann war gar kein Mann.
Als er mit einer leichten Handbewegung unerwartet ihren Arm berührte, schrie sie auf.
Er ließ einen Laut des Unwillens hören. »Frau, wenn du mit deinem Geschrei die Leute anlockst, bleibt mir nichts anderes übrig, als einen von ihnen zu töten.«
Sie erstarrte. Auch dies glaubte sie ihm. »Hast du schon jemanden getötet – auf deinem Weg hierher?«, flüsterte sie.
»Nein. Ich habe große Entbehrungen auf mich genommen, weil ich deinetwegen nicht töten wollte. Ich nahm an, du hättest Verwandte in dieser Gegend.«
»Ganze Generationen von Verwandten. Söhne und Enkel, sogar die Söhne dieser Enkel.«
»Ich wollte keinen von ihnen töten. Keinen deiner Söhne.«
»Warum nicht?« Anyanwu war erleichtert und neugierig zugleich. »Was können sie dir bedeuten?«
»Wie hättest du mich empfangen, wenn ich im Körper eines deiner Söhne oder Enkel zu dir gekommen wäre?«
Sie wich zurück. Entsetzt und gleichzeitig unfähig, sich unter dem Gesagten etwas vorstellen zu können.
»Begreifst du nicht? Deine Kinder dürfen nicht einfach umgebracht werden. Vielleicht sind sie verwendbar für …« Er gebrauchte ein Wort in einer fremden Sprache. Sie hörte es klar und deutlich, doch es ergab keinen Sinn. Das Wort war »Saatgut«.
»Was ist das, Saatgut?«, fragte sie.
»Menschen, die zu wertvoll sind, um zufällig getötet zu werden.«
»Und welchen Wert besitzen meine Söhne für dich?«
Er maß sie mit einem langen, stummen Blick, dann sprach er mit ungewohnter Sanftheit: »Vielleicht muss ich zu ihnen gehen. Vielleicht üben sie eine noch größere Anziehung auf mich aus als ihre Mutter.«
Sie konnte sich nicht erinnern, jemals auf eine so sanfte und doch wirksame Weise bedroht worden zu sein. Ihre Söhne … »Komm«, flüsterte sie. »Hier möchte ich mich dir nicht zeigen.«
Mit mühsam beherrschter Erregung folgte Doro der kleinen, verhutzelten Gestalt zu ihrer Behausung. Die über sechs Fuß hohe Mauer aus rotem Lehm gab ihnen die Intimität, die Anyanwu sich wünschte.
»Meine Söhne können dir nicht helfen«, sagte sie auf dem Weg durch den Garten. »Es sind gute Männer, aber sie wissen nur wenig.«
»Sind sie nicht wie du? Wenigstens einige von ihnen?«
»Nein.«
»Und deine Töchter?«
»Auch nicht. Ich habe sie genau beobachtet, bis zu dem Tag, an dem sie zu ihren Ehemännern gingen. Sie sind wie meine Mutter. Sie besitzen großen Einfluss auf ihre Männer und auf andere Frauen, aber darüber hinaus sind sie Mittelmaß. Sie leben ihr Leben, und sie sterben.«
»Sie sterben?«
Anyanwu öffnete das hölzerne Tor und führte ihn in den Hof. Dann verriegelte sie das Tor hinter ihm.
»Ja, sie sterben«, sagte sie traurig. »Wie ihre Väter.«
»Vielleicht hätten deine Söhne und Töchter einander heiraten sollen …«
»Abscheulich«, unterbrach sie ihn voller Entsetzen. »Wir sind doch keine Tiere, Doro.«
Er zuckte die Schultern. Sein ganzes Leben lang hatte er solche Einwände missachtet und die Protestierenden gezwungen, ihre Meinung zu ändern. Die Moral der Leute überlebte selten die Auseinandersetzung mit ihm. Dieses Mal verzichtete er auf die Anwendung von Gewalt. Diese Frau war wertvoll. Wenn sie nur halb so alt war, wie er vermutete, müsste sie der älteste Mensch sein, den er jemals getroffen hatte – und sie war immer noch voller Lebenskraft. Sie stammte von Menschen ab, deren ungewöhnlich lange Lebensdauer, deren Widerstandskraft gegenüber Krankheiten und die weit über das Normale hinausgehende Veranlagung sie für ihn besonders wichtig machten. Menschen, die – wie so viele andere – eine willkommene Beute für Sklavenhändler und feindliche Stämme wurden. Ein Grund, weshalb sie nur noch ganz selten zu finden waren. Nichts durfte dieser einen Überlebenden, diesem ungewöhnlichen Glücksfall der Gattung Mensch zustoßen. Vor allem musste sie beschützt werden vor ihm, Doro, selbst. Es durfte nicht geschehen, dass er sie tötete. Aus Zorn oder durch einen Unfall – und Unfälle passierten so leicht in diesem Land. Er musste sie mitnehmen zu einem seiner Saatgutdörfer, wo sie vor diesen Gefahren sicher sein würde. Bei ihrer außergewöhnlichen Begabung war es vielleicht möglich, dass sie sich wieder verjüngte und dass aus der Verbindung mit ihm Kinder entstanden, die ihrer würdig waren. Blieb sie unfruchtbar, gab es immer noch ihre bereits lebenden Kinder.
»Würdest du herschauen, Doro!«, unterbrach sie seine Gedankengänge. »Dies ist es, was du sehen wolltest.«
Er wandte ihr seine Aufmerksamkeit zu, und sie begann, sich die Hände zu reiben. Ihre Hände waren wie Vogelkrallen, gekrümmt von der Gicht, dürr und knochig. Während er ihr zuschaute, begannen sie, sich zu füllen, wurden fleischig und glatt und nahmen das Aussehen einer Mädchenhand an. Arme und Schultern verloren ihre Hagerkeit, und die schlaff herabhängenden Brüste wurden voll und fest. Die Hüften rundeten sich unter dem Stoff ihres Gewands, und Doro verspürte das Verlangen, sie auf der Stelle zu entkleiden und nackt zu sehen. Schließlich berührte sie ihr Gesicht und glättete die Falten darin. Eine tiefe dunkle Linie unter ihrem linken Auge verschwand. Die Haut wurde zart und rosig, und die Frau erschien überraschend schön.
Sie sah aus wie eine Zwanzigjährige. Sie räusperte sich, und die Stimme, mit der sie zu ihm redete, war weich wie die Stimme einer jungen Frau. »Genügt das?«
Einen Augenblick lang verschlug es ihm die Sprache. Fassungslos starrte er sie an, dann sagte er: »Bist du es wirklich, Anyanwu?«
»Ja. In meiner wirklichen Gestalt. So wie ich immer bin, wenn ich für andere nicht mein Alter verändere. Diese Verwandlung gelingt mir sehr leicht. Nicht jede ist so einfach.«
»Nicht jede?«
»Glaubst du, ich könnte nur diese eine Gestalt annehmen?« Sie begann damit, ihrem verwandlungsfähigen Körper eine neue Form zu geben. »Ich nehme Tiergestalten an, um meine Leute zu erschrecken, wenn sie mich töten wollen«, sagte sie. »Ich verwandle mich in einen Leoparden und fauche sie an. Sie glauben an solche Dinge, aber sie mögen es nicht, wenn sie sich tatsächlich vor ihren Augen ereignen. Ab und zu werde ich zur heiligen Python, und keiner wagt es, mir ein Leid anzutun. Die Python-Gestalt brachte mir Glück. Wir brauchten Regen, wenn die Dürre nicht unsere ganze Jahresernte vernichten sollte. Und während ich eine Python war, kam der Regen. Die Leute hielten meinen Zauber für wirksam, und es dauerte eine sehr lange Zeit, bis mich wieder jemand von ihnen töten wollte.«
Während sie sprach, verwandelte sie sich in einen kleinen muskulösen Mann.
Doro ging einen Schritt auf sie zu. Er beabsichtigte, ihr die Kleider abzustreifen, aber er bewegte sich langsam, damit sie seine Absicht verstand. Sie griff nach seinem Arm, und er spürte ihre Stärke. Obgleich sie ohne Kraftanstrengung zulangte, hatte er den Eindruck, sein Handgelenk würde brechen. Mühsam brachte er sich wieder unter Kontrolle, nachdem er die Schrecksekunde überwunden hatte. Er schaute Anyanwu an und sah, dass sie selbst ihr Gewand löste und zu Boden gleiten ließ. Er stand immer noch unter dem Eindruck der ungeheuren Stärke, die ihr Griff offenbart hatte. Doch dann bemerkte er ihren Körper und stellte überrascht fest, dass sie tatsächlich den Körper eines Mannes angenommen hatte.
»Kannst du auch ein Kind zeugen?«, fragte er.
»Manchmal. Nicht jetzt.«
»Hast du das schon einmal getan?«
»Ja. Aber nur Mädchen.«
Er lachte und schüttelte den Kopf. Diese Frau war weit interessanter, als er es für möglich gehalten hatte. »Es verwundert mich, dass dein Volk dich am Leben gelassen hat«, sagte er.
»Glaubst du, ich hätte zugelassen, dass sie mich töten?«, fragte sie.
Erneut lachte er. »Was wirst du also tun, Anyanwu? Bei ihnen bleiben und dich mit jeder neuen Generation anlegen, bis die Leute begriffen haben, dass sie dich am besten in Ruhe lassen, oder wirst du mit mir kommen?«
Sie streifte ihr Gewand wieder über und starrte ihn an. Die großen klaren Augen blickten täuschend sanft aus ihrem Jungmännergesicht. »Ist es das, was du willst?«, fragte sie. »Ich soll mit dir gehen?«
»Ja.«
»Das also ist der eigentliche Grund, weswegen du hergekommen bist.«
Er glaubte, Furcht in ihrer Stimme zu hören, aber sein schmerzendes Handgelenk erinnerte ihn daran, dass sie keine übermäßige Angst vor ihm zu haben brauchte. Sie war stark. Sie hätte ihn zwingen können, sie zu töten. Er sprach zu ihr, und das, was er sagte, war offen und aufrichtig.
»Ich kam zufällig hierher, weil Menschen, die mir in Treue dienten, in die Sklaverei verschleppt wurden«, sagte er. »Ich ging zu ihrem Dorf, um sie von dort fortzuholen. Um sie zu einem Platz zu bringen, an dem sie sicher waren. Aber ich fand nur noch das, was die Sklavenjäger von ihnen übrig gelassen hatten. Ich verließ den Ort der Zerstörung, ohne darauf zu achten, wohin ich ging. Plötzlich war ich hier und erwachte wie aus einem Traum. Ich war überrascht, und zugleich war ich froh – zum ersten Mal nach sehr langer Zeit.«
»Es sieht so aus, als habe man dir dein Volk schon sehr oft weggenommen.«
»Es sieht nicht nur so aus, es ist so. Aus diesem Grund bin ich dabei, sie an einen neuen Ort zu bringen. Dort wird es leichter für mich sein, sie zu beschützen.«
»Ich habe mich bisher immer noch selbst beschützt.«
»Ich weiß. Du wirst sehr nützlich für mich sein. Ich nehme an, du bist in der Lage, andere genauso gut zu beschützen wie dich selbst.«
»Soll ich mein Volk verlassen, nur um dir zu helfen, das deine zu beschützen?«
»Du sollst dein Volk verlassen, damit du endlich unter Menschen leben kannst, die von der gleichen Art sind wie du.«
»Zum Beispiel mit einem, der Männer tötet und in ihre Haut schlüpft? Wir sind nicht von der gleichen Art.«
Doro stieß einen Seufzer aus. Er blickte hinüber zu ihrem Haus, einem kleinen, quaderförmigen Gebäude mit einem tief heruntergezogenen Strohdach. Die Wände bestanden aus den gleichen roten Lehmziegeln, aus denen die Hofmauer errichtet war. Vage kam ihm der Gedanke, ob es sich dabei um ein ähnliches Material handelte, wie es die Ureinwohner im Südwesten des nordamerikanischen Kontinents für ihre Behausungen verwendeten. Doch dann galt seine Aufmerksamkeit wieder dem Haus Anyanwus, und er fragte sich, ob es darin eine Lagerstatt, Wasser und etwas zu essen für ihn geben würde. Er war zu müde und zu hungrig, um sich mit der Frau noch lange herumzustreiten.
»Gib mir zu essen, Anyanwu«, sagte er. »Dann werde ich die Kraft haben, dich von hier wegzulocken.«
Sie blickte ihn entsetzt an, dann lachte sie gepresst. Sie erweckte den Eindruck in ihm, als sei es ihr nicht recht, wenn er bliebe und bei ihr aß. Seine Gegenwart schien sie zu beunruhigen. Irgendwie glaubte sie seinen Worten, und sie fürchtete, er könne sie tatsächlich gegen ihren Willen von hier fortlocken. Sie wollte, dass er weiterzog – jedenfalls wollte sie es mit einem Teil ihrer selbst. Der andere Teil dagegen war voller Neugier auf das, was geschehen würde, wenn sie ihr Heim verließ und sich diesem Fremden anschloss. Ihr Geist war zu lebendig und aufgeschlossen, um sich nicht dann und wann in ein Abenteuer zu begeben.
»Wenigstens ein paar süße Kartoffeln, Anyanwu!«, sagte er lächelnd. »Ich habe den ganzen Tag noch keinen Bissen zu mir genommen.« Er wusste, sie würde ihn bewirten.
Wortlos ging sie zu einem der Nebengebäude und kam zurück mit zwei großen Jamsknollen. Sie führte ihn in die Küche und reichte ihm ein Rehfell, auf das er sich setzen konnte, da er nichts anderes trug als einen Lendenschurz. Noch immer in der Gestalt eines jungen Mannes trank sie etwas Milch der Kolanuss und einen Schluck Palmwein mit ihm. Dann begann sie mit der Zubereitung des Essens. Außer den süßen Kartoffeln hatte sie Gemüse, geräucherten Fisch und Palmöl. Zwischen drei Ziegeln, die ihr als Herd dienten, entzündete sie ein Holzkohlenfeuer und setzte einen Tontopf mit Wasser auf. Während das Wasser zu kochen begann, schälte sie die Kartoffeln. Sie würde sie klein schneiden und zu einem Brei verkochen. Vielleicht machte sie aus dem Gemüse, dem Öl und dem Fisch eine Soße, aber das würde noch einige Zeit dauern.
»Wie ist das?«, fragte sie ihn während der Arbeit. »Stiehlst du dir die Nahrung, wenn du Hunger hast?«
»Ja«, erwiderte er. Er stahl mehr als nur Nahrung. Wenn keine Menschen, die er kannte, in der Nähe waren, oder wenn er Menschen, die er kannte, nicht willkommen war, nahm er sich deren kraftvolle, junge Körper. Niemand, kein Einzelner und keine Gruppe, konnte ihn daran hindern. Es konnte ihn überhaupt niemand daran hindern, das zu tun, wozu er sich entschlossen hatte.
»Ein Dieb«, sagte Anyanwu voller Abscheu, der ihm allerdings nicht ganz echt vorkam. »Du stiehlst, du mordest. Was machst du sonst noch alles?«
»Ich schaffe ein Volk«, antwortete er ruhig. »Ich suche das Land für die Menschen, die anders sind als andere. Ein wenig anders – oder sehr viel anders. Ich wähle sie aus, gliedere sie in Gruppen und fange an, aus ihnen ein neues, starkes Volk zu schaffen.«
Erstaunt sah sie ihn an. »Und sie lassen dich gewähren? Wehren sich nicht dagegen, wenn du sie fortholst aus ihrem Volk, aus ihren Familien?«
»Manche bringen ihre Familien mit. Viele haben keine Familie. Ihr Anderssein macht sie zu Ausgestoßenen. Sie sind froh, mir folgen zu können.«
»Immer?«
»Meistens.«
»Und was ist, wenn jemand sich weigert, dir zu folgen? Was geschieht, wenn sie sagen: ›Es sieht so aus, als würden zu viele Mitglieder deines Volkes sterben, Doro. Wir bleiben lieber da, wo wir sind, wo wir jetzt leben?‹«
Er erhob sich und ging zu der Tür, die in den angrenzenden Raum führte. Dort befanden sich, eingebaut in die Wand, zwei breite, längliche Nischen mit harten, aber einladenden Lagerstätten aus Lehm. Er musste sich hinlegen und schlafen. Trotz der Jugend und Robustheit des Körpers, den er trug, handelte es sich nur um den Körper eines normalen Mannes. Wenn er sorgsam damit umging – ihm den notwendigen Schlaf und genügend Nahrung gab, ihn nicht überforderte und ihn vor Verletzungen bewahrte –, würde er ihn noch ein paar Wochen länger behalten können. Wenn er ihn jedoch zu Hochleistungen antrieb, wie er es getan hatte, um möglichst schnell zu Anyanwu zu kommen, würde er ihn bald verschlissen haben. Er streckte die Hände aus, die Handflächen nach unten, und er sah, dass sie zitterten.
»Ich muss schlafen, Anyanwu. Wecke mich, sobald das Essen fertig ist.«
»Warte!«
Die Schärfe in ihrer Stimme zwang ihn, stehen zu bleiben und zurückzublicken.
»Antworte!«, forderte sie ihn auf. »Antworte mir auf meine Frage! Was geschieht, wenn Leute dir nicht folgen wollen?«
War das alles, was sie von ihm wollte? Er schenkte ihr keine Beachtung mehr, kletterte auf eine der Lagerstätten, legte sich auf die Schilfmatte, die darauf ausgebreitet war, und schloss die Augen. Bevor ihn der Schlaf übermannte, glaubte er zu hören, wie sie den Raum betrat und wieder hinausging. Aber er kümmerte sich nicht darum. Schon vor langer Zeit hatte er die Erfahrung gemacht, dass die Leute eine viel größere Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigten, wenn er sie die Antwort auf eine Frage, wie Anyanwu sie stellte, selbst finden ließ. Nur ein Dummkopf brauchte darauf wirklich eine Antwort, und diese Frau war kein Dummkopf.
Als er erwachte, war das Haus vom Duft des Essens erfüllt. Rasch und voller Heißhunger stand er auf. Er kauerte sich ihr gegenüber auf den Boden, wusch sich in einer Schüssel, die sie ihm reichte, zerstreut die Hände. Er benutzte die Finger, um sich etwas von den gestampften Kartoffeln zu nehmen und sie in die stark gepfefferte Soße zu tunken, die in einer Schüssel vor ihm stand. Das Essen war reichlich und sättigend. Eine Zeit lang widmete er sich ganz dem Vorgang der Nahrungsaufnahme. Auch Anyanwu schenkte er keine Beachtung. Er nahm lediglich zur Kenntnis, dass sie ebenfalls mit Essen beschäftigt war und keine Neigung zu einem Gespräch zu haben schien. Vage erinnerte er sich daran, dass es eine kleine religiöse Zeremonie zwischen der Waschung der Hände und dem Beginn der Mahlzeit gegeben hatte, als er das letzte Mal bei ihrem Volk geweilt hatte. Eine Art Speise- und Palmweinopfer für die Götter. Nachdem er seinen ersten, quälenden Hunger gestillt hatte, erkundigte er sich danach.
Sie blickte ihn an. »Welche Götter verehrst du?«
»Keine.«
»Und warum nicht?«
»Ich helfe mir selbst«, entgegnete er.
Sie nickte. »Das tust du auf wenigstens zwei Arten. Auch ich helfe mir selbst.«
Er lächelte kaum merklich und überlegte, wie schwer es sein mochte, sich eine Frau, die sich bereits seit dreihundert Jahren selbst half, gefügig zu machen. Würde es einer großen Anstrengung bedürfen, sie zum Mitgehen zu bewegen? Sie hatte Söhne, und sie liebte sie, sorgte sich um sie. An dieser Stelle war sie verwundbar. Und es war auch möglich, dass er es einmal bedauerte, sie mitgenommen zu haben – vor allem deshalb, weil sie so wertvoll für ihn war, dass er sie nur im äußersten Notfall töten würde.
»Ich verehre die Götter nur wegen meines Volkes«, sagte sie. »Ich war für sie die Stimme, der Mund der Gottheit. Was mich selbst betrifft, so …« Sie brach ab und schwieg eine Weile. Dann fuhr sie fort: »In meinem langen Leben bin ich zu der Einsicht gekommen, dass der Mensch sein eigener Gott werden und sein Schicksal selbst in die Hände nehmen muss. Missgeschick und Unheil kommen so oder so über ihn.«
»Du bist hier völlig fehl am Platz.«
Anyanwu stieß einen Seufzer aus. »Es ist immer wieder das Gleiche. Ich bin zufrieden und fühle mich hier wohl. Inzwischen hatte ich schon zehn Männer, denen ich gehorchen musste. Weshalb sollte ich dich zu meinem elften machen? Weil du mich umbringen wirst, wenn ich mich weigere? Umwerben die Männer deiner Heimat eine Frau, indem sie ihr mit Mord drohen? Nun, vielleicht ist es dir wirklich nicht möglich, mich zu töten. Wir sollten es darauf ankommen lassen, es herauszufinden.«
Er ignorierte ihren Gefühlsausbruch. Stattdessen bemerkte er, wie selbstverständlich sie davon ausging, dass er sie zu seiner Frau machen würde. Von ihrem Standpunkt aus war eine solche Annahme durchaus natürlich, vielleicht sogar richtig. Er hatte sich bereits die Frage gestellt, mit welchem seiner Leute er sie zuerst vermählen sollte. Doch nun wusste er, dass er sie selbst zur Frau nehmen würde – eine Zeit lang wenigstens. Oftmals behielt er die Gesündesten und Kraftvollsten aus seinem Volk für einige Monate oder sogar ein ganzes Jahr bei sich. Waren es Kinder, so lernten sie, ihn als ihren Vater anzuerkennen. Waren es Männer, lernten sie, ihm als ihrem Herrn zu gehorchen. Waren es Frauen, akzeptierten sie ihn am ehesten als Liebhaber und Ehegatten. Anyanwu war eine der schönsten Frauen, die er jemals gesehen hatte. Er hatte sofort beschlossen, sie in dieser Nacht zu sich auf sein Lager zu nehmen. Und auch in den folgenden Nächten sollte sie mit ihm die Schlafstätte teilen. So lange, bis sie das Zuchtdorf erreicht hatten, das er in der britisch regierten Kolonie von New York begründen wollte. Als er sprach, war seine Stimme sanft.
»Warum sollte ich versuchen, dich zu töten, Anyanwu, warum? Würdest du mich töten, wenn du es könntest?«
»Vielleicht kann ich es.«
»Hier bin ich.« Er blickte sie an mit Augen, die die Männergestalt, in die sie geschlüpft war, ignorierten. Mit Augen, die die Frau in ihr ansprachen – so hoffte er wenigstens. Es würde viel befriedigender für ihn sein, wenn sie freiwillig zu ihm kam und nicht aus Furcht oder weil er sie dazu zwang.
Sie sagte kein Wort. Es war, als brächte seine Sanftheit sie in Verwirrung. Genau das hatte er beabsichtigt.
»Wir würden gut zueinander passen, Anyanwu. Hast du dir nie einen Mann gewünscht, der deiner würdig ist?«
»Du bist sehr von dir eingenommen.«
»Und von dir. Aus welchem Grund sollte ich sonst hier sein?«
»Ich habe Ehemänner gehabt, die große Persönlichkeiten waren«, sagte sie. »Männer von Adel, mutig und heldenhaft, obwohl ihnen diese besonderen Fähigkeiten fehlten, die du besitzt. Ich habe Söhne, die Priester sind, wohlhabende Männer von Rang und Würden. Warum sollte ich mir einen Gatten wünschen, der auf andere Jagd machen muss wie auf wilde Tiere?«
Er zeigte mit dem Finger auf seine Brust. »Dieser Mann machte Jagd auf mich. Er griff mich mit einem Buschmesser an.«
Einen Moment lang spannte sich ihre Haltung. Ein Zittern lief durch ihren Körper. »Auch mich hat man auf diese Weise angegriffen und beinahe in zwei Hälften geteilt.«
»Was hast du gemacht?«
»Ich … ich habe mich selbst geheilt. Ich hätte nie geglaubt, dass mir das in so kurzer Zeit gelingen würde.«
»Ich möchte wissen, was du mit dem Mann gemacht hast, der dich mit dem Buschmesser angriff!«
»Es war nicht nur einer. Es waren sieben, die kamen, um mich zu töten.«
»Was hast du mit ihnen gemacht, Anyanwu?«
Sie schien in sich zusammenzusinken bei der Erinnerung. »Ich habe sie getötet«, murmelte sie. »Zur Warnung für alle anderen und weil … weil ich zornig war.«
Doro saß da und beobachtete sie. Er sah den Ausdruck der Qual in ihren Augen. Er konnte sich nicht erinnern, wann er selbst das letzte Mal beim Töten eines Menschen so etwas wie Schmerz empfunden hatte. Zorn oder Wut vielleicht, wenn ein brauchbarer und gesunder Mann aufsässig wurde und getötet werden musste. Zorn und Wut über ein solch sinnloses Ende. Aber Schmerz? Nein, keinen Schmerz.
»Begreifst du jetzt?«, sagte er ruhig. Er wartete eine Weile, dann fragte er: »Wie hast du sie getötet?«
»Mit meinen Händen.« Sie streckte die Hände aus, gewöhnliche Hände, nicht einmal auffallend hässlich, so wie die der alten Frau, in deren Gestalt sie gelebt hatte. »Ich war zornig«, wiederholte sie. »Aber von diesem Augenblick an habe ich mir alle Mühe gegeben, meinen Zorn zu beherrschen.«
»Und was hast du sonst noch gemacht?«
»Warum willst du all diese beschämenden Einzelheiten wissen?«, fragte sie. »Ich habe sie getötet. Sie sind tot. Es waren meine Leute, und ich habe sie getötet.«
»Was ist daran beschämend, die zu töten, die dir ans Leben wollen?«
Anyanwu schwieg.
»Diese sieben sind bestimmt nicht die Einzigen, die du getötet hast.«
Sie seufzte, starrte ins Feuer. »Ich jage ihnen Angst ein, wenn ich kann. Ich töte sie nur im äußersten Notfall. Sie zittern oft vorher schon vor Angst, und es ist ein Leichtes, sie davonzujagen. Ich mache die Leute hier reich und wohlhabend, damit sie für lange Zeit nicht mehr auf die Idee kommen, meinen Tod zu wünschen.«
»Sag mir, wie du die sieben getötet hast!«
Sie erhob sich und ging nach draußen. Inzwischen war es dunkel geworden – tiefe, mondlose Nacht, aber Doro zweifelte nicht daran, dass Anyanwus Augen auch diese Dunkelheit durchdringen konnten. Wohin war sie gegangen und warum?
Sie kam zurück, setzte sich wieder und reichte ihm einen Felsbrocken. »Zerbrich ihn«, sagte sie ausdruckslos.
Es war Felsgestein, das er in der Hand hielt, kein getrockneter Lehm. Und obwohl er ihn mit einem anderen Stein oder einer Eisenstange hätte zertrümmern können, vermochten seine bloßen Hände keinerlei Wirkung auf den Stein auszuüben. Unbeschädigt gab er ihn ihr zurück.
Anyanwu nahm ihn und zermalmte ihn mit einem Druck ihrer Hand.
Er musste diese Frau haben! Sie war wildes Saatgut von der besten Art. Sie würde den Kindern, die er mit ihr zeugte, frisches Blut zuführen. Sie würde für seine ganze Nachkommenschaft eine unerwartete und unvorstellbare Kräftigung bedeuten.
»Komm mit mir, Anyanwu! Du gehörst zu mir und zu dem Volk, das ich sammle. Bei uns bist du unter deinesgleichen. Bei uns brauchst du dich vor niemandem zu fürchten, und du brauchst niemanden zu bestechen, damit er dich am Leben lässt.«
»Ich wurde unter den Menschen hier geboren«, sagte sie. »Ich bin eine von ihnen.« Und hartnäckig wiederholte sie: »Du und ich, wir gleichen uns nicht. Wir passen nicht zueinander.«
»Wir haben mehr Ähnlichkeit miteinander als mit jedem anderen Menschen. Vor allem haben wir es nicht nötig, uns voreinander zu verstecken.« Er betrachtete ihren kraftvollen, muskulösen Jungmännerkörper. »Verwandle dich wieder in eine Frau, und ich werde dir zeigen, dass wir zueinander passen.«
Sie brachte ein schmales Lächeln zustande. »Ich habe mit zehn Ehemännern siebenundfünfzig Kindern das Leben geschenkt«, sagte sie. »Was, glaubst du, kannst du mir noch zeigen?«
»Wenn du mit mir kommst – dessen bin ich sicher –, werde ich dir eines Tages Kinder zeigen können, die du niemals zu Grabe tragen musst.« Er machte eine Pause, sah, dass er nun ihre volle Aufmerksamkeit besaß. »Eine Mutter sollte nicht mit ansehen müssen, wie ihre Kinder älter werden und sterben«, fuhr er fort. »Wenn du lebst, sollten auch sie leben. Es liegt an ihren Vätern, dass sie sterben. Lass mich dir Kinder schenken, die am Leben bleiben.«
Sie bedeckte das Gesicht mit ihren Händen, und einen Moment lang glaubte er, sie weine. Doch dann blickte sie auf, und ihre Augen waren trocken. »Kinder aus deinen geraubten Lenden«, murmelte sie.
»Nicht aus diesen Lenden.« Er wies auf seinen Körper. »Dieser Mann war nichts Besonderes. Ich verspreche dir, wenn du mit mir kommst, werde ich dir Kinder schenken, die von deiner Art sind.«
Ein langes Schweigen folgte. Anyanwu saß da und starrte ins Feuer. Vielleicht war sie dabei, sich zu einem Entschluss durchzuringen. Schließlich sah sie ihn an. Sie musterte ihn mit solcher Eindringlichkeit, dass er anfing, sich unbehaglich zu fühlen unter ihrem Blick. Seine Reaktion belustigte ihn. Er war es eher gewohnt, andere in Verlegenheit zu bringen, ihnen Unbehagen zu bereiten. Er mochte das abschätzende Forschen ihres Blickes nicht – obwohl sie dabei war, sich zu entscheiden, ob sie seinen Vorschlag annehmen sollte oder nicht. Falls er sie lebend bekommen konnte, würde er ihr eines Tages Manieren beibringen müssen.
Erst als sie damit begann, sich Brüste wachsen zu lassen, hatte er die Gewissheit, dass er Sieger geblieben war. Er stand auf, und nachdem die Verwandlung beendet war, zog er sie mit sich zu der Bettstatt.
II
Am nächsten Morgen standen sie bei Tagesanbruch auf. Anyanwu gab Doro ein Buschmesser und versah sich ebenfalls mit einer solchen Waffe. Sie wirkte ruhig und zufrieden, als sie einige ihrer Habseligkeiten in einen länglichen Korb packte. Nun, da ihr Entschluss gefasst war, hatte sie alle Zweifel beiseitegeschoben, obwohl sie sich wegen ihrer Leute immer noch große Sorgen machte.
»Ich werde die Führung übernehmen, bis wir die Dörfer hinter uns gelassen haben«, sagte sie. Sie trug wieder die Gestalt eines jungen Mannes und hatte nach Männerart ein schalartiges Tuch um ihre Hüften geschlungen. »Rings um meine Behausung liegen Dörfer, und für einen Fremden ist es unmöglich, ungesehen bis zu mir vorzudringen. Du hattest großes Glück, dass du auf dem Weg zu mir von niemandem aufgehalten wurdest. Oder vielleicht sollte man sagen: Mein Volk hatte Glück. Und ich möchte, dass dieses Glück bis nach unserem Weggang anhält.«
Er nickte. Solange sie die gewünschte Richtung einhielt, sollte sie ihn führen. Zum Frühstück hatte sie ihm den Kartoffelbrei vom vergangenen Abend vorgesetzt. Und in der Nacht war es ihr gelungen, seinen jungen, starken Körper völlig zu entkräften. »Du bist ein ausgezeichneter Liebhaber«, hatte sie befriedigt festgestellt. »Es ist lange Zeit her, seit ich das letzte Mal mit einem Mann zusammen war.«
Überrascht wurde er sich darüber klar, wie gut ihm diese Worte taten, wie gut ihm die Frau selbst getan hatte. Sie war in verschiedener Hinsicht eine lohnenswerte Entdeckung. Er beobachtete, wie sie einen letzten Blick auf ihre Behausung warf, die sie gefegt und aufgeräumt verließ, wie ihre Augen über den Hof und den Garten wanderten, die trotz ihrer geringen Ausdehnung einen weiträumigen Eindruck machten. Er fragte sie, wie viele Jahre dies alles ihr Zuhause gewesen war.
»Meine Söhne haben mir beim Bau des Hauses und beim Anlegen des Gartens geholfen«, sagte sie leise. »Ich erklärte ihnen, dass ich einen Platz ein wenig abseits von den Behausungen der anderen brauche, um in Ruhe meine Arzneien und Heiltränke herstellen zu können. Alle, außer einem, kamen, um mir zu helfen. Dieser eine war mein Ältester. Er verlangte von mir, dass ich in seinem Kral wohnte, und er war überrascht, dass ich davon nichts wissen wollte. Er ist reich und voller Hochmut, und er ist es gewohnt, dass man auf ihn hört. Selbst dann, wenn er Unsinn redet – was ziemlich oft vorkommt. Er hat nicht das geringste Verständnis für das, was mich angeht. Er begreift mich nicht, und deshalb zeigte ich ihm einige von den Dingen, die ich dir zeigte. Das verschloss ihm den Mund.«
»Das glaube ich gern!« Doro lachte.
»Inzwischen ist er ein sehr alter Mann geworden. Ich glaube, er wird der einzige von meinen Söhnen sein, der mich nicht vermissen wird. Im Gegenteil, er wird froh sein, wenn er feststellt, dass ich nicht mehr da bin. Er und einige andere von meinen Leuten, obgleich sie mir ihren ganzen Reichtum verdanken. Die meisten sind so alt, dass sie sich noch an meine großen Verwandlungen erinnern können – von einer Frau in einen Leoparden und in eine Python. Jetzt haben sie noch ihre Legenden und ihre Furcht.« Sie holte zwei süße Kartoffeln und steckte sie in ihren Korb. Dann holte sie weitere Kartoffeln und warf sie ihren Ziegen hin, die zuerst erschreckt zurückwichen, sich dann aber begierig über das ungewohnte Futter hermachten. »So etwas Gutes haben sie selten zu fressen bekommen«, sagte Anyanwu lachend. Dann wurde sie wieder ernst und trat zu einem niedrigen Schutzdach, unter dem einige Götterfiguren aus Lehm standen.
»Die stehen hier meiner Leute wegen«, erklärte sie Doro. »Diese hier und einige Figuren drinnen.« Sie zeigte zu ihrem Haus hinüber.
»Ich habe drinnen keine Einzige davon gesehen.«
Obwohl ihr Gesichtsausdruck ernst blieb, erschien ein Lächeln in ihren Augen. »Du hast beinahe darauf gesessen.«
Alarmiert versuchte er, sich zu erinnern. Für gewöhnlich bemühte er sich, die religiösen Überzeugungen anderer zu respektieren. Anyanwu machte nicht den Eindruck eines besonders religiösen Menschen, aber der Gedanke, so nahe an irgendwelche Kultgegenstände herangekommen zu sein, dass er sich fast daraufgesetzt hätte, bestürzte ihn.
»Meinst du die beiden Lehmgebilde in der Ecke?«
»Die«, erwiderte sie nur. »Meine Mütter.«
Ahnenbilder. Jetzt erinnerte er sich. Unwillig schüttelte er den Kopf. »Ich werde sorglos«, sagte er in englischer Sprache.
»Was hast du gesagt?«
»Dass es mir leidtut. Ich bin zu lange von deinem Volk fort gewesen.«
»Es ist nicht weiter schlimm. Ich sagte schon, diese Dinge stehen hier mehr wegen der anderen. Ich muss immer ein wenig lügen. Sogar in meinem eigenen Haus.«
»Das ist vorbei«, sagte er.
»Diese Stadt wird denken, ich sei endlich tot«, meinte sie und starrte nachdenklich auf die Götterfiguren. »Vielleicht werden sie mir einen Schrein errichten und ihm meinen Namen geben. Andere Städte haben das gemacht. Und in den Nächten, wenn die Schatten tanzen und der Wind die Zweige der Bäume bewegt, können sie einander erzählen, mein Geist sei ihnen erschienen.«
»Ein Schrein, in dem dein Geist wohnt, wird ihnen lange nicht so viel Angst einflößen wie die leibhaftige Anyanwu, vermute ich.«
Mit einem wehmütigen Lächeln schritt Anyanwu vor ihm her durch das Hoftor. Sie traten den Weg durch ein Labyrinth von Fußpfaden an, die so schmal waren, dass sie die meiste Zeit hintereinandergehen mussten. Anyanwu trug ihren Korb auf dem Kopf. An ihrer Seite baumelte in einer Scheide das Buschmesser. Beide waren barfuß, und der Staub zwischen den hohen Bäumen verschluckte das Geräusch ihrer Schritte. Es gab nichts, das Anyanwus hoch entwickeltes Gehör beeinträchtigte. Einige Male blieb sie lauschend stehen. Dann verließen sie den Pfad und versteckten sich in den Büschen, um nicht von den Menschen gesehen zu werden, die ihnen entgegenkamen. Meist waren es Gruppen von Frauen und Kindern mit Wasserkrügen und Brennholzbündeln auf dem Kopf. Auch Männer mit Hacken und Buschmessern waren unterwegs. Es war, wie Anyanwu gesagt hatte: Sie befanden sich mitten in ihrer Stadt und waren umgeben von zahlreichen Ortschaften. Ein Europäer würde nichts von einer Stadt bemerkt haben, da es fast kaum Häuser oder Hütten zu sehen gab. Doch auf seinem Weg zu Anyanwu hatte Doro viele Dörfer durchwandert, war an großen und kleinen Gehöften vorübergekommen. Manchmal hatte er sie dreist und unerschrocken durchquert, so als hätte er ein Recht dazu. Glücklicherweise hatte niemand ihn bedroht, da er zielbewusst und entschlossen seinen Weg verfolgt hatte. Wenn er sich dagegen als Fremder vor den Leuten versteckt oder den Eindruck erweckt hätte herumzuspionieren, wäre es gewiss zu einer Katastrophe gekommen. Während Doro hinter Anyanwu herging, beschlich ihn die Sorge, dass es Verdruss geben könnte, weil er vielleicht den Körper eines ihrer Verwandten trug. Er war erleichtert, als sie ihm sagte, dass sie das Territorium ihres Volkes hinter sich gelassen hatten.
Nun konnte Anyanwu belebtere Wege benutzen. Auch hier kannte sie sich aus. Sie hatte entweder früher einmal in diesem Gebiet gewohnt oder eine ihrer Töchter lebte jetzt hier. Einmal erzählte sie Doro von einer Tochter, die einen gut aussehenden, starken, aber faulen jungen Mann geheiratet hatte, ihm dann jedoch fortlief, um mit einem ganz unansehnlichen, aber strebsamen Mann zusammenzuleben. Er hörte ihr eine Weile zu, dann fragte er: »Wie viele deiner Kinder haben das Erwachsenenalter erreicht, Anyanwu?«
»Alle«, antwortete sie voller Stolz. »Alle waren gesund und kräftig, und keins von ihnen trug einen verbotenen Makel an sich.«