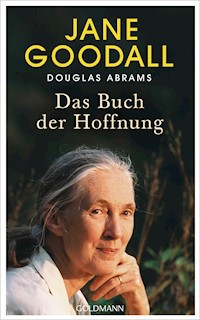9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Jane Goodall hat unsere Vorstellungen von der Verbindung zwischen Mensch und Schimpanse für immer verändert. Die berühmte Verhaltensforscherin hat Schimpansen als Erste als Individuen betrachtet und revolutionierte so ihr Fachgebiet. Es ist Goodall zu verdanken, dass wir heute wissen, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen und komplexe soziale Hierarchien bilden. Die Neuauflage ihres 1971 erstmals erschienenen Buchs erzählt von den Anfängen ihrer Feldstudien im Gombe-Nationalpark in Tansania und ist in seinem Einsatz für Umwelt- und Artenschutz so aktuell wie eh und je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Ähnliche
Jane Goodall
Wilde Schimpansen
Verhaltensforschung am Gombe-Strom
Aus dem Englischen von Mark W. Rien
Über dieses Buch
Jane Goodall hat unsere Vorstellungen von der Verbindung zwischen Mensch und Schimpanse revolutioniert. Ohne jede akademische Ausbildung reiste die heute weltberühmte Verhaltensforscherin in den 1960er-Jahren nach Tansania, um dort aus nächster Nähe Schimpansen zu beobachten. Erst seit Goodalls unorthodoxen Feldstudien wissen wir, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen und herstellen, gemeinsam auf die Jagd gehen und komplexe soziale Bindungen eingehen – genau wie wir Menschen.
Spannend und einfühlsam erzählt Goodall von ihren Anfängen im Gombe-Nationalpark und schildert, wie sie nach anfänglichen Rückschlägen das Vertrauen der Schimpansen gewinnt. Hautnah erlebt man mit, wie sie den charakterlich so unterschiedlichen Tieren so nahe kommt wie nie jemand zuvor und auf diese Weise ganz neue Erkenntnisse erlangt. Ein Forschungsabenteuer, das sich so packend liest wie ein Roman.
«Jane Goodall ist eine lebende Legende.» Der Spiegel
Vita
Jane Goodall wurde am 3. April 1934 in England geboren. 1957 reiste sie zum ersten Mal nach Afrika und begann ab 1960, das Verhalten wildlebender Schimpansen im Gombe-Nationalpark in Tansania zu untersuchen. 1965 promovierte sie an der Universität in Cambridge zum Thema Verhaltensbiologie. Für ihre bahnbrechenden Erkenntnisse über das Leben der Schimpansen erhielt sie viele Preise und Orden, wurde 2004 von der Queen geadelt und ist UN-Friedensbotschafterin. Sie ist Gründerin des Jane Goodall Institute, einer internationalen Tier- und Umweltschutzorganisation, und begeistert mit dem «Roots & Shoots»-Programm auch Kinder und Jugendliche für ein ökologisches Engagement. Ihre Bücher über Verhaltensforschung und und ihre Kinderbücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Wenn sie nicht auf Vortragsreisen ist, lebt Jane Goodall heute im englischen Bournemouth.
Inhaltsübersicht
Für Hugo, Vanne und Louis und dem Andenken an David Greybeard
Vorspiel
Seit dem Morgengrauen war ich die steilen Berghänge hinauf- und hinabgestiegen, hatte ich mir meinen Weg durch die dichten Wälder des Tals gebahnt. Wieder und wieder war ich stehen geblieben, um zu horchen oder mit dem Feldstecher die Umgebung abzusuchen. Aber ich hatte nicht einen einzigen Schimpansen gehört oder gesehen, und inzwischen war es bereits fünf Uhr. In zwei Stunden würde die Dunkelheit über das zerklüftete Gelände des Gombe Stream Reserve hereinbrechen. In der Hoffnung, wenigstens einen Schimpansen zu entdecken, der sein Nest für die Nacht baute, ließ ich mich an dem Platz nieder, von dem aus ich am liebsten Ausschau hielt: auf meinem «Gipfel».
Ich beobachtete eben einen Trupp Paviane in dem bewaldeten Tal unter mir, als ich plötzlich das Geschrei eines jungen Schimpansen hörte. Schnell suchte ich mit meinem Feldstecher die Bäume ab. Doch bevor ich genau ausmachen konnte, woher der Lärm kam, war er bereits verstummt, und es kostete mich einige Minuten angestrengten Spähens, ehe ich vier Schimpansen entdeckte. Die kleine Streiterei war vorüber, und sie kauten friedlich gelbe, pflaumenähnliche Früchte.
Ich saß zu weit weg, als dass ich Einzelheiten hätte beobachten können. Deshalb entschloss ich mich zu dem Versuch, näher an sie heranzukommen. Vorsichtig suchte ich die Bäume ab, bei denen sich die Gruppe aufhielt: Wenn es mir gelänge, überlegte ich, den großen Feigenbaum zu erreichen, ohne die Schimpansen zu verscheuchen, dann könnte ich sie großartig beobachten. Ich brauchte etwa zehn Minuten, um zu dem Baum zu gelangen. Als ich behutsam um den dicken, knorrigen Stamm herumschlich, bemerkte ich, dass die Schimpansen verschwunden waren; die Äste des Baums mit den pflaumenartigen Früchten waren leer, und wieder stellte sich das inzwischen wohlvertraute Gefühl der Niedergeschlagenheit ein. Wieder einmal hatten mich die Schimpansen gesehen und waren lautlos geflohen.
Plötzlich blieb mein Herz einen Augenblick lang stehen.
Keine achtzehn Meter weit weg saßen zwei Schimpansenmännchen auf dem Boden und sahen mich forschend an. Ich wagte kaum zu atmen und wartete auf die panische Flucht, die für gewöhnlich das Ende solcher unerwarteten Begegnungen auf so knappe Distanz war. Aber nichts dergleichen geschah. Die beiden großen Schimpansen fuhren ganz einfach fort, mich anzustarren. Langsam ließ ich mich nieder, und wenig später fingen die beiden an, sich in aller Ruhe gegenseitig das Fell zu pflegen.
Während ich – immer noch ein wenig zweifelnd, ob ich meinen Augen trauen konnte – dasaß und ihnen zusah, entdeckte ich zwei weitere Schimpansen, die jenseits der kleinen Lichtung ihre Köpfe aus dem Gras hervorstreckten und zu mir herüberspähten: ein Weibchen und ein Jungtier. Als ich ihnen mein Gesicht zuwandte, zogen sie rasch die Köpfe ein, aber schon bald tauchte erst der eine, dann der andere in den unteren Zweigen eines Baumes, der knapp vierzig Meter von mir entfernt stand, wieder auf. Dort blieben sie fast regungslos sitzen und beobachteten mich.
Über ein halbes Jahr hatte ich versucht, die angeborene Furcht zu überwinden, die die Schimpansen vor mir hatten, jene Furcht, die sie veranlasste, im dichten Gestrüpp zu verschwinden, sobald ich mich ihnen näherte. Zuerst hatten sie schon die Flucht ergriffen, wenn mich noch 500 Meter und obendrein eine Schlucht von ihnen trennten. Jetzt saßen zwei Männchen so nahe bei mir, dass ich sie fast atmen hören konnte.
Kein Zweifel, es war der stolzeste Augenblick, den ich bis dahin erlebt hatte. Die beiden prachtvollen Geschöpfe, die sich da unmittelbar vor meinen Augen gegenseitig «lausten», hatten mich akzeptiert. Ich kannte sie beide: David Greybeard, der stets am wenigsten Furcht vor mir gezeigt hatte, war der eine; der andere war Goliath. Er war nicht der Gigant, den sein Name vermuten lässt, aber er hatte einen imponierenden Körperbau und war das ranghöchste aller Männchen. Das Fell der beiden schimmerte glänzend schwarz im Dämmerlicht des Abends.
Länger als zehn Minuten saßen David Greybeard und Goliath da und lausten sich. Dann, kurz bevor in meinem Rücken die Sonne hinter dem Horizont verschwand, stand David auf und starrte mich an. Und so geschah es, dass mein vom Abendlicht verlängerter Schatten über ihn fiel. Die Faszination des ersten engen Kontakts mit einem in Freiheit lebenden Schimpansen und der seltsame Zufall, der meinen Schatten über David warf, während er mir forschend in die Augen zu blicken schien: All das prägte sich tief in mein Gedächtnis ein. Später gewann dieser Augenblick eine fast allegorische Bedeutung für mich; denn unter allen Lebewesen, die heute die Erde bevölkern, ist es allein der Mensch mit seinem überlegenen Gehirn, seinem überlegenen Verstand, der den Schimpansen in den Schatten stellt. Allein der Mensch mit seinen Gewehren und seinem Siedlungs- und Zivilisierungsdrang wirft seinen verhängnisvollen Schatten über die Freiheit des Schimpansen in den Wäldern. In jenem Augenblick indessen kam mir dieser Gedanke nicht. Ich sah nur David und Goliath.
Die Niedergeschlagenheit und die Verzweiflung, die mich während der vorausgegangenen Monate so oft überkommen hatten, waren nichts im Vergleich zu dem Gefühl des Triumphs, das mich erfüllte, als ich, nachdem die Gruppe schließlich davongezogen war, in der hereinbrechenden Dunkelheit den Berghang hinunter zu meinem Zelt am Seeufer hastete.
Begonnen hatte alles drei Jahre zuvor, als ich in Nairobi den berühmten Anthropologen und Paläontologen Louis Leakey kennenlernte. Vielleicht hatte es auch schon in meiner frühesten Kindheit begonnen. Ich war kaum mehr als ein Jahr alt, als mir meine Mutter einen von den großen, zottigen Spielzeugschimpansen schenkte, mit denen die Geburt des ersten Schimpansenbabys im Londoner Zoo gefeiert wurde. Die meisten Freunde meiner Mutter waren entsetzt und prophezeiten, dass die scheußliche Kreatur ihrer kleinen Tochter Albträume bescheren werde. Aber Jubilee (so hieß das gefeierte Affenbaby) wurde zu meinem kostbarsten Besitz, den ich während meiner ganzen Kindheit mit mir herumschleppte. Und noch heute zählt der Veteran zu meinen Besitztümern.
Aber auch lebende Tiere haben mich seit meinen ersten Kriechversuchen fasziniert. Ja, zu meinen frühesten Erinnerungen gehört der Tag, an dem ich mich in einem kleinen muffigen Hühnerstall versteckte, um herauszufinden, wie ein Huhn es fertigbrachte, ein Ei zu legen. Als ich an die fünf Stunden später stolz wieder zum Vorschein kam, erfuhr ich, dass der gesamte Haushalt stundenlang nach mir gesucht hatte und dass meine Mutter sogar die Polizei angerufen hatte, um mein Verschwinden zu melden.
Es muss etwa vier Jahre nach diesem denkwürdigen Tag gewesen sein, als ich den Entschluss fasste, sobald ich erwachsen wäre, nach Afrika zu reisen und mit wilden Tieren zu leben. Und wenn ich auch, nachdem ich mit achtzehn die Schule verlassen hatte, einen Sekretärinnenkurs besuchte und dann zwei verschiedene Arbeitsstellen übernahm, war meine Sehnsucht nach Afrika immer noch so groß, dass ich, als ich die Einladung erhielt, mit einer Schulfreundin nach Kenia zu fahren und dort auf der Farm ihrer Eltern zu leben, noch am gleichen Tag meine Kündigung einreichte. Ich gab einen interessanten, wenn auch schlecht bezahlten Posten in einem Dokumentarfilmstudio auf, um während der Sommersaison in meiner Heimatstadt Bournemouth als Serviererin mein Geld für die Überfahrt nach Afrika zu verdienen.
«Wenn du dich für Tiere interessierst», sagte irgendjemand etwa einen Monat nach meiner Ankunft in Afrika zu mir, «dann musst du Dr. Leakey kennenlernen.» Ich hatte damals bereits einen ziemlich trostlosen Bürojob angenommen, weil ich die Gastfreundschaft der Eltern meiner Freundin nicht allzu sehr hatte strapazieren wollen. Ich sehnte mich danach, endlich den wilden Tieren zu begegnen. Denn Tiere, wilde Tiere – das war für mich Afrika.
Ich suchte Leakey im Museum für Naturgeschichte auf, dessen Kurator er zu jener Zeit war. Irgendwie muss er gespürt haben, dass mein Interesse für Tiere nicht nur eine vorübergehende Vorliebe war, sondern etwas, das tiefer ging. Jedenfalls, er engagierte mich vom Fleck weg als Assistentin und Sekretärin.
Ich lernte eine Menge, während ich am Museum arbeitete: Die Mitarbeiter waren ohne Ausnahme begeisterte Naturforscher, die nur zu gern bereit waren, etwas von ihrem ungeheuren Wissen mit mir zu teilen. Das Beste aber war, dass mir die Gelegenheit geboten wurde, zusammen mit einem anderen Mädchen Leakey und seine Frau Mary auf einer ihrer jährlichen paläontologischen Expeditionen zur Oldowayschlucht in der Serengeti zu begleiten. In jenen Tagen vor der Erschließung der Serengeti für die Touristen, vor der Entdeckung des Zinjanthropus, des «Nussknacker-Menschen» und des Homo habilis in der Oldowayschlucht war dieses Gebiet noch absolut unwegsam. An die Straßen, Reisebusse und Flugzeuge, die heute die Serengeti zugänglich machen, dachte damals noch kein Mensch. Was wir unternahmen, war eine echte Expedition ins «tiefste Afrika», wie ich sie mir seit meiner Kindheit erträumt hatte.
Die Ausgrabungsarbeiten waren an sich schon faszinierend. Wenn ich Stunden um Stunden den uralten Lehm oder das Gestein des Oldowaybruchs mit der Hacke bearbeitete, um die Überreste von Kreaturen ans Licht zu bringen, die vor Millionen von Jahren gelebt hatten, so war das reine Routinearbeit. Von Zeit zu Zeit aber erfüllte mich der Anblick oder der Tasteindruck eines Knochens, den ich in meiner Hand hielt, mit tiefer Ehrfurcht. Dieser Knochen war einmal Teil eines lebenden, atmenden Tiers gewesen, das sich fortbewegt, geschlafen, sich fortgepflanzt hatte. Wie hatte es tatsächlich ausgesehen? Welche Haarfarbe hatte es gehabt? Was für einen Körpergeruch? Solche und ähnliche Fragen gingen mir durch den Kopf – Fragen, die die Wissenschaft vermutlich niemals wird beantworten können.
Es waren die Abende, die jenen wenigen Monaten für mich ihren besonderen Zauber gaben. Wenn gegen sechs Uhr die harte Tagesarbeit beendet war, konnten meine Mitassistentin Gillian und ich über die ausgedörrte Ebene oberhalb der Schlucht, in der wir den ganzen Tag geschwitzt hatten, zum Camp zurückgehen. In der Trockenzeit wird Oldoway fast zur Wüste, aber wenn wir an den niedrigen Dornbüschen vorbeigingen, sahen wir nicht selten Dikdiks, jene anmutigen Zwergantilopen, die kaum größer sind als ein Hase. Manchmal lief uns auch eine kleine Herde von Gazellen oder Giraffen über den Weg, und gelegentlich hatten wir sogar das Glück, ein schwarzes Rhinozeros unten in der Schlucht dahinstampfen zu sehen. Einmal begegneten wir einem jungen männlichen Löwen: Kaum fünfzehn Schritt trennten uns von ihm, als wir sein leises Knurren hörten, vorsichtig den Kopf wendeten und ihn hinter einem kleinen Gebüsch entdeckten. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde mir die volle Bedeutung des Ausdrucks «Mein Herz stand still» bewusst. Wir waren unten auf dem Grund der Schlucht, wo die Vegetation streckenweise verhältnismäßig dicht ist. Als wir uns langsam zurückzogen, beobachtete er uns, wobei sein Schwanz ruckartig hin und her zuckte. Als wir dann behutsam durch die Schlucht gingen, um auf die offene, baumlose Ebene auf der anderen Seite zu gelangen, setzte er sich in Bewegung, um uns – vermutlich aus Neugier – zu folgen. Als wir aufzusteigen begannen, verschwand er im Busch, und wir sahen ihn nicht wieder.
In dieser Zeit muss Leakey zu dem Schluss gekommen sein, in mir den Menschen gefunden zu haben, nach dem er beinahe zwanzig Jahre gesucht hatte: jemand, der zutiefst fasziniert war von Tieren und ihrem Verhalten; jemand, der ohne die geringsten Schwierigkeiten über längere Zeiträume hinweg auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation verzichten konnte. Denn gegen Ende der Ausgrabungsperiode in der Oldowayschlucht zog er mich in ein Gespräch über eine Gruppe von wilden Schimpansen, die am Ufer des Tanganjikasees lebte.
Wilde Schimpansen kommen nur in Afrika vor. Ihr Lebensraum ist der tropische Regenwald am Äquator von der Küste Westafrikas bis zu einem Punkt am Ostufer des Tanganjikasees. Die Gruppe, von der mir Louis erzählte, gehört zu der östlichen oder langhaarigen Form der Schimpansengattung. In der zoologischen Systematik hat diese Unterart den wissenschaftlichen Namen Pan troglodytes schweinfurthi bekommen. Louis beschrieb ihr Wohngebiet als bergig, schroff und völlig abgeschnitten von der Zivilisation, und er wies nachdrücklich darauf hin, welche Hingabe und Geduld jeder Versuch erfordern würde, die Lebensgewohnheiten dieser wilden Schimpansen zu erforschen.
Erst ein einziger Mensch, so erfuhr ich von Louis, hatte bis dahin ernsthaft versucht, das Verhalten der Schimpansen in freier Wildbahn zu studieren. Und Henry Nissen, der diese Pionierarbeit unternahm, hatte im damals französischen Guinea die Schimpansen nur zweieinhalb Monate lang in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Louis meinte, dass in so kurzer Zeit niemand befriedigende Aufschlüsse erwarten könne – um wirkliche Ergebnisse zu erzielen, brauche man mindestens zwei Jahre. Besonders interessant sei für ihn, erklärte Louis mir damals bei unserem ersten langen Gespräch darüber, das Verhalten einer Gruppe wilder Schimpansen, die nahe an einem See lebt; denn an Seeufern hätten sich vielfach die Überreste von vorgeschichtlichen Menschen gefunden, und so könne vielleicht die Erforschung des Verhaltens heutiger Schimpansen einiges Licht bringen in die Frage nach dem Verhalten unserer steinzeitlichen Vorfahren.
Während er so sprach, ahnte ich wahrscheinlich schon, was kommen würde, und doch konnte ich einfach nicht glauben, dass er es ernst meinte, als er mich nach einer Pause fragte, ob ich bereit sei, die Aufgabe zu übernehmen. Denn obwohl eine solche Aufgabe genau das war, was ich mir immer am meisten gewünscht hatte, war mir natürlich klar, dass ich völlig unqualifiziert war für die wissenschaftliche Verhaltensforschung an Tieren.
Louis jedoch wusste genau, was er tat. Er war der Meinung, dass ein Universitätsstudium nicht nur unnötig war, sondern in mancher Hinsicht sogar von Nachteil sein konnte. Er brauchte jemand, dessen Verstand nicht von Theorien verwirrt und voreingenommen war, jemand, der die Aufgabe einzig und allein aus einem echten Wissensdrang heraus anging und der außerdem ein einfühlsames Verständnis für Tiere mitbrachte.
Nachdem ich mich vorbehaltlos und begeistert bereit erklärt hatte, die Arbeit zu übernehmen, machte sich Louis an die schwierige Aufgabe, die nötigen Geldmittel zu beschaffen. Er musste jemanden finden, der sich zum einen von der Notwendigkeit des Forschungsvorhabens an sich überzeugen ließ und zum anderen davon, dass ausgerechnet ein junges Mädchen ohne jede fachliche Vorbildung die richtige Person für dieses Unternehmen war. Schließlich jedoch erklärte sich die Wilkie Foundation in Illinois bereit, eine Summe zur Verfügung zu stellen, von der die Kosten für ein kleines Boot, ein Zelt, Flugtickets und die ersten sechs Monate meiner Feldstudien bestritten werden konnten. Ich werde Mr. Leighton Wilkie stets dankbar sein dafür, dass er mir, nur im Vertrauen auf Louis’ Urteilsfähigkeit, die Chance gab, mich zu bewähren.
Ich war inzwischen wieder in England, aber sobald ich die Nachricht erhielt, bereitete ich mich auf meine Rückkehr nach Afrika vor. Die Regierungsbeamten in Kigoma, in deren Gebiet ich arbeiten wollte, hatten sich mit meinem Forschungsprojekt einverstanden erklärt. In einem Punkt jedoch waren sie unerbittlich: Sie wollten nichts davon hören, dass ein junges englisches Mädchen ohne europäische Begleitung allein im Busch leben wollte. So erklärte sich meine Mutter, Vanne Goodall, die schon einmal für ein paar Monate in Afrika gewesen war, bereit, mich bei meinem neuen Unternehmen zu begleiten.
Nach unserer Ankunft in Nairobi verlief zunächst alles planmäßig. Das Gombe Stream Chimpanzee Reserve (heute Gombe National Park), die Heimat meiner Schimpansengruppe, fiel unter die Zuständigkeit des Tanganyika Game Department, und der Chief Game Warden war überaus hilfsbereit. Er schickte mir die Genehmigung für meine Arbeit im Reservat und dazu mancherlei nützliche Informationen über die Bedingungen, die dort herrschten – über die Höhenlage und die Temperatur, über die Bodenbeschaffenheit und die Vegetation und über die Tiere, denen ich dort begegnen konnte. Inzwischen hatten wir die Nachricht erhalten, dass das kleine Aluminiumboot, das Louis gekauft hatte, sicher in Kigoma angekommen war. Und Bernard Verdcourt, der Direktor des East African Herbarium, erklärte sich bereit, Vanne und mich nach Kigoma zu fahren: Er könne unterwegs Pflanzen sammeln und auch in dem botanisch so gut wie unerforschten Gebiet um Kigoma.
Unsere Vorbereitungen für den Aufbruch waren gerade abgeschlossen, als der erste Rückschlag kam. Der Distriktkommissar des Kigoma-Gebietes teilte uns mit, dass am Ufer des Tanganjikasees, dort, wo das Schimpansenreservat war, Streitigkeiten zwischen den afrikanischen Fischern ausgebrochen seien. Der für das Gebiet zuständige europäische Game Ranger sei hingefahren, um die Sache in Ordnung zu bringen. Bevor die Ruhe nicht wiederhergestellt sei, könne ich unmöglich mit meiner Arbeit beginnen.
Zum Glück für meinen inneren Frieden machte Louis sofort den Vorschlag, ich solle zunächst für kurze Zeit probeweise das Verhalten der Meerkatzen auf einer Insel im Viktoriasee beobachten. Eine Woche später schon tuckerten Vanne und ich gemächlich in seinem Motorboot durch das flache trübe Wasser des Sees zum unbewohnten Lolue Island. Bei uns waren Hassan, der Kapitän der kleinen Barkasse, und sein Helfer, beides Afrikaner vom Kakamega-Stamm. Hassan, der später auch mit mir ins Schimpansenreservat zog, ist ein prachtvoller Kerl. Er ist nie aus der Ruhe zu bringen, strahlt stets eine gewisse Würde aus, ist absolut zuverlässig und ehrlich, hat einen ausgeprägten Sinn für Humor und ist intelligent – alles Eigenschaften, die ihn zu einem großartigen Weggefährten machen. Er hatte damals schon fast dreißig Jahre für Louis gearbeitet.
Drei Wochen vergingen, ehe man uns über Funk nach Nairobi zurückrief, und diese drei Wochen waren voller Zauber. Die Nächte verbrachten wir auf dem Boot, das dicht am Strand vor Anker lag, und die sanften Wellen des Sees wiegten uns in den Schlaf. Jeden Morgen kurz vor Sonnenaufgang ruderte mich Hassan in dem kleinen Dingi an Land, und ich blieb bis zum Abend – bei hellem Mondlicht sogar bis in die Nacht hinein – auf der Insel und beobachtete die Affen. Dann traf ich mich mit Hassan am Strand, und er ruderte mich zum Boot zurück. Bei einem bescheidenen Abendessen, das gewöhnlich aus gebackenen Bohnen, Eiern oder Würstchen aus Dosen bestand, tauschten Vanne und ich die Neuigkeiten vom Tage aus.
Da ich ein Buch über Schimpansen schreiben will, ist hier nicht der rechte Ort, von den sechzehn Affen meiner kleinen Horde und ihrem faszinierenden Verhalten zu berichten. Immerhin lernte ich während meines kurzen Aufenthalts auf der Insel unter anderem eine ganze Menge darüber, wie man im Freiland Notizen macht, welche Kleidung am zweckmäßigsten ist, welche Bewegungen ein in Freiheit lebender Affe bei einem Menschen, der ihn beobachtet, toleriert und welche nicht. Wenn auch die Schimpansen in vieler Hinsicht ganz anders reagierten, so kamen mir doch die Kenntnisse, die ich auf Lolue sammeln konnte, sehr zustatten, als ich mit meiner Arbeit am Gombe begann.
Irgendwie tat es mir doch leid, als eines Abends die ersehnte Nachricht kam; denn sie bedeutete, dass ich die Meerkatzen gerade in dem Augenblick verlassen musste, als mir die einzelnen Tiere der Gruppe vertraut geworden waren und ich begann, etwas über ihr Verhalten zu lernen. Es ist nie erfreulich, eine Arbeit unvollendet beiseitezulegen. Als wir jedoch erst in Nairobi waren, dachte ich an nichts anderes mehr als an das Abenteuer der Reise über 1200 Kilometer nach Kigoma – und an die Schimpansen. Da schon vor unserer Abfahrt nach Lolue fast alles vorbereitet gewesen war, dauerte es nur wenige Tage, bis wir uns mit Bernard Verdcourt auf den Weg nach Kigoma machen konnten.
Die Reise selbst verlief ohne besondere Zwischenfälle, wenn man von drei kleineren Pannen absieht und davon, dass der Landrover mit unserer Ausrüstung so überladen war, dass er bei schneller Fahrt gefährlich ins Schlingern geriet. Als wir jedoch nach drei Tagen auf staubigen Straßen in Kigoma ankamen, herrschte in der ganzen Stadt das Chaos: Seit unserer Abfahrt in Nairobi war es im Kongo, dessen Grenze keine vierzig Kilometer westlich von Kigoma, am gegenüberliegenden Ufer des Tanganjikasees, verläuft, zu Gewalttätigkeiten und Blutvergießen gekommen, sodass ganze Schiffsladungen von belgischen Flüchtlingen in Kigoma Zuflucht suchten. Es war Sonntag, als wir zum ersten Mal die von Schatten spendenden Mangobäumen gesäumte einzige große Straße der Stadt hinunterfuhren. Alles war geschlossen, und kein Vertreter der Behörden, der uns hätte helfen können, war aufzutrei ben.
Schließlich aber machten wir den Distriktkommissar ausfindig, der uns nachdrücklich, wenn auch mit Bedauern, erklärte, dass vorerst keinerlei Aussicht für mich bestünde, ins Schimpansenreservat vorzudringen. Man müsse zunächst abwarten und herausfinden, wie die Afrikaner im Kigoma-Distrikt auf die Nachricht von den Unruhen im Kongo reagieren würden. Das war ein harter Schlag, aber wir hatten keine Zeit, Trübsal zu blasen.
Wir besorgten uns Einzelzimmer in einem der beiden Hotels, aber mit diesem Luxus sollte es schon bald ein Ende haben. Am Abend traf ein weiteres Schiff voller Flüchtlinge ein, und jeder Quadratzentimeter Raum wurde gebraucht. Vanne und ich zogen zusammen und begnügten uns mit dem bisschen Platz, das noch übrig war, nachdem wir unsere gesamte Ausrüstung vom Landrover abgeladen und in unsere Unterkunft gebracht hatten. Bernard teilte sein Zimmer mit ein paar heimatlosen Belgiern, und wir holten sogar unsere drei Zeltbetten heraus und liehen sie dem bedrängten Hotelbesitzer. Sämtliche Zimmer waren überbelegt, aber die Flüchtlinge, die in ihnen auf engstem Raum hausten, waren geradezu im Paradies, verglichen mit jenen, die vorübergehend in dem riesigen Lagerhaus untergebracht wurden, in dem sich für gewöhnlich die Schiffsfracht stapelte, die über den See zum Kongo gebracht werden sollte oder die vom Kongo herüberkam. In diesem Speicher schliefen sie in langen Reihen auf Matratzen oder, in Bettlaken gehüllt, auf dem Zementboden und standen zu Hunderten Schlange, um die dürftigen Mahlzeiten entgegenzunehmen, die Kigoma für sie bereitstellen konnte.
Sehr bald schon hatten Vanne, Bernard und ich mit einigen Einwohnern der Stadt Bekanntschaft geschlossen. Es versteht sich von selbst, dass wir uns erboten, beim Heranschaffen und Verteilen der Lebensmittel behilflich zu sein, und man war nur zu gerne bereit, unsere Hilfe anzunehmen. Am zweiten Abend in Kigoma belegten wir drei, zusammen mit ein paar anderen Helfern, zweitausend Sandwiches mit Büchsenfleisch. Die Sandwiches wurden stapelweise sorgfältig in feuchte Tücher gewickelt und in großen Weißblechkisten verstaut, die dann auf Karren zum Lagerhaus transportiert wurden. Später halfen wir dabei, sie zusammen mit Suppe, Früchten, Schokolade, Zigaretten und Getränken an die Flüchtlinge zu verteilen. Seit jenem Tag habe ich eine unüberwindliche Abneigung gegen Büchsenfleisch.
Zwei Abende später waren die meisten der Flüchtlinge wieder fort; in Sonderzügen hatte man sie in die Hauptstadt von Tanganjika, nach Daressalam, gebracht. Das hektische Treiben war vorüber, aber man erlaubte uns immer noch nicht, zum Schimpansenreservat aufzubrechen. Die Situation begann für uns alle ein wenig deprimierend zu werden. Meine Geldmittel waren zu knapp bemessen, als dass Vanne und ich auch weiterhin im Hotel hätten wohnen können. Deshalb entschlossen wir uns, irgendwo zu zelten. Als wir uns erkundigten, wo wir ein Zelt aufschlagen könnten, wies man uns das Gelände des Gefängnisses von Kigoma an! Das war freilich keineswegs so schlecht, wie es zunächst klingt; denn dieses Gebäude bestand aus herrlich gepflegten Anlagen mit Blick über den See, und überall standen Zitrusbäume, deren Zweige zu dieser Jahreszeit unter dem Gewicht süß duftender Orangen und Mandarinen ächzten. Nur die Moskitos am Abend waren eine Plage.
Während dieser Zeit der erzwungenen Untätigkeit lernten wir die kleine Stadt Kigoma – nach europäischen oder amerikanischen Maßstäben eher ein Dorf – recht gut kennen. Das Zentrum lag unten am Seeufer, wo der natürliche Hafen den Schiffen nach Burundi, Sambia, Malavi und dem Kongo Ankerplätze bietet. Auch die Verwaltungsgebäude, der Bahnhof und die Post liegen nahe am See.
Das reizvollste Schauspiel aller kleinen Städte Afrikas ist der farbenprächtige Obst- und Gemüsemarkt, auf dem die Ware in kleinen Haufen genau abgezählt und, mit Preisen versehen, feilgeboten wird. In Kigoma verfügten die wohlhabenderen Händler über ansehnliche, durch ein Zeltdach geschützte Verkaufsstände aus massiven Steinmauern, während die andern auf der roten Erde des Hauptmarktes saßen und ihre Waren säuberlich auf Sackleinen ausgebreitet hatten oder auf dem nackten Boden. Bananen, grüne und gelbe Orangen und die dunkelroten, runzligen Beeren der Passionsblume wurden in verschwenderischer Fülle angeboten. Daneben reihten sich Flaschen und Krüge mit rot schimmerndem Speiseöl, das aus den Früchten der Ölpalme gewonnen wird.
Der Stolz Kigomas ist die Hauptstraße, die vom Verwaltungszentrum am See hinauf mitten durch die Stadt führt und zu beiden Seiten von großen, schattigen Mangobäumen und zahllosen winzigen Läden flankiert wird, die man in Ostafrika dukhas nennt. Als wir durch Kigoma bummelten, fragten wir uns immer wieder, wie so viele Läden existieren konnten, wo doch alle das Gleiche verkauften. Überall sahen wir Kessel und Töpferwaren, Turnschuhe und Hemden, Taschenlampen und Wecker. Und in den meisten Läden leuchteten jene quadratischen farbenprächtigen Tücher, die kangas genannt und von den afrikanischen Frauen paarweise gekauft wurden. Das eine Quadrat wird unter den Armen um den Körper gewickelt und hängt so weit herab, dass es eben die Knie bedeckt; das zweite wird turbanartig um den Kopf geschlungen. Vor einigen dukhas arbeiteten Schneider an Nähmaschinen mit Fußantrieb. Vor einem winzigen Laden saß ein alter Inder, der Schuhe nähte, klebte und besohlte und dabei mit den Füßen wie mit einem zusätzlichen Händepaar das Leder festhielt. Er war so geschickt, dass es ein Vergnügen war, ihm zuzusehen.
Der unfreiwillige Aufenthalt in Kigoma bot uns Gelegenheit, einige der Bewohner der Stadt näher kennenzulernen. Es waren vorwiegend Regierungsbeamte und ihre Frauen, die sich durch große Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft auszeichneten.
Ich werde nie vergessen, wie Vanne, die keinen unserer neuen Freunde kränken wollte, gleich zwei Einladungen zu einem heißen Bad für ein und denselben Abend annahm. Bernard, überzeugt, dass wir beide ein wenig verrückt waren, fuhr sie mit stoischer Miene von einem Haus zum anderen, damit sie ihre Verabredungen einhalten konnte, ohne das Gesicht zu verlieren.
Nachdem wir etwas über eine Woche in Kigoma verbracht hatten, kam David Anstey, der Game Ranger, der sich um eine Schlichtung der Streitigkeiten zwischen den Fischern im Gombe Stream Reserve bemüht hatte, von seiner Mission zurück. Er hatte eine lange Besprechung mit dem Distriktkommissar, deren Ergebnis war, dass ich die offizielle Erlaubnis erhielt, zum Gombe weiterzufahren. Ich hatte inzwischen schon fast die Hoffnung aufgegeben, einen Schimpansen auch nur zu Gesicht zu bekommen; denn ich war ständig darauf gefasst gewesen, dass man uns nach Nairobi zurückschicken werde. Deshalb kam es mir fast schon wie ein Traum vor, als ich endlich in dem Motorboot saß, das uns die Regierung für den Transport unserer Ausrüstung, darunter unser dreieinhalb Meter langes Dingi, zur Verfügung gestellt hatte.
Als die Maschine ansprang und der Anker gelichtet wurde, winkten wir Bernard noch einmal zum Abschied, verließen den Hafen und fuhren in Richtung Norden am Ostufer des Sees entlang. Ich erinnere mich noch, wie ich in das unglaublich klare Wasser hinunterschaute und bei mir dachte: «Entweder sinkt das Boot, oder ich falle über Bord und werde von einem Krokodil gefressen.» Aber nichts dergleichen geschah.
Die Anfänge
Während der ganzen Fahrt über die achtzehn Kilometer von Kigoma bis zu unserem Zeltplatz im Gombe Stream Reserve hatte ich das seltsame Gefühl, in einer Traumwelt zu leben. Wir befanden uns mitten in der Trockenzeit, und das kongolesische Ufer an der Westseite des langgestreckten, schmalen Tanganjikasees war, obwohl nur dreißig Kilometer entfernt, nicht einmal andeutungsweise zu erkennen. Die frische Brise und das tiefe Blau des Wassers, das von kleinen Wellen aufgeraut und von weißem Schaum gefleckt war, vermittelten uns das Gefühl, auf hoher See zu sein.
Ich richtete die Augen starr auf das Ostufer. Zwischen Kigoma und der Grenze des Schutzgebiets der Schimpansen sind die jähen Hänge des Steilabbruchs, die bis zu einer Höhe von 750 Metern über dem See aufragen, an vielen Stellen infolge jahrelanger Abholzung nackt und abgetragen. Dazwischen schmiegen sich kleine Waldflächen in Engtäler, durch die reißende Bergflüsse zum See hinunterrauschen. Die Uferlinie gliedert sich in eine Kette von länglichen Buchten, die häufig durch felsige Landzungen voneinander getrennt sind, die weit in den See hineinragen. Wir steuerten einen geraden Kurs, der uns von Landzunge zu Landzunge führte, aber wir sahen, dass die kleinen Kanus der Fischer sich dicht am Ufer hielten. David Anstey, der mit uns fuhr, um uns mit den afrikanischen Bewohnern des Gebietes bekannt zu machen, erklärte, dass der See manchmal ganz plötzlich zu toben beginnt; ein rauer Wind fährt dann durch die Täler herab und peitscht das Wasser zu gischtenden Wellen auf.
Überall am Ufer lehnten sich kleine Fischerdörfer an die Berghänge oder säumten die Mündungen der Täler. Ihre Bewohner lebten zumeist in einfachen Hütten aus Schlick und Gras, wenn wir auch schon damals hier und da größere Gebäude sahen, die mit glitzerndem Wellblech bedeckt waren – mit jenem Material, das für alle, die die Schönheit der Natur lieben, der Fluch der heutigen afrikanischen Landschaft ist.
Als wir ungefähr zehn Kilometer gefahren waren, deutete David auf den mächtigen Felsvorsprung, der die Südgrenze des Schimpansenreservats markiert. Sobald wir diese Grenzlinie passiert hatten, merkten wir, dass die Landschaft sich unvermittelt und dramatisch veränderte: Die Berge waren jetzt dicht bewachsen, und die Täler waren mit tropischen Wäldern bedeckt. Selbst hier sahen wir immer wieder Fischerhütten, die vereinzelt am weißen Strand standen. David erklärte uns, dass sie nur zeitweilig bewohnt seien. Die Afrikaner hatten die Erlaubnis, während der Trockenzeit zu fischen und ihren Fang an dem zum Reservat gehörenden Ufer zu trocknen. Wenn die Regenzeit begann, kehrten die Fischer in ihre Heimatdörfer außerhalb des Schimpansenreservats zurück. Diese Männer waren es, zwischen denen es kurz zuvor zu Streitigkeiten gekommen war; die Fischer zweier Dörfer hatten sich nicht einigen können, wer von ihnen das Recht auf einen bestimmten Strandabschnitt hatte.
Ich habe mich oft gefragt, was ich während dieser Bootsfahrt gefühlt haben mag, als ich wie gebannt die wilde Landschaft betrachtete, in der ich so bald schon umherstreifen sollte. Vanne gab später zu, dass der Anblick der steilen Hänge und der schier undurchdringlichen Wälder in den Tälern sie insgeheim zutiefst erschreckt habe, und David Anstey verriet mir ein paar Monate später, er sei völlig überzeugt gewesen, dass ich nach spätestens sechs Wochen aufgeben würde. Ich erinnere mich, dass ich weder Erregung noch Angst verspürte, sondern ein seltsames Gefühl der Gleichgültigkeit. Was hatte ich, das Mädchen, das da in Jeans auf dem Motorboot der Regierung stand, zu tun mit dem Mädchen, das wenige Tage später auf ebendiesen Bergen nach wilden Schimpansen suchen würde? Doch als ich mich in jener Nacht schlafen legte, hatte sich die Verwandlung bereits vollzogen.
Nach zweistündiger Fahrt ging das Motorboot in Kasakela, wo die beiden Game Scouts der Regierung ihr Standquartier hatten, vor Anker. David Anstey hatte uns geraten, dass wir wenigstens so lange, bis uns das Gebiet vertraut sei, unser Camp in der Nähe ihrer Hütten aufschlagen sollten. Als unser Dingi sich dem weißen Sandstrand näherte, sahen wir, dass sich eine ansehnliche Gruppe von Menschen versammelt hatte, um unsere Ankunft zu beobachten: die beiden Scouts, die wenigen Afrikaner, die die Erlaubnis hatten, ständig im Reservat zu leben, damit die Scouts nicht völlig isoliert waren, und einige Fischer aus den nahegelegenen Hütten. Wir wateten durch das seichte Wasser mit seinen glitzernden kleinen Wellen an Land und wurden zuerst von den Scouts und dann mit großem Zeremoniell von dem Ehrenhäuptling des Dorfes, dem alten Iddi Matata, begrüßt. Mit seinem roten Turban, seinem roten, europäisch geschnittenen Rock, den er über einem fließenden weißen Gewand trug, seinen Holzschuhen und seinem weißen Bart bot er einen farbenprächtigen Anblick. Er hielt eine lange Willkommensrede in Kisuaheli, von der ich nur Bruchstücke verstand, und wir übergaben ihm ein kleines Geschenk, das wir, auf Davids Anraten, für ihn gekauft hatten.
Als die Formalitäten vorüber waren, folgten Vanne und ich David auf einem schmalen Pfad von etwa dreißig Schritt Länge, der vom Strand durch ein Dickicht zu einer natürlichen Lichtung führte. Mit Unterstützung Davids und der afrikanischen Scouts hatten wir das große Zelt, das für Vanne und mich bestimmt war, in kurzer Zeit aufgeschlagen. Hinter dem Zelt floss ein kleiner gurgelnder Bach vorbei, und hohe Ölpalmen spendeten Schatten. Es war ein idealer Zeltplatz. Etwa fünfzig Schritt entfernt, unter ein paar Bäumen am Strand, schlugen wir ein zweites, kleineres Zelt auf, das unserem Koch Dominic, den wir vor unserer Abfahrt aus Kigoma angeheuert hatten, als Unterkunft dienen sollte.
Als unser Camp eingerichtet war, machte ich mich auf einen Erkundigungsgang. Das hohe Gras auf den unteren Hängen war kurz zuvor einem Buschfeuer zum Opfer gefallen, und die Aschenschicht, die sich dabei gebildet hatte, machte den Boden schlüpfrig. Es war ungefähr vier Uhr, aber die Sonne brannte immer noch erbarmungslos herab, und ich war schweißbedeckt, als ich endlich hoch genug gestiegen war, um den See und das breite Tal überblicken zu können, das sich üppig und grün von dem geschwärzten Berghang abhob, auf dem ich stand.
Ich saß schwitzend auf einem großen flachen Felsen und konnte fühlen, wie ich, nach der Niedergeschlagenheit der Woche in Kigoma und dem trancehaften Zustand, in dem ich seit unserer Abfahrt gewesen war, wieder zum Leben erwachte. Eine Horde von etwa sechzig Pavianen, die den versengten Boden nach gebratenen Insekten absuchten, zog vorüber. Einige der Tiere kletterten auf Bäume, als sie mich sahen, und schüttelten die Zweige mit ruckartigen, drohenden Bewegungen; zwei der großen Männchen stießen ihren lauten, bellenden Warnruf aus. Im Großen und Ganzen jedoch fühlte sich die Horde wenig beunruhigt durch meine Gegenwart und zog, mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, langsam weiter. Auch einen Buschbock sah ich, ein graziöses, kastanienbraunes Tier, kaum größer als eine Ziege, mit kräftigen, schraubig gedrehten Hörnern. Er sah mich regungslos an, machte dann plötzlich eine Wendung und sprang, den Wedel aufgestellt und wie ein Hund bellend, in weiten Sprüngen davon.
Ich blieb nicht länger als eine Dreiviertelstunde auf dem Berg, aber als ich – fast ebenso schwarz wie die Hänge, auf denen ich herumgekrochen war – zurückkehrte, fühlte ich mich nicht mehr wie ein Eindringling. In jener Nacht zog ich mein Feldbett ins Freie und schlief unter den Sternen, die durch die raschelnden Wedel einer Palme herabblinkten.
Am nächsten Morgen brannte ich natürlich darauf, mich auf die Suche nach Schimpansen zu machen, aber ich fand sehr bald heraus, dass ich, jedenfalls für den Anfang, keineswegs mein eigener Herr sein würde. David Anstey hatte mit einer Reihe von Afrikanern aus der Umgehung abgesprochen, dass sie kommen und Vanne und mich kennenlernen sollten. Er erklärte uns, dass sie alle besorgt und aufgebracht seien. Sie konnten einfach nicht glauben, dass ein junges Mädchen die lange Reise von England bis zu ihnen unternommen hatte, bloß um sich Affen anzuschauen, und so lief das Gerücht um, ich sei ein Spitzel der Regierung. Ich war David natürlich sehr dankbar dafür, dass er gleich zu Anfang alles für mich regelte, aber ich verlor mehr und mehr den Mut, als ich von den Plänen hörte, die er für mich gemacht hatte.
Zunächst kamen wir überein, dass der Sohn des Häuptlings von Mwamgongo, einem großen Fischerdorf im Norden des Schimpansenreservats, mich begleiten sollte. Seine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass ich nicht in mein Buch schrieb, ich hätte zehn oder zwanzig Schimpansen gesehen, wenn es nur ein einziger gewesen war. Später begriff ich, dass die Afrikaner immer noch darauf hofften, die vierzig Quadratkilometer des Reservats wieder zurückzuerhalten. Wenn ich daher vorgab, mehr Schimpansen gesehen zu haben, als es in diesem Bereich tatsächlich gab, so lieferte ich damit nach Meinung der Afrikaner der Regierung Argumente, auf die sie sich berufen konnte, wenn sie das Gebiet auch künftig zum geschützten Reservat erklären wollte. Darüber hinaus war David der Ansicht, dass ich aus Prestigegründen einen Afrikaner anstellen sollte, der meine Provianttasche trug.
Da ich überzeugt war, dass es mir nur dann gelingen würde, einen Kontakt mit den scheuen Tieren herzustellen, wenn ich allein war, brachte mich der Gedanke, ständig von zwei Begleitern behelligt zu sein, ziemlich aus der Fassung. Aber das war noch nicht alles: Ich musste obendrein noch einen der Game Scouts mitnehmen. Ich war deprimiert und unglücklich, als ich am Abend jenes Tages ins Bett ging.
Am nächsten Morgen jedoch war alles neu und aufregend, und meine gedrückte Stimmung war bald verflogen. Wir hatten verabredet, dass ich mich mit dem Sohn des Häuptlings in einem Tal in der Nähe der Nordgrenze des Reservats treffen sollte, da mein Game Scout Adolf dort am Tag zuvor bei einem Patrouillengang Schimpansen gesichtet hatte. David Anstey hatte etwas in Mwamgongo zu erledigen; so ergab es sich, dass er Adolf, meinen «Träger» Raschidi und mich in seinem Boot mitnahm und uns am verabredeten Treffpunkt absetzte.
Der Sohn des Häuptlings kam, gefolgt von fünf oder sechs anderen Afrikanern, auf uns zu, und ich erstarrte bei dem Gedanken, dass sie alle darauf bestehen könnten, mit mir zu kommen. Aber meine Befürchtungen erwiesen sich rasch als unbegründet. Der junge Mann erkundigte sich, wohin ich gehen wolle, und ich deutete in die Richtung der steilen, dichtbewaldeten Hänge am Rand des Tales. Er wirkte ziemlich bestürzt und sprach in Kiha, der Sprache des Ha-Stammes, ruhig und ernst mit seinen Freunden. Wenig später trat er wieder auf uns zu und sagte mir, er fühle sich nicht besonders wohl und werde mich an diesem Tag nicht begleiten. Später fand ich heraus, dass er geglaubt hatte, ich würde lediglich am Ufer auf und ab fahren und die Schimpansen zählen, die ich vom Boot aus sehen konnte. Die Aussicht, in den Bergen herumklettern zu müssen, gefiel ihm ganz und gar nicht, und ich sah ihn nie wieder.
Als wir gerade aufbrechen wollten, kamen zwei Fischer herbeigelaufen und fragten uns, ob wir einen Augenblick Zeit hätten. Sie führten uns zu einem Baum unmittelbar hinter einer der provisorischen Illitten, dessen Rinde wohl an hundert Stellen abgestoßen war. Am Abend zuvor hatte hier ein Büffelbulle, einer der gefährlichen Einzelgänger, einen der Fischer angegriffen. Der Mann hatte es fertiggebracht, auf den Baum zu klettern und sich so in Sicherheit zu bringen, aber der Büffel hatte wieder und wieder den schlanken Stamm attackiert. Ich weiß nicht, ob die Männer lediglich dem Game Scout Bericht erstatten wollten oder ob sie versuchten, mir die Gefahren, die in ihrem Land auf mich lauerten, vor Augen zu führen, aber die Erinnerung an den zerschundenen Baum verfolgte mich noch wochenlang, sooft ich in dem dichten Unterholz der Talwälder umherkroch.
Nach dem kleinen Ausflug zu dem Baum, den der Büffel berannt hatte, zogen wir durch das Mitumba-Tal, und wenig später schon befanden wir uns mitten im afrikanischen Urwald, wie ich ihn mir stets erträumt hatte. Ringsum standen riesenhafte mit Lianen behangene Bäume, und immer wieder schimmerten leuchtend rote oder weiße Blüten durch das dichte Laubwerk. Wir gingen an einem rasch dahinfließenden seichten Bach entlang und wateten durch das Wasser, sooft das andere Ufer ein leichteres Vorankommen versprach. Dann und wann schoss ein bunter Rakenvogel oder irgendein anderer Waldvogel an uns vorüber, und einmal sahen wir, wie eine Horde von kleineren Affen, deren Schwänze kupferfarben leuchteten, über eine Lücke im Blätterdach sprang. Der dichte Dom des Waldes, der sich in einer Höhe von mehr als dreißig Metern über uns wölbte, ließ nur wenig Sonnenlicht durchdringen. Und auf der Talsohle gab es kaum Unterholz, das uns den Weg hätte versperren können.
Nachdem wir etwa zwanzig Minuten gegangen waren, führte uns Adolf vom Flussbett weg und den Hang hinauf, der das Tal begrenzte. Fast im gleichen Augenblick wurde das Gehen sehr viel schwieriger: Die Bäume waren kleiner, und das Unterholz war dicht und von Schlingpflanzen durchzogen, sodass wir zumeist auf allen vieren kriechen mussten, um voranzukommen. Unter einem riesigen Baum blieb Adolf stehen. Ich schaute hinauf und sah, dass er mit kleinen orangefarbenen und roten Früchten beladen war: Der Boden ringsum war besät mit abgebrochenen Zweigen und angebissenen Früchten. Wir standen unter einem Msulula-Baum, in dem sich am Tag zuvor die Schimpansen gelabt hatten.
Es war nicht meine Absicht gewesen, dicht an den Baum heranzugehen, und in der Hoffnung, dass wir noch keine Schimpansen gestört hätten, erklärte ich rasch meinen Führern, dass ich den Baum aus einiger Entfernung – von der anderen Seite des Tals aus – beobachten wolle.
Zehn Minuten später hatten wir uns auf einer kleinen, grasbewachsenen Lichtung unmittelbar gegenüber dem Msulula-Baum und etwa auf der gleichen Höhe niedergelassen. Später machte ich die Entdeckung, dass wir in der Tat die einzige wirklich günstige Stelle erwischt hatten, von der aus man den Baum beobachten konnte. Raschidis geübte Augen hatten den Platz sofort entdeckt. Ich selber hätte ihn zu jener Zeit niemals bemerkt. Es schien ein sehr stiller und friedlicher Platz, zu dem das Rauschen des Flusses nicht hinaufdrang. Nur ein paar Zikaden ließen unentwegt ihr schrilles Zirpen hören, hier und da sang ein Vogel, und gelegentlich drang das Bellen oder Kreischen eines Pavians zu uns herüber.
Plötzlich erstarrte ich vor Erregung; denn unten im Tal hörte ich die Rufe einer Gruppe von Schimpansen. Natürlich hatte ich Schimpansen im Zoo gehört, aber hier draußen, im afrikanischen Urwald, war der Klang ihrer Stimmen unbeschreiblich aufregend. Zuerst ließ einer der Schimpansen seine tiefen, widerhallenden pant-hoots vernehmen, laute, tutende Rufe, auf die jeweils ein hörbares Einsaugen der Luft folgt. Diese Rufe wurden lauter und lauter, bis sie schließlich beinahe zu einem Kreischen wurden. Nachdem die ersten Rufe verhallt waren, fiel ein zweites Tier ein, dann ein drittes. In dem Bericht von Nissen hatte ich von Schimpansen gelesen, die auf Baumstämme trommeln: Jetzt hörte ich mit meinen eigenen Ohren das seltsame, hallende Geräusch, dessen Echo das ganze Tal erfüllte und in das sich der wilde Chor der pant-hoots mischte.
Die Gruppe befand sich ganz dicht bei dem Msulula-Baum, und ich saß, alle Sinne angespannt, wartend da, den Blick starr auf den gegenüberliegenden Wald gerichtet. Trotzdem war es Raschidi, der die erste Bewegung sah: Ein Schimpanse kletterte auf einen Palmenstamm und von dort in die Zweige des riesigen Baums. Ein zweiter folgte ihm, dann ein dritter, ein vierter – alle in geordneter Reihe. Ich zählte insgesamt sechzehn Tiere; einige davon waren groß, einige viel kleiner. Auch eine Schimpansenmutter war darunter, deren winziges Baby sich an ihrem Bauch festklammerte.
Bei aller Erregung war ich dennoch zugleich ein wenig enttäuscht; denn obwohl die Schimpansen zwei Stunden lang in dem Baum blieben, sah ich nicht viel mehr als dann und wann einen schwarzen Arm, der aus dem Blattwerk herauslangte und mit einer Handvoll Früchten wieder verschwand. Schließlich kletterten die Tiere eines nach dem anderen lautlos die Palmenleiter, über die sie vorher hinaufgelangt waren, wieder hinunter und verschwanden im Wald.
Das war es, was mich am meisten erstaunte: sechzehn Schimpansen in einem Baum, und die einzigen Geräusche, die ich gehört hatte, waren die Rufe gewesen, die ihre Ankunft verkündet hatten.
Wenige Minuten nachdem der letzte Schimpanse verschwunden war – ich saß immer noch da und suchte das Tal mit meinem Feldstecher ab in der Hoffnung, die Gruppe beobachten zu können, wie sie in einen anderen Baum kletterte –, schreckten mich Adolf und Raschidi auf mit der Feststellung, ihre Essenszeit sei gekommen und wir müssten uns deshalb auf den Rückweg machen. Ich protestierte vergebens: Solange ich mich noch nicht ganz und gar sicher fühlte, wagte ich nicht, ihnen zu befehlen, sie sollten dableiben. Genauso wenig wagte ich es, Davids Missfallen dadurch zu erregen, dass ich ohne seine Eskorte ausharrte. Als wir im Gänsemarsch durch den Urwald zurückgingen, fasste ich aber den Entschluss, die Dinge in Zukunft anders zu regeln.
Der Msulula-Baum trug noch zehn Tage lang Früchte, und Raschidi und Adolf, die von nun an ihre Mittagsmahlzeit mitnahmen, begleiteten mich abwechselnd. Dreimal blieben wir sogar über Nacht draußen. Raschidi und Adolf schliefen eng aneinandergerückt neben einem kleinen Lagerfeuer; ich selber wickelte mich ein wenig abseits in eine Wolldecke.
Während der zehn Tage sah ich zahlreiche Schimpansen. Manchmal kletterten große Gruppen auf den Baum und fraßen von den Msulula-Früchten; manchmal bestand die Gruppe auch nur aus zwei oder drei Tieren. Zweimal sah ich, wie ein einzelnes Männchen kam und über eine Stunde ganz allein im Baum saß und fraß. Mir wurde bald klar, dass die Gruppen nicht konstant waren: Einmal, zum Beispiel, kamen vierzehn Schimpansen zusammen an, zogen aber in zwei verschiedenen Gruppen wieder ab, wobei die zweite Gruppe gut eine halbe Stunde später als die erste vom Baum herabkletterte. Und nach den Geräuschen zu urteilen, entfernten sich die beiden Gruppen in verschiedene Richtungen. Bei einer anderen Gelegenheit sah ich, wie sich zwei kleine Gruppen auf dem Baum trafen und mit viel Geschrei in den Zweigen herumtobten. Dann beruhigten sie sich, fraßen in aller Stille gemeinsam und zogen, soweit ich sehen konnte, gemeinsam wieder ab. Überdies machte ich die Entdeckung, dass einige Gruppen ausschließlich aus erwachsenen Männchen, andere nur aus Weibchen und Jungtieren und wieder andere aus Männchen, Weibchen und Jungtieren bestanden.
Ich war indessen keineswegs zufrieden mit dem, was ich entdeckt hatte. Das Laubwerk des Msulula war so dicht, dass ich kaum Gelegenheit hatte zu beobachten, wie sich die einzelnen Schimpansen zueinander verhielten. Zweimal versuchte ich, näher an den Baum heranzukommen, um besser beobachten zu können, aber beide Versuche scheiterten kläglich: Beim ersten Mal entdeckten mich die Affen auf ihrem Weg zum Baum und flohen; beim zweiten Versuch saßen vier Schimpansen eine Stunde lang fast direkt über mir, und doch sah ich sie nur für Sekunden, als sie die Palmenleiter hinauf- und wieder hinunterkletterten.
Später jedoch wurde mir klar, wie viel Glück ich gehabt hatte, solange der Msulula-Baum Früchte trug. In jenen zehn Tagen lernte ich vermutlich mehr als in den ganzen acht deprimierenden Wochen, die auf diese Zeit folgten. So viel wir auch suchen mochten, wir fanden keinen einzigen großen Baum, der Früchte trug. Wir durchkämmten die meisten der zwölf Täler des Reservats, aber Unterholz und Gebüsch waren oft sehr dicht, und das Rauschen der Flüsse übertönte nicht nur den Lärm, den wir selber verursachten, sondern genauso die Geräusche, die uns hätten verraten können, wo sich die Schimpansen aufhielten. Sahen wir einmal ein paar Tiere, dann waren wir ihnen gewöhnlich bereits so nahe, dass sie sofort die Flucht ergriffen. Heute kann ich mir sehr gut vorstellen, wie oft sie uns gesehen haben und leise verschwunden sein müssen, ohne dass wir ihre Gegenwart auch nur ahnten.
Ein wenig mehr Glück hatten wir, wenn wir auf die Hügelketten zwischen den Tälern kletterten. Aber auch dann machten sich die Schimpansen davon, sobald sie uns sahen, mochten uns auch fünfhundert Meter und eine Schlucht von ihnen trennen. Oder sie waren so weit weg, dass es unmöglich war, ihr Verhalten im Einzelnen zu beobachten. Eine Zeitlang dachte ich, dass die Schimpansen vielleicht deshalb so ängstlich seien, weil wir zu dritt waren. Aber ihre Reaktion war die gleiche, wenn ich meine Begleiter irgendwo an einem hochgelegenen Platz zurückließ, von dem aus sie mich im Auge behalten konnten, und allein versuchte, näher an eine Gruppe heranzukommen: Sie flohen.
Neben den enttäuschenden Tagen, an denen wir nur Schimpansen sahen, die entweder zu weit weg waren, als dass man sie genau hätte beobachten können, oder die nach wenigen Minuten flohen, gab es auch Tage, an denen wir überhaupt keine Schimpansen sahen. Je mehr ich an die Aufgabe dachte, die ich mir gestellt hatte, desto mehr verzagte ich. Immerhin hatten diese Wochen den Vorteil, dass ich mit dem zerklüfteten Terrain vertraut wurde. Meine Haut wurde unempfindlich gegen die scharfen und rauen Grasarten der Täler, und mein Blut wurde immun gegen das Gift der Tsetsefliege, sodass ich nicht mehr jedes Mal gewaltig anschwoll, wenn ich gestochen wurde. Außerdem lernte ich mehr und mehr, mich sicher auf den heimtückischen Hängen zu bewegen, die stets schlüpfrig waren, ganz gleich, ob sie nackt und ausgewaschen, mit einer Kruste von Asche bedeckt oder mit trockenem, zertrampeltem Gras bewachsen waren.
Auch mit vielen der Wildwechsel in den fünf Tälern, die mein Hauptarbeitsgebiet werden sollten, wurde ich nach und nach vertraut.
Nicht zuletzt gaben mir unsere täglichen Wanderungen Gelegenheit, viele der anderen Bewohner der Berge kennenzulernen: die gewaltigen grauen Buschschweine mit ihrer silbrigen Nackenmähne; Horden von Streifenmangusten, die auf der Suche nach Insekten die Blätter rascheln ließen; die Hörnchen und die gestreiften und gefleckten Rüsselspringer der dichten Wälder. Mit der Zeit gewann ich auch einen Überblick über die vielen verschiedenen Affenarten, die im Gombe-Gebiet anzutreffen sind. Am häufigsten liefen uns Horden von Pavianen über den Weg. Manchmal fanden sie sich, wie die Gruppe, der ich am ersten Nachmittag begegnete, ohne viel Aufhebens mit unserer Gegenwart ab; einige Trupps aber schlugen so lange Lärm, bis wir oder sie aus dem Blickfeld verschwunden waren. In jedem der Täler gab es zwei oder drei kleine Gruppen von Berg-Weißnasenmeerkatzen und ein paar Blaugesichtige Diademmeerkatzen. Weit größer waren die Horden der Roten Kolobusaffen. Sie bestanden aus sechzig und mehr Tieren und waren jeweils in zwei und mehr Tälern zu Hause. Gelegentlich begegneten wir auch einer einzelnen Silbermeerkatze, deren schwarzes Gesicht von einem weißen Haarkranz eingerahmt ist. Unten am See gab es sogar ein paar Gruppen von Grünen Meerkatzen, die mich an meine Affenstudien auf der Insel Lolue erinnerten.
Besonders gern beobachtete ich die Roten Kolobusaffen. Der Rote Kolobus ist ein großer Affe, und es kam gelegentlich vor, dass ich die ausgewachsenen Männchen für Schimpansen hielt, weil das dunkelbraune Haar auf ihrem Rücken bei bestimmten Lichtverhältnissen schwarz wirkt und weil sie aufrecht auf den Zweigen sitzen und sich an einem Ast über ihrem Kopf festhalten, wie es die Menschenaffen tun. Ihr langer, dicker, herabhängender Schwanz jedoch verrät sehr rasch ihre tatsächliche Identität. Wenn ich nahe an sie herankam und sie aus den Zweigen zu mir herabschauten, erinnerten mich ihre Gesichter stets an aufgeschreckte alte Jungfern mit gelblich roten Vogelscheuchenperücken auf dem Kopf.
Von Raschidi lernte ich eine Menge über die Gesetze des Urwalds. Er war es auch, der mir beibrachte, wie man sich im scheinbar undurchdringlichen Dickicht zurechtfindet, und obwohl ich zunächst enttäuscht gewesen war, als ich gehört hatte, dass mir nicht erlaubt war, allein zu gehen, war ich in jener ersten Zeit dankbar für seine Hilfe. Bald jedoch musste er mich verlassen und für einige Zeit in sein Dorf zurückkehren, und da ich die Erfahrung machte, dass Adolf, der Scout, nicht in der Lage war, ohne Essen lange, anstrengende Stunden in den Bergen durchzuhalten, hatte ich in den folgenden Monaten eine Reihe von anderen afrikanischen Begleitern. Da war zunächst Soko aus Nyanza, dessen Name unter den in dieser Gegend wohnenden Afrikanern eine Welle von Heiterkeit auslöste, da «Soko» ihr Name für den Schimpansen ist! Dann kam der baumlange und gertenschlanke Wilbert, der selbst dann noch makellos aussah, wenn er auf dem Bauch kriechend eine Schweinefährte verfolgt hatte; und schließlich Short, der, wie bereits sein Name sagt, sehr klein war. Alle drei waren zähe, kräftige Männer, die ihr Leben lang im Busch mit Tieren gearbeitet hatten. Es machte mir Spaß, wenn sie mich begleiteten, und ich lernte viel dazu in der Zeit, in der sie für mich arbeiteten.
Erste Beobachtungen
Ungefähr drei Monate nach unserer Ankunft wurden Vanne und ich zur gleichen Zeit krank. Wir hatten eindeutig Malaria, aber da uns kein Geringerer als der Arzt in Kigoma versichert hatte, dass es in diesem Gebiet keine Malaria gäbe, hatten wir keinerlei Medikamente dagegen mitgenommen. Ich kann mir mit dem besten Willen nicht vorstellen, wie er zu dieser seltsamen Annahme gekommen sein mag, aber wir waren damals zu naiv, um ihm weitere Fragen zu stellen. Fast zwei Wochen lang lagen wir Seite an Seite auf unseren flachen Feldbetten in dem heißen, stickigen Zelt und schwitzten das Fieber aus. Gelegentlich rafften wir uns dazu auf, unsere Temperatur zu messen – unser einziger Zeitvertreib, da keinem von uns nach Lesen zumute war. Vanne hatte fünf Tage lang fast konstant eine Temperatur von vierzig Grad; nur während der kühlen Nächte ließ das Fieber ein wenig nach. Später erklärte man uns, wir könnten von Glück sagen, dass sie überhaupt durchgekommen ist. Um alles noch schlimmer zu machen, lag während der ganzen Zeit, in der wir an unser Feldbett gefesselt waren, ein entsetzlicher Gestank über dem Zeltplatz – ein Gestank, der an faulendes Kohlwasser erinnerte. Er entströmte den Blüten eines Baums, dessen Name mir entfallen ist. Für mich heißt er seit damals der «Fieberblütenbaum».
Unser Koch Dominic flehte uns an, nach Kigoma zu fahren und einen Arzt aufzusuchen. Als wir ihm klarmachten, dass wir viel zu krank waren, um die dreistündige Reise in unserem kleinen Boot verkraften zu können, machte er die mangelnde ärztliche Pflege dadurch wett, dass er ständig auf die rührendste Weise für uns sorgte. Eines Nachts wanderte Vanne im Delirium aus dem Zelt und fiel bewusstlos neben einer Palme zu Boden. Ich selber hatte überhaupt nicht gemerkt, dass sie das Zelt verlassen hatte. Es war Dominic, der sie gegen drei Uhr morgens fand und ihr zu ihrem Bett zurückhalf. Später verriet er uns, dass er Nacht für Nacht mehrmals herübergekommen war, um nachzusehen, ob bei seinen «Memsahibs» alles in Ordnung sei.
Sobald ich fieberfrei war, packte mich die Ungeduld. Fast drei Monate waren vergangen, und ich hatte das Gefühl, noch keinerlei Fortschritt gemacht zu haben. Ich fühlte mich dem Wahnsinn nahe, wenn ich daran dachte, dass in wenigen Monaten die Geldmittel, die mir zur Verfügung standen, verbraucht sein würden. Da ich nicht wollte, dass mich irgendeiner meiner afrikanischen Begleiter in meinem angeschlagenen Zustand sah, machte ich mich – auf die Gefahr hin, das Missfallen der offiziellen Stellen zu erregen – eines Morgens allein auf den Weg, um den Berg zu besteigen, der sich in unmittelbarer Nähe unseres Camps erhob – denselben Berg, auf den ich an meinem ersten Nachmittag geklettert war. Ich brach wie gewöhnlich beim ersten Morgendämmer auf, zu einer Tageszeit also, zu der es noch kühl war. Nach etwa zehn Minuten begann mein Herz wild zu hämmern. Ich konnte fühlen, wie das Blut in meinen Schläfen pochte, und ich musste stehen bleiben, um Atem zu holen. Schließlich jedoch schaffte ich es bis zu einem unbewachsenen Gipfel, der etwa dreihundert Meter über dem See lag, und da ich von diesem Punkt aus einen herrlichen Blick über das Tal hatte, beschloss ich, eine Weile sitzen zu bleiben und mit meinem Feldstecher nach Zeichen von Schimpansen zu suchen.
Ich hatte wohl fünfzehn Minuten so dagesessen, als ich auf dem kahlgebrannten Hang auf der gegenüberliegenden Seite einer schmalen Schlucht eine Bewegung wahrnahm. Ich sah genau hin und entdeckte drei Schimpansen, die zu mir herüberspähten. Ich nahm an, dass sie fliehen würden, da sie nur etwa 75 Meter von mir entfernt waren. Aber sie flohen nicht, sondern gingen nach ein paar Augenblicken in aller Ruhe weiter, und ich verlor sie erst aus den Augen, als sie in dichteres Buschwerk eindrangen. Hatte ich am Ende doch recht gehabt mit meiner Annahme, dass sie weniger Angst haben würden vor einem Menschen, der völlig allein war? Denn selbst wenn ich mich von meinen afrikanischen Begleitern entfernt und einer Gruppe allein genähert hatte, werden die Schimpansen ohne Zweifel bemerkt haben, was da gespielt wurde.
Ich blieb auf meinem Gipfel sitzen, und später am Morgen stürmte eine Horde von Schimpansen schreiend, bellend und heulend den gegenüberliegenden Berghang hinunter und machte sich über die Früchte eines der Feigenbäume her, die dicht an dicht unten im Tal am Rand des Bachs wuchsen. Etwa zwanzig Minuten später schon zog eine weitere Schimpansengruppe über den kahlen Hang, auf dem ich zuvor die drei Tiere gesehen hatte. Auch diese Gruppe entdeckte mich, da ich auf meinem felsigen Gipfel weithin sichtbar war. Aber wenngleich alle Tiere stehen blieben, zu mir herüberschauten und ihre Schritte ein wenig beschleunigten, als sie weiterzogen, konnte doch von einer panischen Flucht keine Rede sein. Mit heftigem Ästeschütteln und großem Geschrei begrüßten die Neuankömmlinge jene Gruppe, die sich bereits über die Feigen hergemacht hatte. Nach einer Weile beruhigten sich alle und widmeten sich gemeinsam und still der Mahlzeit. Schließlich kletterten sie von den Bäumen herunter und zogen, zu einer einzigen großen Gruppe vereinigt, davon. Auf einem Teil ihres Wegs durch das Tal konnte ich beobachten, wie sie in langer, geordneter Reihe einer nach dem andern dahinwanderten. Zwei kleine Schimpansenbabys hockten wie Jockeys auf dem Rücken ihrer Mütter. Ich sah sogar noch, wie sie anhielten, um – je etwa eine Minute lang – zu trinken, bevor sie über den Bach sprangen.
Es war bei weitem der erfolgreichste Tag, den ich seit meiner Ankunft im Gombe Stream Reserve erlebt hatte, und als ich am Abend ins Camp zurückkehrte, war ich trotz meiner Erschöpfung in bester Stimmung. Vanne, die weit kranker gewesen war als ich und immer noch im Bett lag, machte meine Begeisterung neuen Mut.
Dieser Tag markierte den Wendepunkt in meinem Forschungsunternehmen. Die Feigenbäume wuchsen überall am Unterlauf des Bachs und trugen in jenem Jahr in unserem Tal acht Wochen lang reichlich Früchte. Tag für Tag stieg ich auf meinen Gipfel, und Tag für Tag kamen auch die Schimpansen und fraßen von den Feigen im Tal. Sie kamen in großen Horden und in kleinen Gruppen, einzeln und paarweise. Regelmäßig zogen sie an mir vorbei, und zwar entweder auf dem ursprünglichen Weg über den kahlen Hang unmittelbar über mir oder auf einer der Fährten, die unterhalb meines Platzes über den grasbewachsenen Kamm führten. Und da ich mit meiner unauffälligen Kleidung immer gleich aussah und nie versuchte, ihnen zu folgen oder sie irgendwie zu stören, wurde den Schimpansen nach und nach klar, dass ich wohl doch nicht das grauen- und furchterregende Monstrum war, für das sie mich zunächst gehalten hatten. Natürlich war ich zumeist allein auf meinem Gipfel; es war nicht nötig, dass mir meine afrikanischen Begleiter den Berg hinauf- und hinunterfolgten, da sie stets wussten, wo sie mich finden konnten. Als Short nicht länger bleiben konnte, entschloss ich mich, keinen Afrikaner mehr einzustellen, und obgleich Adolf und später Saulo David, der neue Scout, am Abend häufig heraufkamen, um nachzuschauen, ob mir nichts zugestoßen war, blieb ich doch zumeist völlig allein.
Mein Gipfel wurde rasch zu dem Gipfel schlechthin. Im ganzen Gombe-Reservat gibt es meiner Ansicht nach keinen günstigeren Platz für den, der die Schimpansen beobachten will. Natürlich findet man, wenn man höher hinaufsteigt, Stellen, von denen aus man einen herrlichen Blick in alle Richtungen hat. Aber die Schimpansen sieht man nur selten in solchen Höhen, weil sie den größten Teil ihrer Nahrung weiter unten an den Berghängen finden. Von meinem Platz aus konnte ich, wenn ich nach Süden schaute, das Tal überschauen, an dessen Ausgang unser Camp lag. Und ich brauchte nur wenige Schritte in nördlicher Richtung zu gehen, um in das beinahe kreisrunde Becken des unteren Kasakela-Tals hinabschauen zu können, das von dichtem Urwald bedeckt war. Ich fand rasch heraus, dass man durch einen verhältnismäßig lichten Wald – in dem ich mehrmals einer kleinen Herde von etwa sechzehn Büffeln begegnete –, ohne viel Steigungen überwinden zu müssen, das obere Kasakela-Tal durchqueren konnte. Nördlich des Büffelwalds hatte man von einem anderen unbewachsenen Kamm aus einen guten Ausblick auf den oberen Teil des schmalen, von steilen Hängen begrenzten Mlinda-Tals.