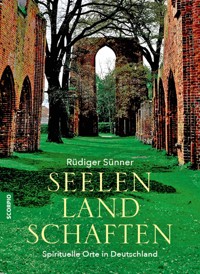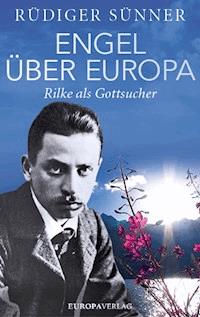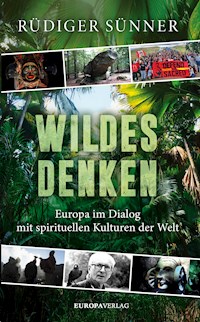
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem berühmten Buch "Das wilde Denken" beschrieb der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss die ganzheitliche, bildhafte und mit der Natur verbundene Weltsicht indigener Kulturen. Dieses "wilde Denken" sieht – anders als das dualistische Weltbild westlicher Tradition – eher fließende Übergänge zwischen Mensch und Natur, Realität und Geisterwelt, Leben und Tod, was Rüdiger Sünner an ausgewählten Beispielen aus Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien eindrucksvoll veranschaulicht. Indigene Kulturen halten die Natur für durchgängig beseelt und glauben an ein Fortleben der Seele nach dem Tode, egal ob in Form von Wiedergeburt, Seelenwanderung oder Ahnenkult. Solche Auffassungen werden in unserem wissenschaftlich bestimmten Weltbild schnell als "esoterisch" abgetan, obwohl Europa über Jahrtausende selbst Ausprägungen eines "wilden Denkens" kannte. Rüdiger Sünner, seit Jahrzehnten auf der Suche nach spirituellen Traditionen, zeigt anschaulich, welche Formen dieses Denken in verschiedenen Kulturen angenommen hat und welche Inspirationen wir gerade im Zeitalter von Naturzerstörung, Klimawandel und ökonomischem "Steigerungszwang" daraus ziehen können. "Wildes Denken" kann zu einer neuen Identität Europas beitragen, zu der auch die Mythen, spirituelle Traditionen und Weisheitslehren gehören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RÜDIGER SÜNNER
WILDES DENKEN
Europa im Dialogmit spirituellen Kulturen der Welt
1. eBook-Ausgabe 2020
© 2020 Europa Verlag AG, Zürich
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, nach einer Idee von © Rüdiger Sünner
Bildnachweis: Anita Albus S. 13; Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte (bpk), S. 10, 75; Thomas Fischermann (»Der letzte Herr des Waldes«, C.H. Beck-Verlag), S. 52, 53; Erich Kasten, S. 56; Godula Kosack S. 94; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Karol Schauer S. 131; Michael Oppitz S. 108/109; Rüdiger Sünner S. 9, 60 (Papua Museum Gelnhausen, Dr. Werner Weiglein), 69, 86 (Grassi-Museum, Leipzig), 101 (Papua Museum Gelnhausen, Dr. Werner Weiglein), 103 (Papua Museum Gelnhausen, Dr. Werner Weiglein), 129 (Fotocollage), 134, 135, 138, 143 (Fotocollage), 155, 158, 164, 168, 175, 188, 200, 204, 205, 208 (Fotocollage), 216, 218, 222; Wikimedia Commons S. 82, 84, 116, 129, 148, 187, 192, 229 Layout & Satz: Buchhaus Robert Gigler, München Gesetzt aus der Adobe Garamond LT und der Dreamwalker
Redaktion: Franz Leipold
Lektorat: Annette Barth
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-314-2
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
IM PALAST DER MYTHEN
REHABILITIERUNG DES MYTHOS PIONIERE DES ›WILDEN DENKENS‹
1»Animal symbolicum«: Ernst Cassirer
2»Ewiggleiches Indianertum«: Aby Warburg
3Mythos als Sprachspiel und Lebensform: Ludwig Wittgenstein
4Mythos als Denkform: Claude Lévi-Strauss
LOB DES ANIMISMUS BESEELTE NATUR UND GEISTERWELT
1»Ich verbinde mich, also bin ich«
2Heilige Tiere
2.1Tiere als »verkleidete Menschen«
2.2Die Maskentänze der Kwakiutl
2.3Die Söhne des Krokodils
2.4Karni Mata und Hanuman
3Heilige Elemente
3.1Pachamama: Mystik der Erde
3.2Ganga: Der heilige Strom
4Die Welt der Geister: Zugänge zu einer anderen Wirklichkeit?
4.1»Holy People«: Heilungszeremonien der Navajo
4.2Tanz mit den Waldgeistern: Maskenzeremonien in Papua-Neuguinea
4.3»Kraftbegabte« und »Seelenverzehrer«: Geisterglaube in Afrika
5Die Reise der Seele: Ahnenkult, Schamanismus und Wiedergeburt
5.1»Ahnenpfahl« und »Seelenboot«
5.2Der Flug des Schamanen
5.3Reinkarnation in Tibet
AUF DER SUCHE NACH DEM ›WILDEN EUROPA‹
1Höhlengeheimnisse: Schamanen im frühen Europa?
2Häuser der Ewigkeit: Die Tempel der Megalithkulturen
3Reisen in die »Anderswelt«: Keltische Wandlungsmysterien
4Teufelssteine: Die Dämonisierung des »wilden Denkens« durch die Kirche
5Gutenborn: Wasserkultstätten und Quellheiligtümer
6»Magna Mater« und »Große Göttin«
7»Satan« und »heilige Grünkraft«: Der innere Kampf der Hildegard von Bingen
8»Hagazussa«: Die Nachtfahrten der Hexen
9Faust als moderner Schamane? Goethe und die »Walpurgisnacht«
10Das »Rauschen der Haine«: »Wildes Denken« in der deutschen Romantik
›WILDES DENKEN‹ HEUTE
1»Defend the Sacred«: Spirituelle Tiefenökologie der Gegenwart
2»Endloses Bewusstsein«: Ein neuer Blick auf den Tod und das Leben
3Ausblick
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
IM PALAST DER MYTHEN
Vor ein paar Jahren besuchte ich ein letztes Mal das Ethnologische Museum in Berlin-Dahlem, bevor es für immer seine Pforten schloss, um ins Humboldt Forum in die Mitte der Stadt umzuziehen, wo seine Sammlungen ab Mitte 2021 gezeigt werden sollen. Viele Male schon hatte ich dieses riesige Ausstellungsgebäude aufgesucht, in dessen Depots über 500 000 ethnographische und kulturhistorische Sammlerstücke aus aller Welt lagern. Während meiner Studienzeit an der Freien Universität Berlin in den 1980er-Jahren war es zu einer zweiten geistigen Heimat für mich geworden. Ich besuchte damals häufig Seminare und Vorlesungen in der »Rostlaube«, einer Zweigstelle der Freien Universität. In längeren Pausen zwischen Lehrveranstaltungen ging ich manchmal hinüber zum Museum, das nur fünf Minuten Fußweg entfernt lag.
Das ehemalige Ethnologische Museum in Berlin Dahlem
Dort empfing mich eine andere Welt. Während in den kahlen Seminarräumen der FU die auf Logik und Empirie beruhende wissenschaftliche Methodik gelehrt wurde, öffnete sich im Dämmerlicht des Ethnologischen Museums ein Reich der Bilder und Träume. Rätselhafte Masken von indianischen und afrikanischen Kulturen waren dort zu bewundern, Ahnenpfähle aus der Südsee und religiöse Skulpturen aus Indien, Tibet und China. Es wimmelte von Göttern, Geistern und Dämonen aus allen Teilen der Welt, die in mir zunächst nur grenzenloses Staunen hervorriefen. Bei meinem letzten Besuch las ich in einer Vitrine den Hinweis, dass für bestimmte Völker Asiens selbst in einem Reiskorn eine Seele wohnt, und ein doppelköpfiges afrikanisches »Krafttier« wurde so gedeutet, dass das eine Antlitz zum Dorf und das andere zur Welt der Toten schaut. Alles war in diesen mythologischen Kulturen beseelt, und das Leben der Seele endete auch nicht mit dem physiologischen Sterben des Körpers.
Gesichtsmaske aus der Republik Kongo, mit deren Hilfe der Träger in die Geisterwelt schauen kann
Einem ganz anderen Geist begegnete ich, wenn ich nach solchen Erlebnissen wieder zur Universität zurückkehrte, um an Vorlesungen oder Seminaren teilzunehmen. An der FU war kein Platz für mythologische oder gar spirituelle Vorstellungen, hier herrschte der kühle Geist der wissenschaftlichen Vernunft. Es ging nicht um Götter oder Geister, sondern alles musste mithilfe von Fakten und logischen Verknüpfungen erklärt werden. Hier dominierte die Wissenschaft als Erbe der Aufklärung, die vor knapp 400 Jahren in Europa begonnen hatte, sich von allen metaphysischen Gedanken zu befreien, damit der Mensch sich seines »eigenen Verstandes ohne Anleitung eines anderen« (Immanuel Kant) bediente.
Es gab durchaus spannende Veranstaltungen für mich an der Universität, etwa über Theodor W. Adorno, Martin Heidegger, Paul Celan oder die deutsche Romantik. Aber als spirituell Suchender fand ich an der FU keine Antworten. Das Wort »Spiritualität« tauchte während meines gesamten Studiums nicht ein einziges Mal auf, und der Begriff »Mythos« war an der Universität in der Regel mit einem negativen Beigeschmack versehen. Meistens wurde er synonym für Schein, Lüge, Verschleierung und Illusion eingesetzt, bedeutete also das genaue Gegenteil der auf »Wahrheit« hin orientierten Wissenschaft.
Im benachbarten Ethnologischen Museum dagegen regierte die Welt der Mythen in unumschränkter und nicht infrage gestellter Pracht. In diesen Hallen wurden meine künstlerischen Seiten aktiviert, die an der Universität meistens brachlagen: Fähigkeiten des intuitiven, imaginativen und assoziativen Denkens, die in den Seminarräumen eher störten. Oft hatte ich den Eindruck gehabt, dass ich diese für mich so wertvollen Eigenschaften mit meinem Mantel an der Garderobe abgeben musste, um sie nicht in die Hörsäle zu tragen, wo nur »klares« und »logisches« Denken gefragt war. Meine subjektiven Gedanken und Assoziationen interessierten dort nicht, aber in der Mythenwelt des benachbarten Museums wurden sie stimuliert und halfen mir, mich besser in die verschiedenen Objekte einzufühlen. Ich war oft erstaunt darüber, welch hohes ästhetisches Niveau diese Sammlerstücke besaßen, egal ob sie aus Indien, Japan oder Papua-Neuguinea stammten. Alle Objekte hatten eine enorme Kraft, die nichts mit ornamentaler Ästhetik zu tun hatte, sondern in tiefste Schichten der menschlichen Existenz reichte, was mich im Innersten berührte. Auch abgründige Bereiche des Todes, der Sexualität und des Dämonischen wurden dabei gestreift. Ich erlebte Momente der Verzauberung, aber auch des Schreckens, und manche Objekte lösten Empfindungen aus, für die sich gar keine Worte fanden. Ich war hier mit Kulturen konfrontiert, die meinen europäischen Horizont weit überstiegen und mir zeigten, wie unterschiedlich man über Tiere und Pflanzen, Bäume und Flüsse, Gut und Böse sowie das Sterben denken konnte. Mir wurde klar, wie viele Formen der »Gottesverehrung« es gab und wie viele verschiedene Ansichten über Krankheit und Medizin. All das geschah aber nicht in abstrakten Begriffen wie nebenan an der Universität, sondern in großen Bildern, Symbolen und Metaphern, die niemals auf eine abschließende Bedeutung gebracht werden konnten.
Lange existierten diese beiden Welten in mir wie unversöhnt nebeneinander her: der schillernde »Palast der Mythen« und die nüchternen Hallen der wissenschaftlichen Rationalität, bis ich eines Tages einen Buchtitel entdeckte, der wie ein Donnerschlag auf mich wirkte: »Das wilde Denken« (1968) des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss.
Dieses Buch war nicht nur spannend zu lesen, weil es über die indigene Bevölkerung in Brasilien berichtete, sondern weil es deren »wildes Denken« leidenschaftlich gegenüber der westlichen Rationalität verteidigte. Lévi-Strauss war weit davon entfernt, die Mythenwelt indigener Völker als kindlich zurückgebliebene Stufe der menschlichen Evolution zu betrachten. Vielmehr betonte er, dass ihr magisch-bildhaftes Denken nur eine andere Form von Erkenntnis darstellte; keine bloße Vorform von Wissenschaft, sondern ein hochkomplexes Gedankensystem, mit dem diese Völker ihr Leben immer gut gemeistert hatten.1
Der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss (1908–2009)
Seitdem übt »Das wilde Denken« eine starke Anziehungskraft auf mich aus, und die folgenden Ausführungen sowie der parallel dazu entstandene Film versuchen, seine Tiefe in immer neuen Umkreisungen auszuloten. Für die Ethnologen ist Lévi-Strauss’ Haltung inzwischen selbstverständlich: Mythische Weltbilder vor allem von außereuropäischen Völkern werden nicht als rückständig oder defizitär angesehen, sondern als Systeme alternativer Lebensformen respektiert. Aber in unserem Alltag sieht es doch ganz anders aus: Begriffe wie »Mythos«, »übersinnlich«, »Geister«, »Magie« sind – vor allem in Deutschland – mit einer zwielichtigen Aura versehen und werden eigentlich nur in esoterischen Privatnischen geduldet. Die »Leitmedien« und die meisten Vertreter der Wissenschaft fassen sie, wenn überhaupt, nur mit spitzen Fingern an. In unserer Gesellschaft ist ein tiefes Misstrauen gegenüber dem »Übernatürlichen« und »Spirituellen« weit verbreitet, selbst in der sonst so offenen Kunst- und Kulturszene. Künstler wie Joseph Beuys2 oder Anselm Kiefer, die sich mit mythischen oder magischen Weltbildern auseinandergesetzt haben, wurden deshalb sehr skeptisch betrachtet – und wenn manchmal vom »Schamanen Beuys« die Rede ist, so schwingt auch immer ein negativer Unterton in Richtung »Scharlatan« mit. In unserem »aufgeklärten« Zeitalter gibt es keinen wirklichen Platz für Mythos und Magie. Und sicher spielen hierzulande auch die Erfahrungen mit der pseudoreligiösen Inszenierung des NS-Regimes eine Rolle, die dazu führten, dass solche wissenschaftlich nicht erfassbaren Bereiche als »irrational« aus dem Diskurs der Moderne verbannt wurden.
Diese verkrampfte Haltung lockert sich immer dann ein wenig, wenn spirituelle Leitfiguren aus außereuropäischen Kulturen zu uns kommen. Der 14. Dalai Lama beispielsweise ist jederzeit hochwillkommen als geschätztes religiöses Oberhaupt Tibets und darf über alle Themen – auch über Karma und Wiedergeburt – reden, so viel er möchte. Würden sich aber etwa Anthroposophen, die Anhänger Rudolf Steiners, in die Debatte einmischen, blinkten gleich alle möglichen Alarmlampen auf und warnten vor »Okkultismus« und »voraufklärerischem« Denken. So ist hierzulande eine große, von der »offiziellen« Welt abgespaltene Esoterikszene entstanden, die sich des Internets und privat organisierter Kongresse bedient, um ihrem Interesse für das »Übersinnliche« nachzugehen. Dort können sich Neo-Schamanen, alternative Heiler, Neu-Heiden, »Hexen« und naturreligiöse Gruppen tummeln, solange sie keine justiziablen Taten begehen oder völkische Ideologien verbreiten. Ernstgenommen wird diese immer größer werdende Szene von Politikern, Intellektuellen, Publizisten und Kirchenvertretern in unserem Land nicht. Ihr wird ein Freiraum in unserer pluralistischen Gesellschaft zugestanden, den man zwangsläufig zu tolerieren hat, aber auf den auch stets ein wachsames Auge geworfen werden muss: Magische Rituale, die Anbetung von Naturgeistern, Astralreisen und schamanische Zeremonien haben, so der offizielle Tenor, eigentlich nichts mehr in unserer Welt zu suchen, aber als Träumereien von Schwärmern sollen sie doch ein (überwachtes) Plätzchen behalten. Man will ja tolerant und großzügig sein. Ich selbst bin für eine kritische Auseinandersetzung mit Esoterik und Spiritualität und habe mit meinem Film- und Buchprojekt »Schwarze Sonne« auch einiges dazu beigetragen.3 Aber ich bin immer wieder verwundert über die starke Spaltung, die in unserer Gesellschaft häufig zwischen Vertretern der »aufgeklärten Vernunft« und spirituell interessierten Menschen zu beobachten ist, zwischen der Welt des »Rationalen« und scheinbar »Irrationalen«, Ratio und Mythos, Wissenschaft und Magie.
Dass diese Spannung mitten ins Ethnologische Museum hineinreicht, verdeutlichte eine ZDF-Reportage, die 2014 vom Besuch einiger Vertreter der Kogi, eines indigenen Volkes aus Kolumbien, berichtete.4 Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und damals noch einer der drei Gründungsintendanten des Humboldt Forums, begrüßte die Kogi und führte sie in die Depots, wo »Sonnenmasken« ihres Volkes lagern. Während die offiziellen Vertreter in ihren Anzügen etwas hilflos herumstanden, rasselte der in indigener Tracht gekleidete Schamane andächtig mit einem Schwirrholz vor der Vitrine mit den Masken. Doch der Funke wollte nicht überspringen, zu fremd und künstlich war das Ambiente, als dass die Kogi mit den in den Objekten verkörperten Ahnengeistern kommunizieren konnten. Die Zeremonie wurde abgebrochen, und der politische Sprecher der Kogi erklärte, dass die Masken zurückgegeben werden müssten, da sie in das lebendige Umfeld der Sierra Nevada gehörten, aus dem sie ursprünglich stammten. Dort könne man ungestört mit ihnen reden und die Geister bitten, den Kogi bei ihrer Aufgabe zu helfen, das Wasser und die Erde vor weiterer Verunreinigung zu beschützen. Die Vertreter des Museums reagierten eher verlegen, und am Ende beschloss man, diese Masken nun doch nicht im künftigen Humboldt Forum auszustellen. Auf die Rückgabeforderung hin angesprochen, sagte Hermann Parzinger, die Indianer hätten dieses Anliegen nicht korrekt an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gerichtet und daher sei ihre Bitte gegenstandslos. Bei Bedarf könne man jedoch über eine temporäre Ausleihe reden, wenn entsprechende konservatorische Auflagen gewährleistet seien.
Ein kleines Ereignis am Rande, das jedoch zeigt, welche tiefe Kluft zwischen der Welt der Wissenschaftler und jener der indigenen Vertreter besteht. Auf der einen Seite die Schamanen, für die die Holzmasken eine echte »Seele« haben und lebendige Personen sind, auf der anderen die Funktionäre und Restauratoren, für die die Objekte wissenschaftlich analysierbare Objekte darstellen, deren Besitzstatus nicht eindeutig ist. Eine spirituelle Atmosphäre jedenfalls kam bei diesem Treffen nicht auf. Zwei vollkommen unterschiedliche Welten prallten aufeinander, die auch durch respektvolle Gesten vonseiten der Gastgeber nicht zu vermitteln waren.
Solche Gedanken begleiteten mich auch während meines letzten Besuches im Berliner Ethnologischen Museum, da ich ja wusste, dass 30 000 Objekte aus dessen Beständen in das Humboldt Forum umziehen sollten. Nach der »Wende« hatte man das Dahlemer Museum immer mehr vernachlässigt, wohl weil es in den Augen der Verantwortlichen zu wenig geeignet war, glanzvolle repräsentativen Aufgaben zu erfüllen, die Deutschland ja so liebt. Man hatte sich entschieden, die entlegene »Schmuddelecke« im Süden Berlins zu verlassen und in das für 600 Millionen wiedererbaute Berliner Schloss umzusiedeln, in der Überzeugung, dass dies für die Augen der Welt attraktiver sein würde. Ich hatte diese Ansichten nie ganz teilen können. Weder verstand ich, warum der Dahlemer Standort »entlegen« war, die U-Bahnfahrt vom Zentrum dorthin dauerte nur 20 Minuten, noch stellte ich mir die Mythenwelt des alten Museums gerne in einem Barockschloss vor, auf dessen Dach ein christliches Kreuz thronen sollte.
Viele Diskussionen sind inzwischen darüber entbrannt, ob das Stadtschloss der ehemaligen Kolonialmacht der Hohenzollern der geeignete Ausstellungsort für ethnographische Objekte sei, von denen einige unter das Verdikt der »Raubkunst« fielen. Die medialen Präsentationen des zukünftigen Humboldt Forums hatten für mich oft einen etwas zu selbstherrlichen Ton. Etwas von einem millionenschweren Staatsprojekt haftete dem Bau an, mit dem man im Geiste der Humboldtbrüder »Weltoffenheit« praktizieren wollte, als sei dies in den alten Dahlemer Räumen nie möglich gewesen. Für mich war eher das Gegenteil der Fall. Ich mochte den etwas abgeschabten Charme des alten Museums, seine labyrinthischen und leicht abgedunkelten Gänge, die für mich der verschlungenen Rätselwelt der Mythen entsprachen. Hier war noch das freie Träumen möglich gewesen, man konnte durch einen Meditationsort wandeln, der gerade abseits der Großstadthektik Ruhe und selbstverlorene Kontemplation ermöglichte.
Immerhin ermöglichten mir die Besuche im alten Ethnologischen Museum, eine völlig neue Welt kennenzulernen, die seither mein Leben nachhaltig mitbestimmt hat – und ich hoffe, dass diese Erlebnisse im künftigen Humboldt Forum fortgesetzt werden können. Für die Vorbereitung zu diesem Film- und Buchprojekt besuchte ich auch andere große Ethnologische Museen in Deutschland, etwa in Hamburg, Leipzig und Köln. Daneben vertiefte ich meine Kenntnisse durch Bücher, Kataloge und Gespräche mit Ethnologen und Sammlern der Kunst indigener Kulturen. Immer mehr kristallisierte sich heraus, dass es mir vor allem um die Vertiefung von Lévi-Strauss’ Begriff des »wilden Denkens« ging, der für mich als Filmemacher eine zentrale Rolle spielt. Denn ich arbeite – ähnlich wie Lévi-Strauss die Mythen beschreibt – ebenso mit Metaphern und Symbolen, aus denen ich eine komplexe Bildersprache herzustellen versuche, die Erkenntnisse jenseits des rein Begrifflichen vermitteln soll. Darüber hinaus wirkt der Terminus des »wilden Denkens« befreiend auf mich als spirituell suchenden Menschen, weil er das Fantastische, Spielerische und Geheimnisvolle unseres Geistes hervorhebt. Imagination und Rationalität, Fühlen und Denken, Bild und Begriff, Fantasie und Vernunft müssen hier keine Gegensätze sein, sondern können befruchtend zusammenwirken. Das »wilde Denken« muss auch keine endgültige Trennmauern zwischen Mensch und Natur sowie zwischen der Welt der Lebenden und Toten ziehen: Was wissen wir Europäer schon über das, was alles zwischen Himmel und Erde möglich ist und was – laut Shakespeare – unsere »Schulweisheit« übersteigt? Unsere Kultur besitzt nur einen von vielen möglichen Zugängen zu den Geheimnissen des Kosmos und der Natur. Daher will ich in diesem Projekt erkunden, wie andere Perspektiven aussehen und was wir davon lernen können.
REHABILITIERUNG DES MYTHOS: PIONIERE DES ›WILDEN DENKENS‹
Wir stellten schon fest, dass Begriffe wie »Mythos« oder »mythisch« in unserer Gesellschaft keinen hohen Stellenwert mehr haben, während sie in spirituell geprägten Kulturen Amerikas, Afrikas oder Asiens mit hoher Wertschätzung betrachtet werden. Doch es hat in der europäischen und auch deutschen Geistesgeschichte immer auch Denker gegeben, die das anders gesehen haben. Schon im 19. Jahrhundert brachen Philosophen wie Friedrich Wilhelm Schelling oder Friedrich Nietzsche eine Lanze für den Mythos, später dann so verschiedene einflussreiche Persönlichkeiten wie Rudolf Steiner, C. G. Jung, Karl Kerényi, Jean Gebser oder Hans Blumenberg. In diesem Buch sollen vier Forscher zurate gezogen werden, die ohne metaphysische Überhöhung über die Kraft und Berechtigung symbolischen Denkens sprechen. Vielleicht können ihre Gedanken einer zu schnellen Polarisierung in »aufgeklärt« und »mythisch«, wie sie hierzulande üblich ist, etwas entgegensetzen. Ernst Cassirer, Aby Warburg, Ludwig Wittgenstein und Claude Lévi-Strauss stammen aus jüdischen Familien, Cassirer und Lévi-Strauss mussten vor den Nazis fliehen und in die USA emigrieren. Doch trotz des perfiden Missbrauchs, den die Nationalsozialisten mit Mythen aller Art betrieben, scheuten die Forscher sich nicht, ihrer Begeisterung für das »wilde Denken« weiter nachzugehen. Ihre scharfsinnigen Gedanken zum Wert des Mythos sollen uns weiterhelfen, die in Ethnologischen Museen empfangenen Inspirationen zu vertiefen und für einen aktuellen Dialog mit spirituellen Kulturen der Welt fruchtbar zu machen.
1| »Animal symbolicum«: Ernst Cassirer
»Der Begriff der Vernunft«, so schrieb der Philosoph Ernst Cassirer (1874–1945) 1944 im New Yorker Exil, »ist höchst ungeeignet, die Formen der Kultur in ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit zu erfassen. Alle diese Formen sind symbolische Formen. Deshalb sollten wir den Menschen nicht als animal rationale, sondern als animal symbolicum definieren.«5
In diesem eindrücklichen Satz ist Cassirers gesamte Philosophie im Keim enthalten: Der Weltzugang von uns Menschen war und ist immer symbolisch, egal ob in Wissenschaft, Kunst, Religion oder im Mythos. Wir dringen nie ganz zum Eigentlichen vor ohne die mediale Vermittlung von Bildern, Zeichen und Symbolen – und das war wohl von Anbeginn der Menschheit nie anders. Es gehört zu unserem Wesen, symbolisch, also auch in Mythen, zu denken, und vermutlich ist dies ein Hauptmerkmal, mit dem wir uns vom Tier unterscheiden. Die Höhlenkunst der Altsteinzeit, die bis zu 40 000 Jahre zurückreicht, legt dafür schon ein beredtes Zeugnis ab. Doch nicht nur Kunst, Religion und Mythologie denken in Symbolen, wie häufig geglaubt wird. Auch die Physik etwa wirft der Natur das »symbolische Kleid« der Mathematik über und benutzt Begriffe wie »Kraft« und »Energie«. Die Geometrie arbeitet mit abstrakten Formen, die es so in der Natur genauso wenig gibt wie die Metaphern eines Dichters. Alle unsere Zeichensysteme bilden nicht eine schon objektiv bestehende Welt ab, sondern erschaffen sie erst.
Ob ein Biologe eine Eiche durch »Moleküle« erklärt oder ein Schamane durch »Baumgeister«, sind nur zwei verschiedene und letztlich gleichberechtigte Perspektiven auf diesen Baum. Letztere als unsinnigen Aberglauben zu verurteilen ergibt keinen Sinn: Diese Sichtweise ist nicht nur älter als die erste, sondern bis heute bei vielen indigenen Kulturen üblich, die damit jahrhundertelang gut leben konnten – ohne eine solche Naturzerstörung anzurichten wie wir. Vielleicht besteht in nicht allzu ferner Zukunft die Chance eines fruchtbaren Zusammenwirkens so unterschiedlicher Symbolzugänge zur Wirklichkeit?
Cassirer, dem solche Gedanken 1917 beim Besteigen einer Berliner Straßenbahn kamen6, betont immer wieder, dass alle Grundformen unserer Kultur dem mythischen Bewusstsein entstammen. Daher nütze es nichts, dieses zu verbannen, sondern man müsse es ernst nehmen und verstehen. Der Mythos sei keine bloße Erfindung oder Erdichtung; wer das glaube, sei nicht in der Lage, dessen »unvergleichliche Kraft« in der Geschichte zu verstehen. Daher komme ihm eine »eigene Weise der Realität« zu.7 Jahrtausendelang habe der Mensch die Welt nicht analytisch aufgespalten und dabei Geist und Natur, Verstand und Gefühl, Logik und Fantasie getrennt, sondern er wollte immer die unauflösbare Gesamtheit des Seins verstehen, in der Innen und Außen, Seele und Natur nicht getrennt seien. Den flüchtig-chaotischen Sinneseindrücken, die ihn umfingen, stellte der Mensch schon im Paläolithikum eine selbstständige Bildwelt entgegen. Der Macht des »Eindrucks«, so Cassirer, trat allmählich immer deutlicher die tätige Kraft des »Ausdrucks« gegenüber:8 ein ungeheures schöpferisches Vermögen des »wilden Denkens«, das mich bei den Objekten des Berliner Ethnologischen Museums jedes Mal neu in seinen Bann gezogen hatte.
Ich weiß nicht, ob Cassirer auch solche Museen besuchte, aber er fand diese kreative Fülle mythischer Ausdrucksformen sicherlich in der riesigen Hamburger Bibliothek des Kunsthistorikers Aby Warburg, den wir später noch genauer betrachten wollen. Beide waren befreundet, und der vermögende Warburg ließ für Cassirer selbst die entlegensten Buchwünsche erfüllen. Die Fußnoten von Cassirers Hauptwerk »Philosophie der symbolischen Formen« enthalten viele Verweise auf die reiche mythologische und religionsgeschichtliche Literatur aus Warburgs Bibliothek. Neben Büchern über chinesische, indische, römische, griechische, germanische und ägyptische Mythologie finden sich dort auch Studien zu entlegeneren Kulturen wie etwa jenen der Algonkin, Cherokee, Huichol, Zuni, Bororo, Yoruba, Aborigines und Polynesier, die Cassirers großes Interesse gerade auch für außereuropäische Weltbilder bezeugen.
»Wie von einem Zauberhauch schien mir dieser nicht abbrechende Zug der Bücher umwittert«, schrieb Cassirer, »wie ein magischer Bann lag es über ihnen.« Warburgs Bibliothek muss einen solchen Eindruck auf ihn gemacht haben, dass er sie sogar als »gefährlich« beschrieb: »Entweder ich muss sie ganz meiden oder mich für Jahre dort einsperren.«9 Diese Sätze deuten darauf hin, dass Cassirers Begegnung mit dem tiefgründigen Denken indigener Völker ein äußerst beeindruckendes Erlebnis gewesen sein muss. Er war nicht – wie Warburg oder Lévi-Strauss – selbst in solche Kulturen gereist, aber durch die Lektüre über ihre Mythen und Bräuche sprang bei ihm der Funke über. Es zeichnet Cassirer aus, dass er bereits in den 1920er-Jahren auf jede Form eurozentrischer Überheblichkeit verzichtete und wie später Lévi-Strauss die Gleichwertigkeit von magischem und rationalem Denken betonte. Auch indigene Völker, so Cassirer, ordneten die Welt mithilfe von Raum- und Zeitbegriffen sowie mit Zahlen, aber auf eine andere Weise als wir. Für sie sei z. B. der Raum kein bloß »dinglicher Behälter«, sondern ein auch gefühlsmäßig erlebter »Ausdrucksraum«. Dies sei jedoch kein geometrischer Raum, sondern ein »konkretes Bewußtseinsgebilde«10, in dem heilige Orte und geweihte Bezirke zur Ordnung der Welt beitrügen. So hatten etwa im alten Rom jedes Haus, jede Feldflur, jeder Acker und Weinberg einen eigenen Gott, der diese Räume mit einer eigenen Aura versah. Bereits die Schwelle zu einem Tempel habe solche spirituellen Raumempfindungen ausgelöst, man fühlte Scheu vor dieser Stelle, die den sakralen Raum gegenüber der profanen Welt abgrenzte. Unser Wort »Schwellenangst« – so Cassirer – erinnere noch von ferne daran.11 Ringförmige Heiligtümer machten durch ihre spezielle Form ebenfalls klar, dass das mythische Raumempfinden nichts mit Quantitäten zu tun hat, sondern mit dem Gespür des Besonderen und Herausgehobenen. Ähnliches habe für den mythischen Zeitbegriff gegolten, der etwa an Sonnenwendfesten die Kraft und den Zauber kosmisch-zyklischer Verläufe erlebbar machte.
Anders als unser Raumempfinden, so betonte Cassirer, verknüpfe das mythische auch Himmelsrichtungen mit Elementen, Jahreszeiten und Berufen. So stellten für die Zuni-Indianer in New Mexico die Begriffe für Norden, Luft, Winter und den Beruf des Kriegers eine ähnliche Einheit dar wie z. B. jene für Süden, Feuer, Sommer und Medizin. Raum werde so für indigene Kulturen »zu einem Zusammenschluss aller Differenzen in einem großen Ganzen, in einem mythischen Grundplan der Welt«.12
Das Argument, dies seien doch letztlich fantastische Konstruktionen, kann Cassirer nicht gelten lassen, da auch unser geometrischer Raum ein ersonnenes »Instrument der Welterklärung« darstelle, das sinnliche Inhalte in eine räumliche Form gieße, die aus Punkten, Flächen, Linien, Körpern bestehend gedacht werde: der »Funktionsraum« der Mathematik.
Der mythische Raum dagegen ruhe »auf einem ursprünglichen Gefühlsgrund« und deute die uns umgebende Welt häufig vom Leib-Erleben des Menschen her. So erzählt der indische Mythos, dass alles aus dem tausendköpfigen Urmenschen »Purusha« entstanden sei: Aus seinem Geist wurde der Mond geboren, aus seinen Augen die Sonne, aus dem Kopf der Himmel, aus dem Nabel der Luftraum und aus den Füßen die Erde.13 Im Mythos hängen Makro- und Mikrokosmos stets zusammen. Alles ist Ausdruck eines holistischen Daseinsgefühls, das keine starren Grenzen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen zieht. Auch wenn wir heute weit von einem solchen Denken entfernt sind, könnte man die Frage stellen, ob angesichts der ökologischen Krise dieser Blick auf die Welt nicht etwas Beeindruckendes und Inspirierendes hat.
Auch in unserem eigenen Leben kennen wir ja Gefühle eines qualitativen Raum- und Zeiterlebens, das nichts mit Mathematik zu tun hat. Wenn wir auf unserer Lieblingsbank im Park sitzen oder im Urlaub die Weite von Meer und Gebirge genießen, erleben wir keine Messdaten, sondern den Zauber vielfältiger Naturformen. Es ist schmerzhaft zu sehen, dass in unserer Kultur solche Empfindungen oft in den Privatbereich abgedrängt werden, ins bloß »Subjektive«, während die Außenwelt in den Zustandsbereich »objektivierender« Wissenschaft fällt. Solche Trennungen kennt der Mythos nicht. Cassirer weist uns darauf hin, dass im mythischen Denken gar keine festen Begriffe von »Seele« und »Wirklichkeit« existieren, sondern dass sie tastend und in einem »stets schwankenden Übergang« erst gesucht werden.
Solche Gedanken bestärken mich in meiner künstlerischen Arbeit ungemein. Auch für mich als Filmemacher stellen Dreharbeiten immer Versuche dar, den Raum zwischen mir und der Außenwelt neu auszuloten, wobei sich die Grenzen zwischen meinem »subjektiven« Empfinden und der »buchstäblichen« Realität verschieben. Der Baum vor mir existiert ›objektiv‹ gar nicht. Erst das Licht und der jeweilige Kameraausschnitt geben ihm »Wirklichkeit«, erst mein Bild von ihm lässt ihn für mich – und für meine Zuschauer – entstehen.
Der Mythos ist für Cassirer also eine Erkundungsfahrt, um zu verstehen, was »Seele« und »Wirklichkeit« überhaupt sind und wo sie ineinander übergehen. Das ganze abendländische Modell, wonach nur in unserem Kopf eine Seele bzw. ein Bewusstsein wohnt, dem außerhalb des Körpers ein unbeseelter Objektraum gegenübersteht, wird hier auf den Kopf gestellt. Manche Völker, so Cassirer, glauben sogar, dass jeder Mensch mehr als nur eine Seele hat, verschiedene Seelenteile, die den Körper verlassen, umherfliegen und vorübergehend in einem Teich oder Baum wohnen können. Afrikaner und Malaien gehen von vier bzw. sieben verschiedenen Seelen aus, »bei den Yoruba besitzt jedes Individuum drei Seelen, von denen die eine im Kopf, die andere im Magen, die dritte in der großen Zehe wohnt«.14
Bei den alten Ägyptern ging man davon aus, dass im Menschen drei verschiedene Seelen existierten, die nach dem Tode weiterlebten: der Ka, ein geistiger Doppelgänger, der im Grab beim Toten bleibt und ihn beschützt, ferner der in Vogelgestalt umherwandernde Ba, der gelegentlich zur Mumie zurückkehrt, und Khu, der unsterbliche Teil, der vielleicht am ehesten unserem Begriff »Geist« entspricht. Mythische Kulturen, so Cassirer, arbeiteten noch kein Prinzip einer einheitlichen »Persönlichkeit« heraus, was für ihn kein intellektuelles Unvermögen darstellt, sondern ein anderes Lebensgefühl spiegelt: das »Phasengefühl«. Für das »wilde Denken« entsteht zu Beginn einer jeden Lebensphase ein neues Selbst, etwa bei den Initiationsriten, wo die alte Seele »getötet« wird, um eine Neubeseelung zu ermöglichen.
Ein solcher erweiterter Seelenbegriff führt auch zu Cassirers animistischem Weltverständnis, zum »Gefühl der Gemeinschaft alles Lebendigen«.15 Mit vielen Beispielen beschreibt Cassirer das noch nicht gespaltene Verhältnis mythischer Kulturen etwa zur Tier- und Pflanzenwelt: »Von den Buschmännern wird noch heute berichtet, dass sie auf Befragen keinen einzigen Unterschied zwischen Mensch und Tier anzugeben vermochten. Bei den Malaien gilt der Glaube, dass die Tiger und Elefanten im Dschungel eine eigene Stadt haben, wo sie in Häusern wohnen und in jeder Hinsicht gleich menschlichen Wesen handeln.«16 Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist noch magisch, die Jagd dient nicht der reinen Fleischbeschaffung, sondern wird rituell vorbereitet, etwa beim Bisontanz nordamerikanischer Indigener, in dem mimisch die Gefangennahme und Tötung des Tieres dargestellt wird. Dies ist keine bloße Einübung von Fertigkeiten, sondern drückt auch tiefen Respekt vor den Tieren aus, von denen nur so viele gejagt werden, wie zum eigenen Überleben nötig ist.
Dasselbe animistische Gefühl der Anteilnahme wird im Mythos auch der Pflanzenwelt entgegengebracht. Cassirer beschreibt, wie bei den Dschagga in Tansania Mensch und Pflanze als Schicksalseinheit gedacht werden, die zu einer Gemeinschaft gestaltet werden muss. Man setzt unsere Lebensstufen eins mit denen der Banane, und Bananenstauden spielen eine wichtige Rolle bei Initiations- und Hochzeitsritualen.17 Es wirkt anrührend auf mich, wie hier eine für uns eher unbedeutende Frucht aufgewertet und in den Zusammenhang mit existenziellen Fragen gestellt wird.
Cassirer weist darauf hin, dass es auch in Europa einst ein so tief mit der Vegetation verbundenes mythisches Denken gab: Der Attis-, Dionysos- und Osiriskult in der ägyptischen und griechischen Antike war mit Bräuchen verbunden, in denen das Werden und Verwelken der Pflanzenwelt miterlebt wurde. Man spielte das Drama des sterbenden und wiederauferstehenden Gottes in wilden orgiastischen Tänzen nach, in denen »die Identität mit dem Urquell allen Lebens wiederhergestellt« werden sollte: »So spricht sich im Mythos alles natürliche Sein in der Sprache des menschlich-sozialen Seins, alles menschlich-soziale in der Sprache des natürlichen aus.«18
Sind dies nun überholte Vorstellungen, die der aufgeklärte oder christliche Mensch der Neuzeit erfolgreich hinter sich gelassen hat? Cassirer verweist auch auf die Gewaltakte, die die monotheistischen Religionen und die wissenschaftliche Naturbetrachtung mit sich brachten. Kritisch beleuchtet er z. B. die Verdammung der alten heidnischen Kulte durch die Propheten des Alten Testaments, die darin nur »Trug« und »Götzendienst« sahen. Sie glaubten fälschlicherweise, dass die naturreligiösen Völker nur willkürliche Zeichen anstelle des »wirklich Göttlichen« setzten, wobei – so Cassirer – diese keine bloßen »Abbilder« verehrten, weil sie den Unterschied zwischen Abbild und Urbild gar nicht kannten. Die Propheten jedoch entwerteten in ihrem Furor alles, was nicht in ihr geistig-sittliches Ich/Du-Verhältnis von Gott und Mensch hineinpasste. Dadurch wurde – laut Cassirer – die Welt des naturhaften Daseins ihrer religiösen Dimension beraubt und zur seelenlosen, toten »Sache« erklärt:19 eine Beschädigung, die manche Philosophen bis heute auch für die Zerstörung unserer Umwelt verantwortlich machen.
Das neue monotheistische Gottesbild versuchte zwar, die alten Götter und Mythen zu verbannen, aber die religionsgeschichtliche Entwicklung nahm einen anderen Weg:
»Immer wieder drängen sich hier die Bilder der mythischen Fantasie hinzu – auch nachdem sie ihr eigentliches Leben verloren haben, nachdem sie zu einer bloßen Traum- und Schattenwelt geworden sind. Wie im mythischen Seelenglauben der Tote als Schatten noch wirkt und ist, so beweist auch die mythische Bildwelt noch auf lange hinaus ihre alte Macht, obwohl ihr, namens der religiösen Wahrheit, ihr Sein und ihre Wesenheit bestritten werden. Auch hier gehören, wie in der Entwicklung aller symbolischen Formen, Licht und Schatten zusammen.«20
Cassirers Überlegungen zum Wert des Mythos gehören zu den großen philosophischen Würfen des 20. Jahrhunderts. Er plädierte für eine multiperspektivische Annäherung an die Welt, was auch die Anerkennung des mythischen Denkens als eine von vielen möglichen Symbolformen einschließt. Cassirer wollte kein Gegeneinander von Wissenschaft und Mythos, Begriff und Bild, sondern ein kreatives Miteinander, eine – wie sein Biograf Heinz Paetzold treffend formulierte – »Pluralität der Weltbezüge, die heute an die Stelle der Eindimensionalität des überkommenen Rationalismus zu treten hat.«21
2| »Ewiggleiches Indianertum«: Aby Warburg
Aby Warburg (1866–1929) und Ernst Cassirer waren gut befreundet, obwohl sie sich nicht oft getroffen haben. Cassirer besuchte Warburg einmal während einer langwierigen psychischen Erkrankung in Kreuzlingen am Bodensee, was dem in Psychosen versunkenen Warburg eine große Hilfe war. Die Debatten mit dem Freund über symbolisches Denken ließen ihn wiederaufleben und ermöglichten eine neue kreative Arbeitsphase. Aby Warburgs legendäre, am Ende 60 000 Bände umfassende Bibliothek war dadurch zustande gekommen, dass er, der Spross einer reichen Hamburger Bankerfamilie, sein Erstgeburtsrecht an seine Brüder »verkauft« hatte, mit der Bedingung, ihm lebenslang jedes Buch zu finanzieren. Scherzhaft nannte Abys Bruder Max die Bibliothek eine »Zweigstelle des Bankhauses M.M. Warburg, die sich kosmischen statt irdischen Aufgaben widmen sollte«.22
Schon als Kind hatte Aby Warburg Indianerromane verschlungen, auch um sich angesichts der schweren Erkrankung der Mutter in ferne Welten zu entrücken, die sich in seiner Fantasie wie ein »Gärungspilz« weiterentwickelten.23 Sein großes Interesse an Mythologie führte ihn in die Vorlesungen von Hermann Usener und auf eine Reise nach Amerika, wo er auf Rituale der Hopi- und Pueblo-Indianer traf, die ihn tief bewegten. Die abstoßende »Leerheit der Zivilisation« und ein »aufrichtiger Ekel« vor einer ästhetisierenden Kunstgeschichte hatten Warburg 1895 nach Arizona und New Mexico getrieben, wo er eine Kulturstufe anzutreffen glaubte, die jener der heidnisch-europäischen Antike entsprach.24 Diese Reisen zum »wilden Denken« waren auch mit erheblichen Strapazen verbunden, etwa bei Übernachtungen im Freien bei minus 20 Grad oder inmitten von heftigen Sandstürmen. Es war nicht die erbauliche Tour eines Kunsthistorikers, sondern »eine Reise zu den Ursprüngen der Bildschöpfung«, eine Erkundungsfahrt zu dem »kultischen Ursprung des Bildes«.25
Für Warburg waren Bilder nichts rein Ornamentales oder Ästhetisches, sondern tiefgründige Mittel des Menschen, sich mit auch beunruhigenden Grundfragen seines Daseins auseinanderzusetzen. Dabei interessierten ihn vor allem kultische Tänze der Hopi-, Zuni- und Pueblo-Indianer, die sich dabei in Antilopen und Schlangen zu verwandeln suchten. Ähnlich wie Cassirer zeigte auch Warburg ein starkes Interesse an der animistischen Weltsicht der Indigenen in Nordamerika, vor allem auch an ihrem Verhältnis zu Tieren, die als ebenbürtige Partner angesehen wurden. Den Forscher faszinierten insbesondere die berühmten Schlangentänze der Hopi, die er zwar nicht selbst gesehen hat, aber mittels Augenzeugenberichten, Fotos und zahlloser Bücher intensiv studierte. Gerade die Beschäftigung mit Zeremonien und Mythen rund um die Schlange ermöglichte Warburg tiefe Einblicke in das seit Urzeiten von Menschen praktizierte symbolische Denken.
Die Hopi fingen für bestimmte Rituale giftige Klapperschlangen im Busch und wuschen sie in unterirdischen Kulthöhlen, bevor sie dann in zum Teil lebensgefährlichen Schlangentänzen eingesetzt wurden. Anders als in der Bibel verkörperte dieses Tier für die Indigenen nicht das »Böse«, sondern eine ambivalente Urkraft der Natur, mit der man sich immer wieder ins richtige Verhältnis zu setzen hatte. Die Schlange entgleitet ja in ihrer unberechenbaren Vieldeutigkeit immer wieder unserem Zugriff: Sie kann mit ihren Giftzähnen den schnellen Tod bringen, verkörpert aber mit ihren Häutungen auch Kräfte der Umwandlung und Regeneration. Sie kann stundenlang ruhig daliegen, um dann ganz plötzlich zum Angriff hervorzuschnellen. In vorchristlichen Kulten der Antike war man sich dieser Ambivalenz bewusst, ohne sie moralisch zu bewerten. Dem von den Göttern verdammten trojanischen Priester Laokoon bringt die Schlange den Tod durch Erwürgen, aber sie ringelt sich auch um den Stab des Gottes Asklepios als Symbol seiner Heilkunst. In unterirdischen Grotten seiner Tempelanlagen wurden Nattern gehalten, in denen man die Verkörperung von Erdkräften sah, die den Kranken bei ihrer Genesung helfen konnten. Die Mänaden wiederum, weibliche Begleiterinnen des Gottes Dionysos, tanzten mit Schlangen, die dann während ihrer wilden Rituale zerrissen wurden: blutige Opfer für Dionysos, der selbst zerstückelt wurde, aber in den Kultfeiern wieder seine Auferstehung feierte.26
Warburg kannte diese antiken Mythen und sah erstaunliche Parallelen zu den Schlangentänzen der Hopi, die ihn bis zu seinem Tode nachhaltig faszinierten. Es schien ihm, als wären hier mitten in der Wüste Arizonas Teile der paganen Mythenwelt Europas wieder emporgestiegen, archetypische Urempfindungen, die den Menschen über Jahrtausende in Bann halten konnten. Warburg hielt nach seiner Rückkehr aus den USA 1896 im Berliner Völkerkundemuseum, dem Vorläufer des Ethnologischen Museums, einen Vortrag über seine Reise und geriet dabei in Streit mit einigen Anthropologen. Während der Kunsthistoriker in den Ritualen der Hopi die Eröffnung eines besonnenen symbolischen »Denkraumes« sah, mit dem diese sich von Urgewalten der Natur distanzierten, ohne die Nähe zu diesen zu verlieren, diskreditierte der Ethnologe Karl Weule solche Kulte als »primitiv«.27 Gegenüber dieser eurozentrischen Ethnologie vertrat Warburg schon damals – ähnlich wie Cassirer – liberalere Anschauungen, einmal sprach er sogar in sympathisierender Identifikation von seiner »indianischen Seele«.28
Doch Warburg war von eher zartem, fragilem Gemüt. Mehrere Erschütterungen in seinem Leben führten 1918 zu einem psychischen Zusammenbruch, der einen langjährigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik nötig machte. Über die Ursachen ist viel spekuliert worden: eine reizbare, überempfindliche Persönlichkeit, die Wirren und Bedrohungen des Ersten Weltkrieges, anwachsende antisemitische Strömungen, die dem Gelehrten wohl auch den Weg an die Hochschulen unmöglich machten. Nach schweren Wahnanfällen, in denen Warburg mit einer Pistole herumlief und Angehörige bedrohte, wurde er im April 1923 in die Klinik Belvedere am Bodensee eingeliefert, wo ihn der namhafte Psychiater Ludwig Binswanger betreute. Warburgs Krankenakte ist deshalb so erschütternd, weil sich in ihr auch das Doppelgesicht magischsymbolischen Denkens ablesen lässt. Wenn er in der Klinik Tomatensauce und Wirsingkohl ablehnt, weil er darin das Blut und Gehirnteile seiner Angehörigen sieht, die von bösartigen Verfolgern getötet worden seien, liest sich das wie eine verdrehte Form von Animismus. Warburg war vorübergehend in dem Wahnglauben gefangen, dass jede Erbse und Bohne auf seinem Teller eine eigene Seele habe und er sie deshalb nicht essen könne.29 Ein Fischgericht ließ er mit der Begründung zurückgehen, dass sein Sohn in dieses Tier verwandelt worden sei und er es nicht einfach so verspeisen könnte. Während heftiger Anfälle greift er sogar Krankenschwestern an und bringt sie durch Würgegriffe fast zu Tode, wobei er nach Zeugenberichten ungeheure körperliche Kräfte entwickelt haben soll. Andererseits studiert er mit großem Interesse das Buch des Psychiaters Hans Prinzhorn über die »Bildnerei von Geisteskranken« und spricht nachts mit kleinen Faltern, die in sein Zimmer geflogen kommen, nennt sie liebevoll seine »Seelentierchen«.30 Binswanger, ein an Philosophie und Kunst interessierter Psychiater, setzt bei seiner Therapie auch auf die Aktivierung von Selbstheilungskräften durch schöpferische Arbeit. Daher erlaubt er Warburg, vor dem versammelten Klinikpersonal einen Vortrag über seine Erfahrungen mit den Hopi-Indianern zu halten, der auch tatsächlich zu einer psychischen Stabilisierung führt.
Was ist bei dieser geistigen Tätigkeit mit Warburg passiert? Interessant ist, dass gerade Warburgs Durcharbeitung von Aspekten des »wilden Denkens« zu einem besser ausbalancierten Umgang mit eigenen »wilden« Energien geführt hat. Er bewundere die animistischen Rituale der Hopi, so Warburg bei seinem Vortrag 1923 in der Klinik, wegen ihrer »schrankenlosen Beziehungsmöglichkeit zwischen Mensch und Umwelt« und ihres »andächtigen Selbstverlust(s) an ein fremdes Wesen«.31 Die indianischen Maskentänzer verwandeln sich in Antilopen, Schlangen und »Korndämonen«, um mit starken Naturkräften zu verschmelzen, sich in ihre durchaus auch bedrohlichen Energien einzufühlen und sie für eigene Zwecke zu nutzen. Für die Hopi- und Pueblo-Indianer ist die erfolgreiche Maisernte lebenswichtig, die nur nach ausgiebigen Regenfällen in den sommerlichen Dürreperioden erfolgen kann. Dazu müssen Gewitter herbeigerufen werden, deren Blitzeinschläge die Wolken zum Abregnen bringen. Für die Indianer verkörpert die Schlange in ihrer Form und Kraft solche Blitze, und daher versucht man, sie in Ritualen zur Verbündeten zu machen. Indem man ohne Angst ganz mit ihr verschmilzt, glaubt man sich den elementaren Naturkräften nahe, die Gewitter und Regen hervorbringen. Daher nehmen die Hopi-Tänzer die Schlangen während der Rituale auch in den Mund, teilweise als Bündel, kleine Schlangen sogar als Ganzes, sodass nur ihr Kopf aus dem Mund herausschaut: ein für uns Europäer irritierendes Spektakel, auf das wir mit Angst, Abwehr, aber auch Faszination reagieren.
Nach den Tänzen warfen die Indianer die Schlangen auf sorgsam gemalte Sandmandalas, wobei die fragile Zeichnung zerstört wurde und die Schlangen sich mit dem farbigen Sand vermischten. Das gefährliche Reptil wurde damit zum Mitgestalter der Zeichnung, der menschliche Künstler ließ sie in einem rituellen Kunstwerk mitspielen. Nach der Zeremonie wurden die Reptilien freigelassen und in die Wüste ausgesandt, um – zu Botschaftern umgewandelt – in Blitzgestalt das Gewitter am Himmel zu erzeugen.32 Sie sollten der »geistigen Welt« berichten, dass ihnen bei den Menschen nichts Schlechtes widerfahren war und dass diesen nun von höheren Mächten geholfen werden sollte.
Warburg erwähnt in seinem Vortrag auch die Parallelen zu den Schlangenkulten der griechischen Antike und arbeitet heraus, dass auch im Judentum und Christentum dieses ambivalente Tiersymbol unterschwellig weiterwirkte.33