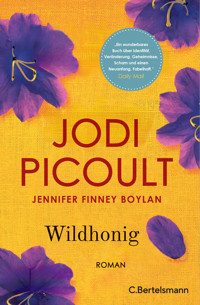
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Der fesselndste, herausforderndste und zeitgemäßeste Roman des Jahres. – Er wird eine Debatte über Authentizität, Identität und Gender anstoßen.« Boston Globe
Olivia McAfee hätte nie gedacht, je wieder in ihre verschlafenen Heimatstadt in New Hampshire zurückzukehren, in das Haus ihrer Kindheit. Doch als ihr Mann, ein brillanter Chirurg, seine dunkle Seite offenbarte, war die Flucht dorthin für sie und ihren Sohn Asher die einzige Wahl. Sie fassen schnell Fuß, Olivia übernimmt den Imkereibetrieb ihres Vaters, und Asher verliebt sich in Lily, die wie er neu an der Schule ist. Lily erwidert seine Liebe, allerdings trägt sie ein Geheimnis mit sich herum, und sie ist sich nicht sicher, ob sie Ash wirklich alles anvertrauen kann.
Doch dann geschieht das Unvorstellbare: Lily ist tot, und Asher wird von der Polizei verhört. Olivia ist von der Unschuld ihres Sohnes überzeugt. Aber in Ash schlummern auch Anteile seines Vaters. Als sich der Verdacht gegen ihn verhärtet, merkt sie, dass er etwas verbirgt ...
»Wildhonig« ist ein fesselnder Spannungsroman, eine unvergessliche Liebesgeschichte und eine bewegende Erkundung der Geheimnisse, die wir bewahren, und der Risiken, die wir eingehen, um wir selbst zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ZUDIESEMBUCH
Olivia McAfee hätte nie gedacht, je wieder in ihre verschlafene Heimatstadt in New Hampshire zurückzukehren, in das Haus ihrer Kindheit. Doch als ihr Mann, ein brillanter Chirurg, seine dunkle Seite offenbarte, war die Flucht dorthin für sie und ihren Sohn Asher die einzige Wahl. Sie fassen schnell Fuß, Olivia übernimmt den Imkereibetrieb ihres Vaters, und Asher verliebt sich in Lily, die wie er neu an der Schule ist. Lily erwidert seine Liebe, allerdings trägt sie ein Geheimnis mit sich herum, und sie ist sich nicht sicher, ob sie Ash wirklich alles anvertrauen kann.
Doch dann geschieht das Unvorstellbare: Lily ist tot, und Asher wird von der Polizei verhört. Olivia ist von der Unschuld ihres Sohnes überzeugt. Aber in Ash schlummern auch Anteile seines Vaters. Als sich der Verdacht gegen ihn verhärtet, merkt sie, dass er etwas verbirgt …
Wildhonig ist ein fesselnder Spannungsroman, eine unvergessliche Liebesgeschichte und eine bewegende Erkundung der Geheimnisse, die wir bewahren, und der Risiken, die wir eingehen, um wir selbst zu werden.
»Herzergreifend und herzzerreißend.« The Washington Post
ZUDENAUTORINNEN
Jodi Picoult, geboren 1966 in New York, studierte in Princeton und Harvard. Seit 1992 schrieb sie neunundzwanzig Romane, die alle auf den vorderen Plätzen der New York Times-Bestsellerliste standen. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem renommierten New England Book Award. Picoult lebt mit ihrem Mann und zahlreichen Tieren in Hanover, New Hampshire.
Jennifer Finney Boylan, geboren 1958, schrieb zahlreiche erfolgreiche Romane und Artikel für die New York Times. Sie ist eine bekannte Menschenrechtsaktivistin und Kuratorin des PEN America. Ihre 2003 erschienenen Memoiren, She’s Not There: A Life in Two Genders gelten als »ein bahnbrechendes Werk des trans Literaturkanons«. Heute lebt sie mit ihrer Frau Deedie und ihren beiden Kindern in New York City und in Belgrade Lakes.
Jodi Picoult
Jennifer Finney Boylan
Wildhonig
Aus dem Amerikanischen von Elfriede Peschel
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Mad Honey bei Ballentine Books a division of Penguin Random House, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 der Originalausgabe by Jodi Picoult und Jennifer Finney Boylan
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe by C. Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: www.buerosued.de nach einem Entwurf von Lisa Amoroso
Umschlagmotiv: © Евгения Матвеец und Rosemary Calvert / Getty Images
This translation is published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of Penguin Random House, a division of Random House LLC.
Redaktion: Gerhard Seidl
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26337-9V003
www.cbertelsmann.de
»Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden.«
SØRENKIERKEGAARD
1 Olivia
6. Dezember 2018 Der Tag an dem …
Von dem Augenblick an, als ich wusste, dass ich ein Baby erwartete, wünschte ich mir ein Mädchen. Ich lief durch die Gänge der Kaufhäuser, strich mit der Hand über Kleider in Puppengröße und griff nach winzigen paillettenbesetzten Schuhen. Sah uns mit gleichfarbigem Nagellack – mich, die noch nie eine Maniküre hatte machen lassen. Ich stellte mir den Tag vor, an dem ihre hellen Haare lang genug für Rattenschwänze wären; sah ihre an der Scheibe des Schulbusses platt gedrückte Nase, ihren ersten Schwarm, das Kleid für den Abschlussball, Liebeskummer. Jedes dieser geistigen Bilder war eine Perle im Rosenkranz zukünftiger Erinnerungen – ich betete täglich.
Wie sich herausstellte, war ich keine Zelotin … nur eine Märtyrerin.
Als der Arzt, nachdem ich das Kind zur Welt gebracht hatte, sein Geschlecht bekannt gab, wollte ich es anfangs nicht glauben. Es war mir auf ganz unglaubliche Weise gelungen, von dem auszugehen, was ich mir wünschte, sodass ich darüber ganz vergaß, was ich brauchte. Aber als ich Asher im Arm hielt, war ich erleichtert.
Es war besser, einen Jungen zu haben, der nie jemandes Opfer sein würde.
Die meisten Leute in Adams, New Hampshire kennen mich beim Namen, und jene, die nicht dazugehören, machen einen großen Bogen um mein Haus. Es ist ein Schicksal, das wir Imker mit Feuerwehrleuten teilen, denn wie sie bringen wir uns willentlich in Situationen, die anderen Menschen Albträume bereiten. Allerdings sind Honigbienen weitaus weniger rachsüchtig als die mit ihnen verwandten Wespen, aber viele Menschen kennen den Unterschied nicht, weshalb alles, was sticht und summt, eine potenzielle Gefahr darstellt. Ein paar Hundert Meter vom alten Haus im Cape-Cod-Stil entfernt sieht man den Halbkreis der regenbogenfarbenen Bienenstöcke, in denen meine Völker leben und von wo aus sie fast den ganzen Frühling und Sommer über zu den Blütenfeldern schwirren, die sie unter warnendem Summen bestäuben.
Ich wuchs auf diesem kleinen Hof auf, der seit Generationen von der Familie meines Vaters bewirtschaftet wurde: Die Ernte der Apfelplantage wurde im Herbst als Apfelwein mit hausgemachten Donuts meiner Mutter verkauft, im Sommer gab es Erdbeeren zum Selberpflücken. Wir waren reich an Land, hatten aber wenig Geld. Die Imkerei war das Hobby meines Vaters, wie schon vor ihm seines Vaters und so weiter bis zurück zu dem ersten McAfee, der zu den frühesten Siedlern von Adams gehörte. Adams liegt glücklicherweise so weit vom White Mountains National Forest entfernt, dass die Immobilienpreise hier noch bezahlbar sind. Die Stadt besteht aus einer Verkehrsampel, einer Bar, einem Diner, dem Postamt, einer Grünfläche, auf der früher mal Schafe geweidet haben, und dem Slade Brook – einem Bach, dessen Name auf einer geologischen Landkarte von 1789 falsch gedruckt worden war, sich aber durchgesetzt hatte. Eigentlich hätte er Slate Brook heißen sollen, wegen des Schiefergesteins an seinen Ufern, das in der ganzen Gegend zu Grabsteinen verarbeitet wurde. Slade hingegen hieß der örtliche Bestatter und Dorftrunkenbold, der in seinem Suff umherzuziehen pflegte und ironischerweise im fünfzehn Zentimeter tiefen Wasser des Bachlaufs ertrank.
Als ich Braden zum ersten Mal zu meinen Eltern mitbrachte, erzählte ich ihm unterwegs diese Geschichte. Aber wer,wunderte er sich grinsend, hat den Bestatter bestattet?
Damals hatten wir am Stadtrand von Washington gelebt; Braden arbeitete an der Johns Hopkins als Assistenzarzt der kardiologischen Chirurgie, während ich mit meinem Job im National Zoo versuchte, genügend Geld für ein Graduiertenprogramm in Zoologie aufzubringen. Wir waren zwar erst seit zwei Monaten zusammen, aber ich war bereits bei ihm eingezogen. Und an diesem Wochenende besuchten wir meine Eltern, weil ich instinktiv wusste, dass Braden Fields der Richtige war.
Auf dieser ersten Fahrt zurück nach Hause war ich mir meiner Zukunftsaussichten so sicher. Und lag damit völlig falsch. Nie hätte ich gedacht, als Imkerin in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, nie damit gerechnet, als Erwachsene wieder in meinem Kinderzimmer zu schlafen, unvorstellbar, mich auf dem Hof niederzulassen, der für meinen älteren Bruder Jordan und mich ein Ort gewesen war, den wir so schnell wie möglich hinter uns lassen wollten. Ich heiratete Braden, er bekam ein Stipendium am Mass General, dem Lehrkrankenhaus der Harvard University, wir zogen nach Natick, und ich war eine Arztgattin. Aber dann, fast auf den Tag genau ein Jahr nach meiner Hochzeit, kam mein Vater eines Abends nicht mehr zurück von seiner Inspektion der Bienenstöcke. Er hatte einen Herzanfall erlitten, und meine Mutter fand ihn tot im hohen Gras liegen, umschwirrt von Bienen.
Das Stück Land mit unserer Apfelplantage verkaufte meine Mutter an ein Pärchen aus Brooklyn. Die Erdbeerfelder behielt sie, aber was sollte sie mit den Bienenstöcken meines Vaters machen? Sie selbst reagierte allergisch auf Bienen, und mein Bruder war durch seine Anwaltskarriere völlig in Beschlag genommen, also fiel die Imkerei mir zu. Fünf Jahre lang fuhr ich jede Woche von Boston nach Adams, um mich um die Bienenvölker zu kümmern. Nach Ashers Geburt nahm ich ihn mit und ließ ihn bei meiner Mutter, während ich mich der Imkerei widmete. Ich fand Gefallen an der Arbeit mit den Bienen, dem behutsamen Herausziehen eines Rahmens aus dem Stock auf der Suche nach der Bienenkönigin. Aus fünf Völkern wurden fünfzehn. Ich experimentierte mit den Erbanlagen von Bienenvölkern aus Russland, Slowenien und Italien. Ich schloss Verträge zur Befruchtung mit den Brooklynites und drei weiteren örtlichen Obstplantagen und stellte auf ihren Arealen neue Bienenkörbe auf. Ich erntete und schleuderte den Honig und verkaufte ihn zusammen mit Bienenwachsprodukten auf Bauernmärkten von der kanadischen Grenze bis zu den Vororten von Massachusetts. Mehr oder weniger zufällig wurde ich zur ersten wirtschaftlich erfolgreichen Imkerin in der Imkereigeschichte der McAfees.
Als Asher und ich dann dauerhaft nach Adams zogen, tat ich dies in der Gewissheit, dass ich damit zwar nie reich werden, meinen Lebensunterhalt aber durchaus würde bestreiten können.
Mein Vater lehrte mich, dass die Bienenzucht sowohl eine Last als auch ein Privileg war. Man behelligt die Bienen nicht, es sei denn, sie benötigen Hilfe, und man hilft ihnen, wenn es nötig ist. Es ist ein feudales Abhängigkeitsverhältnis: Du gewährst ihnen Schutz und bekommst dafür einen Anteil der Früchte ihrer Arbeit.
Von ihm lernte ich, dass ein Körper, der so leicht zerquetscht werden kann, eine Waffe entwickelt, um das zu verhindern.
Er brachte mir bei, abrupte Bewegungen zu unterlassen, um nicht gestochen zu werden.
Diese Lektionen nahm ich mir ein wenig zu sehr zu Herzen.
Am Tag der Beerdigung meines Vaters und Jahre später, als meine Mutter ihm folgte, ging ich zu den Bienen, um ihnen davon zu berichten. Es ist alte Tradition, sie über einen Todesfall in der Familie zu unterrichten; wenn ein Imker stirbt und die Bienen nicht gebeten werden, bei ihrem neuen Herrn zu bleiben, werden sie wegfliegen. In New Hampshire ist es Brauch zu singen, und die Nachricht muss sich reimen. Ich hüllte also jedes Volk in schwarzen Krepp, klopfte behutsam und summte meine Botschaft. Mein Imkernetz wurde zum Trauerflor. Der Bienenstock hätte auch ein Sarg sein können.
Als ich an jenem Morgen nach unten komme, sitzt Asher bereits in der Küche. Wir haben uns darauf geeinigt, dass, wer immer als Erster aufsteht, Kaffee kocht. Mein Becher dampft noch ein wenig. Er schaufelt sich Müsli in den Mund und hängt an seinem Smartphone.
»Guten Morgen«, sage ich und bekomme ein Grunzen zur Antwort.
Ich erlaube mir, ihn einen Moment lang anzustarren. Kaum zu glauben, dass der zartbesaitete kleine Junge, der in Tränen ausbrach, wenn seine Hände vom Propolis aus den Bienenstöcken klebrig waren, nun eine Zarge mit vierzig Pfund Honig hochheben kann, als wöge sie nicht mehr als sein Eishockeyschläger. Asher ist über einen Meter achtzig, war im Heranwachsen aber nie ungelenk. Er bewegt sich mit der Anmut von Wildkatzen, die es unbemerkt schaffen, ein junges Tier oder ein Hühnchen zu stehlen. Von mir hat Asher die blonden Haare und geisterhaft grünen Augen, für die ich immer dankbar gewesen bin. Er trägt zwar den Nachnamen seines Vaters, aber hätte ich jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, Braden vor mir, wäre alles noch viel schwerer.
Aufmerksam betrachte ich die Breite seiner Schultern, die feuchten Haarkringel im Nacken und das Spannungsspiel seiner Sehnen beim Scrollen durch seine Textnachrichten. Manchmal ist die Konfrontation damit ein Schock, denn hat er nicht gerade noch auf meinen Schultern gesessen und versucht, einen Stern vom Nachthimmel zu holen?
»Kein Training heute Morgen?«, frage ich und trinke einen Schluck Kaffee. Seitdem wir hier leben, spielt Asher Eishockey und bewegt sich auf den Kufen so mühelos wie beim Gehen. In der elften Klasse wurde er Kapitän und in diesem Jahr wiedergewählt. Nie kann ich mir merken, ob vor oder nach der Schule Training ist, da es täglich wechselt.
Ein kleines Lächeln umspielt seine Lippen, während er etwas eintippt, aber er gibt keine Antwort.
»Hallo?«, spreche ich ihn an. Ich stecke eine Scheibe Brot in den alten Toaster, den Klebeband zusammenhält, das schon mal Feuer fängt. Frühstück besteht für mich aus Toast mit Honig, und davon gibt es immer genug.
»Dann hast du wohl später Training«, nehme ich die Antwort vorweg, die Asher mir verweigert. »Ja doch, Mom, danke, dass du dich so für mein Leben interessierst.«
Ich verschränke die Arme über meinem unförmigen Zopfpullover. »Bin ich zu alt für dieses Bustier?«, werfe ich lässig ein.
Schweigen.
»Tut mir leid, aber ich werde nicht zum Abendessen da sein, weil ich mich einer Sekte anschließen werde.«
Stille.
»Ich habe zum Throwback Thursday auf Instagram dieses Nacktfoto von dir als Kleinkind gepostet.«
Asher grunzt unverbindlich. Mein Toast springt raus, ich bestreiche ihn mit Honig und setze mich auf den Stuhl Asher direkt gegenüber. »Es wäre mir wirklich lieb, wenn du für dein Pornhub-Abo nicht meine Mastercard verwenden würdest.«
Sein Blick wendet sich mir so abrupt zu, dass ich glaube, seinen Nacken knacken zu hören. »Was?«
»Oh, hey«, erwidere ich geschmeidig. »Schön, dass du mich wahrnimmst.«
Asher schüttelt den Kopf, legt aber das Telefon beiseite. »Ich habe deine Mastercard nicht benutzt«, sagt er.
»Ich weiß.«
»Ich habe deine Amex genommen.«
Ich lache los.
»Außerdem, trag bitte niemals ein Bustier«, sagt er. »Himmel.«
»Dann hast du mir also doch zugehört.«
»Wie auch nicht?«, kontert Asher. »Nur damit du’s weißt, keine der anderen Mütter spricht beim Frühstück über Pornos.«
»Gehörst du dann nicht zu den Glücklichen?«
»Na ja«, meint er achselzuckend. »Ja.« Er hebt seinen Kaffeebecher, stößt mit mir an und trinkt.
Ich habe keine Ahnung, wie es um die Beziehung anderer Eltern zu ihren Kindern bestellt ist, aber die zwischen mir und Asher wurde im Feuer geschmiedet und ist vielleicht aus diesem Grund unerschütterlich. Obwohl er lieber tot umfallen würde, als zuzulassen, dass ich ihn nach einem gewonnenen Spiel in die Arme schließe, sind wir, sofern wir unter uns sind, ein eigenes Universum, ein Mond und ein Planet, verbunden im Orbit. Mag Asher auch nicht in einem Haushalt mit zwei Elternteilen aufgewachsen sein, so würde der eine Teil doch für ihn durchs Feuer gehen.
»Apropos Porno«, erwidere ich. »Wie geht’s Lily?«
Er verschluckt sich fast an seinem Kaffee. »Wenn du mich liebst, sag nie wieder diesen Satz.«
Ashers Freundin ist winzig, dunkelhaarig und hat ein so breites Lächeln, dass es die Landschaft ihres Gesichts völlig verändert. Ist Asher zielorientiert, so hat sie Flausen im Kopf, ist wie ein Kobold, der ihn davon abhält, sich selbst zu ernst zu nehmen – ein Fragezeichen am Ende seines vorhersehbaren Lebens als Liebling aller. Seit Kindergartentagen hatte er keinen Mangel an romantischen Verwicklungen mit Mädchen. Lily ist neu in der Stadt.
Seit diesem Herbst sind sie unzertrennlich. Für gewöhnlich heißt es beim Abendessen: Lily hat dies gemacht, Lily hat jenes gesagt.
»Ich habe sie diese Woche noch gar nicht hier gesehen«, werfe ich ein.
Ashers Telefon summt. Mit fliegenden Daumen antwortet er.
»Ach ja, jung und verliebt müsste man sein«, gebe ich zum Besten. »Und unfähig, auch nur dreißig Sekunden mal nicht zu kommunizieren.«
»Ich schreibe Dirk. Ihm ist ein Schnürsenkel abgerissen, und er möchte wissen, ob ich noch einen übrig habe.«
Einer der Jungs aus dem Eishockeyteam. Beweisen kann ich es nicht, aber bei Dirk hatte ich immer das Gefühl, dass er, wenn wir uns begegnen, nur so trieft vor Charme, um dann, wenn ich weg bin, irgendeine Gemeinheit wie etwa Hast ’ne heiße Mom, Bro, loszuwerden.
»Wird Lily sich dein Spiel am Samstag ansehen?«, frage ich. »Bring sie doch danach zum Abendessen mit hierher.«
Asher nickt und stopft sein Mobiltelefon in die Tasche. »Ich muss los.«
»Du hast noch nicht mal dein Müsli aufgegessen …«
»Ich komm sonst zu spät.«
Er nimmt noch einen großen Schluck Kaffee, wirft sich den Rucksack über die Schulter und schnappt sich die Autoschlüssel aus der Schüssel auf der Küchentheke. Er fährt einen 1988er Jeep, gekauft vom selbst verdienten Geld als Betreuer im Eishockey-Camp.
»Zieh einen Mantel an!«, rufe ich ihm hinterher, als er schon halb durch die Tür ist. »Es …«
Sein Atem dampft in der Luft, er setzt sich ans Steuer und wirft den Motor an.
»… schneit«, beende ich meinen Satz.
Im Dezember hat man als Imkerin eine Verschnaufpause. Im Herbst hingegen ist ständig was zu tun, erst wird der Honig geerntet, dann muss man gegen die Milben vorgehen und anschließend die Bienen auf einen Winter in New Hampshire vorbereiten. Dazu wird ein kräftiger Zuckersirup angesetzt, den man in einen Aufsatz auf dem Bienenstock einfüllt, anschließend wickelt man den ganzen Bienenstock vor dem ersten Kälteeinbruch ein. Die Bienen gehen mit ihrer Energie im Winter sparsam um, und das sollte auch der Imker tun.
Ich bin allerdings nie gut mit Stillstand klargekommen.
Die Erde ist schneebedeckt, und das gibt mir den nötigen Impuls, auf den Dachboden zu steigen, um den Weihnachtsschmuck runterzuholen. Es ist noch immer derselbe wie in meiner Kindheit: Keramikschneemänner für den Küchentisch; Elektrokerzen, die nachts jedes Fenster beleuchten, eine Lichterkette für den Kaminsims. Es gibt auch noch eine zweite Kiste mit unseren Socken und dem Baumbehang, aber die Tradition will es, dass Asher und ich uns gemeinsam darum kümmern. Vielleicht werden wir an diesem Wochenende unseren Baum schlagen. Wir könnten es gemeinsam mit Lily nach seinem Spiel am Samstag machen.
Ich bin nicht bereit, ihn zu verlieren.
Dieser Gedanke lässt mich auf der Stelle innehalten. Selbst wenn wir Lily nicht einladen mitzukommen, um einen Baum auszuwählen – und dann zu schmücken, während er ihr erzählt, was es mit dem Rentierschmuck auf sich hat, den er in der Vorschule aus Stöckchen gefertigt hat, oder mit den winzigen Babysöckchen, sowohl seinen als auch meinen, die wir immer in die höchsten Zweige hängen –, wird schon bald eine andere unsere Zweisamkeit ergänzen. Und das ist es auch, was ich mir für Asher am meisten wünsche – die Beziehung, die ich selbst nicht habe. Mir ist bewusst, dass Liebe kein Nullsummenspiel ist, aber ich bin selbstsüchtig genug, zu hoffen, dass er noch eine Weile länger ganz mir gehört.
Während ich die erste Kiste über die Dachbodentreppe nach unten trage, höre ich Ashers Stimme in meinem Kopf. Warum hast du nicht gewartet? Ich hätte sie für dich holen können? Als mein Blick durch die offene Tür seines Zimmers auf das ungemachte Bett fällt, verdrehe ich automatisch die Augen. Es macht mich wahnsinnig, dass er die Laken nicht glatt zieht, aber genauso wahnsinnig findet er es, sich dieser Mühe zu unterziehen, wenn er doch weiß, dass er sich in ein paar Stunden wieder hineinlegen wird. Seufzend stelle ich die Kiste ab und gehe in Ashers Zimmer. Ich reiße die Decke hoch und ziehe sein Laken glatt. Dabei fällt ein Buch zu Boden.
Es ist ein Blankoheft mit Farbstiftskizzen, die Asher angefertigt hat. Da ist eine Biene, die über einer Apfelblüte schwebt, so nah, dass man die arbeitende Mandibel und den Pollen an ihren Beinen sieht. Dann mein alter Truck, ein taubenblauer Ford Baujahr 1960, der meinem Vater gehört hat.
Diese weichere Seite war Asher schon immer eigen, und ich liebe ihn dafür umso mehr. Sein künstlerisches Talent zeigte sich schon, als er klein war, und ich hatte ihn sogar für einen Malkurs angemeldet, was allerdings seine Eishockeyfreunde herausfanden. Als er dann beim Spiel einen Pass vergeigte, meinte einer von ihnen, er sollte seinen Schläger besser nicht so halten wie Bob Ross seinen Pinsel, und da gab er die Kunst auf. Wenn er jetzt zeichnet, dann nur für sich. Ich bekomme seine Werke nie zu Gesicht. Aber in der Post waren in letzter Zeit Collegebroschüren von der Rhode Island School of Design und der SCAD, der University for Creative Careers, und ich war nicht diejenige, die sie angefordert hat.
Ich blättere ein paar Seiten weiter. Es gibt eine Zeichnung, auf der eindeutig ich zu sehen bin, wenn auch von hinten, als ich vor der Spüle stehe. Ich wirke müde und abgekämpft. Ist dies das Bild, das er von mir hat?
Ein Streifenhörnchen mit herausforderndem Blick. Eine Steinmauer. Ein Mädchen – Lily? Den Arm über den Augen, liegt sie mit nacktem Oberkörper auf einem Bett aus Blättern.
Unverzüglich lasse ich das Heft fallen, als hätte ich mich daran verbrannt. Ich presse die Handflächen gegen meine Wangen.
Natürlich habe ich angenommen, dass er mit seiner Freundin intim ist, aber Thema war es nicht zwischen uns. Irgendwann, seit er die Highschool besucht, habe ich pro-aktiv begonnen, Kondome zu kaufen, und ihm diese ganz sachlich mit den üblichen Kosmetika wie Deodorant, Rasierklingen und Shampoo ins Zimmer gelegt. Asher liebt Lily – auch wenn er mir das so nicht direkt mitgeteilt hat, erkenne ich es an seinem Strahlen, wenn sie neben ihm Platz nimmt, daran, wie er ihren Sicherheitsgurt überprüft, wenn sie sich zu ihm in den Wagen setzt.
Und schon mache ich mich daran, Ashers Laken und Decke wieder in ihren Urzustand zu versetzen. Das Heft stecke ich unter eine Falte im Laken, hebe ein Paar Socken auf und schließe hinter mir die Zimmertür.
Zwei Dinge gehen mir durch den Kopf, als ich die Weihnachtskiste wieder hochnehme: dass Erinnerungen verdammt schwer sind und mein Sohn ein Recht auf seine Geheimnisse hat.
Die Bienenzucht ist der zweitälteste Beruf der Welt. Die ersten Imker waren die alten Ägypter. Bienen waren Königssymbole, die Tränen von Re, dem Sonnengott.
In der griechischen Mythologie hat Aristaios, der Gott der Imkerei, die Hege der Bienen von den Nymphen gelernt. Er verliebte sich in Eurydike, die Frau von Orpheus. Als diese seine Avancen abzuwehren versuchte, trat sie auf eine Schlange und starb. Während Orpheus in den Hades hinabstieg, um sie zurückzuholen, bestraften Eurydikes Nymphenschwestern Aristaios, indem sie alle seine Bienen töteten.
Die Bibel verspricht ein Land aus Milch und Honig. Im Koran hält das Paradies für all jene, die das Böse abwehren, Ströme von Honig bereit. Der indische Gott Vishnu wird oft mit einer blauen Biene auf der Stirn dargestellt. Die Biene selbst wird als Symbol für Christus angesehen: der Stachel der Gerechtigkeit und die Gnade des Honigs Seit an Seit.
Die ersten Voodoopuppen wurden aus Bienenwachs geformt, ein oungan, Priester des haitischen Voodoo, empfiehlt zur Abwehr von Geistern das Bestreichen einer Person mit Honig, seine weibliche Entsprechung, die mambo, verspricht einen Blick in die eigene Zukunft, wenn man ihre aus Honig, Amaranth und Whiskey gefertigten kleinen Kuchen vor Neumond zu sich nimmt.
Manchmal frage ich mich, welcher meiner prähistorischen Vorfahren als Erster seinen Arm in eine Höhlung im Baum gesteckt hat. Zog er eine Handvoll Honig heraus oder eine Faust voller Stiche? Lohnt das Versprechen auf das eine das Risiko des anderen?
Als der Weihnachtsschmuck im ganzen Haus verteilt ist, schlüpfe ich in Winterstiefel und Parka und wandere über das weitläufige Anwesen, um Nadelzweige zu schneiden. Dafür muss ich bis an den Rand der Felder mit den wenigen Apfelbäumen, die noch immer der Familie gehören. Heimtückisch und hexenhaft heben sie sich mit knorrigen, nach oben gereckten Armen vom frostigen Boden ab, und der Wind lässt die toten Blätter raunen: Näher, komm näher. Asher ist früher immer raufgeklettert, einmal so hoch, dass ich die Feuerwehr rufen musste, um ihn runterholen zu lassen, als wäre er eine Katze. Zweige knacken unter meinen Sohlen, als ich hinter der Obstplantage den Wald erreiche. Es gibt nur wenige Bäume, deren fiedrige Gliedmaßen ich mit meiner Handsäge erreiche, an die meisten komme ich selbst auf Zehenspitzen nicht dran, aber ich bin zufrieden mit allem, was ich sammeln kann. Der Haufen aus Kiefern-, Fichten- und Tannenzweigen wächst, und ich muss dreimal laufen, um alles zurück zur Veranda der Farm zu schleppen.
Bis ich schließlich alles beisammenhabe – die Zweige und eine Rolle Floristendraht –, sind meine Wangen gerötet und meine Ohrläppchen taub. Ich breite die Tannenzweige auf der Veranda aus, schneide sie zurecht, bündle sie und winde dann die lange Lichterkette aus der Weihnachtskiste, die ich vom Dachboden geholt habe, um die grüne Girlande und befestige diese am Rahmen der Haustür.
Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, mich beobachtet zu fühlen.
Alle Nackenhaare stellen sich auf, als ich mich langsam zu den öde daliegenden Erdbeerfeldern umdrehe.
Im Schnee erinnern sie an Schwaden aus weißer Baumwolle. So spät im Jahr liegt der hintere Teil des Feldes im Schatten. Im Sommer fallen Waschbären und Rehe über die Erdbeeren her, hin und wieder auch ein Kojote. Doch jetzt, kurz vor Winterbeginn, haben sich die meisten Räuber in ihre Höhlen verzogen …
So schnell ich kann, renne ich zu meinen Bienenkörben.
Noch bevor ich den Elektrozaun erreiche, der sie umgibt, riecht es bereits penetrant nach Bananen – das sicherste Zeichen, dass die Bienen aufgebracht sind. Vier Stöcke hocken stabil und still unter ihrer Abdeckung. Aber der Stock ganz rechts wurde völlig auseinandergenommen. Meine Bienenköniginnen werden alle nach Diven benannt: Adele, Beyoncé, Lady Gaga, Whitney und Mariah. Taylor, Britney, Miley, Aretha und Ariana stehen in der Apfelplantage, Sia, Dionne, Cher und Katy auf den anderen Vertragsplantagen. Der Bienenstock, der angegriffen wurde, ist der von Celine.
Der Elektrozaun wurde auf dieser Seite niedergerissen und niedergetrampelt. Überall auf dem frischen Schnee liegen Holzstreben vom Bienenstock verteilt, Styroporplatten wurden in Stücke gerissen. Ich stolpere über ein Stück Honigwabe mit dem Tatzenabdruck eines Bären.
Ich spähe zu der dunklen Linie, wo das Feld in Wald übergeht, aber der Bär hat bereits das Weite gesucht. Unter Einsatz ihres Lebens dürften sie versucht haben, ihren Angreifer loszuwerden – indem sie ihn so lange stachen, bis er sich trollte.
Es ist nicht das erste Mal, dass bei mir ein Bär einen Stock angreift, aber so spät im Jahr habe ich das noch nie erlebt.
In der Hoffnung, noch ein paar Bienen zu finden, die nicht erfroren sind, gehe ich auf das Gebüsch am Feldrand zu. Ein kleines Knäuel wimmelt und tropft, dunkel wie Sirup auf der Astgabel eines Zuckerahorns. Celine kann ich nicht entdecken, aber wenn die Bienen geflüchtet sind, gibt es eine Chance, dass Celine unter ihnen ist.
Im Frühling kommt es vor, dass Bienen ausschwärmen. Dann kann man sie, so wie jetzt diese, in einem Übergangsstadium vorfinden, bevor sie ganz aufbrechen zu ihrem neuen Zuhause.
Bienen, die im Frühjahr schwärmen, tun dies, weil der Platz in ihrem Stock knapp geworden ist.
Bienen, die im Frühjahr schwärmen, sind honigsatt, es geht ihnen gut, und sie sind ganz ruhig.
Wenn Bienen im Frühjahr schwärmen, lassen sie sich manchmal wieder einfangen und in eine neue Kiste verfrachten, wo sie genügend Platz für ihre Brutzellen, den Pollen und den Honig haben.
Das hier ist kein Schwarm. Diese Bienen sind wütend und verzweifelt.
»Wartet«, flehe ich sie an und renne dann so schnell ich kann zurück zum Haus.
Drei Mal muss ich die achthundert Meter über die vom Schnee rutschigen Felder zurücklegen. Schleppe einen neuen Holzsockel und einen leeren Bienenkorb von einem Volk heran, das ich im letzten Jahr verloren habe, und will versuchen, die Bienen umzulenken; meine Imkerausrüstung muss ich aus dem Keller holen, wo ich sie bereits für den Winter verstaut habe – Smoker und Stockmeißel, etwas Draht und einen Abkehrbesen, Hut, Schleier und Handschuhe. Bis ich alles parat habe, bin ich schweißgebadet, meine Hände zittern, und die Finger sind steif vor Kälte. Tapsig greife ich nach den paar Rahmen, die nach der Bärenattacke noch zu gebrauchen sind, und setze sie in die Brutkiste. Einige der zerbrochenen Waben befestige ich mit Draht in den Rahmen und hoffe, dass die Bienen sich zum Vertrauten hingezogen fühlen werden. Als der neue Bienenstock fertig ist, gehe ich zum Zuckerahorn.
Weil die Dämmerung früh einsetzt, ist es schon ziemlich dunkel. Ich erkenne die Bienen eher anhand der Bewegung als an ihren sich windenden Umrissen. Wenn Asher hier wäre, könnte er für mich die Brutkiste direkt unter den Ast halten, während ich die Bienen hineinschiebe, aber ich bin allein.
Wegen des Windes gelingt es mir erst nach mehreren Versuchen, eine Birkenrindenlocke zum Brennen zu bringen, um damit den Smoker anzuzünden. Endlich glimmt das Holz, und ich werfe die rote Glut in den kleinen Metalltopf auf eine Handvoll Holzspäne. Ich drücke ein paarmal den Blasebalg, und Rauch entweicht dem schmalen Tubus. Ein paar Rauchstöße auf die Bienen haben betäubende Wirkung und machen sie weniger aggressiv.
Ich setze Hut und Schleier auf und greife zur Handsäge, mit der ich zuvor die Tannenzweige abgeschnitten habe. Doch ich komme nicht dran an den Ast. Fluchend zerre ich den kaputten Holzsockel des alten Stocks unter den Baum und versuche, darauf vorsichtig die Balance zu halten. Entweder gelingt es mir, den Ast abzusägen, oder ich breche mir den Knöchel. Als sich der Ast vom Baum löst, schluchze ich fast vor Erleichterung und trage ihn dann ganz behutsam zum neuen Bienenstock. Indem ich ihn einmal kräftig schüttele, regnen die Bienen hinein. Ich wiederhole das Ganze und hoffe, dass auch die Königin darunter ist.
Wenn es wärmer wäre, hätte ich Gewissheit. Denn ein paar Bienen würden sich mit nach außen gekehrten Hinterteilen auf dem Anflugbrett versammeln, mit den Flügeln fächeln und Pheromone ausschütten, damit die Streuner den Weg nach Hause finden. Das ist ein Zeichen, dass der Bienenstock weiselrichtig ist, also seine Königin hat. Aber es ist zu kalt, und ich muss jeden Rahmen einzeln rausholen und das Bienengewusel untersuchen. Gott sei Dank ist Celine eine markierte Königin – ich entdecke den grünen Punkt auf ihrem langen schmalen Rücken und ziehe sie an den Flügeln in einen Abfangkäfig, eine kleine Plastikvorrichtung, die wie eine Libelle für die Haare aussieht. Der Abfangkäfig wird ein paar Tage für ihre Sicherheit sorgen, während sich alle an ihr neues Zuhause gewöhnen. Und garantiert, dass das Volk sich nicht aus dem Staub macht. Manchmal hauen die Bienen einfach mit ihrer Königin ab, wenn ihnen die Umstände nicht zusagen. Ist die Königin aber gefangen, werden sie nicht ohne sie den Stock verlassen.
Ich blase noch ein paar Rauchschwaden über den Stock, in der Hoffnung, die Bienen damit zu beruhigen. Dann versuche ich, den Abfangkäfig zwischen Rahmen mit Waben zu setzen, aber meine Finger sind so steif von der Kälte und gleiten immer wieder ab. Als meine Hand dabei die Kante der Holzkiste berührt, wehrt sich eine der Arbeiterbienen mit ihrem Stachel.
»Miststück«, stöhne ich und weiche zurück. Eine Bienentraube folgt mir, angezogen vom Duft des Angriffs. Mit Tränen in den Augen umfange ich meine Hand.
Nachdem ich Hut und Schleier abgerissen habe, vergrabe ich mein Gesicht in den Händen. Selbst mit den besten Vorkehrungen für diese Königin, Zuckersirup als Bienenfutter und einer Isolierung ihrer neuen Brutkiste, dazu noch inständige Gebete – dieses Volk hat keine Chance, den Winter zu überleben. Es wird einfach nicht genug Zeit haben, die Honigvorräte wieder aufzubauen, die der Bär ihnen geraubt hat.
Und dennoch. Ich kann es doch nicht einfach aufgeben.
Also setze ich vorsichtig den Schiebedeckel auf die Kiste und hebe mit der unverletzten Hand meine Imkerausrüstung auf. Die andere kühle ich mit einem Schneeball und trotte zurück zum Haus. Morgen werde ich sie mit zusätzlicher Nahrung versorgen und die neue Kiste umwickeln, aber das ist Hospizarbeit. Wenn ich im Frühjahr den Stock öffne, werden diese Bienen tot sein. Es gibt Verläufe, die kann man nicht beeinflussen, egal was man macht.
Wieder zu Hause, bin ich so damit beschäftigt, meine pochende Handfläche zu kühlen, dass ich gar nicht bemerke, wie spät es ist und dass Asher nicht zum Abendessen nach Hause gekommen ist.
Beim ersten Mal war der Anlass ein Passwort.
Ich hatte mich gerade erst bei Facebook angemeldet, vor allem damit ich mir die Fotos von Sam, dem Baby meines Bruders Jordan und seiner Frau Selina, ansehen konnte. Braden war Stipendiat für Herzchirurgie, und wir wohnten in einem Stadthaus auf der Mass Ave. Unser Mobiliar stammte hauptsächlich aus Garagenverkäufen, die wir an den Wochenenden in den Vororten aufsuchten. Eins der besten Fundstücke hatten wir von einer alten Dame, die ins betreute Wohnen umzog. Wir kauften ihren antiken Rollschreibtisch mit Klauenfüßen (meiner Meinung nach von einem Greifen, Braden behauptete, sie seien von einem Adler). Es war eindeutig eine Antiquität, aber jemand hatte die ursprüngliche Lackierung entfernt, was den Wert minderte und weshalb wir uns das Stück überhaupt leisten konnten. Erst als er bei uns zu Hause stand, entdeckten wir das Geheimfach – eine schmale Zierleiste zwischen den Holzschubladen, die dekorativ wirken sollte, sich jedoch lösen ließ und dann ein Fach freigab, in dem Dokumente und Papiere versteckt werden konnten. Ich war natürlich begeistert und hoffte auf eine Kombination zu einem alten Safe voller Goldbarren oder einem heißen Liebesbrief, aber wir fanden nichts weiter als eine Büroklammer. Ich hatte fast schon vergessen, dass dieses Fach existierte, bis ich für Facebook ein Passwort brauchte und, weitaus wichtiger, einen Ort benötigte, um es zu verwahren für den Fall, dass ich es vergaß. Welcher Ort wäre besser dafür geeignet als ein Geheimfach?
Eigentlich war die Antiquität für Braden als Arbeitsplatz gedacht, aber als er feststellte, dass sein Laptop viel zu groß dafür war, wurde er zu einem Dekorationsstück am Fußende der Treppe. Wir verwahrten dort unsere Schlüssel und meinen Geldbeutel, gelegentlich auch eine Pflanze, die bei mir überlebt hatte. Deshalb war ich auch so überrascht, als ich Braden eines Abends davorsitzen und an dem Geheimfach herumfummeln sah.
»Was machst du da?«, fragte ich.
Er griff hinein und zog triumphierend das Blatt Papier heraus. »Nachsehen, welche Geheimnisse du vor mir verbirgst«, kam Bradens prompte Antwort.
Das war so lächerlich, dass ich lachend erwiderte: »Ich bin doch ein offenes Buch«, ihm dabei aber das Blatt Papier aus der Hand nahm.
Er zog die Brauen hoch. »Was steht da drauf?«
»Mein Facebook-Passwort.«
»Und?«
»Wie und, es ist meins.«
Braden runzelte die Stirn. »Wenn du nichts zu verbergen hättest, würdest du es mir zeigen.«
»Was glaubst du denn, was ich auf Facebook mache?«, hakte ich skeptisch nach.
»Sag du’s mir«, erwiderte Braden.
Ich rollte mit den Augen. Aber bevor ich etwas sagen konnte, schnappte er schon nach dem Blatt.
PEPPER70. Das stand darauf. Es war der Name meines ersten Hundes, dazu mein Geburtsjahr. Absolut uninspiriert, etwas, worauf er auch selbst hätte kommen können. Aber als mir schlagartig das Prinzip hinter diesem blöden Streit klar wurde, riss ich das Blatt an mich, bevor er es erwischen konnte.
Und in dem Moment kippte die Situation – der Ton, die Stimmung. Die Luft zwischen uns schien stillzustehen, und seine Pupillen zogen sich zusammen. Er holte aus, und sein Arm wurde zu einer angreifenden Schlange, die mein Handgelenk packte.
Instinktiv entzog ich mich ihm und jagte die Treppe hinauf. Er rannte mir wie ein Gewittersturm hinterher, meinen Namen auf den Lippen. Es war albern, es war dumm, es war ein Spiel. Nur fühlte es sich nicht an wie eins, denn das Herz schlug mir bis zum Hals.
Sobald ich es in unser Schlafzimmer geschafft hatte, schlug ich die Tür zu, lehnte den Kopf dagegen und versuchte, wieder zu Atem zu kommen.
Braden stieß die Tür mit solcher Wucht auf, dass der Rahmen splitterte.
Mir war nicht klar, was passiert war, bis plötzlich alles grell wurde und es zwischen meinen Augen zu hämmern begann. Ich fasste mir an die Nase und hatte Blut an den Fingern.
»Oh mein Gott«, murmelte Braden. »Oh mein Gott, Liv.« Er verschwand kurz, drückte mir dann ein Handtuch ins Gesicht und begleitete mich zum Bett und strich mir übers Haar.
»Ich glaube, da ist was gebrochen«, würgte ich hervor.
»Lass mal sehen.« Vorsichtig löste er das blutige Handtuch und tastete dann mit zarten Chirurgenhänden den Wulst über den Augen und dann den Knochen darunter ab. »Sieht nicht danach aus«, sagte er mit bebender Stimme.
Braden säuberte mich, als wäre ich aus Glas, und brachte mir dann einen Eisbeutel. Inzwischen hatte sich der stechende Schmerz gelegt. Es tat noch weh, und meine Nase war verstopft. »Meine Finger sind zu kalt«, sagte ich und ließ den Eisbeutel fallen. Er nahm ihn und drückte ihn sanft an mich. Ich merkte, dass seine Hände zitterten und er mir nicht in die Augen schauen konnte.
Ihn derart erschüttert zu sehen, schmerzte mich noch mehr als die Verletzung.
Also legte ich tröstend meine Hand auf seine. »Ich hätte nicht so dicht an der Tür stehen dürfen«, murmelte ich.
Endlich sah Braden mich an und nickte bedächtig. »Nein. Hättest du nicht.«
Ich habe Asher ein halbes Dutzend Textnachrichten geschickt, die aber unbeantwortet blieben. Sie fielen von Mal zu Mal wütender aus. Obwohl er sonst offensichtlich kein Problem damit hat, alles liegen und stehen zu lassen, um seiner Freundin oder Dirk zu schreiben, scheint er sein Kommunikationsvermögen bei Bedarf auch stark einschränken zu können. Höchstwahrscheinlich war er irgendwo zum Essen eingeladen worden und hielt es nicht für nötig, mich davon in Kenntnis zu setzen.
Zur Strafe wird er sich später um die Tannenzweige kümmern müssen, die noch auf der Veranda herumliegen, da ich mit meiner gestochenen Hand keine Girlanden mehr winden kann.
Auf dem Küchentisch liegt ein kleines Päckchen aus Zeitungspapier, das ich vorsichtig öffne. Es war aus Versehen in die Kiste für die Weihnachtsdeko gelangt, gehört aber eigentlich zum Baumschmuck. Es ist mein Lieblingsstück – eine mundgeblasene Glaskugel mit blauen und weißen Wirbeln, obendrauf ein Glastropfen mit einem Draht zum Aufhängen. Asher hat sie mit sieben Jahren für mich gemacht, nachdem wir nach meiner Scheidung von Braden aus Boston weggezogen waren. Ich hatte damals im Herbst einen Stand auf einem Jahrmarkt und verkaufte Honig und Bienenwachsprodukte. Eine Glasbläserin freundete sich mit Asher an und lud ihn in ihre Werkstatt ein. Ohne dass ich es mitbekam, half sie ihm, dieses Geschenk für mich anzufertigen. Ich fand es wunderschön, doch seine wahre Magie bestand darin, dass es eine Zeitkapsel war. Gefangen in dieser zarten Kugel war Ashers kindlicher Atem. Und der würde mir für immer bleiben, egal wie alt oder wie groß er wurde.
In dem Moment klingelt mein Mobiltelefon.
Asher. Wenn er nicht schreibt, steckt er meist in Schwierigkeiten.
»Ich hoffe, du hast eine gute Ausrede«, beginne ich, aber er fällt mir ins Wort.
»Ich brauche dich, Mom. Ich bin auf der Polizeiwache.«
Ich habe Mühe, die Worte zu artikulieren. »Wie? Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Ich … ich bin … nein.«
Mein Blick fällt auf das Kunstwerk in meiner Hand, dieses Stück Vergangenheit.
»Mom«, sagt Asher mit brechender Stimme. »Ich glaube, Lily ist tot.«
1 Lily
Dezember 2018 Vier Tage davor
Von dem Moment an, als meine Eltern wussten, dass sie ein Baby bekommen, wünschte sich mein Vater einen Jungen. Stattdessen bekam er eine Tochter: wohl durchaus jungenhaft in mancher Hinsicht, aber nicht auf die Weise, die für ihn zählte. Er nahm sich jeden Tag Zeit dafür, mich an all das zu erinnern, worin ich ihn enttäuschte, nicht weil ich irgendwas angestellt hätte, sondern einfach, weil ich so war, wie ich bin.
Manchmal denke ich, dass ich ihm in meiner Fechtausrüstung deshalb am besten gefiel, weil er hinter der Maske mein Gesicht nicht sehen konnte.
Ich hätte ihm entgegnen können: You don’t always get what you want. Jeder erkennt das als einen Song von den Rolling Stones, aber wer weiß schon, dass Keith Richard seine Gitarre ohne die tiefe E-Saite spielt? Das erwähnte ich einmal vor langer Zeit meinem Vater gegenüber, als der Song im Autoradio lief.
Er schaltete auf stumm. Nachdem wir eine Weile schweigend weitergefahren waren, sagte er schließlich: Du weißt auch nicht alles.
Ich hätte ihn am liebsten angeschrien, sagte aber nichts, was bei Dad eine ziemlich gute Strategie war. Natürlich weiß ich nicht alles. Aber ich möchte alles wissen.
Als meine Mutter und ich im letzten Sommer Point Reyes verließen, um nach New Hampshire zu ziehen, meinte Mom: Das ist unsere zweite Chance, und dabei sagte sie »unsere«, als wäre es auch eine Chance für sie.
Wir fuhren am Nordrand der Bay entlang durch das San Pablo Wildlife Refuge. Es war der Anfang unserer langen Reise nach Osten, einer Reise, die zehn Tage dauern sollte, mit Zwischenstopps für Collegebesichtigungen und Vorstellungsgespräche. Ich fragte mich, ob ich jemals wieder zurückkommen würde.
»Alles okay mit dir, Lily?«, erkundigte sich Mom.
Mir lag auf der Zunge, ihr zu versichern, dass es mir gut ging, denn genau das wollte sie hören, aber die Worte blieben mir im Hals stecken. Ich wandte mich ab, als würde ich mich plötzlich für die Schilder entlang des Highways interessieren. Nächste Ausfahrt Vallejo. »Ich bin einfach ein einziges Chaos«, sagte ich.
Mom griff nach meiner Hand. »Du bist kein Chaos«, sagte sie. »Du bist eine Heldin.«
Ich schielte auf die Narben an meinen Handgelenken und fragte mich, was die Kids in meiner neuen Schule wohl davon halten würden. Ich überlegte, eine Weile langärmlige Shirts zu tragen. Schließlich hieß es, der Winter in New Hampshire dauere neun Monate. Ich fragte mich, ob dies wirklich der Neuanfang wäre, von dem meine Mutter ausging, oder wieder derselbe alte Scheiß.
»Ich bin keine Heldin«, entgegnete ich. »Ich bin einfach jemand, der endlich herausgefunden hat, wie man aufhört, traurig zu sein.«
Asher erzählt mir ständig: Ich habe das allerbeste Weihnachtsgeschenk für dich! Es ist so gut, dass du es schon früher bekommst. Maya meint, er werde mir den Ring seiner Großmutter schenken. »Sie hat uns immer auf verrückte Exkursionen mitgenommen«, erzählt sie. »Einmal fuhr sie mit uns zu einem Santa-Claus-Dorf – im Juli –, was wirklich krank war, denn dort machen sie selbst mitten im Sommer Schnee. Und Asher ist ausgerastet, weil er unbedingt nebenan in der Six Gun City Cowboy spielen wollte, also blieben wir kurzerhand über Nacht in einem beschissenen Hotel, wo Asher und ich uns ein Bett teilen mussten.« Gleich darauf sah sie mich an, als wäre ihr gerade klar geworden, was sie da gesagt hatte. »Ich meine, wir dürften da etwa sechs Jahre alt gewesen sein, kein Grund also, eifersüchtig oder so zu sein.«
Ich bin nicht eifersüchtig, nicht, wie sie denkt. Aber Maya kennt Asher, seit sie zusammen im Kindergarten waren. Das ist ein Teil seines Lebens, der mir immer fehlen wird, und manchmal verspüre ich ein solches Verlangen nach all dem, was ich noch nicht kenne, dass ich das Gefühl habe, nach Jahrzehnten des Hungers in ihm ein Festmahl gefunden zu haben. Immer wieder rede ich mir gut zu, dass, auch wenn Maya früher mal mit ihm Vater-Mutter-Kind gespielt hat, ich diejenige bin, die er in diesem Herbst gezeichnet hat, mit hochgesteckten Haaren und oben ohne, umhüllt von der herbstlichen Sonne wie von einem Cape.
Jede Minute wird Asher hier sein. Ich werfe noch einen Blick in den Spiegel. Wir haben Dezember in New England, nicht gerade Bikiniwetter. Aber mein Haar ist nun lang und lockig – ich habe es nicht mehr geschnitten, seit wir im Osten angekommen sind. Ich trage Lapis-Ohrringe, die meinen Augen, obwohl sie eher an einen trüben Teich erinnern, ein juwelengleiches Funkeln entlocken, und das Shirt, das Maya und ich letzte Woche im Hippieladen entdeckt haben. Es hat keine langen Ärmel, nur dreiviertellange, aber es macht mir nichts aus, wenn Asher die Narben sieht. Er kennt bereits die ganze Geschichte und meint, darauf komme es nicht an.
Mir ist es aber wichtig. Ich wünschte, er müsste sie nicht jedes Mal sehen, wenn er meine Hand hält.
Ich gehe nach unten. Mom sitzt mit einem Glas Wein vor dem Kamin. Sie hat noch ihre National-Forest-Dienstuniform an – die kakifarbene Bluse, die grüne Hose. Auf der Bluse befinden sich links über der Brust das Dienstabzeichen und über der rechten Blusentasche ihr Namensschild: AVACAMPANELLO. Einer der Ärmel trägt den grünen Aufnäher mit der von den Buchstaben U und S gerahmten Pinie, darüber Forest Service und darunter Department of Agriculture, alles in Gold gestickt.
Ihr silbergrauer Stetson-Filzhut liegt umgedreht neben Boris auf dem Fußboden. Ich bezeichne ihn als schwarzen Labrador, aber er ist überwiegend grau.
Fünf Dinge, weshalb meine Mutter wirklich krass ist
5. Sie kann sämtliche Spuren lesen: von Wildkatzen, Schwarzbären, Stachelschweinen, Korallenottern, Opossums. Außerdem: von Menschen. Nachdem ich Asher zum ersten Mal mit nach Hause gebracht habe, ertappte ich sie am nächsten Tag dabei, wie sie sich seinen Stiefelabdruck im Schlamm ansieht. Ich sagte: Was ist? Worauf sie erwiderte: Dein Freund hat eine Dominanz des linken Fußes, ist also wahrscheinlich Linkshänder.
4. Sie brachte mir bei, wie ich mir den Tierkreis in seiner Abfolge mit folgendem Satz merken kann: Wieder stieren zwei krebsende Löwen-Jungtiere: Wagen sie es, Skorpione zu schützen und Steine aus dem Wasser zu fischen? (Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische)
3. Es gibt keine Situation, für die sie nicht den richtigen Knoten kennt und weiß, wie er gemacht wird: Webleinstek, Palstek, Schotstek, Reffknoten. »Und dann gibt es noch den Gordischen Knoten. Aber der lässt sich nur mit einem Schwert lösen.« Ratet mal, ob Mom ein geschwungenes verziertes Langschwert aus Japan besitzt, das sie über dem Kamin an die Wand gehängt hat? Ja, hat sie. Sie sagt, man nennt es Katana.
2. Noch bevor meine Mutter an der Syracus University ihren Abschluss in Forstwissenschaft machte, war sie bereits Fallschirm springen, klettern, zum Bungee-Jumping und Haitauchen gewesen. Außerdem dürfte sie Grateful Dead fünfzehn Mal gesehen haben, doch darüber spricht sie nicht gern. Weil sie noch immer wütend auf Jerry Garcia ist, der »wie ein gestrandeter Wal gestorben« ist.
1. Ihre beste Freundin bin ich, ihre zweitbeste Freundin ist sie selbst. Ich nenne sie Ranger Mom. Auf den ersten Blick würde man sie für eine ruhige, sanftmütige Person halten. Was sie auch ist, es sei denn, man versucht, ihrer Tochter blöd zu kommen. Wenn das passiert, zieht sie die Krempe ihres Rangerhuts tief in die Stirn und sagt: Mister? Sie haben gerade einen großen Fehler gemacht.
Mom hebt den Blick und lächelt mich müde an. In diesem Herbst ist ihr die Erschöpfung immer öfter anzumerken, was zum Teil daran liegt, dass sie ihren Job als Park-Rangerin in Point Reyes gegen den Schreibtischjob hier in New Hampshire beim Forstamt eingetauscht hat. Jedenfalls vermute ich, dass sie deshalb so müde wirkt – aber es mag auch andere Gründe geben, Gründe, die mit mir zu tun haben.
»Siehst hübsch aus«, sagt Mom.
»Ja schön, du allerdings siehst ziemlich fertig aus. Ist alles in Ordnung mit dir?«
Sie trinkt einen Schluck Wein und erwidert lächelnd: »Mir geht’s gut. Mach dir keine Sorgen.« Ihr langer Zopf hängt über die linke Schulter. Und ich denke: Boris ist nicht der Einzige, der grau wird.
»Zu spät. Ich mach mir Sorgen. Wenn du nicht arbeitest, schläfst du. Oder redest mit dem Hund.«
Wieder antwortet sie lächelnd: »Er ist ein ausgezeichneter Zuhörer.«
»Boris ist taub, Mom.«
Mom blickt auf Boris herab. »Bei ihm sind meine Geheimnisse sicher.«
»Du hast Geheimnisse?«, frage ich, nur halb im Scherz.
Sie winkt ab. »Asher führt dich aus?«
»Er will mir ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen. Er meint, es sei zu toll, um länger zu warten.«
»Was schenkst du ihm denn?« Ihr durchdringender Blick legt nahe, dass ich aus dieser Frage womöglich was herauslesen sollte.
»Bis Weihnachten sind es doch noch zweiundzwanzig Tage«, erwidere ich. »Ich weiß es noch nicht.«
Sie nippt an ihrem Chablis. »Ich darf wohl annehmen, dass sein großartiges Geschenk in aller Öffentlichkeit übergeben wird? Und die Empfängerin voll bekleidet ist?«
»Und ich darf annehmen, dass wir beide so tun werden, als hättest du das nie gesagt«, kontere ich. »Weihnachtsgeschenke sind ohnehin doof. Es ist eine völlige Fehlinterpretation der Tradition.«
Nach einer kurzen Pause fragt sie: »Über welche Tradition sprechen wir da?«
»Die Geschenke der Heiligen Drei Könige. Selbst wenn diese drei weisen Männer tatsächlich existiert haben, dann haben sie Jesus nicht in der Nacht seiner Geburt besucht. Das geschah erst Wochen später – vielleicht auch Jahre.«
Mom zieht eine Braue hoch. »Liest du jetzt die Bibel?«
»Ich lese alles«, erwidere ich.
Mom hebt den Rangerhut vom Boden auf und legt ihn auf die Kaminplatte. »Ich weiß nur, dass es eine freundliche Geste ist, Menschen Geschenke zu machen. Während beide bekleidet sind.«
»Oh mein Gott. Hör auf. Hör einfach auf.«
Mom lacht. »Aber du wirst Asher genau das sagen, wenn er dir sein besonderes Geschenk macht.«
Mein Telefon meldet eine Textnachricht, Asher ist da. »In diesem Sinne …«, sage ich. Boris hebt nicht mal den Kopf.
Ich schlüpfe in meine dicke Daunenjacke und die Handschuhe und blicke in den Flurspiegel.
»Lily«, sagt Mom. »Du siehst wirklich hübsch aus.«
Ich werfe ihr ein Lächeln zu und stürme dann hinaus in die kalte New-Hampshire-Nacht.
Ashers alter Jeep wartet mit laufendem Motor in der Einfahrt. Ein paar Schneeflocken tanzen träge im Kegelstrahl der Scheinwerfer. Ich öffne die Beifahrertür, und er begrüßt mich mit einem breiten Lächeln, das auch seine grünen Augen erfasst, die mich immer an den Juni denken lassen, wenn alles in voller Blüte steht. Er beugt sich über mich und gibt mir einen so wahnsinnig elektrisierenden Kuss, dass mein Herz einen Sprung macht, als würde ein Motor neu gestartet.
Nach einer Minute, vielleicht auch nach einem ganzen Leben, zieht er sich zurück. »Bist du bereit?«, fragt er. Er legt den Rückwärtsgang ein.
Bei leiser Musik des Oldie-Senders folgen wir der Straße. Ich lege meine Hand auf die, mit der Asher den Schalthebel bedient. Er wirft mir einen kurzen Blick zu.
»Und?«, frage ich ihn.
»Was und?«
»Willst du mir keinen Tipp geben?«
Er scheint zu überlegen. »Hm, ich denke, eher nicht.«
»Werden wir länger weg sein? Ich habe nämlich keine Zahnbürste eingepackt.«
»Ich werde versuchen, dich bis zum Morgen zurückzubringen«, erwidert Asher.
Im Song aus dem Radio klimpert eine Registrierkasse, und da erkenne ich die Melodie. »Money« von Pink Floyd. Mein Vater hat es immer gesungen.
»Ich hasse diesen Song.«
Mit einem Seitenblick fragt er: »Soll ich einen anderen Sender einstellen?«
Ich schüttele den Kopf. »Es ist ein 7/4-Takt. Ein verrücktes Metrum.«
Asher geht nicht sofort darauf ein. »Dann stört dich also das Metrum?«
Ich möchte nicht darauf eingehen. »Weißt du, was noch im 7/4-Takt ist? ›All You Need Is Love‹ von den Beatles und Blondies ›Heart of Glass‹ sowie ›Spoonman‹ von den Soundgardens.«
Asher lächelt. »Unfassbar, was du alles weißt.«
Wir schweigen eine Weile. Ohne es laut aussprechen zu müssen, sagen wir uns beide, wie schön es doch wäre, manche Dinge vergessen zu können.
Wir nähern uns Adams. Rechts von uns ist dichter Nadelwald. Durch diesen Wald gibt es einen Pfad entlang des Slade Brooks, der vom Presidents’ Square direkt zu unserem Haus führt. In der ersten Woche nach unserer Ankunft bin ich diesen Weg entlanggelaufen und war mir ziemlich sicher, Bärenexkremente entdeckt zu haben.
»Ich habe noch nie einen Bären gesehen«, sage ich zu Asher.
»Keine Sorge. Du erzählst ihm einfach alles, was du über Metren in Popsongs weißt. Und ehe du dich’s versiehst, rollt er sich auf den Rücken und lässt sich von dir den Bauch kraulen.«
»Meine Mom hat mir beigebracht, dass man auf einer Wanderung, wo mit Grizzlybären zu rechnen ist, ein kleines Glöckchen dabeihaben sollte.«
Asher sieht mich verdutzt an. »Gab es in Point Reyes denn Bären?«
»Also, keine Grizzlys. Bären sind im Marin County seit hundert Jahren ausgestorben. Aber dann tauchte vor ein paar Jahren ein Schwarzbär auf. Er fraß Müll hinter einer Pizzeria.«
Asher lacht.
»Was?«
»Ich überlege nur gerade, welche Pizza Bären wohl mögen.«
»Vielleicht Hawaii?«
»Keiner mag eine Pizza Hawaii. Nicht mal Bären.«
»Sei still«, widerspreche ich. »Die ist köstlich.«
»Wenn du Pizza Hawaii magst, Lily, dann fürchte ich, das könnte das K.-o.-Kriterium für unsere Beziehung sein.« Aber er lächelt dabei, und ich sage mir: Fuck, ich kann nicht glauben, dass er der Meine ist.
Wir kommen am Opernhaus vorbei, vor dem ein Schild ankündigt: Heute Abend White Mountain Symphony Orchestra. Mozart-Abend. Lädt Asher mich zu einem Mozartkonzert ein? Ist das die große Überraschung? Aber er fährt weiter.
Am Presidents’ Square legt sich der Schnee auf Franklin Pierce. »Armer Kerl«, sage ich. »Sieht richtig verfroren aus.«
»Er ist daran gewöhnt.«
»Sein Sohn ist bei einem Zugunglück umgekommen, einen Monat bevor er Präsident wurde«, werfe ich leise ein. »Der Junge war erst elf Jahre alt. Pierce ist nie darüber hinweggekommen.« Wir fahren über die Bahngleise, kommen an der alten Mühle vorbei. »So etwas erlebt man immer wieder, den Menschen passiert etwas Schlimmes, und sie gehen daran zugrunde. Werden zu Schatten ihrer selbst.« Ich spüre Ashers Blick auf mir und versuche, den Ärmel meines Mantels über mein linkes Handgelenk zu ziehen.
»Du bist kein Schatten deiner selbst«, sagt Asher.
Was paradox ist, denn ich bin mir ganz sicher, dass Asher die einzige Person ist, die mich wirklich sieht.
»Wir fahren auf den Parkplatz eines A1-Diners. »Bereit?«, fragt er und schaltet den Motor aus.
»Das ist meine Überraschung?«, frage ich mit Blick auf das Lokal. Ein Mann trinkt in einer Nische Kaffee, und eine gelangweilte Kellnerin liest hinterm Tresen Zeitung. Ich gebe mir Mühe, nicht enttäuscht zu sein.
Asher hingegen strahlt vor Aufregung.
»Komm mit«, sagt er.
Wir steigen die Stufen hoch. Asher hält die Tür auf. Beim Eintreten rieche ich sofort Pommes und Kaffee. Die Kellnerin blickt von ihrer Zeitung auf.
Ebenso der Mann in der Sitznische.
Ich habe ihn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Habe ihn nie mit Bart gesehen. Der ist mehr oder weniger grau. »Dad?«, sage ich.
»Hey, Kumpel«, sagt er und steht auf.
»Frohe Weihnachten, Lily«, sagt Asher.
Das ist nicht wahr. Das ist nicht mehr mein Leben. Aber hier ist Asher, und dort ist mein Dad, wie Kalium und Wasser. Jeden Moment wird es eine Explosion geben.
Um mich herum dreht sich alles, und ich sehe in Panik erst Dad, dann Asher an. Was verdammt soll das?, möchte ich ihn fragen. Von allem Möglichen, was du mir hättest schenken können, hast du mir ausgerechnet ein Wiedersehen mit der Person beschert, die ich mehr hasse als alles andere auf der Welt.
Fünf Minuten später sitze ich auf einer Parkbank gegenüber der Stadthalle. Schnee legt sich auf meine Haare. Die einzige Ampel der Stadt blinkt gelb.
Ich hole mein Telefon heraus und starre eine ganze Minute darauf. Ich möchte mit jemandem reden, der mich kennt. Und wer sollte das sein, wenn nicht Asher?
Meine Mutter, aber das kann ich ihr nicht erzählen.
Maya könnte ich vermutlich anrufen, aber ich weiß, dass sie sich auf Ashers Seite schlagen wird. Wie sie das immer macht.
Also sitze ich da, gestrandet auf einer Parkbank, während der Schnee auf das beleuchtete Glas meines Telefons fällt, bis dieses dunkel wird.
Meine letzte Begegnung mit meinem Vater hatte ich anlässlich eines Fechtkampfs – es dürfte etwa zwei Jahre her sein. Ich befand mich auf der Fechtbahn, und mein Florett war auf meine Gegnerin von St. Agatha gerichtet. Nach dreißig Sekunden griff ich sie mit einem Flèche und einem ohrenbetäubenden Schrei an. Und die Jugendliche von St. Agatha schrie und rannte zurück zu ihrer Bank. Alle lachten und applaudierten. Der Schiedsrichter gab mir den Punkt.
Dann hörte ich von der Tribüne diese Stimme. Vier Jahre waren vergangen. Aber ich brauchte nicht hinzusehen, um zu wissen, zu wem sie gehörte. Ich wusste auch, dass er betrunken war.
Das ist mein Junge!,schrie er. Das ist …
Ich ließ mein Florett fallen und stürmte davon.
Schneeflocken sammeln sich in meinen Haaren, und meine Zähne klappern vor Kälte, aber innerlich habe das Gefühl zu brennen. Aus der Stadthalle höre ich Applaus.
»Lily.« Asher steht vor mir. Er sieht aus wie von einem Pfeil durchbohrt. Mein erster Gedanke ist Gut so.
»Ich will eigentlich nicht mit dir reden«, sage ich, stehe auf und laufe los.
»Warte, Lily«, sagt er und packt mich am Arm.
»Lass mich los.«
»Bitte. Lass es mich erklären.« Sein hübsches Gesicht ist bleich und angsterfüllt. »Bitte?«
Er fasst mich hart an. Ich muss nicht nachsehen, um zu wissen, dass ich einen Bluterguss haben werde. Es wäre nicht das erste Mal.
»Ich habe dir doch nur was Gutes tun wollen.«
»Du hieltst es also für eine gute Idee, eine Wiedervereinigung mit der Person zu veranstalten, die mein Leben ruiniert hat? Wie kommst du darauf, dass ich das jemals wollte?«
»Weil ich weiß, wie das ist. Keinen Vater zu haben.«
»Du Glücklicher!«
Zorn blitzt in Ashers Augen auf, wird aber rasch unterdrückt. »Glücklich trifft es nicht, Lily. Nicht für mich. Für mich fühlte sich das immer an wie ein großes schwarzes Loch.«
»Ich hätte lieber ein riesiges schwarzes Loch als dieses Arschloch«, erwidere ich.
»Das meinst du doch nicht so.«
»Woher willst du wissen, was ich meine? Du warst nicht dabei!«
Ich trete den Rückzug an, aber er packt mich erneut am Arm. »Du hast recht, ich war nicht dabei«, sagt er. »Ich war hier. Ohne meinen Vater. Und ich dachte, wenn ich das mit meinem Vater wieder hinbekomme, dann könnte ich das auch für dich tun.«
Ich durchbohre ihn nachgerade mit meinem Blick und lasse mir Zeit für jedes Wort: »Du nimmst jetzt deine verdammte Hand von meinem Arm.«
Ich entwinde mich seinem Griff und laufe los durch den Schnee. Bis nach Hause sind es acht Kilometer, aber ich würde auch hundert laufen, um dieses Gespräch zu beenden.
»Findest du nicht, dass er eine zweite Chance verdient hat?«, ruft Asher mir nach.
»Nein«, blaffe ich.
Er lässt nicht locker. »Lily, mir hast du doch auch eine gegeben.«
Ich bleibe wieder abrupt stehen. Das Schneetreiben ist jetzt heftiger geworden. »Vielleicht war das ja mein erster Fehler«, kontere ich und steuere auf den Pfad zu, der durch den dunklen Wald zu unserem Haus führt.
Vier Tage später wache ich auf und bin krank. Korrektur: immer noch krank. Es ist der zweite Tag, an dem ich zu Hause bleibe und nicht zur Schule gehe. Allerdings kann ich mich ehrlich gesagt kaum mehr an Montag und Dienstag erinnern, weil ich an beiden Tagen versucht habe, Asher und allen anderen auf der Adams High aus dem Weg zu gehen. Was immer ich mir eingefangen habe, nahm seinen Anfang in der Nacht, als ich durch den Wald nach Hause lief, und wurde seitdem immer schlimmer.
Natürlich fällt es mir schwer zu trennen, ob ich mich elend fühle, weil ich krank bin, oder wegen Asher.
Ich weiß nicht mal, wie um alles in der Welt er meinen Vater gefunden hat. Soziale Medien? Ein Privatdetektiv? Darüber zu grübeln, macht mich wahnsinnig. Und wenn Dad nun noch irgendwo in der Nähe ist? Was hält ihn ab, herzukommen und an unsere Tür zu klopfen? Uns zu finden, dürfte nicht allzu schwer sein. Die Stadt ist klein.
Der Bluterguss, den mir Ashers Zupacken beschert hat, ist inzwischen grünblau. Als ich Mom gestern sagte, ich würde gern zu Hause bleiben, hat sie einen Blick darauf geworfen und gemeint: Sprich mit mir, Lily.
Aber was könnte ich schon sagen? Mir fehlen die Worte.
Lily, insistierte sie, wenn dieser Junge dir Schmerz zufügt, dann musst du mir das sagen.
Ich machte den Mund auf, aber dann brach ich in Tränen aus. Also legte Mom ihre Arme um mich und hielt mich fest; so verweilten wir lange Zeit. Er hat mir Schmerz zugefügt, Mom, flüsterte ich. Aber nicht, wie du denkst.
Fast hätte ich vergessen, dass heute der Tag ist, an dem ich mit einem Vorab-Entscheid des Oberlin-Konservatoriums rechnen kann. Doch offengestanden wollte ich nur schlafen. Um die Mittagszeit sieht Mom noch mal nach mir. Sie trägt keine Arbeitsuniform, was nur bedeuten kann, dass sie sich meinetwegen freigenommen hat. Sie bringt mir eine Tasse Tee und stellt sie auf dem Nachttisch ab, bevor sie mir eine Hand auf die Stirn legt. »Du hast Fieber«, sagt sie.
Ich trinke meinen Tee. Es ist Irish Breakfast, mein Lieblingstee, nur schade, dass wir keinen Honig von Olivia haben.
Wenn ich mich von Asher trenne, bedeutet das wohl auch, dass ich den Kontakt zu seiner Mom abbreche? Was traurig wäre, denn ich mochte sie wirklich. Einmal nannte Olivia mich eine Pixie, obwohl sie die Mythologie eindeutig nicht kannte. In England wurden nämlich ungetauft gestorbene Kinder Pixies genannt.
Mom setzt sich zu mir aufs Bett. »Du siehst furchtbar aus.«
»Du bist zu bedingungsloser Liebe verpflichtet«, erwidere ich, aber meine Stimme ist nur ein Krächzen.
Der lange Zopf meiner Mutter schwingt über ihre rechte Schulter. »Vielleicht sollten wir mit dir zum Arzt gehen.«
»Mir geht es gut«, behaupte ich. »Ich will einfach nur schlafen.«
»Lily.« Sie beißt kurz die Zähne zusammen. »Ich habe mich nicht mit dir auf die Reise durchs ganze Land gemacht, damit du jetzt Angst vor einem …«, sie sucht nach dem Wort, »… Jungen hast.«
Ich drehe mich herum und schließe die Augen. »Ich habe keine Angst vor ihm. Ich habe Angst vor mir.«
»Wovor hast du Angst?«, hakt sie nach.
Wie soll ich ihr das sagen. Meiner Mom, die für mich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat und zweimal mit mir umgezogen ist, sich einen Job in New Hampshire gesucht hat, damit wir noch mal neu anfangen können? »Ich habe einfach Angst …«, sage ich. »Dass es nicht reicht, um mich glücklich zu machen.«
Sie denkt nach. »Manche Leute«, erwidert sie mit sanfter Stimme, »müssen dafür härter kämpfen als andere.«





























