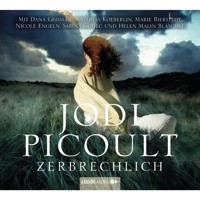
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die bewegendsten Romane von US-Bestsellerautorin Jodi Picoult bei beHEARTBEAT
- Sprache: Deutsch
Willow, ihr lang ersehntes Kind, ist perfekt. Das ist das Erste, was Charlotte O'Keefe hört, als sie ihr Baby auf dem Ultraschallbild sieht. Ja, es ist perfekt. Daran ändert auch Willows Krankheit nichts. Charlotte liebt ihr Kind abgöttisch und will nur eins: es beschützen. Denn Willow braucht allen Schutz der Welt. Beim kleinsten Stoß brechen ihre Knochen. Jedoch auch ihr Herz kann brechen.
Das scheint Charlotte zu vergessen, als sie vor Gericht das Geld für die richtige Behandlung erkämpfen will. Die Krankheit hätte früh erkannt und die Eltern gewarnt werden können. Charlotte muss jedoch behaupten, ihr geliebtes Kind sei besser nie geboren worden ...
Eine tief bewegende Geschichte über die Zerbrechlichkeit des Lebens von der US-Bestsellerautorin Jodi Picoult. Der Roman erschien im Original unter dem Titel Handle with Care.
»Grandios, vielschichtig und erschreckend aktuell.« THE TIMES
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 2 min
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelWidmungZitatPrologCharlotteTeil IRezeptAmeliaSeanCharlotteSeanMarinPiperCharlotteTeil IIRezeptCharlottePiperAmeliaMarinSeanCharlotteSeanAmeliaRezeptMarinPiperSeanAmeliaPiperCharlotteMarinAmeliaCharlotteAmeliaTeil IIIRezeptCharlotteSeanMarinSeanAmeliaPiperMarinRezeptCharlotteSeanAmeliaCharlotteMarinSeanAmeliaCharlotteAmeliaPiperMarinCharlotteTeil IVRezeptMarinCharlottePiperMarinSeanCharlotteAmeliaSeanMarinPiperCharlotteAmeliaSeanCharlotteAmeliaRezeptCharlotteAmeliaPiperSeanAmeliaCharlottePiperCharlotteMarinAmeliaSeanAmeliaMarinAmeliaCharlottePiperCharlotteRezeptWillowRezeptDanksagungAnmerkung der AutorinÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Willow, ihr lang ersehntes Kind, ist perfekt. Das ist das Erste, was Charlotte O’Keefe hört, als sie ihr Baby auf dem Ultraschallbild sieht. Ja, es ist perfekt. Daran ändert auch Willows Krankheit nichts. Charlotte liebt ihr Kind abgöttisch und will nur eins: es beschützen. Denn Willow braucht allen Schutz der Welt. Beim kleinsten Stoß brechen ihre Knochen. Jedoch auch ihr Herz kann brechen.
Das scheint Charlotte zu vergessen, als sie vor Gericht das Geld für die richtige Behandlung erkämpfen will. Die Krankheit hätte früh erkannt und die Eltern gewarnt werden können. Charlotte muss jedoch behaupten, ihr geliebtes Kind sei besser nie geboren worden …
JODI PICOULT
Zerbrechlich
Aus dem amerikanischen Englisch vonRainer Schumacher
Für Marjorie Rose,
die Blumen auf der Bühne erblühen lässt,
mich auf der anderen Seite der Welt mit Pflanzen versorgt
und die weiß, dass man ohne eine Blume im Haar
nie wirklich angezogen ist.
BFFI
Und? Hast du bekommen,
was du vom Leben gewollt hast? Trotz allem?
Ich ja.
Und was hast du gewollt?
Mich geliebt zu nennen, mich auf der Welt
geliebt zu fühlen.
RAYMOND CARVER, ›FRAGMENT‹
Prolog
Charlotte
14. Februar 2002
Ständig brechen oder zerbrechen irgendwelche Dinge. Gläser, Geschirr und Fingernägel. Autos, Schallplatten und Kartoffelchips. Man kann ein Pferd brechen oder einen Vertrag. Man kann das Eis brechen. Stimmen brechen; Schweigen wird gebrochen, und Tag und Nacht brechen an.
In den letzten beiden Monaten meiner Schwangerschaft habe ich mir eine Liste all dieser Dinge gemacht in der Hoffnung, es würde deine Geburt einfacher gestalten.
Versprechen werden gebrochen.
Und Herzen.
In der Nacht vor deiner Geburt habe ich mich im Bett aufgesetzt, um der Liste etwas hinzuzufügen. Ich kramte im Nachttisch nach Stift und Papier, doch Sean legte seine warme Hand auf mein Bein. Charlotte?, fragte er. Ist alles in Ordnung?
Bevor ich ihm darauf antworten konnte, zog er mich in die Arme, drückte mich an sich, und ich schlief friedlich ein. Was ich niederschreiben wollte, war vergessen.
Erst Wochen später, als du schon da warst, fiel mir wieder ein, welcher Gedanke mich in jener Nacht geweckt hatte: Verwerfungen. Das sind die Stellen, an denen die Erde auseinanderbricht. Das sind die Stellen, wo Erdbeben entstehen und Vulkane geboren werden. Oder anders gesagt: Die Welt zerbröckelt unter uns; der feste Boden unter unseren Füßen ist Illusion.
Du bist während eines Sturms angekommen, den niemand vorausgesagt hat. Ein »Nordoster«, sagten die Meteorologen später, ein Blizzard, der eigentlich nach Norden in Richtung Kanada hätte ziehen sollen, anstatt sich in einen wahren Rausch zu steigern und über der Küste Neuenglands niederzugehen. Aus den Nachrichten verschwanden die Berichte über ein Highschool-Pärchen, das sich in einem Altenheim wiedergetroffen und geheiratet hatte. Stattdessen wurde in einem fort gemeldet, wie stark der Sturm war und in welchen Gemeinden durch Vereisungen der Strom ausfiel. Amelia saß in der Küche und bastelte Valentinskarten, während ich beobachtete, wie sich über ein Meter Schnee vor der Glasschiebetür türmte. Im Fernsehen waren Bilder von Autos zu sehen, die von der Straße rutschten.
Mit zusammengekniffenen Augen schaute ich auf den Bildschirm, ob es sich bei dem Fahrer des Streifenwagens, der mit blinkendem Blaulicht hinter einem umgestürzten Fahrzeug stand, um Sean handelte.
Ein lauter Knall an der Schiebetür ließ mich erschrocken zusammenzucken. »Mami!«, schrie Amelia; auch sie hatte sich erschreckt.
Ich drehte mich gerade um, als der nächste Hagelschlag einen fingerlangen Sprung in das dicke Glas machte, aus dem rasch ein faustgroßes Netz von Rissen wuchs. »Daddy wird das später wieder in Ordnung bringen«, sagte ich.
Das war der Augenblick, in dem meine Fruchtblase platzte.
Amelia schaute zwischen meine Füße. »Dir ist da was passiert.«
Ich tappte zum Telefon, und als Sean nicht ans Handy ging, rief ich in der Zentrale an. »Ich bin die Frau von Sean O’Keefe«, sagte ich. »Bei mir haben die Wehen eingesetzt.« Der Diensthabende sagte, er werde einen Krankenwagen schicken, aber es könne eine Weile dauern; aufgrund der vielen Autounfälle seien alle unterwegs.
»Ist schon okay«, sagte ich und erinnerte mich, wie lange ich mit deiner Schwester in den Wehen gelegen hatte. »Vermutlich habe ich ohnehin noch Zeit.«
Plötzlich überfiel mich eine derart starke Wehe, dass ich mich zusammenkrümmte und den Hörer fallen ließ. Amelia starrte mich mit aufgerissenen Augen an. »Alles in Ordnung, Liebling«, log ich und lächelte, bis mir die Wangen schmerzten. »Mir ist nur das Telefon runtergefallen.« Ich griff nach dem Hörer, und diesmal rief ich Piper an, der ich jetzt am ehesten zutraute, mich zu retten.
»Du kannst noch keine Wehen haben«, erklärte sie im Brustton der Überzeugung, obwohl sie es natürlich besser wusste – sie war nicht nur meine beste Freundin, sie hatte auch mit mir an dem Geburtshilfekurs teilgenommen. »Der Kaiserschnitt ist erst für Montag angesetzt.«
»Ich glaube nicht, dass das Baby darüber informiert worden ist«, keuchte ich und biss die Zähne zusammen, weil schon wieder eine Wehe kam.
Piper sprach nicht aus, was wir beide dachten: dass ich dich nicht auf natürliche Weise zur Welt bringen durfte. »Wo ist Sean?«
»Ich … ich weiß nicht … oh, Piper!«
»Atme«, sagte Piper instinktiv, und ich begann zu keuchen, ha-ha-hi-hi, wie ich es gelernt hatte. »Ich werde Gianna anrufen und ihr sagen, dass wir auf dem Weg sind.«
Gianna war Dr. Del Sol, die Spezialistin, die ich vor knapp acht Wochen auf Pipers Bitte hin hinzugezogen hatte. »Wir?«
»Wolltest du etwa selber fahren?«
Fünfzehn Minuten später hatte ich deine Schwester bestochen, das Fragen sein zu lassen, indem ich sie auf die Couch setzte und Blau und Schlau einschaltete. Ich habe mich neben sie gesetzt, in Vaters Wintermantel, denn ein anderer passte mir nicht mehr.
Als damals bei Amelias Geburt die Wehen einsetzten, stand die gepackte Tasche bereits neben der Tür. Ich hatte einen Geburtsplan und eine eigens zusammengestellte Musikkassette bei mir, die im Kreißsaal gespielt werden sollte. Ich wusste, es würde schmerzhaft werden, doch dafür winkte eine schier unglaubliche Belohnung: das Kind, auf das ich monatelang sehnsüchtig gewartet hatte. Darum war ich bei meinen ersten Wehen ganz aufgeregt gewesen.
Diesmal jedoch war ich wie versteinert. In meinem Bauch warst du einfach sicherer als draußen.
Dann stand plötzlich Piper in ihrem leuchtend pinkfarbenen Parka in der Tür und füllte den Raum mit ihrer selbstbewussten Stimme. »Blau und Schlau?«, sagte sie und machte es sich neben deiner Schwester bequem. »Das ist meine absolute Lieblingssendung, weißt du … nach Jerry Springer natürlich.«
Amelia. Bis dahin hatte ich noch nicht einmal darüber nachgedacht, wer auf sie aufpassen würde, während ich im Krankenhaus war, um dich zur Welt zu bringen.
»Wie weit sind sie auseinander?«, fragte Piper.
Die Wehen kamen inzwischen alle sieben Minuten. Als die nächste wie eine Flut über mich hereinbrach, krallte ich mich in die Couchlehne und zählte bis zwanzig, den Blick fest auf die Risse in der Glastür gerichtet.
Um das Zentrum hatte sich spiralförmig Reif ausgebreitet. Ein beängstigender, wenn auch schöner Anblick.
Piper nahm meine Hand. »Alles wird gut, Charlotte«, versprach sie mir, und weil ich eine Närrin war, habe ich ihr geglaubt.
Die Notaufnahme war voller Menschen, die bei Unfällen während des Sturms verletzt worden waren. Junge Männer hielten sich blutige Handtücher an den Kopf, und auf Tragen lagen jammernde Kinder. Piper führte mich an allen vorbei und in die Gynäkologie hinauf, wo Dr. Del Sol bereits im Gang auf und ab lief. Binnen zehn Minuten gab man mir eine Periduralanästhesie und fuhr mich in den Operationssaal für einen Kaiserschnitt.
Ich spielte dabei ein Spiel mit mir selbst: Wenn in diesem Gang eine gerade Zahl von Leuchtstoffröhren an der Decke hing, würde Sean noch rechtzeitig eintreffen. Wenn mehr Männer als Frauen im Aufzug waren, würde sich alles als falsch erweisen, was die Ärzte mir gesagt hatten. Ohne dass ich Piper hatte bitten müssen, hatte sie sich OP-Kleidung angezogen, um notfalls für Sean an meiner Seite einspringen zu können. »Er wird schon noch rechtzeitig kommen«, sagte sie und schaute zu mir herunter.
Der Operationssaal war kalt und metallisch. Eine Krankenschwester mit grünen Augen – das war alles, was ich zwischen Maske und Kappe von ihr sehen konnte – hob mein Krankenhaushemd hoch und rieb mir den Bauch mit Betadine ein. Als sie das sterile Abdecktuch darüberlegten, bekam ich Angst. Wenn nun mein Unterleib nicht ausreichend betäubt war und ich das Skalpell noch spüren konnte? Was, wenn du entgegen all meiner Hoffnung die Geburt nicht überleben würdest?
Plötzlich flog die Tür auf, und Sean wehte mit einem kalten Luftzug herein. Er band sich eine Maske vors Gesicht und hatte sich das OP-Hemd nur halb in die Hose gesteckt. »Warten Sie!«, rief er. Er trat an den Tisch und berührte meine Wange. »Schatz«, sagte er. »Es tut mir leid. Als ich es gehört habe, bin ich so schnell wie möglich …«
Piper tätschelte Sean den Arm. »Da ist ja das Publikum«, bemerkte sie und machte ihm Platz, doch nicht ohne mir noch mal schnell die Hand zu drücken.
Und dann war Sean an meiner Seite. Ich spürte seine warmen Hände auf meinen Schultern, und der Klang seiner Stimme lenkte mich ab, als Dr. Del Sol das Skalpell ansetzte. »Ihr habt mir eine Heidenangst eingejagt«, sagte er. »Was habt ihr beide euch nur dabei gedacht, allein zu fahren?«
»Dass wir das Kind nicht auf dem Küchenboden bekommen wollen?«
Sean schüttelte den Kopf. »Es hätte etwas Furchtbares passieren können.«
Ich spürte ein Ziehen unter dem weißen Abdecktuch. Unwillkürlich atmete ich tief ein und drehte den Kopf zur Seite. Da habe ich es dann gesehen: das vergrößerte Ultraschallbild aus der 27. Woche mit deinen sieben Knochenbrüchen, den einwärtsgebogenen Gliedern. Es ist schon etwas Furchtbares passiert, dachte ich.
Und dann hast du geschrien, obwohl sie dich so behutsam hochhoben, als wärst du aus Zuckerwatte. Du hast geschrien, doch nicht wie die normalen Neugeborenen. Du hast geschrien, als würden sie dich zerreißen. »Vorsichtig«, ermahnte Dr. Del Sol die OP-Schwester. »Sie müssen das ganze …«
Es gab ein Knacken, ein Geräusch wie beim Platzen einer Luftblase, und du hast noch lauter geschrien, was ich nicht für möglich gehalten hätte. »Oh Gott«, sagte die Krankenschwester, und ihre Stimme nahm einen hysterischen Tonfall an. »War das ein Bruch? War ich das?« Ich habe den Kopf nach dir gereckt, doch ich konnte nur deinen winzigen Mund und die feuerroten Wangen sehen.
Das Ärzteteam und die Krankenschwestern scharten sich um dich, konnten dein Weinen jedoch nicht stoppen. Ich glaube, bis zu dem Moment habe ich fest gehofft, all die Ultraschallaufnahmen und Testergebnisse wären ein Irrtum. Bis zu dem Augenblick, wo ich dich schreien hörte, habe ich Angst gehabt, ich würde dich vielleicht nicht lieben können.
Sean schaute den Ärzten über die Schulter. »Sie ist perfekt«, sagte er und drehte sich zu mir um, doch seine Worte hatten einen Nachhall, als wollte er sie von mir bestätigt wissen.
Perfekte Babys schreien nicht so laut, dass es einem das Herz zerreißt. Perfekte Babys sehen nicht nur so aus, sie sind es auch.
»Heb nicht ihren Arm hoch«, murmelte eine Krankenschwester.
Und eine Kollegin erwiderte: »Wie soll ich sie denn wickeln, wenn ich sie nicht anfassen darf?«
Und die ganze Zeit über hast du geschrien, und das in einer Tonlage, wie ich sie noch nie gehört hatte.
Willow, flüsterte ich. Das war der Name, auf den dein Vater und ich uns geeinigt hatten. Ich hatte ihn erst davon überzeugen müssen. Nein, so werde ich sie nicht nennen, hatte er gesagt. Willow heißt »Weide«, und Weiden trauern. Aber ich wollte dir eine Prophezeiung mit auf den Weg geben, den Namen eines Baumes, der sich biegt, anstatt zu brechen.
Willow, flüsterte ich erneut, und irgendwie hast du mich gehört, trotz der aufgeregten Ärzte und Schwestern, der surrenden Geräte und trotz deiner Schmerzensschreie.
Willow, sagte ich laut, und du hast den Kopf nach mir gedreht, als hätte ich dich mit dem Wort umarmt. Willow, sagte ich erneut, und du hast aufgehört zu schreien – einfach so.
Als ich im fünften Monat schwanger war, habe ich von dem Restaurant, in dem ich früher gearbeitet habe, einen Anruf bekommen. Die Mutter des Patissiers hatte sich die Hüfte gebrochen, und für den Abend war ein Restaurantkritiker des Boston Globe angekündigt. Natürlich sei es unverschämt und sicher kein guter Zeitpunkt für mich, aber ob ich nicht eben reinkommen und schnell mein Millefeuille machen könne? Das mit dem Würzschokaladeneis, den Avocados und dem Bananenbrûlée?
Ich muss zugeben, ich war egoistisch. Ich fühlte mich träge und fett, und ich wollte mir zeigen, dass ich noch zu mehr taugte, als mit deiner Schwester Karten zu spielen und Koch- und Buntwäsche auseinanderzusortieren. Also habe ich Amelia bei ihrem Babysitter gelassen und bin zu Capers gefahren.
Die Küche hatte sich in all den Jahren, da ich nicht mehr dort gewesen war, nicht verändert, nur die Speisekammer hatte der neue Chefkoch umgestaltet. Sofort räumte ich mir einen Arbeitsplatz frei und machte mich an den Blätterteig. Irgendwann mittendrin ließ ich ein Stück Butter fallen und bückte mich, um es aufzuheben, bevor jemand darauf ausrutschen konnte. Dabei war mir in aller Deutlichkeit bewusst, dass ich bei Weitem nicht mehr so beweglich in der Hüfte war wie noch vor wenigen Monaten. Ich spürte, wie du mir den Atem geraubt hast, als ich dir deinen stahl. »Tut mir leid, Schatz«, sagte ich laut und richtete mich wieder auf.
Nun frage ich mich: War das der Augenblick, wo dir die Knochen brachen? Habe ich dich verletzt, weil ich verhindern wollte, dass sich ein anderer verletzt?
Kurz nach drei in der Nacht bist du auf die Welt gekommen, aber bis zum nächsten Abend habe ich dich nicht mehr wiedergesehen. Alle halbe Stunde ging Sean, um sich von den Ärzten auf den neuesten Stand bringen zu lassen: Sie wird geröntgt. Sie nehmen ihr Blut ab. Sie glauben, es könnte auch ein Knöchel gebrochen sein. Und dann, um sechs Uhr, brachte er mir die bis dahin beste Nachricht: Typ III, sagte er. Sie hat sieben Brüche, die bereits verheilen, und vier neue, aber sie atmet normal. Ich lag im Krankenhausbett und lächelte wie blöde. Ich war sicher die einzige Wöchnerin auf der Geburtsstation, die sich über solch eine Neuigkeit freute.
Seit zwei Monaten wussten wir schon, dass du mit OI – Osteogenesis imperfecta, der so genannten Glasknochenkrankheit – geboren werden würdest, zwei Buchstaben, die unser ganzes Leben bestimmen sollten. Es handelt sich um eine Kollagenfehlbildung, die Knochen so brüchig macht, dass sie beim Stolpern, beim Umdrehen, ja sogar beim Niesen brechen können. Es gibt mehrere Typen davon, doch nur bei zweien kommt es zu Knochenbrüchen im Mutterleib, wie wir sie auf den Ultraschallbildern gesehen hatten. Trotzdem konnte uns der Radiologe seinerzeit nicht sagen, ob du nun Typ II hattest, was bei der Geburt tödlich gewesen wäre, oder Typ III, was ernst ist und zu immer weiteren Deformierungen führt. Nun wusste ich, dass du im Laufe der Jahre Hunderte Knochenbrüche haben würdest, doch wichtig war nur noch eins: dass du überhaupt am Leben warst.
Als der Sturm nachließ, fuhr Sean nach Hause, um deine Schwester zu holen, damit sie dich kennenlernen konnte. Ich schaute mir die Radarbilder im Fernsehen an, die zeigten, wie der Blizzard nach Süden zog und sich in einen alles lahmlegenden Eisregen verwandelte, der über Washington, D.C., niederging. Ich versuchte, mich ein wenig aufzusetzen, obwohl die frisch genähte OP-Wunde wie Feuer brannte. »Hey«, sagte Piper, kam herein und setzte sich auf die Bettkante. »Ich habe es schon gehört.«
»Ja«, sagte ich. »Wir sind ja so glücklich.«
Piper zögerte nur einen winzigen Augenblick, bevor sie lächelte und nickte. »Sie ist jetzt auf dem Weg nach unten«, erzählte sie, und im selben Moment schob eine Krankenschwester ein Kinderkörbchen in den Raum.
»Sooo. Hier ist deine Mami«, trällerte sie.
Du lagst auf dem Rücken auf einem Kissen aus speziellem Schaumstoff, das sich dem Körper anpasst, und hast tief und fest geschlafen. Deine winzigen Ärmchen und Beinchen und dein linker Knöchel waren mit Bandagen umwickelt.
Sobald du älter wärst, so hieß es, würde man dir ansehen können, dass du unter OI leidest – zumindest wer sich auskennt. Die Beugung deiner Arme und Beine und die dreieckige Gesichtsform würden auffallen, und du würdest nie größer werden als einen Meter. Doch jetzt, in diesem Augenblick, sahst du trotz deiner Verbände makellos aus: eine pfirsichfarbene Haut, ein winziger himbeerroter Mund, die Haare widerspenstig und goldblond, die Wimpern so lang wie mein kleiner Fingernagel. Ich streckte die Hand aus, um dich zu streicheln – und zog sie wieder zurück, weil ich mich erinnerte.
Ich hatte mir so sehr gewünscht, du mögest die Geburt überleben, dass ich über die Herausforderungen, die das für uns bedeutete, gar nicht nachgedacht hatte. Ich hatte ein wunderschönes kleines Mädchen, das so zerbrechlich war wie eine Seifenblase. Als deine Mutter sollte ich dich vor Schaden bewahren. Doch was würde werden, wenn ich dich immer wieder verletzte?
Piper und die Krankenschwester schauten einander an. »Du willst sie in den Arm nehmen, nicht wahr?«, fragte Piper. Sie schob die Hand als Stütze unter das Schaumstoffkissen, während die Krankenschwester die Seiten anhob, um deine Ärmchen zu stützen. Langsam legten sie mir das Kissen in die Armbeuge.
Hey, flüsterte ich und nahm dich ein wenig enger. Den rauen Schaumstoff in den Händen, fragte ich mich, wie lange es wohl dauern würde, bis ich dich richtig spüren, deine Haut an meiner fühlen durfte. Ich dachte an Amelias Säuglingszeit: wie ich sie im Bett in den Arm nahm, wenn sie weinte, und mit ihr einschlief. Da habe ich zwar stets Angst gehabt, ich könnte mich versehentlich auf sie legen und sie ersticken. Aber bei dir stellte es schon eine Gefahr dar, dich aus der Wiege zu heben. Oder dir den Rücken zu reiben.
Ich schaute zu Piper auf. »Vielleicht solltest du sie besser nehmen …«
Piper ließ sich neben mir nieder und strich mit einem Finger über deinen Kopf. »Charlotte«, sagte Piper, »sie wird schon nicht zerbrechen.«
Wir wussten beide, dass das gelogen war, aber bevor ich dahingehend etwas sagen konnte, stapfte Amelia herein, mit Schnee an Handschuhen und Pudelmütze. »Sie ist da! Sie ist da!«, sang deine große Schwester. An dem Tag, als ich ihr gesagt habe, dass du kommst, hat sie gefragt, ob du rechtzeitig zum Mittagessen da sein würdest. Als ich daraufhin erwidert habe, das dauere noch gute fünf Monate, hat sie erklärt, das sei zu lang. Stattdessen hat sie so getan, als wärst du schon da. Sie trug ihre Lieblingspuppe herum und nannte sie »Schwesterchen«. Manchmal, wenn sie dazu keine Lust mehr hatte oder von etwas abgelenkt wurde, ließ sie die Puppe auf den Kopf fallen, und dein Vater hat gelacht. Gott sei Dank ist das nur das Übungsexemplar, hat er dann immer gesagt.
Sean stand in der Tür, während Amelia aufs Bett und zu Piper auf den Schoß kletterte, um ihr Urteil abzugeben. »Sie ist viel zu klein, um mit mir Rollschuh zu fahren«, sagte Amelia. »Und warum sieht sie wie eine Mumie aus?«
»Das sind Schleifen«, antwortete ich, »wie bei einem Geschenk.«
Das war das erste Mal, dass ich gelogen habe, um dich zu beschützen, und als hättest du das mitbekommen, bist du in diesem Augenblick aufgewacht. Du hast nicht geweint, dich nicht gewunden. »Was ist denn mit ihren Augen passiert?« Amelia schnappte nach Luft, und wir alle sahen zum ersten Mal das deutlichste Merkmal deiner Krankheit: Die Lederhaut deiner Augen war nicht weiß, sondern strahlend blau.
Mitten in der Nacht hatten die Krankenschwestern Schichtwechsel. Du und ich, wir schliefen beide tief und fest, als die Neue den Raum betrat. Träge wachte ich auf, sah ihren Schwesternkittel und las das Namensschild. »Warten Sie«, sagte ich, als sie nach deiner Windel griff. »Vorsichtig.«
Sie lächelte nachsichtig. »Entspannen Sie sich, Mom. Ich habe schon zehntausend Windeln gewechselt.«
Doch das war, bevor ich gelernt habe, mich für dich einzusetzen, und als sie an der Windel zog, zog sie zu schnell. Du hast dich auf die Seite gerollt und zu kreischen begonnen. Das war nicht das Weinen, mit dem du zu verkünden pflegtest, dass du Hunger hast; das war das schrille Schreien, das ich nach deiner Geburt gehört hatte. »Sie tun ihr weh!«
»Sie mag es einfach nicht, mitten in der Nacht geweckt zu werden …«
Es setzte mir schon furchtbar zu, dich so schreien zu hören, doch dann wurde auch noch deine Haut vollkommen blau, und dein Atem ging schnell und flach. Die Krankenschwester beugte sich mit ihrem Stethoskop über dich. »Was ist denn los? Was hat sie denn?«, verlangte ich zu wissen.
Die Krankenschwester runzelte die Stirn, während sie deine Brust abhörte, und plötzlich wurdest du ganz schlaff. Die Schwester drückte einen Knopf hinter meinem Bett. »Code Blau«, hörte ich, und binnen Sekunden war der Raum voller Menschen, obwohl es mitten in der Nacht war. Dann Diagnosen und Anweisungen im Stakkato: Sie ist hypoxämisch … Luft in den Arterien … Stickstoff bei achtundvierzig Prozent … Zuführung von FIO2 …
»Ich beginne mit der Herzmassage«, sagte jemand.
»Das Kind hat OI.«
»Besser leben mit gebrochenen Rippen als mit heilen Knochen sterben.«
»Wir brauchen ein tragbares Bruströntgengerät …«
»Links waren keine Atemgeräusche zu hören, als das begonnen hat …«
»Es hat keinen Zweck, auf den Röntgenapparat zu warten. Es könnte zu einem Pneumothorax gekommen sein …«
Zwischen zwei weißen Kitteln hindurch sah ich eine Nadel aufblitzen und zwischen deine Rippen dringen, und dann, nur Augenblicke später, schnitt ein Skalpell knapp unter dem Einstich in deine Haut. Blut war zu sehen, eine Klammer und schließlich ein Schlauch, den man dir in den Brustkorb schob. Ich schaute zu, wie sie den Schlauch einnähten.
Als Sean eintraf, atemlos und völlig außer sich, hatte man dich schon auf die Intensivstation verlegt. »Sie haben sie aufgeschnitten«, schluchzte ich; mehr brachte ich nicht heraus. Sean nahm mich in die Arme, und endlich ließ ich den Tränen freien Lauf, die ich bis dahin ängstlich zurückgedrängt hatte.
»Mr. und Mrs. O’Keefe? Ich bin Dr. Rhodes.« Ein Mann, der aussah, als könnte er noch zur Highschool gehen, steckte den Kopf zur Tür herein, und Sean packte fest meine Hand.
»Ist Willow okay?«, fragte er.
»Wann können wir sie sehen?«
»Bald«, antwortete der Arzt, und der Kloß in meinem Hals löste sich langsam auf. »Beim Röntgen hat sich der Verdacht einer gebrochenen Rippe bestätigt. Sie war mehrere Minuten lang hypoxämisch, was wiederum mit einem sich erweiternden Pneumothorax in Verbindung stand. Als Folge davon kam es zu einer mediastinalen Verlagerung und kardiopulmonalem Arrest.«
»Reden Sie Englisch mit uns, verdammt!«, brüllte Sean.
»Sie hat über mehrere Minuten hinweg keinen Sauerstoff bekommen, Mr. O’Keefe. Das Herz, die Luftröhre und weitere wichtige Organe und Gefäße sind als Folge der angestauten Luft im Brustkorb auf die andere Seite des Körpers verschoben worden. Dank der Bülow-Drainage, also des Schlauchs, den wir gelegt haben, werden sie jedoch wieder dahin zurückkehren, wo sie hingehören.«
»Keinen Sauerstoff«, wiederholte Sean, und die Worte blieben ihm im Halse stecken. »Reden wir hier von Hirnschäden?«
»Das ist durchaus möglich. Allerdings müssen wir noch eine Weile warten, bis wir das wissen.«
Sean beugte sich vor. Er ballte die Fäuste so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Aber ihr Herz …«
»Sie ist jetzt stabil. Allerdings besteht nach wie vor die Möglichkeit eines Herz-Kreislauf-Zusammenbruchs. Es lässt sich einfach nicht vorhersagen, wie ihr Körper auf unsere Rettungsmaßnahmen reagieren wird.«
Ich brach in Tränen aus. »Ich will nicht, dass sie das noch einmal durchmacht. Ich kann nicht zulassen, dass sie ihr das noch einmal antun, Sean.«
Der Arzt machte ein untröstliches Gesicht. »Vielleicht sollten Sie sich überlegen, eine DNR-Anordnung zu unterschreiben und einen entsprechenden Vermerk in die Krankenakte setzen zu lassen, damit derartige Wiederbelebungsmaßnahmen künftig unterbleiben.«
Die letzten Wochen meiner Schwangerschaft hatte ich damit verbracht, mich auf alles gefasst zu machen, doch wie sich nun herausstellte, war ich nicht annähernd genug vorbereitet.
»Denken Sie einfach mal darüber nach«, riet der Arzt.
Vielleicht ist es ihr nicht bestimmt, hier bei uns zu sein, sagte Sean. Vielleicht ist das Gottes Wille.
Und was ist mit meinem Willen?, entgegnete ich. Ich will sie. Ich habe sie immer gewollt.
Verletzt schaute er mich an. Glaubst du, ich nicht?
Aus dem Fenster konnte ich den abschüssigen Krankenhausrasen sehen, der ganz und gar mit glitzerndem Schnee bedeckt war. Es war ein strahlend schöner Tag, und niemand wäre je auf die Idee gekommen, dass hier vor Kurzem noch ein Blizzard gewütet hatte. Ein unternehmungslustiger Vater, der seinen Sohn beschäftigen wollte, hatte ein Tablett aus der Cafeteria mitgenommen. Darauf rodelte der Junge jauchzend den Hügel hinunter, dass der Schnee hinter ihm aufspritzte. Unten angekommen, kullerte er vom Tablett, stand auf und winkte zur Krankenhausfassade hinauf, wo ihm vermutlich jemand aus einem Fenster wie meinem zuschaute. Ich fragte mich, ob seine Mutter wohl gerade ein Baby bekommen hatte. Vielleicht lag sie ja direkt nebenan und lachte ihrem Sohn zu.
Meine Tochter, dachte ich gedankenverloren, wird nie rodeln dürfen.
Piper hielt meine Hand, während wir dich auf der Intensivstation besuchten. Der Schlauch ragte zwischen deinen Rippen hervor, und an den Armen und Beinen hattest du feste Verbände. Ich schwankte ein wenig. »Alles in Ordnung mit dir?«, fragte Piper.
»Ich bin nicht diejenige, um die du dir Sorgen machen musst.« Ich schaute sie an. »Sie haben uns gefragt, ob wir einen Reanimationsverzicht unterschreiben wollen.«
Piper riss die Augen auf. »Wer hat euch das gefragt?«
»Dr. Rhodes …«
»Der ist noch in der Facharztausbildung«, sagte Piper derart angewidert, als hätte sie ihn beschuldigt, Nazi zu sein. »Ein Azubi. Der kennt nicht mal den Weg zur Cafeteria, geschweige denn, dass er weiß, wie man mit einer Mutter sprechen muss, die gerade dabei war, als ihr Baby einen Herzstillstand erlitt. Kein Kinderarzt würde eine DNR-Anordnung für ein Baby empfehlen, solange nicht durch Tests bestätigt ist, dass tatsächlich ein irreversibler Hirnschaden vorliegt …«
»Sie … sie haben sie vor meinen Augen aufgeschnitten«, berichtete ich mit zitternder Stimme. »Ich habe gehört, wie ihre Rippen brachen, als sie versucht haben, ihr Herz wieder zum Schlagen zu bringen.«
»Charlotte …«
»Würdest du so eine Anordnung unterschreiben?«
Als Piper nicht darauf antwortete, ging ich auf die andere Seite deines Bettchens, sodass du zwischen uns lagst. »Sieht so der Rest meines Lebens aus?«
Piper schwieg lange Zeit. Wir lauschten der Symphonie aus Surren und Piepen, die dich umgab. Ich sah dich im Schlaf zusammenzucken. Du hast deine winzigen Zehen gekrümmt und die Ärmchen ausgebreitet. »Nicht deines Lebens«, erwiderte Piper schließlich, »sondern Willows.«
Noch am selben Tag habe ich, mit Pipers Worten in den Ohren, die DNR-Anordnung unterschrieben. Es war ein Flehen um Gnade in Schwarz auf Weiß … und zwischen den Zeilen stand: Das war das erste Mal, dass ich gelogen und gesagt habe, ich wünschte, du wärst nie geboren worden.
Teil I
Die meisten Dinge brechen, Herzen eingeschlossen.Die Lektionen, die einem das Leben erteilt, lehren einen nicht Weisheit, sondern hinterlassen Narben und Schwielen.
Wallace Stegner, DIE NACHT DES KIEBITZ
Temperieren: auf eine mäßig warme, auf den Bedarf gut abgestimmte Temperatur bringen.
Das lateinische Wort ›temperare‹ bedeutet ›sich mäßigen‹ oder ›ins richtige Verhältnis setzen‹. Dennoch bringen wir mit ›Temperament‹ häufig ein Übermaß an Erregung in Verbindung, wann immer ein Mensch rasch zu Zornesausbrüchen neigt. In der Kochkunst hingegen kommt der Begriff des ›Temperierens‹ der ursprünglichen Bedeutung schon viel näher, heißt ›Temperieren‹ doch, einen Effekt zu verstärken, indem man sich Zeit lässt. So temperiert man Eier, indem man geringe Mengen heißer Flüssigkeit hinzugibt. Die Idee dahinter ist, die Temperatur anzuheben, ohne dass die Eier stocken. Das Ergebnis ist eine Eiercreme, die man als Bestandteil von unterschiedlichen Desserts verwenden kann.
Interessant ist dabei Folgendes: Die Konsistenz des fertigen Produkts hat nichts mehr mit der Flüssigkeit gemein, die man dafür verwendet hat; und je mehr Eier man benutzt, desto dicker und reichhaltiger wird das Ergebnis.
Mit anderen Worten: Die Substanz, mit der man beginnt, bestimmt das Ergebnis.
Crème Patisserie
2 Tassen Vollmilch6 Eigelb, zimmerwarm140 Gramm Zucker40 Gramm Stärkemehl1 Teelöffel Vanille
Die Milch in einem unbeschichteten Topf zum Kochen bringen. Eigelb, Zucker und Stärkemehl in einer Stahlschüssel miteinander verrühren. Die Eigelbmischung mit der Milch temperieren, dann unter stetem Rühren erhitzen. Sobald die Mixtur zu stocken beginnt, schneller rühren, bis sie kocht; von der Herdplatte nehmen. Vanille zugeben, und das Ganze in eine Stahlschüssel schütten. Darauf ein wenig Zucker streuen und eine Plastikfolie direkt auf die Crème legen. Das Ganze in den Kühlschrank stellen und kalt servieren. Die fertige Crème eignet sich auch hervorragend als Füllung für Obstkuchen, Napoleontorte, Bienenstich, Eclairs etc.
Amelia
Februar 2007
In meinem ganzen Leben war ich noch nie in Urlaub. Ich habe noch nicht einmal New Hampshire verlassen, es sei denn, man zählt das eine Mal mit, als ich mit dir und Mom nach Nebraska gefahren bin – und selbst du musst zugeben, dass man es nicht gerade mit einem Strandspaziergang oder einem Besuch des Grand Canyon vergleichen kann, wenn man drei Tage lang im Krankenzimmer eines Shriner-Hospitals hockt und alte Tom-und-Jerry-Cartoons schaut, während du untersucht wirst. Du kannst dir also vorstellen, wie aufgeregt ich war, als ich erfuhr, dass unsere ganze Familie nach Disney World fahren würde. Die Reise sollte während der Februarferien stattfinden, und wir würden in einem Hotel wohnen, durch das eine Monorail fährt.
Mom stellte eine Liste der Vergnügungsbahnen zusammen, auf die wir gehen würden: »It’s a Small World«, »Dumbo, the Flying Elephant«, »Peter Pan’s Flight«.
»Die sind doch nur was für Babys«, beschwerte ich mich.
»Aber sie sind auch sicher«, erwiderte Mom.
»Was ist mit ›Space Mountain‹?«, schlug ich vor.
»›Fluch der Karibik‹«, konterte sie.
»Na, toll!«, schrie ich. »Da fahre ich das erste Mal in meinem Leben in Urlaub und werde noch nicht einmal Spaß dabei haben!« Dann stürmte ich rauf in unser Zimmer. Da konnte ich zwar nicht mehr hören, was unten vor sich ging, konnte mir aber sehr gut vorstellen, was unsere Eltern jetzt sagten: Da haben wir’s. Amelia spielt schon wieder die Trotzige.
Es ist schon komisch … Wenn so etwas passiert (nämlich ständig), ist es nicht Mom, die alles wieder glattbügelt. Sie ist einfach zu beschäftigt, weil sie nur dafür sorgt, dass mit dir alles in Ordnung ist; also muss Dad das erledigen. Ach, das ist auch so etwas, weswegen ich eifersüchtig bin: Du hast einen echten Vater, ich nur einen Stiefvater. Meinen richtigen Vater kenne ich gar nicht. Mom und er haben sich schon vor meiner Geburt getrennt, und sie schwört, sein Verschwinden sei das Beste, was er je für mich habe tun können. Doch Sean hat mich adoptiert, und er verhält sich so, als liebte er mich genauso sehr wie dich … wäre da nicht dieser finstere Stachel, der mich ständig daran erinnert, dass das nicht sein kann.
»Meel«, sagte er, als er in mein Zimmer kam (er ist der Einzige, der mich so nennen darf; der Name erinnert mich immer an Mehlwürmer, nur nicht, wenn Dad ihn sagt), »ich weiß, dass du alt genug für die großen Vergnügungsbahnen bist. Aber wir wollen, dass auch Willow Spaß an der Reise hat.«
Denn wenn Willow Spaß hat, dann haben wir alle Spaß. Er musste das nicht extra aussprechen; ich habe es auch so gehört.
»Wir wollen einfach nur eine ganz normale Familie auf Urlaub sein«, sagte er.
Ich zögerte. »Das Teetassenkarussell«, hörte ich mich sagen.
Dad versprach, sich für mich einzusetzen. Obwohl Mom strikt dagegen war – und wenn Willow gegen die harte Wand einer Teetasse schlägt, was dann? –, überzeugte er sie, dass wir uns ruhig herumwirbeln lassen dürften, denn wenn wir dich fest zwischen uns nähmen, würdest du dich gar nicht verletzen können. Danach grinste er mich an. Er war so stolz darauf, diesen Deal erkämpft zu haben, dass ich es einfach nicht übers Herz brachte, ihm zu sagen, dass mir das Teetassenkarussell vollkommen egal war.
Es war mir nur in den Sinn gekommen, weil ich im Fernsehen mal vor ein paar Jahren einen Werbespot für Disney World gesehen hatte. Darin war Tinker Bell wie ein Moskito über den Köpfen glücklicher Besucher durchs Zauberreich geflattert. Dann zeigte der Spot eine Familie mit zwei Töchtern, die ungefähr im selben Alter waren wie wir beide, und die amüsierten sich auf dem Teetassenkarussell des Verrückten Hutmachers. Ich starrte sie an und konnte gar nicht wegsehen – die ältere Tochter hatte sogar braune Haare wie ich, und wenn man die Augen zusammenkniff, sah der Vater genauso aus wie Dad. Natürlich war mir klar, dass die Leute in dem Werbespot wahrscheinlich noch nicht mal eine echte Familie waren, sondern Schauspieler, die ihre falschen Töchter vielleicht erst am Morgen der Aufnahme kennengelernt hatten; aber ich wollte, dass sie echt waren. Ich wollte glauben, dass sie von Herzen lachten, während sie sich wie verrückt im Kreis drehten.
Nimm zehn Fremde, steck sie in einen Raum, und frag sie, mit wem von uns beiden sie mehr Mitleid haben – mit dir oder mit mir. Wir wissen alle, welche Antwort sie geben werden. Es ist schon verdammt schwer, deine Gipsverbände zu übersehen, wie auch die Tatsache, dass du trotz deiner fünf Jahre erst so groß bist wie eine Zweijährige. Auch deinen schiefen Gang kann man nicht ignorieren – das heißt, wenn du ausnahmsweise mal so gesund bist, dass du gehen kannst. Ich will damit nicht sagen, du hättest es leicht gehabt. Aber ich habe es schwerer gehabt, denn jedes Mal, wenn ich mein Leben beschissen fand, habe ich dich angesehen und mich dafür gehasst, so etwas auch nur gedacht zu haben.
Hier mal eine Kurzfassung, was es heißt, ich zu sein:
Amelia, spring nicht aufs Bett. Du tust Willow weh.
Amelia, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst deine Socken nicht auf dem Boden liegen lassen? Willow könnte darüber stolpern.
Amelia, schalte den Fernseher aus – obwohl ich erst seit einer halben Stunde geschaut habe, während du fünf Stunden am Stück darauf gestarrt hast.
Ich weiß, wie selbstsüchtig das klingt; doch man wird ein Gefühl ja nicht los, nur weil man weiß, dass es falsch ist. Und ich bin zwar erst zwölf, aber glaub mir, ich habe längst kapiert, dass unsere Familie nicht wie andere ist und auch nie sein wird. Ein typisches Beispiel: Welche Familie packt einen ganzen zusätzlichen Koffer mit Verbänden und wasserdichten Schienen voll, nur für den Fall? Welche Mutter verbringt vor dem Urlaub einen ganzen Tag damit, sich über sämtliche Krankenhäuser in Orlando zu informieren?
Es war am Tag unserer Abreise, und während Dad den Wagen beladen hat, haben du und ich am Küchentisch gesessen und Schnick-Schnack-Schnuck gespielt. »Schnuck«, sagte ich, und wir beide hatten »Schere«. Ich hätte es wissen müssen; du hast immer »Schere« gemacht. »Schnuck«, sagte ich wieder, und diesmal nahm ich »Stein«. »Stein bricht Schere«, sagte ich und tippte mit der Faust auf deine Hand.
»Vorsichtig«, ermahnte mich Mom, obwohl sie noch nicht einmal in unsere Richtung schaute.
»Gewonnen.«
»Du gewinnst immer.«
Ich lachte. »Das kommt, weil du immer ›Schere‹ machst.«
»Leonardo da Vinci hat die Schere erfunden«, hast du gesagt. Du hattest schon immer den Kopf voll von Dingen, die außer dir niemand wusste, die aber auch keinen interessierten. Du hast ständig gelesen, im Netz gesurft oder dir Sendungen im History Channel angeschaut, bei denen ich eingeschlafen wäre. Die Leute erschraken regelrecht, wenn sie auf eine Fünfjährige trafen, die wusste, dass das Geräusch einer Toilettenspülung die Tonlage E-Dur hat oder dass ›town‹ das älteste Wort der englischen Sprache ist. Aber Mom hat gesagt, dass viele Kinder mit OI ungewöhnlich früh zu lesen beginnen und sprachliche Frühentwickler sind. Ich habe mir das immer wie einen Muskel vorgestellt: Dein Gehirn ist eben mehr benutzt worden als dein übriger Körper, in dem ständig ein Knochen kaputt war; kein Wunder also, dass du wie Klein-Einstein geklungen hast.
»Habe ich alles?«, fragte meine Mutter, aber sie redete mit sich selbst. Sie ging nun schon zum millionsten Mal ihre Liste durch. »Der Brief«, sagte sie und drehte sich zu mir um. »Amelia, wir brauchen den Arztbrief.«
Sie meinte einen Brief von Dr. Rosenblad, in dem das Offensichtliche stand: dass du OI hast und von ihm im Krankenhaus behandelt wirst. Der Brief sollte im Notfall vorgelegt werden – was ziemlich komisch war, denn mit deinen ganzen Knochenbrüchen warst du ständig ein Notfall. Der Brief lag im Handschuhfach des Vans neben den Fahrzeugpapieren, dem Handbuch des Toyotas, einer alten Karte von Massachusetts, einer Quittung von Jiffy Lube und einem alten, ausgewickelten Kaugummi, der inzwischen vertrocknet war. Ich hatte einmal Inventur gemacht, während Mom an der Tankstelle bezahlte.
»Wenn er sowieso im Van liegt, warum kannst du ihn dir dann nicht selbst nehmen, wenn wir zum Flughafen fahren?«
»Weil ich das mit Sicherheit vergessen werde«, antwortete Mom, als Dad gerade hereinkam.
»Alles abreisebereit«, erklärte er. »Was meinst du, Willow? Wollen wir Micky besuchen gehen?«
Du hast ihn breit angegrinst, als wäre Micky Maus real und nicht irgendein Teenager, der sich in den Ferien mit einem großen Plastikteil auf dem Kopf etwas dazuverdient. »Micky Maus hat am 18. November Geburtstag«, hast du verkündet, während Dad dir vom Stuhl herunterhalf. »Amelia hat mich beim Schnick-Schnack-Schnuck geschlagen.«
»Das kommt, weil du immer ›Schere‹ machst«, sagte Dad.
Mom warf noch einen letzten Blick auf ihre Liste und runzelte die Stirn. »Sean, hast du das Motrin eingepackt?«
»Zwei Flaschen.«
»Und die Kamera?«
»Mist, die habe ich oben auf der Kommode liegen lassen …« Er drehte sich zu mir um. »Süße, kannst du sie eben holen, während ich Willow in den Wagen setze?«
Ich nickte und lief nach oben. Als ich mit der Kamera in der Hand wieder nach unten kam, war Mom allein in der Küche und drehte sich langsam im Kreis, als wisse sie nicht, was sie ohne Willow an ihrer Seite tun solle. Schließlich schaltete sie das Licht aus, schloss die Haustür ab, und ich hüpfte zum Wagen. Ich gab Dad die Kamera und schnallte mich hinten neben deinem Kindersitz an. Auch wenn es mir mit meinen zwölf Jahren schwerfällt, das zuzugeben, ich freute mich tierisch auf Disney World. Ich dachte an Sonnenschein, Disneylieder und Monorails und nicht eine Sekunde an den Brief von Dr. Rosenblad.
Was heißt, dass alles, was danach geschah, meine Schuld war.
Wir schafften es noch nicht einmal bis zu den bescheuerten Teetassen. Bis wir endlich im Hotel waren, war es bereits Spätnachmittag. Wir fuhren zum Park und hatten gerade die Main Street, U.S.A., betreten – mit direktem Blick auf Cinderellas Schloss –, als die Katastrophe ihren Lauf nahm. Du sagtest, du hättest Hunger, und so gingen wir in einen auf altmodisch getrimmten Eissalon. Dad stellte sich an und hielt dich an der Hand, während Mom Servietten zu dem Tisch brachte, an dem ich schon saß. »Schaut mal«, sagte ich und zeigte nach draußen auf Goofy, der einem schreienden Kleinkind die Hand schüttelte. In genau dem Moment hob Mom eine Serviette auf, die sie hatte fallen lassen, und Dad ließ deine Hand los, um sein Portemonnaie aus der Tasche zu holen. Du bist sofort zum Fenster gelaufen, um zu sehen, was ich da entdeckt hatte; dabei bist du dann auf einem winzigen Stück Papier ausgerutscht.
Wie in Zeitlupe sahen wir, wie deine Beine unter dir nachgaben und du mit voller Wucht auf den Hintern fielst. Du hast zu uns aufgeschaut, und das Weiße in deinen Augen wurde blau – wie immer, wenn du dir etwas gebrochen hast.
Es war fast so, als hätten die Leute in Disney World damit gerechnet, dass so etwas passiert. Kaum hatte Mom dem Mann hinter der Eistheke gesagt, dass du dir ein Bein gebrochen hast, kamen auch schon zwei Sanitäter mit einer Trage. Mom gab ihnen Anweisungen, wie sie es bei medizinischem Personal immer tat, und den beiden gelang es, dich auf die Trage zu befördern. Du hast weder geschrien noch geweint, doch das hast du eigentlich nie getan. Ich habe mir einmal beim Volleyball in der Schule den kleinen Finger gebrochen und bin fast durchgedreht, als er knallrot wurde und anschwoll wie ein Ballon; aber du hast noch nicht einmal geweint, wenn dir ein gebrochener Armknochen aus der Haut ragte.
»Tut das nicht weh?«, flüsterte ich, als sie die Trage hochhoben, aus der plötzlich Räder klappten.
Du hast dir auf die Unterlippe gebissen und genickt.
Als wir zum Tor von Disney World kamen, wartete dort ein Krankenwagen. Ich warf einen letzten Blick auf die Main Street, U.S.A., auf den Metallkegel, in dem der Space Mountain lag, und auf die Kinder, die hinein- statt hinausliefen. Dann stieg ich in das Auto, das irgendjemand besorgt hatte, damit Dad und ich dir und Mom ins Krankenhaus folgen konnten.
Es war irgendwie seltsam, eine fremde Notaufnahme zu betreten. In unserem Krankenhaus kannte dich jeder, und die Ärzte hörten auf das, was Mom ihnen sagte. Hier jedoch schenkte ihr niemand auch nur die geringste Aufmerksamkeit. Sie sagten, dass es sich nicht nur um einen, sondern um zwei Oberschenkelhalsbrüche handeln könnte, und das wiederum berge die Gefahr innerer Blutungen. Mom ging mit dir zum Röntgen, während Dad und ich auf den grünen Plastikstühlen warten mussten. »Tut mir leid, Meel«, sagte Dad, und ich zuckte nur mit den Schultern. »Vielleicht ist es diesmal ja nur ein ganz einfacher Bruch, und wir können morgen schon wieder in den Park.« In Disney World hatte ein Mann im schwarzen Anzug meinem Vater gesagt, wir würden »kompensiert« oder so ähnlich, falls wir an einem anderen Tag wiederkommen wollten.
Es war Samstagabend, und die Leute, die in die Notaufnahme kamen, waren viel interessanter als das Programm in dem Fernseher in der Ecke. Da waren zwei Jungen im Collegealter. Die bluteten an der gleichen Stelle an der Stirn, und wann immer sie einander ansahen, fingen sie an zu lachen. Dann war da ein alter Mann mit paillettenbesetzter Hose, der sich den Bauch hielt, und ein Mädchen, das nur Spanisch sprach und zwei schreiende Zwillingsbabys in den Armen hielt.
Plötzlich kam Mom rechts von uns durch die Doppeltür gestürmt. Eine Schwester und eine Frau mit engem Nadelstreifenrock und roten Highheels liefen hinter ihr her. »Der Brief!«, schrie Mom. »Sean, was hast du mit dem Brief gemacht?«
»Was für ein Brief?«, erwiderte Dad, doch ich wusste bereits, wovon sie sprach, und mir wurde übel.
»Mrs. O’Keefe«, sagte die Frau in dem engen Rock, »bitte. Lassen Sie uns das irgendwo anders und in Ruhe besprechen.«
Sie berührte Mom am Arm und … Nun, ich kann das nur so beschreiben: Mom klappte einfach zusammen. Wir wurden in einen Raum gebracht, in dem eine alte, zerschlissene rote Couch und ein kleiner, ovaler Tisch mit künstlichen Blumen standen. An der Wand hing ein Bild von zwei Pandas, und ich starrte es an, während die Frau in dem engen Rock – sie sagte, ihr Name sei Donna Roman und sie komme vom Jugendamt – mit unseren Eltern sprach. »Dr. Rice hat uns kontaktiert, weil Willows Verletzungen ihn beunruhigt haben«, erklärte sie. »Die Röntgenaufnahmen deuten darauf hin, dass das nicht ihr erster Knochenbruch war.«
»Willow hat Osteogenesis imperfecta«, sagte Dad.
»Das habe ich ihr schon gesagt«, erwiderte Mom. »Sie hört nicht zu.«
»Ohne entsprechendes ärztliches Attest müssen wir das eingehender untersuchen. Das ist schlicht Routine und dient einzig und allein dem Schutz der Kinder und …«
»Ich würde mein Kind ja gerne beschützen«, unterbrach Mom sie in rasiermesserscharfem Tonfall, »wenn Sie mich nur endlich wieder zu ihm lassen würden!«
»Dr. Rice ist ein Experte in …«
»Wenn er ein Experte wäre, würde er wissen, dass ich die Wahrheit sage«, schoss Mom zurück.
»Wenn ich richtig verstanden habe, versucht Dr. Rice gerade, den Arzt ihrer Tochter zu erreichen«, sagte Donna Roman. »Aber da wir Samstagabend haben, ist das nicht leicht. Deshalb möchte ich, dass Sie uns eine schriftliche Vollmacht geben, Willow eingehend zu untersuchen – einschließlich Computertomografie und neurologischer Tests. Währenddessen können wir ja ein wenig reden.«
»Tests sind das Letzte, was Willow braucht«, erwiderte Mom. »Davon hat sie schon mehr als genug über sich ergehen lassen müssen.«
»Schauen Sie, Miss Roman«, mischte Dad sich ein. »Ich bin Polizeibeamter. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich Sie anlügen würde, oder?«
»Ich habe bereits mit Ihrer Frau gesprochen, Mr. O’Keefe, und ich werde auch noch mit Ihnen sprechen … aber zunächst einmal möchte ich mit Willows Schwester reden.«
Ich klappte den Mund auf und wieder zu, doch es kam kein Ton heraus. Mom starrte mich an, als wolle sie meine Gedanken lesen, und ich schaute zu Boden, bis ich plötzlich diese roten Highheels vor mir sah. »Du musst Amelia sein«, sagte Donna, und ich nickte. »Warum gehen wir nicht ein wenig spazieren?«
Als wir den Raum verließen, trat ein Polizist vor die Tür, der wie Dad aussah, wenn er zur Arbeit ging. »Trennen Sie die beiden voneinander«, sagte die Roman zu ihm, und der Mann nickte. Dann führte sie mich zum Süßigkeitenautomaten am anderen Ende des Gangs. »Was möchtest du gerne? Ich bin ja ein Schokoladenjunkie, aber vielleicht stehst du mehr auf Chips.«
Sie war so viel netter zu mir, wenn meine Eltern nicht dabei waren. Sofort deutete ich auf einen Riegel Snickers. Ich musste die Situation ausnutzen, solange es noch ging. »Ich nehme an, so hast du dir deine Ferien nicht vorgestellt«, bemerkte Donna, und ich schüttelte den Kopf. »Ist das Willow schon öfter passiert?«
»Ja. Sie bricht sich ständig irgendwelche Knochen.«
»Und wie?«
Für jemanden, der eigentlich intelligent sein sollte, kam mir die Frau ziemlich dumm vor. Wie bricht man sich schon die Knochen? »Na, sie fällt hin oder wird von irgendetwas getroffen.«
»Sie wird von irgendetwas getroffen?«, wiederholte Donna Roman. »Oder meinst du von irgendjemandem?«
Auf dem Spielplatz im Kindergarten hat dich mal ein Kind umgerannt. Du warst zwar ziemlich talentiert darin, allem Möglichen auszuweichen, doch an dem Tag warst du einfach nicht schnell genug. »Nun ja«, antwortete ich, »manchmal auch das.«
»Wer war bei Willow, als sie sich diesmal verletzt hat, Amelia?«
Ich dachte an Dad, der an der Eistheke deine Hand gehalten hatte. »Mein Vater.«
Donna kniff die Lippen zusammen. Sie warf Münzen in den Automaten, und heraus kam eine Flasche Wasser. Sie drehte sie auf. Ich hätte gerne einen Schluck davon getrunken, war aber zu verlegen, um sie danach zu fragen.
»War er aufgeregt?«
Ich dachte an das Gesicht meines Vaters, als wir hinter dem Krankenwagen zum Krankenhaus gerast waren. »Ja … ziemlich sogar.«
»Glaubst du, er hat das getan, weil er wütend auf Willow war?«
»Was getan?«
Donna Roman kniete sich neben mich, sodass sie mir in die Augen schauen konnte. »Amelia«, sagte sie, »du kannst mir ruhig erzählen, was wirklich passiert ist. Ich werde schon dafür sorgen, dass sie dir nicht wehtun.«
Plötzlich wusste ich, was sie dachte. »Mein Dad war nicht wütend auf Willow«, sagte ich. »Er hat sie nicht geschlagen. Es war ein Unfall!«
»Solche Unfälle müssen nicht passieren.«
»Nein … Sie verstehen nicht … Willow hat …«
»Nichts, was Kinder tun, rechtfertigt Misshandlung«, murmelte Donna Roman vor sich hin, doch ich konnte sie klar und deutlich hören. Sie ging zu dem Zimmer zurück, wo meine Eltern warteten, doch obwohl ich ihr hinterherschrie, achtete sie nicht mehr auf mich. »Mr. und Mrs. O’Keefe«, sagte sie, »wir nehmen Ihre Kinder zu deren Schutz vorläufig in Verwahrung.«
»Warum fahren wir nicht aufs Revier und reden mal miteinander?«, sagte der Officer zu Dad.
Mom schlang die Arme um mich. »In Verwahrung? Zum Schutz? Was soll das heißen?«
Mit fester Hand – und mithilfe des Polizeibeamten – versuchte Donna Roman, mich aus Moms Armen zu lösen. »Wir wollen nur die Sicherheit der Kinder garantieren, bis sich das alles geklärt hat. Willow wird über Nacht hierbleiben.« Sie wollte mich aus dem Raum führen, doch ich krallte mich am Türrahmen fest.
»Amelia«, rief meine Mutter aufgelöst, »was hast du ihr erzählt?«
»Ich habe versucht, ihr die Wahrheit zu sagen!«
»Wo bringen Sie meine Tochter hin?«
»Mom!«, kreischte ich und streckte die Hand nach ihr aus.
»Komm, Schatz«, sagte Donna Roman und zog an meinen Händen, bis ich loslassen musste. Während ich schrie und um mich trat, wurde ich aus dem Krankenhaus gezerrt. Fünf Minuten lang wehrte ich mich aus Leibeskräften; dann brach ich zusammen. Da verstand ich, warum du nie geweint hast, obwohl es wehgetan hat: Es gibt eine Art von Schmerz, die man einfach nicht laut ausdrücken kann.
Ich kannte das Wort Pflegefamilie sonst nur aus Büchern und Fernsehsendungen. Ich habe mir immer vorgestellt, dass so etwas nur für Straßenkinder ist, für Kinder, deren Eltern Drogendealer sind – nicht für Mädchen wie mich, die in netten Häusern wohnen, viele Weihnachtsgeschenke bekommen und nie hungrig zu Bett gehen. Wie sich herausstellte, war Mrs. Ward, die Pflegemutter, nicht anders als andere Mütter auch. Ich nehme an, sie war auch eine – jedenfalls den Fotos nach zu urteilen, mit denen nahezu jede Wand gepflastert war. In einem roten Bademantel und Pantoffeln, die wie rosa Schweinchen aussahen, empfing sie uns an der Tür. »Du musst Amelia sein«, sagte sie und öffnete die Tür ein wenig mehr.
Ich hatte eine ganze Schar von Kindern erwartet, doch wie sich herausstellte, war ich bei ihr das einzige. Sie führte mich in die Küche, die nach Spülmittel und gekochten Nudeln roch. Dort stellte sie dann ein Glas Milch und eine Stange Kekse vor mich hin. »Du hast sicher großen Hunger«, sagte sie. Das stimmte zwar, aber ich schüttelte trotzdem den Kopf. Ich wollte nichts von ihr annehmen, denn das wäre nichts anderes als eine Kapitulation gewesen.
Mein Schlafzimmer verfügte über eine Kommode, ein kleines Bett und eine Daunendecke, die über und über mit Kirschen bedruckt war. Es gab auch einen Fernseher mit Fernbedienung. Meine Eltern hätten mir nie einen Fernseher ins Zimmer gestellt; meine Mutter sagte immer, das Fernsehen sei die Wurzel allen Übels. Das sagte ich später Mrs. Ward, und sie lachte. »Das mag durchaus sein«, erklärte sie, »aber manchmal sind die Simpsons einfach die beste Medizin.« Sie öffnete eine Schublade und holte ein sauberes Handtuch sowie ein Nachthemd heraus, das mir mehrere Nummern zu groß war. Ich fragte mich, woher es wohl stammte und wie lange das letzte Mädchen darin geschlafen hatte.
»Mein Zimmer ist ein kleines Stück den Flur hinunter, falls du mich brauchst«, sagte Mrs. Ward. »Kann ich dir sonst noch etwas besorgen?«
Meine Mutter.
Meinen Vater.
Meine Schwester.
Mein Zuhause.
»Wie …« Mühsam brachte ich die ersten Worte in diesem Haus hervor. »Wie lange muss ich hierbleiben?«
Mrs. Ward lächelte traurig. »Das weiß ich nicht, Amelia.«
»Sind meine Eltern … Sind sie auch bei fremden Leuten?«
Sie zögerte. »So ungefähr.«
»Ich möchte Willow sehen.«
»Das ist das Erste, was wir morgen machen«, sagte Mrs. Ward. »Wir werden ins Krankenhaus fahren. Gefällt dir das?«
Ich nickte. Ich wollte ihr unbedingt glauben. An diesem Versprechen hielt ich mich fest wie daheim an meinem Plüschelch. Alles wird gut, konnte ich mir einreden.
Ich lag auf dem Bett und versuchte, mich an die nutzlosen Informationshäppchen zu erinnern, die du immer heruntergerasselt hast, bevor wir schlafen gegangen sind und ich dir gesagt habe, du sollst endlich den Mund halten: Frösche müssen vor dem Schlucken die Augen schließen. Mit einem einzigen Bleistift kann man einen fünfunddreißig Meilen langen Strich ziehen. Cleveland rückwärtsgesprochen ergibt DNA Level C.
Allmählich verstand ich, warum du diese dummen Fakten mit dir herumgetragen hast wie andere Kinder ihre Schnuffeldecken: Wenn ich sie mir immer wieder vorsagte, fühlte ich mich fast schon besser. Nur weiß ich nicht, ob das daran lag, dass es half, etwas zu wissen, während der Rest des Lebens ein einziges großes Fragezeichen war, oder daran, dass sie mich an dich erinnerten.
Ich war noch immer hungrig – oder leer, ich weiß es nicht. Nachdem Mrs. Ward in ihr eigenes Zimmer gegangen war, stieg ich auf Zehenspitzen aus dem Bett. Ich schaltete das Licht im Flur an und ging in die Küche hinunter. Dort öffnete ich den Kühlschrank und ließ das Licht und die Kälte auf meine nackten Füße fallen. Ich starrte auf gebratenes Fleisch, das sorgfältig in Plastiktüten portioniert war, auf Äpfel und Pfirsiche in einem Korb und Tetrapaks mit Orangensaft und Milch, die superordentlich nebeneinanderlagen. Als ich glaubte, von oben ein Knarren zu hören, schnappte ich mir, so viel ich konnte: einen Laib Brot, eine Tupperdose mit gekochten Spaghetti und eine Handvoll von diesen Keksen. Dann lief ich in mein Zimmer zurück, schloss die Tür und breitete meinen Schatz auf dem Laken aus.
Zuerst knabberte ich nur an den Keksen. Doch dann knurrte mir der Magen, und ich aß alle Spaghetti – mit den Fingern, weil ich keine Gabel hatte. Anschließend aß ich ein Stück Brot und dann noch eines und noch eines, und bevor ich mich versah, war nur noch die Plastikfolie übrig, in die es eingewickelt gewesen war. Was ist mit mir los?, dachte ich und schaute mir mein Bild im Spiegel an. Wer isst denn einen ganzen Laib Brot? Mein Äußeres war schon widerlich genug – langweiliges braunes Haar, das sich je nach Wetter auch noch kräuselte, Augen, die zu weit auseinanderstanden, schiefe Zähne und Speckröllchen über der Jeans –, aber mein Inneres war noch schlimmer. Ich stellte es mir als schwarzes Loch vor – ja, das aus dem Physikunterricht –, finster und alles verschlingend. Ein Vakuum aus Nichts, hatte mein Lehrer es genannt.
Alles, was je gut in mir gewesen war oder was die Leute Gutes in mir gesehen hatten, war vergiftet worden, weil ich mir im finstersten Teil meiner Seele gewünscht hatte, ich hätte eine andere Familie. Mein wirkliches Ich war eine widerwärtige Person, die sich ein Leben vorstellte, in dem du nie geboren worden warst. Mein wirkliches Ich hat zugeschaut, wie du in den Krankenwagen geschoben worden bist, und hat sich einen Augenblick lang gewünscht, nicht mitfahren zu müssen, sondern in Disney World bleiben zu können. Mein wirkliches Ich war eine bodenlose Seele, die einen ganzen Laib Brot in zehn Minuten essen konnte und immer noch Platz für mehr hatte.
Ich hasste mich.
Ich weiß nicht, warum ich dann nach nebenan ins Badezimmer gegangen bin und mir den Finger in den Hals gesteckt habe. Vielleicht lag es an dem Gefühl, dass mir das Gift ins Blut sickerte, und ich wollte es loswerden. Oder ich wollte mich selbst bestrafen. Oder die Kontrolle über dieses schwarze Loch erlangen, das eben unkontrollierbar alles verschlungen hatte; womöglich würde sich dann auch der Rest von mir beherrschen lassen. Ratten können sich nicht übergeben, schoss es mir durch den Kopf – das hast du mir mal erzählt. Jedenfalls hielt ich mir mit einer Hand das Haar hoch und erbrach mich in die Toilette, bis ich schwitzte, ein knallrotes Gesicht hatte und völlig leer war. Erleichtert stellte ich fest, dass ich wenigstens eine Sache richtig machen konnte, auch wenn es mir danach noch mieser ging als vorher. Mein Magen drehte sich; ich schmeckte Galle im Mund und fühlte mich noch furchtbarer als vorher – doch jetzt hatte dieses Gefühl einen eindeutig körperlichen Grund, auf den ich mit dem Finger zeigen konnte.
Geschwächt taumelte ich zu dem fremden Bett zurück. Meine Augen fühlten sich wie Sandpapier an, mein Hals schmerzte, und ich konnte nicht einschlafen. Darum griff ich nach der TV-Fernbedienung und schaltete durch die Kanäle, durch Heimwerkershows, Cartoons und Late-Night-Talkshows. Es war auf Nick at Nite, nach zweiundzwanzig Minuten der Dick Van Dyke Show: Plötzlich lief da der alte Disney-World-Spot wie ein böser Scherz, wie eine höhnische Erinnerung. Es war wie ein Schlag in die Magengrube: Da war Tinker Bell, da die glücklichen Leute und da die Familie auf dem Teetassenkarussell, die wir hätten sein können.
Was, wenn meine Eltern nie wieder zurückkommen würden?
Was, wenn du nicht wieder gesund werden würdest?
Was, wenn ich für immer hierbleiben müsste?
Als ich zu schluchzen begann, stopfte ich mir einen Kissenzipfel in den Mund, damit Mrs. Ward mich nicht hörte. Ich schaltete den Fernseher stumm und schaute zu, wie die Familie sich in Disney World fröhlich im Kreis drehte.
Sean
Es ist schon komisch, nicht wahr, wie man sich in seiner Meinung zu hundert Prozent sicher sein kann, bis man selbst in die entsprechende Lage kommt. Wie zum Beispiel eine Festnahme. Menschen, die nicht für das Gesetz arbeiten, finden es furchtbar, wenn jemand irrtümlich festgenommen wurde, selbst dann, wenn ein begründeter Verdacht bestanden hat. Aber als Polizist entlässt man die Person einfach wieder und sagt ihr, man habe nur getan, was man habe tun müssen. In jedem Fall sei das besser, als zu riskieren, dass ein Verbrecher auf freiem Fuß bleibt, habe ich immer gesagt. Zum Teufel mit den Bürgerrechtlern, die einen Täter nicht mal erkennen, wenn er ihnen ins Gesicht spuckt. Das war es, was ich aus tiefstem Herzen geglaubt habe, bis man mich selbst unter dem Verdacht der Kindesmisshandlung aufs Revier der Polizei von Lake Buena Vista brachte. Ein Blick auf deine Röntgenbilder, auf Dutzende noch nicht ganz verheilte Brüche, auf die Krümmung deines rechten Unterarms hatte gereicht, und die Ärzte waren durchgedreht und hatten sofort das Jugendamt angerufen. Dr. Rosenblad hatte uns schon vor Jahren ein Attest gegeben, das uns vor einer Festnahme bewahren sollte, denn viele Eltern von Kindern mit OI werden der Misshandlung beschuldigt, wenn die Krankengeschichte nicht bekannt ist – und Charlotte hatte ihn immer im Wagen dabei, nur für alle Fälle. Doch an diesem Tag, nachdem wir wegen der Reise an so vieles hatten denken müssen, war der Brief vergessen worden, und so wurden wir auf dem Revier verhört.
»Das ist Blödsinn!«, brüllte ich. »Meine Tochter ist in der Öffentlichkeit gestürzt. Mindestens zehn Leute können das bezeugen. Warum holen Sie sich die nicht? Haben Sie hier in der Gegend denn nichts Besseres zu tun?«
Ich hatte abwechselnd guter und böser Cop gespielt, doch wie sich herausstellte, wirkt das nicht, wenn man es mit einem fremden Kollegen zu tun hat. Es war Samstag und fast Mitternacht, und das wiederum hieß, dass es vermutlich bis Montag dauern würde, bis die Situation von Dr. Rosenblad geklärt werden konnte. Ich hatte Charlotte nicht mehr gesehen, seit wir in die Streifenwagen gestiegen waren, und in Fällen wie diesen pflegten auch wir die Eltern voneinander zu trennen, damit sie sich keine gemeinsame Lüge ausdenken konnten. Das Problem war nur, dass die Wahrheit ziemlich verrückt klang. Ein Kind rutscht auf einer Serviette aus und trägt einen mehrfachen Bruch des Oberschenkelknochens davon? Man muss nicht wie ich schon neunzehn Jahre bei der Polizei sein, um so etwas verdächtig zu finden.





























