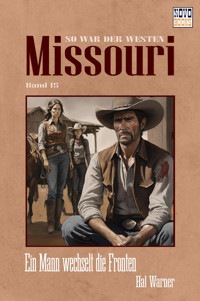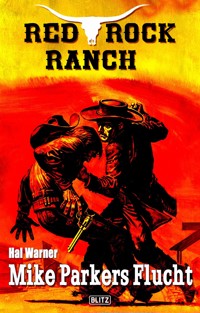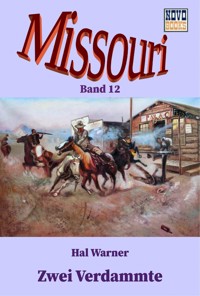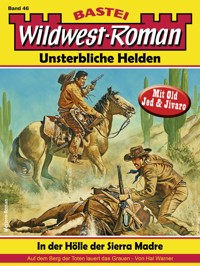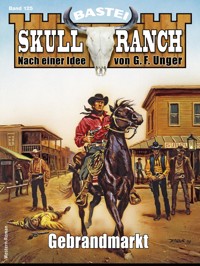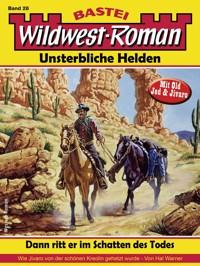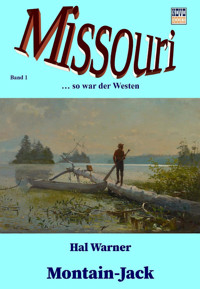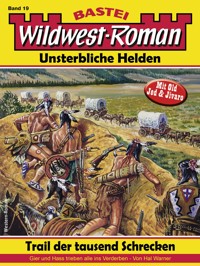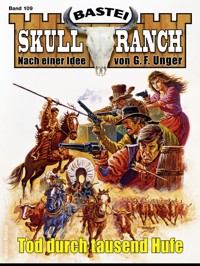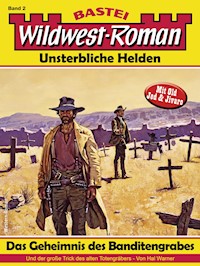1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es sieht so aus, als hätte die letzte Stunde für Jivaro geschlagen. Auch die tapfere Sakawa, die alles darangesetzt hatte, ihn zu retten, ist in die Hände des hinterhältigen Outlaw-Bosses gefallen. Doch inmitten dieser scheinbar aussichtslosen Situation gibt es noch eine Hoffnung - und zwar Old Jed. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber er hat trotzdem einige Tricks auf Lager. Vor allem seinen Mut und seine Kampferfahrung kann man nicht in Abrede stellen. Die Schurken urteilen jedoch bloß nach dem Aussehen, was ihnen sehr bald zum Verhängnis werden soll ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Old Jed - sie unterschätzten ihn alle
Vorschau
Impressum
Old Jed – sie unterschätzten ihn alle
Von Hal Warner
Es sieht so aus, als hätte die letzte Stunde für Jivaro geschlagen. Auch die tapfere Sakawa, die alles darangesetzt hatte, ihn zu retten, ist in die Hände des hinterhältigen Outlaw-Bosses gefallen. Höllenqualen müssen die beiden durchstehen. Jivaro wird mit brutalen Peitschenhieben zur Sklavenarbeit angetrieben. Und Sakawa muss in einem düsteren Verlies so lange ausharren, bis sie gewillt ist, sich den niederträchtigen Wünschen des schmierigen Schurken zu fügen. Ihre letzte Hoffnung haben Jivaro und das Girl auf Old Jed gesetzt, den die Handlanger für tot hielten ...
Die vier Frachtschoner, die sich schwerfällig nach Westen bewegten, wurden von jeweils sechs Maultieren gezogen. Neben jedem Fahrer saß ein zweiter Mann, der schwer bewaffnet war. Außerdem wurde der kleine Treck noch von einigen Reitern begleitet, von denen einer an der Spitze ritt, einer am Schluss und einer hinter dem zweiten Wagen.
Diesem zweiten Wagen war von außen nicht anzusehen, dass er menschliche Fracht hatte. Mehr als ein Dutzend Gefangene hockten längs der Bordwände auf den harten Brettern, an Händen und Füßen mit eisernen Ketten gefesselt.
Insgesamt waren es vierzehn Männer. Dreizehn Schwarze und Jivaro, das Halbblut.
Jivaro saß neben einem Hünen und war wie dieser und alle übrigen Leidensgefährten noch zusätzlich an einen in die Bordwand eingelassenen Eisenring gefesselt.
Sein Gesicht zeigte die Spuren von Misshandlungen. Es war an mehreren Stellen aufgeschlagen und wies Schwellungen und bläuliche Verfärbungen auf. Maddocks Leute hatten Jivaro schlimm verprügelt, nachdem sie ihn auf seiner Ranch in ihre Gewalt bringen konnten.
Nun befand er sich auf dem Weg zu Maddocks Mine, die man auch die Todesmine nannte. Das war alles, was man ihm über sie gesagt hatte. Jivaro wusste weder, wo sie lag, noch wie weit sie von Mesilla entfernt war.
Sicher war nur eins: Dass er in dieser Mine als Sklave würde schuften müssen. Genau wie seine schwarzen Gefährten, die in stummer Verzweiflung vor sich hinstarrten.
Keiner konnte jedoch das Gesicht seines Gegenübers erkennen, denn zwischen den Gefangenen waren Kisten aufgestapelt, sodass sie kaum Platz für ihre Füße hatten. Sie mussten ständig ihre Knie anziehen, konnten die Beine nicht ausstrecken.
Unter der Plane war es drückend heiß. Die stickige, staubgeschwängerte Luft erschwerte das Atmen und trieb den zusammengepferchten Männern den Schweiß aus den Poren. Jedes Mal, wenn der Wagen über eine Bodenmulde rumpelte, stießen die Gefangenen gegeneinander. Der Fahrer nahm keine Rücksicht darauf, sondern hatte lediglich die Meilen im Blick, die er heute noch schaffen musste.
»He, zerdrück mich nicht, Goliath!«, rief Jivaro, als der riesige Schwarze wieder einmal gegen ihn fiel. »Du bist schließlich nicht aus Watte!«
»Ich kann nichts dafür«, entschuldigte sich der Hüne.
»Ja, ich weiß. Schuld ist der Fahrer, dieser Hundesohn. Ich bin wirklich schon besser gereist.«
»Dafür kostet diese Fahrt nichts«, grollte der Hüne mit einem Anflug von Galgenhumor.
Jivaro wollte noch etwas erwidern. Doch da schrie der Reiter, dessen stoppelbärtiges Gesicht durch die hintere Planenöffnung zu erkennen war: »Maul halten, ihr Bastarde, oder es setzt was! Wer hat denn gesagt, dass ihr euch unterhalten dürft?«
Das Reden während der Fahrt war verboten. Rufus Mulligan, der den Treck führte, hatte das so angeordnet. Warum, wusste niemand. Wahrscheinlich war es nur eine Schikane von ihm.
»Selber ein Bastard!«, gab Jivaro furchtlos zurück.
Da trieb der Reiter sein Pferd noch dichter an den Wagen heran. Böse starrte er auf den jungen Halbindianer. Er wusste sofort, dass die Worte von ihm gekommen waren, denn von den Schwarzen wagte keiner so vorlaut zu sein.
»Nimm dich in Acht, Halbblut!«, knurrte er drohend. »Sonst hole ich dich bei der nächsten Rast aus dem Wagen und gerbe dir den Rücken!«
Ausgepeitscht wollte Jivaro nicht werden, und er zog es daher vor, lieber den Mund zu halten.
Seine Gedanken schweiften zu Sakawa, die sich ebenfalls in Maddocks Gewalt befand. In der Gewalt seines schlimmsten Todfeindes, der ihm nicht nur die Ranch, sondern auch das geliebte Mädchen weggenommen hatte.
Er dachte an den letzten Blick, den es ihm noch zuwerfen konnte. Dachte an den Augenblick, als man es von ihm weggerissen und auf ein Pferd verfrachtet hatte, um es nach Mesilla zu bringen. Und er dachte an den verzweifelten Schrei.
Sein Herz krampfte sich bei diesen Erinnerungen schmerzhaft zusammen.
Was ihn selbst erwartete, berührte ihn nicht, obwohl er wusste, dass es die Hölle sein würde.
Jivaro hätte sofort sein Leben dafür gegeben, hätte er Sakawa damit zur Freiheit verhelfen können. Der Gedanke, dass sie Maddocks Geliebte werden sollte, war für ihn unerträglich.
Aber er konnte Sakawa nicht helfen. Ob er wollte oder nicht, er musste sich mit den Dingen abfinden.
Und so ging die Fahrt weiter, einem ungewissen Schicksal entgegen.
Tim Colly war mit der Stallarbeit fertig. Er wischte sich die Hände am aufgenähten Hosenboden ab und wollte sich zu seinem Lieblingsplatz neben der Haferkiste begeben, als jemand an das Fenster neben dem Hinterausgang klopfte.
Nach kurzem Zögern ging der alte Stallmann darauf zu. Forschend spähte er durch die schmutzige Scheibe und erkannte dahinter ein bärtiges Gesicht.
Der Mann, dem es gehörte, winkte kurz und machte dann eine Handbewegung zur Tür.
Colly hatte die Tür bei Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen. Jetzt öffnete er sie nochmals, um den späten Besucher einzulassen.
Es war Old Jed, der ehemalige Totengräber.
»He, wo kommst du denn her?«, empfing ihn der Stallmann. »Und wie siehst du nur aus?«
Jed Hawkins sah aus wie ein Tramp, der tagelang kein Dach mehr über dem Kopf gesehen hatte. Seine Kleidung war an mehreren Stellen aufgerissen, sein grauer Bart völlig zerzaust. Er hatte keinen Hut mehr und auch keine Waffen.
»Hallo, Tim!«, erwiderte Old Jed. »Ich hab gesehen, dass du allein bist. Würdest du so gut sein und auch die Vordertür schließen?«
»Ja, natürlich.« Colly lief zwischen den Boxen nach vorne, sperrte ab und kam wieder zurück. Gemeinsam begaben sich die beiden Oldtimer in den toten Winkel bei der Futterkiste, der von keinem der wenigen Fenster eingesehen werden konnte.
Ernst blickten sie sich an.
»Was ist passiert?«, forschte der Inhaber des Mietstalls nach. »Es ist doch nicht jemand hinter dir her?«
»Nein, Tim. Maddocks Leute halten mich wahrscheinlich für tot«, antwortete Hawkins. »Und ich möchte, dass das so bleibt.«
»Von mir erfährt niemand eine Silbe, dass du hier aufgetaucht bist«, versicherte Colly. »Eher lasse ich mir die Zunge rausschneiden. Aber jetzt erzähl endlich, was denn ...«
»Später«, unterbrach ihn Hawkins. »Gib mir erst was zu essen, sonst kippe ich noch um vor Hunger! Ich hab' seit einer halben Ewigkeit nichts mehr in den Magen bekommen, außer einigen Wasserflöhen. Du hast doch was zu beißen hier?«
Tim Colly konnte mit einem Stück Rauchfleisch und einem Kanten Hartbrot aufwarten.
»Wenn das nicht reicht, hole ich dir noch was aus dem Speiselokal. Aber zu viel auf einmal solltest du jetzt auch nicht vertilgen, das hält dein Magen nicht aus.«
»Danke, das wird genügen.« Gierig schlang Old Jed Brot und Speck in sich hinein.
Als er seinen ärgsten Hunger gestillt hatte, berichtete er, was ihm widerfahren war. Maddocks Leute hatten ihn vor einigen Tagen auf dem Weg zur Ranch, die er zusammen mit seinem Freund Jivaro wieder bewirtschaften wollte, überfallen und zu einer Hütte in einer versteckt liegenden Bucht am Rio Grande verschleppt, wo er unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten wurde.
»Die Schufte wollten mich zwingen, einen Kaufvertrag zu unterschreiben. Maddock, dieser verdammte Hundesohn, ist unheimlich scharf auf die Ranch, und ich weiß inzwischen auch, warum. Er braucht sie, um dort Gefangene zu verstecken. Gefangene, die man offenbar mit einem Dampfboot den Fluss heraufbringt, in der besagten Bucht herauslässt und dann durch einen Arroyo zu unserer Ranch treibt, von wo sie mit Frachtwagen weiterbefördert werden. Wohin, weiß der Teufel. Ich vermute aber, dass es sich um Schwarze handelt, die in einer Silbermine Sklavenarbeit leisten müssen.«
Old Jed machte eine kurze Pause.
Dann fuhr er fort: »Maddock braucht also die Ranch als Zwischenstation, weil man die Schwarzen in Mesilla nicht ausladen kann. Das wagen er und seine Komplizen nun doch nicht, so skrupellos sie auch sind. Immerhin ist die Sklaverei seit Kriegsende streng verboten, und es drohen jedem harte Strafen, der mit Sklaven handelt oder welche beschäftigt. Aus diesem Grund geht die Bande kein unnötiges Risiko ein. Wenn die Schufte wüssten, dass ich noch lebe und hier bei dir bin, würden sie sofort alles unternehmen, um mich unschädlich zu machen. Denn sie würden dann auch wissen, welche Gefahr ich für sie bin. Ich konnte mich, wie gesagt, befreien, hab' einen der Halunken erledigt und mit einem Boot zu entkommen versucht. Aber die Gegner schossen das Boot in Fetzen, und ich wäre beinahe im Fluss ertrunken. Mit knapper Not hab' ich mich irgendwo an Land retten können und mich später auf den Weg zur Ranch gemacht, in der Hoffnung, dass Jivaro und Sakawa dort sind. Aber ein paar von Maddocks Leuten haben die Ranch in der Hand, und ich konnte beobachten, wie sie Sakawa mit einem Pferd fortbrachten.«
»Großer Gott!«, entfuhr es Tim Colly bestürzt. »Dann ist sie also in Maddocks Gewalt?«
»Ja, und Jivaro auch. Er wird wohl in Maddocks Mine landen, um dort Zwangsarbeit zu leisten. Aber noch schlimmer ist, was das Mädchen erwartet.«
»Das arme Ding! O Gott, es ist alles meine Schuld! Ich hab' nicht gut genug auf das Girl aufgepasst!«
Der alte Stallmann berichtete, dass Jivaro mit Sakawa vor zwei Nächten zu ihm kam und ihm das Mädchen anvertraute, weil er es bei ihm sicher wähnte. Jivaro wollte am nächsten Abend heimlich wiederkommen. Doch Sakawa wartete vergeblich auf ihn. Schließlich war sie in einem unbeobachteten Augenblick verschwunden.
»Sie muss nach Jivaro gesucht haben, Jed. Dabei ist sie Maddocks Leuten in die Hände gefallen. Oh, ich könnte mich umbringen, dass ich sie auch nur eine Sekunde lang allein gelassen habe!«
»Mach dir keine Vorwürfe, Tim«, entgegnete Hawkins. »Das nützt uns jetzt nichts. Sag mir lieber, wo sich diese verfluchte Mine befindet.«
»Sie soll in der Gegend von Silver City liegen. Mehr weiß ich auch nicht. Bist du dir sicher, dass man Jivaro dorthin gebracht hat?«
»Fast sicher, Tim. Da der Morgen nicht mehr fern war, und ich nicht mal eine Waffe hatte, konnte ich nichts gegen die Kerle auf der Ranch unternehmen, so gern ich Sakawa und Jivaro auch geholfen hätte. Aber nur mit Wut im Bauch kann man bekanntlich nichts ausrichten. Ich zog mich also zum Rio Grande zurück und hielt mich dort bis Einbruch der Abenddämmerung im Uferdickicht verborgen. Und von dort aus – es war am frühen Vormittag – sah ich von der Stadt her vier Frachtwagen kommen und in Richtung der Ranch fahren. Mit diesen Wagen hat man wohl Jivaro und noch andere Gefangene geholt, um sie zu Maddocks Mine zu bringen. Allmächtiger, was soll ich jetzt nur tun?«
»Ich fürchte, allein wirst du gegen die Bande nichts ausrichten können«, erwiderte Tim Colly. »Auch nicht, wenn du dich bis an die Zähne bewaffnest. Du brauchst unbedingt Unterstützung, Jed.«
»Und wo finde ich welche? Bei Sheriff Bradway etwa? Der steckt doch mit der Bande unter einer Decke.«
»Du hast recht. In Mesilla wirst du kaum Verbündete gewinnen. Die Leute haben Angst vor Maddock und seiner Revolvergarde oder man kann ihnen nicht trauen, weil Maddock sie gekauft hat. Bleibt höchstens Tom Webbster, der Storebesitzer, dem Maddock das Geschäft ruiniert, seit dieser im eigenen Laden alle Waren viel billiger anbietet, als Webbster das kann. Ja, er wird von Maddock mit Schleuderpreisen ruiniert und steht außerdem noch als Halsabschneider da. Auf ihn könntest du vielleicht zählen. Wahrscheinlich auch auf den Doc. Tja, und dann bin noch ich da, Jed. Aber ich bin ein alter Mann, der nur den einen Vorzug hat, dass er außer seinem Leben nicht mehr viel verlieren kann. Aber was können wir paar Männer schon ausrichten?«
»Nichts«, gab Old Jed zu. »Und ich möchte auch nicht, dass jemand unnütz sein Leben riskiert. Ich muss einen anderen Weg finden, um Jivaro und Sakawa zu helfen.«
Hawkins grübelte nach, was er in seiner Lage überhaupt tun konnte.
Sollte er in eine andere Stadt reiten und den dortigen Sheriff um Hilfe ersuchen? Vielleicht nach Las Cruces oder nach Rincon?
Oder war das sinnlos, weil man ihm gar nicht glauben und daher auch nichts unternehmen würde?
Old Jed hatte nicht viel Hoffnung, in einer fremden Stadt Unterstützung zu finden, und er war es außerdem gewöhnt, seine Angelegenheiten selbst zu regeln.
Auch jetzt wollte er das so halten. Und er beschloss, nicht zuerst nach Jivaro zu suchen, sondern nach Sakawa, um die er sich große Sorgen machte.
»Borgst du mir deinen Colt?«, fragte er Tim Colly.
»Selbstverständlich, Jed«, erklärte sich der alte Stallmann sofort bereit. »Morgen kann ich dir auch ein Gewehr beschaffen, und du bekommst, wenn du willst, jederzeit auch ein Pferd von mir. Aber du wirst doch nichts Unüberlegtes tun, oder?«
»Nur keine Angst. Im Moment habe ich nichts weiter im Sinn, als mir ein wenig Maddocks Haus anzusehen.«
Eine Strohschütte, auf der eine Decke lag – das war alles, was Sakawa in dem Kellerverlies zur Verfügung stand. Hier musste sie schlafen, hier saß sie auch meistens, wenn sie wach war.
Die Dunkelheit, die um sie herrschte, war vollkommen. Es gab in dem feuchten Gemäuer keine Fensteröffnung, und es drang auch durch die Spalten der mit Schimmel beschlagenen Tür kein Lichtschimmer. Wie es schien, war sie völlig von der Außenwelt abgeschlossen.
Inzwischen hatte Sakawa ihr Gefängnis gründlich erforscht. Und sie war auf einer Seite auf einen Bretterverschlag gestoßen, der vom Boden bis unter das Gewölbe zu reichen schien und ein zwei Yards breites Stück der Wand einnahm.
Einige der Bretter waren durch die Feuchtigkeit unten angemorscht. Mithilfe ihrer Fingernägel – etwas anderes stand ihr nicht zur Verfügung – hatte sie den Moder in stundenlanger Arbeit so weit weggekratzt, dass das Holz ganz dünn geworden war.
Als sie jetzt mit dem Fuß dagegen trat, gab der Rest mit einem lauten Knacken nach, und sie konnte in der Folge ein Loch ertasten, durch das sie suchend ihren Arm streckte.
Die junge Indianerin stieß auf keinen Widerstand. Das bedeutete, dass sich hinter dem Bretterverschlag ein Hohlraum befand.
Wie groß er war und ob er einen Ausgang hatte, wusste sie nicht. Doch sie war voller Hoffnung, dass es ein Fluchtweg war, ein Weg in die Freiheit.
Allerdings war das entstandene Loch viel zu klein, um hindurchkriechen zu können. Sakawa musste es noch um einiges erweitern und versuchte daher, eines der Bretter weiter oben wegzubrechen.
Doch dazu reichten ihre Kräfte nicht aus. Das Brett bog sich zwar ein wenig, hielt der Belastung aber stand. Um es losreißen oder abbrechen zu können, hätte es schon der Kraft eines Mannes bedurft.
Nach kurzem Überlegen begann Sakawa, die Erde unter der Öffnung wegzugraben. Das war der einzige Weg für sie, um auf die andere Seite des Kellers zu gelangen.
Wieder musste sie mit bloßen Händen arbeiten. Sie riss sich die Nägel blutig und scheuerte sich die Haut an den Fingerkuppen wund. Aber das war jetzt Nebensache.
Sie machte erst eine Pause, als sie verschnaufen musste. Ihr Atem ging heftig, und sie schwitzte trotz der Kühle, die hier unten herrschte. Die spärliche Luft war muffig wie in einem Grab.
Während sie neue Kräfte sammelte, fragte sie sich, was wohl aus Jivaro geworden war.
Würden seine Feinde ihn töten?
Würde sie ihn jemals wiedersehen?
Sakawa war in ernster Sorge um ihn und voller Schmerz über die gewaltsame Trennung. Kaum eine Minute verging, in der sie nicht an den Geliebten dachte.
Und sie wusste, dass sie alles in ihren Kräften stehende zu seiner Rettung unternehmen würde – wenn es ihr nur gelang, von hier zu fliehen.
Sie machte weiter, grub und scharrte. Steine stellten sich ihr in den Weg, die sie mühsam ausbuddeln musste. Die Erde verteilte sie ringsherum am Boden und trat sie mit den Füßen fest, damit es keine verräterischen Spuren gab. Sollte jemand nachsehen kommen, durfte nichts verdächtig erscheinen.
Wie gut sie mit dieser Vorsichtsmaßnahme tat, sollte sich schon bald herausstellen. Plötzlich näherten sich Schritte draußen vor der Tür. Jemand kam durch den Kellergang.
Eilig warf Sakawa die ausgegrabenen Steine in das Loch zurück und tarnte dieses sowie auch die Lücke zwischen den Brettern mit Stroh.
Kaum war sie fertig damit, wurde auch schon ein Schlüssel ins Schloss geschoben und ratschend herumgedreht.
Knarrend und quietschend schwang die Tür auf.
Gelber Lichtschein fiel in das düstere Kellergewölbe.
Es war T. T. Maddock, der mit einer Lampe in der Linken im Türrahmen stand und diesen fast völlig ausfüllte.
»Na, wie fühlst du dich hier unten?«, fragte er und blickte mit einer Mischung aus Spott und heißem Verlangen auf die schöne Indianerin, die vor der Holzwand auf ihrer Strohschütte kauerte. »Meinst du nicht doch, dass es klüger wäre, deinen Widerstand aufzugeben?«
Sakawa schwieg. In ihren dunklen, leicht schräg stehenden Augen war nur Verachtung zu erkennen. Wenn sie jetzt auch Furcht verspürte, zeigte sie es nicht.
Maddock war ein Koloss von einem Mann, der sich so plump wie ein Grizzlybär bewegte. Ein richtiger Fleischberg, der mindestens dreihundertfünfzig Pfund wog.
Erwartungsvoll musterte er die Gefangene.
»Du willst wohl nicht antworten, was? Anscheinend bist du lieber hier unten als oben in meinem schönen Haus, wo du von meinen Dienern verwöhnt werden würdest und alles haben könntest, was sich eine Frau wünscht«, sagte er grinsend. »Aber die Stunde wird kommen, wo du nachgeben wirst. Im Übrigen zähme ich gern kleine Raubkatzen, wie du eine bist. Und ich habe sie bis jetzt noch alle zum Schnurren gebracht. Auch du wirst mir noch aus der Hand fressen.«
»Niemals!«, stieß Sakawa mit funkelnden Augen hervor.
Maddock lachte.
»Das sagst du jetzt«, meinte er zuversichtlich. »Spätestens in ein paar Tagen wirst du anders denken. Vielleicht wirst du mich sogar noch bitten, dass ich dich hier raushole.«