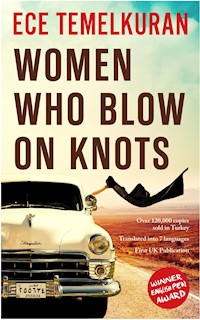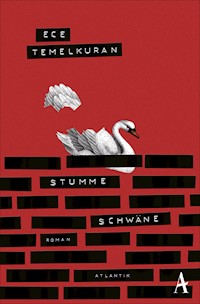15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Handlungsanleitung für ein würdevolles Leben auf unserem Planeten Die vielfach ausgezeichnete Autorin Ece Temelkuran blickt auf unsere Gegenwart: Ratlosigkeit und Verzweiflung, Würdelosigkeit, wohin man schaut. Schluss damit, fordert sie und fragt: Was tun? Wille und Würde ist ihre Antwort, eine Handlungsanleitung in zehn Schritten, voller Optimismus und Hoffnung. Unsere Welt befindet sich in einer Schräglage. Die Gesellschaften leiden unter frappierenden Ungerechtigkeiten. Waldbrände und Überschwemmungen liefern den letzten Beweis für die verheerende Klimakatastrophe. Die Pandemie zeigt, wie prekär die Volkswirtschaften sind, und der chaotische Truppenabzug aus Afghanistan deckt schonungslos auf, wie verantwortungslos mit Menschen umgegangen wird. Die Machthaber ringen nach Antworten, oft sind sie selbst das Problem. Wohin mit unserer Verzweiflung? Ece Temelkuran legt mit Wille und Würde ein klares neues Narrativ vor, nicht für eine idealisierte Zukunft, sondern für die Gegenwart, eine Aufforderung in zehn Schritten. Es gilt jetzt, unsere Würde wiederzufinden. Dafür müssen wir entschlossen handeln, Kraft schöpfen aus der Angst und Vertrauen gewinnen. Für eine Welt, in der Menschlichkeit an erster Stelle steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ece Temelkuran
Wille und Würde
Zehn Wege in eine bessere Zukunft
Hoffmann und Campe
Für den kleinen Valentino
Ich wage das Versprechen.
Ein Talisman für uns, für jetzt
Wegweinen lässt sie sich nicht, also lachen wir: Zwei wild entschlossene kopflose Hühner gackern sich in die Apokalypse. Die Welt geht unter, aber wir trennen seit zehn Minuten akribisch die Luftpolsterfolie unserer Umschläge vom Papier.
Ein weiterer früher Morgen im Frühjahr 2020, nur wenige Wochen nach Beginn des Lockdowns und eine Woche nach dem schweren Erdbeben, das Zagreb erschüttert hat. Jetzt hängt über der ganzen Stadt eine Staubwolke. Wir, zwei gleichaltrige Frauen, stehen mit unseren halb aufgerissenen Luftpolstertaschen vor den Recycling-Containern in der Martićeva-Straße und schütteln uns vor Lachen, obwohl wir uns gar nicht kennen.
Für den Bruchteil einer Sekunde treffen sich unsere Blicke, und wir sehen einander, aber auch uns selbst: Mit Zottelhaaren und schief sitzender Corona-Maske sortieren wir unseren Müll in die entsprechenden Tonnen, um wenigstens ein bisschen Kontrolle über diese schrottreifen Zeiten zu gewinnen, wenn sich mit unseren latexüberzogenen Händen schon nichts anderes in Ordnung bringen lässt. Pyramiden, Revolutionen, Symphonien, die Raumfahrt, die Quantenphysik, die Mona Lisa – und wir stehen Anfang des 21. Jahrhunderts wie der Müll der Menschheitsgeschichte da.
Unser hysterisches Gelächter soll die allzu menschliche Frage ersticken, die sich in dieser Zeit aufdrängt: Sind wir jetzt nur noch so? Können wir wirklich nicht mehr machen?
»Was machen wir jetzt?«
Diese Frage wurde mir nach so gut wie allen Vorträgen gestellt, die ich 2019 an zahlreichen Veranstaltungsorten in zahlreichen Ländern hielt. Nachdem Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist erschienen war, sprach ich fast das ganze Jahr hindurch über die Logik der politischen Maschinerie, der wir all das Chaos, all die Angst und Verzweiflung zu verdanken hatten, unter der wir so sehr litten. Kein Land sei gegen die lähmende politische und moralische Pest unserer Zeit immun, lautete meine Behauptung. Doch bis ich das entspannte westliche Publikum davon überzeugen konnte, dass diese neue Form von Faschismus einen globalen Krieg gegen die Grundlagen menschlicher Vernunft führt, begannen sich meine Vorhersagen auch schon zu bewahrheiten. Nachdem ich meinen Vortrag beendet hatte, herrschte jedes Mal tiefes Schweigen im Saal, bevor jemand die erste Publikumsfrage stellte. Irgendwann wurde mir klar, dass viele Anwesende in der bleiernen Stille mit einer wichtigen Entscheidung rangen: »Soll ich fragen, wie wir diesem übergriffigen Wahnsinn entkommen können, oder einfach rausgehen und das Ganze bei einem Drink vergessen?« Die Alternativen, die uns die Welt von heute bisher geboten hatte, erschienen vielen von uns schließlich kaum sinnvoller als das Entfernen der Luftpolsterfolie aus Papierumschlägen – oder aber als beängstigend radikal, Stichwort Revolution. Der riesige Raum dazwischen, in dem das wahre Leben stattfindet, wurde selten thematisiert. In diesem wahren Leben kam gerade eine historische Phase zum Abschluss; es fühlte sich aber eher so an, als wäre die ganze Menschheit am Ende.
Jeder Status quo besitzt die magische Fähigkeit, den Massen weiszumachen, ein untergehendes System würde auch alles andere mit sich reißen.
So verhalten sich alle Systeme, nämlich wie ängstliche Seeleute in der Antike: Sobald du in unbekannte Gewässer segelst, warnen sie, wirst du über den Rand der Welt hinweggespült. Genau das, erzählt man uns, passiert gerade. Unser politisches und wirtschaftliches System sei an seine Grenzen gelangt, taumle und drohe uns alle mit sich in den Abgrund zu ziehen. Jede Entscheidung, die wir treffen, erscheint so wirkungslos wie der Eimer, mit dem man das volllaufende Boot leer zu schöpfen versucht. Das schiere Ausmaß des Chaos verleitet uns zu dem Glauben, nichts würde genügen, ganz egal was wir machten. Und irgendwann ist vergessen, dass wir Menschen sehr wohl in der Lage sind, uns mit Hilfe auch kleinster Dinge neu zu erfinden.
Ob sie die Sachen nicht richtig in die Hand nimmt, weil Kinder mit kleinen Gegenständen instinktiv behutsam umgehen, oder ob es einem erlernten Ekel geschuldet ist, kann ich aus meinem Blickwinkel nicht erkennen. Jedenfalls sammelt die fünfjährige Zeyno im Sommer 2019 an einem menschenleeren Strand der griechischen Insel Kalymnos etwas. Sie hebt die Sachen mit spitzen Fingern auf und läuft damit zum Sonnenschirm zurück. Ist der Gegenstand sicher deponiert, zieht sie von Neuem los, um langsamen Schrittes den Boden abzusuchen.
Weil sie unermüdlich so weitermacht, folgen ihr irgendwann zwei Frauen mittleren Alters aus entgegengesetzten Richtungen. Der lässige Schlendergang, in dem sie sich nähern, soll ihre Neugier kaschieren und den Anschein erwecken, Zeynos Sonnenschirm läge ganz zufällig auf ihrem Weg. Schließlich bleiben sie davor stehen und betrachten den mysteriösen Haufen. »Plastikteile«, sagt die eine. »Ach, sie sammelt Müll«, meint die andere. Dabei lächeln sie sich so vielsagend zu, wie es Erwachsene tun, wenn ihnen Begeisterung begegnet. Wie eine Eichhörnchenmutter, die Gefahr wittert, eilt Zeyno zurück, um das Nest zu verteidigen. Noch ganz außer Atem hält sie einen sehr engagierten Vortrag darüber, wie schädlich Plastik für »unsere Erde« sei und dass man aus Plastik »Kunst« machen könne, ja wirklich. Nachdem die beiden Frauen dem Kind anerkennend den Kopf getätschelt haben, machen sie sich wieder auf den Weg zu ihren eigenen Sonnenschirmen. Doch dann bleiben sie fast gleichzeitig stehen, bücken sich nach einem Stück Müll im Sand, kommen zurück und fügen es der Sammlung des kleinen Mädchens hinzu. Anstatt sich weiter in der Sonne zu aalen, suchen auch sie jetzt den Strand ab. Von der unverhofften poetischen Mittagsstimmung beflügelt, erinnern sie sich: Selbst in kaputten Zeiten wie diesen gibt es da unsere angeborene Neigung, Schönes zu schaffen. Jedes Mal, wenn ein System in der Mülltonne der Geschichte landete, hat sie dafür gesorgt, dass es mit uns Menschen weiterging. Und allen Schwarzmalern zum Trotz, die noch bei jedem Zusammenbruch das Ende gekommen sahen, war dieser Wesenskern unserer Spezies der Grund, warum wir immer von Neuem an die Menschheit geglaubt haben.
Als ich in Zeynos Alter war, verstand ich die stumme Sprache der Dinge noch. Bei uns zu Hause gab es eine Schublade, die als letzter Aufenthaltsort für kleine, nicht mehr benutzte Gegenstände diente. Die Entscheidung über ihr Schicksal wurde ständig vertagt: Kugelschreiber mit irgendwelchen Macken, die eines Tages aber vielleicht doch funktionieren würden, Bänder, die auf ihren Einsatz als Verschönerung von Notgeschenken warteten, rostige Schlüssel für längst nicht mehr existierende Türen, halb vertrocknete Lippenstifte, ein zerbrochener, von schwarzgrauen Sprüngen durchzogener Handspiegel, Plastikkämme mit abblätternder Beschichtung und der ganze andere Krimskrams unseres Lebens, dessen Anspruch auf einen eigenen Platz im Haus erloschen war. Das alles lag in dieser Schublade und wartete auf den nächsten Wegwerfanfall meiner Mutter. Die Klage dieser Dinge, der verstörende Schrei der Verstoßenen, den nur ich hören konnte, war unerträglich.
Eines Tages kam ich auf die Idee, all die armen Sachen in einer Art Rettungsaktion zusammenzukleben. Nach und nach wuchsen sie sich zu bizarren Talismanen aus, die ich in meinem Zimmer aufhängte. Nun, da sie als Teile eines Ganzen in die Welt zurückgeholt worden waren, vermochten sie wieder zu sprechen.
So verhält es sich auch mit Wille und Würde. Das Buch ist ein Talisman aus all den Kleinigkeiten über unsere Spezies, die wir in den Schubladen der Menschheit vergessen haben, ohne es selbst zu bemerken. Nur indem wir sie aneinanderfügen, können wir uns in Erinnerung rufen, wie und warum es den Menschen gelungen ist, bis heute zu überleben, und weshalb wir immer wieder beschlossen haben, Vertrauen in uns zu setzen.
Sie werden bei der Lektüre auf scheinbar Belangloses stoßen, auf zerbrochene Bilder, halb vertrocknete Träume, nie gebaute Städte und den ganzen Krempel der Welt. Dies ist eine neue Geschichte des Menschen, zusammengesetzt aus den Bruchstücken der kaputten Bilder unserer Spezies.
Es geht in diesem Talisman-Buch um zehn Entscheidungen, die Menschen wie wir, denen es wichtig ist, solche Bücher zu lesen und zu schreiben, im wahren Leben treffen sollten. Und zwar nicht erst in einer unbekannten Zukunft, sondern hier und jetzt, weil wir sie hier und jetzt brauchen. Wille und Würde soll dazu beitragen, dass wir uns einmal mehr für uns entscheiden.
Solche Entscheidungen mögen einigen angesichts der brutalen Gegenwart als zu schwach erscheinen, aber alles Wertvolle ist zerbrechlich – das Schöne, das Menschliche, das Wahre. Und erst wenn alles Zerbrechliche zu einer kompakten Geschichte des Menschen zusammengefügt wäre, könnte ich sagen: »Ich glaube an euch«, ohne dass es komisch klänge.
Doch um eine neue, bessere Geschichte für uns entwerfen zu können, brauche ich Sie. Sie müssen eine Entscheidung treffen, und zwar jetzt.
Jetzt ist ein niederschmetterndes Wort.
Jetzt ist das Bild eines kleinen Mädchens, das mitten in der Bewegung erstarrt, wenn es über das Seil springen soll. Während die anderen »Jetzt! Spring jetzt!« rufen, wird das Hüpfseil für das Mädchen zu einer Schlangenzunge, die immer wieder den Boden leckt und dem Kind jedes Mal verkündet, dass es zu spät dran ist.
Menschen wie Ihnen und mir ergeht es heute wie diesem Mädchen – wir sind mitten in der Bewegung erstarrt. Die einen flehen Hoffnung und Ermutigung herbei, um den Sprung doch noch zu wagen, andere haben bereits aufgegeben und den Spielplatz verlassen. Immer weniger fragen nach dem Ausweg aus dem globalen Wahnsinn, und vielen geht es insgeheim nur noch um die eigene Sicherheit. Jetzt fühlt sich so an, als wäre es schon zu spät – vielleicht sogar schon zu spät für die Frage, was wir jetzt machen sollen.
Und doch ist jetzt der Zeitpunkt, sich für Überzeugungen zu entscheiden: für die Überzeugung, dass wir mehr sind als kopflose Hühner, dass wir für das Schöne bestimmt sind und nicht auf bessere Zeiten warten müssen, um Hoffnung zu schöpfen. Der richtige Augenblick ist … jetzt!
Wenn Sie sich für diese Überzeugungen entscheiden, schaffen wir gemeinsam den Sprung über das verdammte Seil unserer Zeit. Versprochen.
1Glaube statt Hoffnung
Im Verlauf des Jahres 2019 wurde meine Verärgerung über die allgegenwärtige Frage »Wo ist noch Hoffnung?« so selbstdestruktiv, dass ich am Ende nicht mehr anders als sarkastisch darauf reagieren konnte. Ich malte mir aus, wie ich dem Nächsten, der mir diese Frage zu stellen wagte, eine Speisekarte des Restaurants Hoffnung überreichte. Ich stellte mir ein uriges Bierlokal vor, das als Hauptgericht den Eintopf »Zur Räson kommen« anbot, bestehend aus einem Teller Demokratie an einer sämigen Sauce aus vernünftigen, erwachsenen Politikern, so stark eingekocht, dass sich alle globalen Krisen daraus verflüchtigt hatten. Doch wo Sarkasmus ist, ist natürlich auch immer ein nie richtig verheilter Kummer.
Inzwischen weiß es jeder: Mein Heimatland, die Türkei, ist ein schwieriger Ort zum Leben. In den vergangenen Jahren haben dort nur wenige genug getan, um den verfluchten Lauf der Dinge zu verändern. Die restliche Türkei hat derweil um Hoffnung gefleht. Ich habe dieses Wort schon zu oft von Leuten gehört, die nicht annähernd genug machten – so oft, dass es mir irgendwann wie eine emotionale Krücke für diejenigen vorkam, die schlicht nicht den Mut hatten, Rückgrat zu zeigen.
Auch die westliche Welt, die seit dem 18. Jahrhundert den Anspruch erhoben hat, ein sicherer Hafen für das Individuum, den Freigeist, zu sein, wird mittlerweile ein schwieriges Pflaster. Europäer wie Amerikaner empfinden sich immer weniger als Individuen, die durch Gesetze und moralische Werte geschützt sind, und immer mehr als Versuchskaninchen in einem gigantischen Experiment, bei dem gemessen wird, inwieweit wir endlose politische und moralische Herausforderungen erdulden können. Obendrein erlebt der Westen, wie lähmend es ist, Tragödien mitanzusehen, wenn diese von clownesken, manchmal gar Darth-Vader-artigen politischen Gestalten mit Absurditäten vermischt und mit skrupellosen Lügen serviert werden. Inzwischen wissen wir alle, wie sehr das Bombardement von Schamlosigkeit aus den oberen Etagen der Politik uns abstumpft und die Rücksichtslosigkeit im Alltag verstärkt. Die Unmoral hüllt sich in eine kulturelle und politische Identität und heftet sich das Etikett »Wir, das Volk, entscheiden selbst« an. Wie man 2020 in der Pandemie gesehen hat, kann dieser Wahnsinn Hunderttausende von Menschenleben kosten.
Das einzig Gute an diesem weltumspannenden politischen und moralischen Irrgarten ist, dass wir inzwischen alle darin stecken. Kein Land bleibt verschont. Deshalb sollten wir tunlichst zusammenhalten und den Ausgang gemeinsam suchen. Umso mehr schmerzt es mich jedes Mal, wenn Menschen in anderen Ländern, die den Irrgarten erst seit Kurzem von innen kennen, genau die gleichen Fehler begehen, während sie nach der Hoffnung fragen.
Meine Verärgerung ist aber bei weitem nicht das größte Problem. Seit uns diese turbulenten Zeiten die hässlichsten und durchtriebensten Repräsentanten der Menschheit bescheren, taucht früher oder später der gefährliche Gedanke auf, ob der Mensch nicht vielleicht von Natur aus böse sei. Je weiter diese virulente Frage um sich greift, umso stärker beschädigt sie unseren wichtigsten Beweggrund zu leben und zu handeln. Man kann es mit der Szene in Luc Bessons Film Das fünfte Element vergleichen, in der Leeloo, die die Welt retten soll, von der Grausamkeit der Menschen erfährt und zu dem Schluss kommt, dass sie keine Rettung verdienen. In unserem Fall dürfte ein leidenschaftlicher Kuss von Bruce Willis nicht ausreichen, um uns vom Gegenteil zu überzeugen, denn es wächst eine neue Generation heran, die bezweifelt, dass die Menschen das gleiche Existenzrecht besitzen wie andere Spezies. Und es wird nicht einfacher, sie eines Besseren zu belehren, wenn die unmoralischen Repräsentanten der Menschheit und ihre fanatische Anhängerschaft ständig ausloten, was wir moralisch noch verkraften.
Bei einem Vortrag während des Edinburgh Festival stürzte ich mich mit aller Kraft in diese Überzeugungsarbeit. Nachdem ich dem Publikum gesagt hatte, dass es mit Hoffnung allein nicht getan sein werde und uns nur unsere innere Entschlossenheit, Schönes zu schaffen, retten könne, glaubte ich meine Pflicht erfüllt zu haben. Nach der Veranstaltung kam jedoch eine Frau mit wunderschönen grauen Haaren auf mich zu. Um den Hals trug sie ein Kettchen mit Kreuz.
»Seien Sie nicht so ungnädig mit den Leuten, wenn sie um Hoffnung bitten«, sagte sie, ohne mit dem Austausch der zwischen Autoren und Leserschaft üblichen Nettigkeiten Zeit zu verschwenden. Sie kam sofort zur Sache. Und ich dann auch.
»Mich oder vielmehr die ganze Welt zerreißt es gerade«, sagte ich, »und wir können weitaus mehr tun, als nur um Hoffnung zu bitten. Was, wenn es keine Hoffnung gibt? Legen wir uns dann hin und fügen uns in unser Schicksal? Oder – und diese Frage ist noch gefährlicher: Was, wenn es Hoffnung gibt? Wären die Leute überhaupt bereit, alles Nötige zu tun?«
Die Frau ergriff sanft meine fuchtelnde Hand und drückte sie mitfühlend, aber fest, so als würde sie einen Vogel einfangen, der sich in ein Zimmer verirrt hat. Sie gehörte zu den rar gesäten Frauen, die sich jede Falte im Gesicht verdient haben. »Die Leute meinen doch etwas ganz anderes, wenn sie von Hoffnung sprechen«, sagte sie. Dann legte sie meine Hand auf den Tisch, als wollte sie mir ein Geheimnis anvertrauen. »Denken Sie über den Glauben nach.« Als sie sah, dass ich mit einem überheblichen Schmunzeln auf ihr Kreuz blickte, fügte sie nachsichtig lächelnd hinzu: »Nicht den religiösen.«
Und ich dachte darüber nach.
»Wir stellen uns jetzt in die Mitte des Terminals und drehen uns mit geschlossenen Augen im Kreis. Wenn wir stehen bleiben, machen wir die Augen auf, und die erste Stadt, die wir auf den Werbetafeln vor uns sehen, in die fahren wir.«
Die Idee zu dieser Mutprobe kam mir im Frühling 1991. Ein paar Freundinnen und ich, alle vom Jurastudium gelangweilt, hatten sich zum zentralen Busbahnhof in Ankara aufgemacht. Die Herausforderung bestand darin, von dem zufälligen Ziel wieder nach Hause zu kommen. Unser Geld reichte nur für die Hinfahrt; der Rest hing von unserer auf grenzenlosem Selbstbewusstsein basierenden Überlebensstrategie ab. Als die schicksalsschweren Pirouetten vollführt waren, stand der Bestimmungsort fest: Trabzon am Schwarzen Meer, nicht weit von der Grenze zur Sowjetunion entfernt, eines Staats, der kurz zuvor zusammengebrochen war. Und tatsächlich – keine zwölf Stunden nachdem wir uns in Ankara auf der Stelle gedreht hatten, flanierten wir über einen eilig aufgebauten neuen Flohmarkt, von den Einheimischen »russischer Basar« genannt. Auf ihm verwandelte ein gefallenes Regime die Alltagshabe eines Volks in Souvenirs des gescheiterten Sozialismus.
Seit dem Zusammenbruch der UdSSR galten die Orden, für die Menschen gestorben waren und getötet hatten, als coole Accessoires an Studentenjacken – und Gott weiß, was aus den vielen Gasmasken geworden ist. Zwischen klobigen Thermometern, dicken Pelzen und Uniformgürteln lagen einzelne Ohrringe aus Keramik, bemalte Kannen, in denen noch Teeblätter klebten, und Untertassen ohne Tassen. Die abrupte geschichtliche Wende hatte den Leuten nicht einmal Zeit zum Geschirrspülen gelassen. Die ungewöhnliche Stille auf dem Basar hing nicht nur damit zusammen, dass die freie Marktwirtschaft für die Händler noch ganz neu war, sondern auch damit, dass diese nun vor der Aufgabe standen, schlicht ihr Leben zu verhökern.
Plötzlich spürte ich einen Atemhauch im Nacken.
»Hey, Natascha, Sex?«
Die Flüsterstimme des jungen Mannes klang so schmierig, dass ich mir am liebsten das Ohr sauber gewischt hätte. Als ich seinen lüsternen Blick sah, wich ich zurück und sagte hastig: »Ich bin keine Russin.« Die Entschuldigung erfolgte umgehend: »Oh, tut mir leid, Schwester.« Natascha – so wurden käufliche russische Frauen üblicherweise genannt. Ich aber hatte das Glück, Tochter einer offiziell nach wie vor lebensfähigen Ideologie zu sein: des Kapitalismus. Somit war ich nicht auf dem Markt. Ich war in Sicherheit.
Die Frauen auf dem Basar ließen sich plötzlich nicht mehr von der ausgelegten Ware unterscheiden; ihre Preisschilder waren sichtbar geworden. Die anfangs melancholische Stille bekam etwas Abstoßendes. Während westliche Thinktanks unter dem Motto »Der Sozialismus ist tot« Freudenfeste feierten und sich der eine oder andere geschäftstüchtige russische Bandit in einen Jung-Oligarchen verwandelte, gab es in den Ländern rings um die frühere UdSSR auf Märkten wie dem in Trabzon auch die Männer, die nur ein einziges Döschen Kaviar und eine Flasche russischen Wodka feilboten. Mit leerem Blick rauchten sie ihre billigen Zigaretten, und ihre Marxistenbärtchen waren über Nacht zum Kostümzubehör eines Historienschinkens geworden. Wer diese Tage miterlebt hat, wird sich immer daran erinnern, dass das Einzige noch Schlimmere als der Tod eines Handlungsreisenden seine erzwungene Frühgeburt war.
»Der Kapitalismus braucht einen Neustart«, verkündete die Financial Times auf ihrer Titelseite.
Das klang eher wie eine flehentliche Bitte an die nachlässigen Götter des Geldes. Obwohl die klugen Männer der freien Marktwirtschaft bei ihren vertraulichen Gipfeltreffen schon seit Jahren davon gesprochen hatten, dass der Kapitalismus in einer Sackgasse stecke, schlug diese öffentliche Ansage wie eine Bombe ein. Als hätte die Zeitung allein durch die Wahl des Wortes »Kapitalismus« zugegeben, dass es sich dabei nur um ein endliches wirtschaftliches und politisches Modell handelte, nicht um den naturgegebenen Zustand der Welt. Es klang geradezu wie ein Geständnis des Kapitalismus selbst: Es gibt ein Leben jenseits dieses Modells, oder doch zumindest jenseits dieser brutalen Version des Modells.
Obwohl mehr und mehr Menschen klar wird, dass wir den Kollaps eines Wirtschaftsmodells erleben, mag die Frage noch immer surreal klingen: Wie sähe wohl ein Flohmarkt des zusammengebrochenen Kapitalismus aus? Ich gehe jede Wette ein, dass dort neben den Milliarden vollkommen unnötiger Sachen stapelweise Ratgeberliteratur zum Thema individueller Erfolg und genauso hohe Berge von Büchern zu finden wären, in denen steht, dass Scheitern okay ist. Die zwei größten Stapel aber bestünden aus Werken, die versuchten, Hoffnung neu zu erfinden, und aus Dystopien ohne jede Hoffnung. Und ich sehe uns hilflos lächelnd vor diesen beiden Andenkenhaufen stehen, die sich gegenseitig praktisch aufheben. Wir, das Volk, würden dabei aussehen wie – nun ja, nicht viel anders als heute: verloren und ratlos, Opfer eines gescheiterten Projekts. Gut möglich, dass wir dann nur dank unserer Instagram-Filter noch immer besser aussehen als jene ehemaligen Sowjetbürgerinnen und -bürger auf den russischen Basaren. Früher oder später müssten wir jedenfalls erkennen, dass es erstens der Verlust jeder Orientierung ist, der die Menschen innerlich zerreißt, und zweitens der Glaube an unsere Fähigkeit, neue Orientierung zu finden. Genau deshalb stellen wir uns heutzutage die Frage »Ist der Mensch böse und daher überflüssig?«. Genau deshalb verlieren wir den Glauben an die Menschheit.
»Glaube« ist das einzige Wort, das sämtliche scheinbar zerrütteten Prinzipien umfasst: Selbstachtung, Zuversicht, Vertrauen. Allerdings zwingt uns das Wort »Glaube« zu einer Gratwanderung zwischen der Dichtung und dem Nebelreich der Theologie. Beide Felder erfordern ein Vokabular, das mein kleines Buch nicht bieten kann. »Glaube« klingt deshalb religiös, weil Gott beziehungsweise Götter jahrtausendelang zum Leitstern der menschlichen Glaubensfähigkeit gemacht wurden. Es war einfacher, dem Mystizismus das Monopol über das Prinzip Glaube zu überlassen, weil unsere Fähigkeit zu glauben für die weltliche Sphäre zu beängstigend ist. Schon das Wort selbst birgt ein gefährliches, beinahe explosives Potenzial in sich. Deshalb war es schon immer sicherer, diese grenzenlose innere menschliche Kraft mit dem Göttlichen zu ummänteln und ihre Quelle irgendwo jenseits unserer sterblichen Ichs anzusiedeln.
Die Linke hat meist Distanz zum Glauben gewahrt und ihn sogar belächelt (so wie ich in Edinburgh das Kreuz der Frau), weil das Wort »Glaube« ungeachtet aller philosophischen Begründungen leicht außer Kontrolle gerät. Es stiftet eine gefährliche Beziehung zwischen den Sterblichen, verwandelt sie in blinde Anhänger und – nicht selten – in grausame Bestien. Nur indem wir die Idee »Gott« als unsere eigene Erfindung anerkennen – als etwas, das man nicht besudeln kann, wodurch es in unserer herzlosen Welt zum sichersten Mittler zwischen uns und den anderen wird –, könnte es gelingen, den Glauben in unsere weltliche Realität einzubinden.
Ich belasse also Gott im Reich der Dichtung und der Theologie und versuche es lieber mit so etwas wie dem störenden Knuff, den wir jemandem versetzen, der im ach so schön warmen Schnee des Zynismus und der Depression einzuschlafen droht. Hier ist eine weitere Mutprobe, mit der diese Ausführungen über den Glauben im Menschen getestet werden sollen – diesmal an einem heiligen Ort: in der Basilika Palatina di Santa Barbara in der altehrwürdigen italienischen Stadt Mantua.
Jedem Menschen aus der Welt des sunnitischen Islam erscheint es nahezu unvorstellbar, an einem sakralen Ort einen Vortrag über ein politisches Buch zu halten. Und für eine Frau, die die Moschee nur durch eine Seitentür betreten darf und sich vor der männlich dominierten Gemeinde verbergen muss, ist es besonders befremdlich, wenn sie eine Kirche betritt und am Altar begrüßt wird. Aber hier sitze ich nun in dieser Basilika aus dem 16. Jahrhundert und mache die gewöhnungsbedürftige Erfahrung, den Hall meiner eigenen Stimme zu hören, während ich sage: »Ich glaube nicht an Gott, sondern an die Menschen.«
Selbst als ich behaupte, dass wir keine Religion brauchen, um aneinander zu glauben und uns zu vertrauen, verleiht der Nachklang meinen Worten etwas Spirituelles. Als ich vom »Glauben an die Menschheit« und von der »Schönheit des Menschlichen« spreche, verwandelt sich die anfangs auf der gewöhnlichen Neugier einer Zuhörerschaft basierende Stille in das freudige Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gemeinde. Ich höre Seufzer der Erleichterung.
Aber wir sind ja auch in Italien. Als der Rest der westlichen Welt in Bezug auf politischen und moralischen Wahnsinn noch ahnungslos war, hatten die Italiener Silvio Berlusconi, der Boris Johnson an Unterhaltsamkeit und Donald Trump an Gefährlichkeit weit übertraf. Italien war das erste europäische Land, das die scharfe geschichtliche Wende erlebte, während der Rest der westlichen Welt das Ganze für eine kurze mediterrane Eskapade hielt. Die Italiener haben es satt, sich für die schlimmsten Politiker als Repräsentanten ihres Landes schämen zu müssen – was trotz des kühleren Klimas inzwischen auch für die Bewohner der ältesten Demokratien und wirtschaftlich erfolgreichsten Staaten gilt.
Als ich vom Altar hinuntersteige, lächeln mich alle an, und in manchen Augen stehen Tränen, sodass ich mir einen Moment lang wie ein zwielichtiger Fernsehprediger vorkomme. Doch mein Zynismus schwindet, und mir wird bewusst, dass so etwas passiert, wenn man mit der Sprache eine Herzmassage durchführt, um das menschliche Herz wieder in Gang zu bringen, das vor Jahrtausenden die Götter erfand – und noch davor den Glauben selbst. Er ist der einzige Mechanismus im Menschen, mit dem sich unser tief sitzendes Versagensgefühl und der daraus resultierende Selbsthass kurieren lassen. Denn auch nach Hunderten von Katastrophen und Tausenden von Tyrannen, nach all den Situationen, in denen unsere Menschlichkeit verloren zu sein schien, funktioniert er noch immer. Er ist kein richtungsloses »Yes, we can«, sondern erinnert die Menschen an ihre Fähigkeit, eine neue Richtung zu finden – und an die Notwendigkeit, der eigenen Kraft zu vertrauen. Das Wort »Glaube« hat den Vorteil, dass wir es bereits kennen, dass es keines Beweises bedarf und nicht widerlegt werden kann.
»Haben Sie noch Hoffnung für Ihr Land?«, fragte ein Journalist die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani, als sich ihre Heimat wieder einmal gegen den islamischen Totalitarismus auflehnte.
Sie schwieg, und einen Augenblick lang sah es so aus, als würde sie sich über die Frage ärgern. Dann sagte sie: »Ich kann nicht hoffen, dass Feuer brennt. Ich kann nicht hoffen, dass Wasser fließt. Der Mensch will frei sein, das ist seine Natur. Der Iran wird frei sein.«
Verständlich, dass eine so mutige Frau, die ihr Land verließ, um ihren Traum zu verwirklichen, den Drang nach Freiheit für einen wesentlichen Bestandteil des menschlichen Charakters hält. Sieht man sich aber viele unterschiedliche Leute an, wird klar, dass der Beweis für die Existenz so hoher Werte im Menschen schwierig zu führen ist. Sobald man den Glauben an die Menschheit auf derartig hohe Erwartungen gründet, wird es heikel. Ich sage das nicht, weil ich das radikal Böse im Menschen schlummern sehe, sondern weil wir oft so unerträglich banal, mutlos und duldsam sind. Das Verständnis von der menschlichen Natur darf sich nicht auf die faktischen Menschen beschränken, ganz gleich ob sie aufreizend mittelmäßig oder bewundernswert inspirierend sind. »Da muss mehr sein«, sagt mir mein Drang, an den Menschen zu glauben – und damit an Sie.
»Das ist eine der beliebtesten Attraktionen, die unsere Stadt zu bieten hat!« Die sympathische ehrenamtliche Mitarbeiterin am Bücherstand des Festival of Ideas erzählt mir von einem Rundgang unter dem Motto »Das nicht gebaute Bristol«. Auf dem Flyer, den sie mir überreicht, steht: »Besichtigen Sie mit dem Heimatforscher Eugene Byrne Dinge, die es nicht gibt.« Byrne, Autor eines Buchs mit gleichlautendem Titel, führt die Teilnehmer zu nie verwirklichten Projekten. Man sieht sich also einen ganzen Tag lang Dinge an, die nicht existieren. Der Flyer empfiehlt bequeme Schuhe und viel Fantasie.
Die Frage ist nicht, was es zu sehen gibt, wenn nichts da ist, sondern ob die nicht gebaute Stadt tatsächlich nicht existent ist, wenn man in ihr herumspazieren kann. Auf die ganze Welt übertragen: Soll die Menschheit wirklich nur nach ihren dokumentierten Errungenschaften und Fehlschlägen beurteilt werden, oder gebietet es nicht die Fairness, auch ihre Absichten miteinzubeziehen?