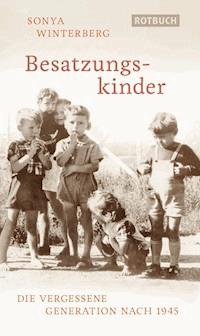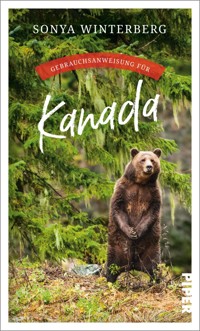10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vermisst, verloren, vergessen: Über 20.000 deutsche Kinder werden ab 1944 in Ostpreußen von ihren Familien getrennt - viele für immer. Gegen Hunger, Kälte und sowjetische Willkür führen sie einen Kampf um Leben und Tod. Monatelang streifen sie, Wölfen gleich, durch die Wälder Litauens. Nach jahrzehntelangem Schweigen erzählen die letzten Wolfskinder erstmals von den Schrecken der Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
FürLea Clarice und Antonio MauriceJasper und Daniël
ISBN 978-3-492-96083-0
Juli 2015
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2012
Fotografien: Claudia Heinermann
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Coverabbildung: Bundesarchiv, Koblenz
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
»Sofern es überhaupt ein ›Bewältigen‹ der Vergangenheit gibt, besteht es in dem Nacherzählen dessen, was sich ereignet hat; aber auch dies Nacherzählen, das Geschichte formt, löst keine Probleme und beschwichtigt kein Leiden, es bewältigt nichts endgültig, es hilft aber, ›die innere Wahrheit des Geschehens so transparent in die Erscheinung‹ zu bringen, daß man sagen kann: Ja, so ist es gewesen.«
Hannah Arendt
Vorwort
Sie sind die Kinder des Zweiten Weltkriegs, die Kinder der Flucht und der Vertreibung – und Kinder Ostpreußens. Niemand hatte sie vorbereitet auf den gewaltvollen Verlust der Mutter und der Angehörigen, den Hunger, die Kälte und schließlich das jahrzehntelange Verlassensein; auf die Traumata ihrer Kindheit, die sie ein Leben lang begleiten würden und die sich bis in die Gegenwart auswirken – so jedenfalls sieht es die Autorin dieses Buches.
In einem Vortrag anlässlich des Preußenjahrs 2001 konstatierte der Historiker Arnulf Baring, dass in Deutschland kaum öffentlich behandelt werde, was es bedeute, »dass der größere Teil des alten Preußen, das 1701 Königreich wurde, heute polnisch, auch russisch oder litauisch ist«. In einem geeinten Europa, in dem seither auch Polen und Litauen Aufnahme gefunden haben, hat sich daran mehr als zehn Jahre später wenig geändert. So wie das Schicksal dieser Gruppe erst sehr spät bearbeitet wurde, erging es auch den Ostpolen, die als Erste zwangsweise umgesiedelt, vertrieben und traumatisiert wurden.
Eines der drei baltischen Länder ist auf ganz besondere Weise mit Deutschland verbunden – Litauen. Hier fanden nach Ende des Zweiten Weltkriegs zahlreiche der Geflohenen oder Vertriebenen aus Ostpreußen eine Zuflucht, einige von ihnen blieben bis heute. Diese Tatsache spiegelt sich im öffentlichen Bewusstsein kaum wider. Wenn wir auf die dramatische Zeitenwende 1989/90 zurückschauen, sollten wir bedenken, dass sich die damaligen Ereignisse aus litauischer Sicht keinesfalls frei von Gewaltandrohung vollzogen.
Als sich Litauen auf einem Parteitag Ende 1989 von der sowjetischen Führung in Moskau lossagte, stieß das Land auf das deutliche Nein Gorbatschows zur Unabhängigkeit der baltischen Staaten. Deutschland wollte auf keinen Fall einen Konflikt mit Gorbatschow wegen der Unabhängigkeitsforderungen im Baltikum. Das hätte das Ziel der deutschen Einheit gefährden können. Wenn ich auch die Zurückhaltung Kohls und Genschers nachvollziehen konnte, suchten wir damals doch nach Wegen, wie wir die Litauer politisch und praktisch unterstützen konnten. Wir bewunderten den Mut derer, die unbeirrt auf ihren »großen Tag« zusteuerten, die Erklärung der Unabhängigkeit am 11. März 1990.
Tagtäglich die Aufbruchsstimmung in Deutschland mitzuerleben, auch die Nachrichten von den vielen Menschen zu sehen, die in Litauen für die Unabhängigkeit auf die Straße gingen, und dennoch die eher zurückhaltende Politik zu erleben und als Bundestagspräsidentin zum Teil auch mittragen zu müssen, fiel mir schwer.
Es wurde damals auch nicht gesehen, dass das Einsetzen für die Belange Litauens eng mit dem Schicksal einer dort lebenden deutschen Minderheit zu tun hatte, die, anders als etwa die Russlanddeutschen, über keine Lobby verfügte und deren deutsche Herkunft vonseiten der Bürokratie aufgrund fehlender Dokumente in Zweifel gezogen wurde. Den Lebensgeschichten dieser Kriegskinder geht die Autorin Sonya Winterberg in diesem Buch nach.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass innerhalb der Regierung größter Druck auf uns Parlamentariern lastete. Dass ich dennoch Anfang September 1991 als erster hochrangiger Politiker nach Litauen flog, um Gespräche mit der von der Sowjetunion nicht anerkannten Regierung zu führen, stieß auf wenig Gegenliebe. Wir sollten nicht nach Litauen fahren, waren aber dennoch da. Die Eindrücke waren bedrohlich und haben sich mir tief eingeprägt. Rund um das Parlament in Vilnius waren noch die Barrikaden aus Sandsäcken zu sehen, die das Gebäude schützen sollten, um dem Angriff sowjetischer Truppen zu widerstehen. Der blutige 13./14. Januar 1991 forderte 14 Menschenleben und weit über 100 Verletzte.
Ich nahm damals unbürokratisch und ohne protokollarische Abstimmung mit Bonn einen schwer verletzten litauischen Soldaten mit zurück nach Hamburg, dem die dringend notwendige medizinische Hilfe sonst verwehrt geblieben wäre. Im Bundeswehrkrankenhaus wurde er sechs Monate behandelt und konnte danach wieder gesund in seine Heimat zurückkehren.
In außenpolitischen Belangen haben Kanzleramt und Außenministerium größeres Gewicht als der Bundestag. Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln wurden die Parlamentarier aber dennoch sehr früh aktiv. Der Deutsch-Baltische Freundeskreis war es in erster Linie, der wichtige Hilfe im Bestreben nach Unabhängigkeit Litauens leistete. Damals gehörten ihm rund 100 Parlamentarier aller Fraktionen (außer der PDS) an. Gegründet wurde er im Frühjahr 1991 durch Wolfgang Freiherr von Stetten, der zudem den Vorsitz übernahm.
Wie kein zweiter Politiker engagierte sich fortan Wolfgang von Stetten für die neuen deutsch-baltischen Beziehungen. Sein Büro im Langen Eugen in Bonn wurde kurzerhand zum Deutsch-Baltischen Informationsbüro, einer Art Übergangsbotschaft, und seine persönlichen Beziehungen zu den führenden Parlamentariern der Region bereiteten den Boden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die nicht zuletzt 2004 in den Beitritt der baltischen Staaten zur Europäischen Union und zur NATO mündete. Damit war das kollektive Trauma, die Angst vor einem erneuten Übergriff Moskaus, beendet.
In diesem Kontext muss das außerordentliche Engagement Wolfgang von Stettens für Litauen, aber auch für die deutsche Minderheit gewürdigt werden. Im Jahr 1992 kam er erstmals in Kontakt mit dem Verein »Edelweiß«, in dem sich viele Betroffene kurz zuvor zusammengeschlossen hatten. Ihre Sache machte er sich in den folgenden Jahren zu eigen. Ob es um Familienzusammenführungen, den komplizierten Staatsbürgerschaftsnachweis, Wiedereinbürgerungsverfahren oder schlicht humanitäre Hilfe ging, von Stetten wurde für viele Betroffene zum Vater, den sie nie hatten. Unermüdlich stand er ihnen zur Seite, wenn sich die Bürokratie der Ämter und Behörden unerbittlich zeigte, und unermüdlich sammelt er bis heute Spenden, um, wie er selbst sagt, »ein wenig die Not zu lindern«. Eine Not, die das Leben ohne elementarste Schulbildung und unterhalb des Existenzminimums in Litauen trotz EU-Mitgliedschaft mit sich bringt.
In seiner damaligen Rede forderte Arnulf Baring übrigens auch, unseren Schulkindern solle das Schicksal der traumatisierten Kinder und jungen Erwachsenen im Baltikum viel stärker erschlossen und vermittelt werden, als es bisher der Fall ist. Diese Notwendigkeit besteht in der Tat.
Prof. Dr. Rita Süssmuth
Berlin, im März 2012
Bundestagspräsidentin a. D.
Prolog
Es ist der 21. März 1992 – eine kleine Wohnung im zweiten Stock eines Backsteingebäudes im norddeutschen Flensburg. Mit zitternden Händen hält Anna Unkat ein maschinell erstelltes Schreiben des Roten Kreuzes in Händen. Tränen rinnen über das zerfurchte Gesicht der alten Dame. Es ist lange her, dass sie zum letzten Mal geweint hat. Fast fünf Jahrzehnte sind vergangen, seit sie ihren jüngsten Sohn auf der Flucht aus Ostpreußen verlor. Endlos scheinende Jahre, die sie in Sorge um ihn war, in denen sie tagtäglich, wieder und wieder, die letzten Momente Revue passieren ließ, bevor der Zug losrollte und sie begriff, dass der kleine Günter am Bahnhof Insterburg zurückgeblieben war. Nie hat sie den Glauben verloren, dass er noch am Leben sei. In all den Jahren hat sie nichts unversucht gelassen, um ihn zu finden. Und doch mussten 50 Jahre bis zu diesem Moment vergehen. Die Greisin wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und bittet die Pflegerin, ohne deren Betreuung sie seit einigen Jahren nicht mehr zurechtkommt, um einen Stift. Mit großer Mühe bringt sie zu Papier, was ihr in diesen Minuten durch den Kopf geht:
Mein lieber Sohn!
Ich habe heute den Brief vom Suchdienst erhalten, dass Du, liebes Günterchen, noch lebst! Ich brach in Freudentränen aus. Du schreibst, dass Du einen anderen Namen angenommen hast. Ist das der Name Deiner Pflegeeltern? Bist Du allein oder hast Du Familie? Bring alles mit, was Du hast. Platz habe ich genug. Mein liebes Günterchen! Gott hat mein Gebet erhört! Komm, so schnell Du kannst. Ich schreibe nicht viel, aber ich möchte, dass wir uns bald wiedersehen. Ich bin ganz aufgeregt und kann einfach nicht mehr schreiben.
Viele herzliche Grüße aus dem fernen Flensburg.
Deine Dich liebende Mutter.
Hans Neumann steht in den späten Abendstunden des 2. September 1991 am Hauptbahnhof in Braunschweig und wird von seinen Gefühlen überwältigt. Vor ihm steht sein Bruder Gerhard, den er zuletzt an einem warmen Frühlingstag 1945 gesehen hatte. Hans war sieben, als er auf der Flucht von Mutter und Bruder getrennt wurde. Zwei Jahre schlug er sich im Grenzgebiet zwischen Königsberg und Litauen in den Wäldern entlang der Memel durch, immer in der Hoffnung, nach Deutschland zu gelangen und die Familie wiederzufinden – ohne Erfolg. Ab 1947 wohnte Hans bei einer litauischen Bauernfamilie. Aus dem deutschen Hans wurde Jonas, ein litauischer Junge. Seine deutschen Wurzeln, die Eltern und seine drei Geschwister vergaß er dennoch nie.
Erst Anfang 1991 gelang es den deutschen Geschwistern, Hans über den Suchdienst der Kirchen und des Roten Kreuzes ausfindig zu machen. Wenige Monate später sind die bürokratischen Hürden genommen, und die beiden Brüder liegen sich in den Armen. Hans Neumann ringt lange um Worte: »Der Himmel öffnet sich …« Anders, weniger pathetisch, kann er seine Gefühle nicht ausdrücken. Auch der Vater lebt noch. Hermann Neumann ist 89 Jahre alt und wohnt in einem Dortmunder Seniorenheim. Ungläubig gibt er dem verlorenen Sohn die Hand. Nur die Mutter wird Hans nicht wiedersehen. Sie ist kurz nach Kriegsende nach Sibirien verschleppt worden und 1948 in einem Lager umgekommen.
Nicht immer gibt es nach so langer Zeit ein Wiedersehen. Ob ihre Mutter noch lebt, weiß ein anderes Wolfskind bis heute nicht: »Ich war vielleicht fünf Jahre alt. Die Bäuerin hielt mich im Stall bei den Schweinen. Als meine Mutter überraschend kam, um mich abzuholen, denn es sollte nach Deutschland gehen, schämte sich die Bäuerin. Sie belog meine Mutter und sagte ihr, dass ich gestorben sei.« So bleibt das Mädchen im litauischen Kaunas. Erst auf dem Totenbett gesteht die katholische Bäuerin ihrer Pflegetochter diese Lüge. Eine unverzeihliche Sünde, die ihr ein ganzes Leben auf dem Gewissen lastete. Sie bittet ihre Ziehtochter um Vergebung. Nach dem Tod der Bäuerin vertraut das einstige Wolfskind seine Geschichte der Historikerin Ruth Kibelka an. Doch nirgendwo in Deutschland findet sich eine Spur.
Drei Schicksale von vielen, welche von deutschen Kindern erzählen, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs oder kurz nach Kriegsende ihre Eltern verloren haben. Damals flohen Zehntausende Familien aus dem nördlichen Ostpreußen vor der Roten Armee. Zahlreich sind die Fälle, in denen auf der Flucht die Kinder zurückblieben. Manche erlebten die Erschießung der eigenen Familie. Andere mussten ohnmächtig zusehen, wie jüngere Geschwister verhungerten oder aus Schwäche starben, wie die Mutter einer Epidemie erlag. Diese Kinder, oft nicht älter als vier oder fünf Jahre, waren plötzlich auf sich allein gestellt und überlebten monatelang, manchmal über Jahre in kleinen Gruppen in der freien Natur Ostpreußens, Königsbergs und des Baltikums. Deshalb nennen sie sich bis heute »Wolfskinder«.
Viele Wolfskinder kamen um, verhungerten, wurden nach dem Krieg von Soldaten der Roten Armee erschossen, weil sie verzweifelt nach Nahrung suchten – oder auch nur, weil sie Deutsche waren. Einige Tausend wurden bis 1951 in Viehwaggons geladen und in die Sowjetische Besatzungszone, später die DDR gebracht, wo man sie auf Kinderheime verteilte und ihnen verbot, von ihrem Schicksal zu erzählen. Eine ebenso große Zahl verblieb in der Sowjetunion. Die meisten gelangten nach Litauen, wo sie als billige Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Weil das verboten war, erhielten sie die litauischen Namen der Bauern, galten als Familienmitglieder. Im besten Falle wurden sie wie Pflegekinder behandelt und später adoptiert. Dennoch besuchten die meisten nie eine Schule, lernten nie Lesen und Schreiben. Manche von ihnen glaubten, Deutschland sei nach dem Krieg untergegangen und existiere nicht mehr. Sie glaubten es auch selbst noch, als sie zu Beginn der Neunzigerjahre vom Kindersuchdienst aufgespürt wurden. Über Jahrzehnte hatten sie ihre alten Namen verleugnen müssen, ihre Muttersprache nicht sprechen dürfen. Manchen gelang es, ihre Vergangenheit zu vergessen; andere zerbrachen daran. In vielen jedoch offenbarte sich eine überraschend starke und trotzige Kinderseele. Obwohl sie ihre Eltern nur wenige Jahre lang erlebt hatten, blieben sie lebenslang auf der inneren Suche nach ihren Familien – bis heute.
Das Schicksal der Wolfskinder beschäftigt mich schon lange. Im Jahr 2007 erschüttert mich eine Analyse des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang von Stetten: »Sie leben letztlich in erbärmlichen Verhältnissen, und es ist eine Schande für den deutschen Staat, dass es trotz aller Anstrengungen nicht gelungen ist, diesen Menschen eine kleine Rente zuzusprechen. Diese nicht einmal hundert Menschen verlieren auch nach 62 Jahren noch immer den Krieg, fühlen sich verraten, verlassen und letztlich vom Vaterland vergessen.«
Im Jahr 2011 begleite ich eine Gruppe Wolfskinder aus Litauen bei ihrem Deutschlandbesuch. Eine von ihnen ist Waltraut Minnt. »Sie ist eine Wanderin!«, raunt mir jemand zu, der sie seit Jahren kennt und damit meint, sie sei eigentlich eine Landstreicherin und nie wirklich sesshaft geworden. Und so hält sie sich stets ein bisschen abseits und ist doch auf Gruppenfotos immer gut zu erkennen – sie steht meist am Rand, ein paar Schritte neben den anderen, als gehöre sie eigentlich gar nicht dazu.
Waltraut ist in diesen Tagen in Deutschland ganz unruhig. Immer wieder hält sie die Gruppe auf, kommt nicht zu verabredeten Zeiten zum Bus zurück. Irgendwann bricht es während unseres Aufenthalts in Berlin aus ihr heraus. Sie erzählt von einem Bruder, der offenbar ganz in der Nähe lebt – Fritz. Dabei weint und strahlt sie zugleich und ist so froh, eine Adresse zu haben, zu wissen, dass es ihn noch gibt. Doch sie traut sich nicht, ihn aufzusuchen. Drei Tage und drei Nächte hat sie nun immerzu überlegt, ob und wie sie ihn doch noch treffen könnte. »Aber wie sollen wir uns verständigen?« – das ist ihre größte Sorge. Wie so viele in Litauen verbliebene Wolfskinder hat auch sie das meiste Deutsch vergessen. Erst später wird sich herausstellen, dass der Bruder Waltraut gar nicht sehen will. Sie ist ihm peinlich, war auch »nur« eine Halbschwester, und überhaupt wisse man ja nicht, »was diese Leute aus dem Osten für Ansprüche hätten«. Alles, was Waltraut bleibt, sind die guten Erinnerungen. Zumindest die kann ihr keiner mehr nehmen.
Waltraut trägt gerne blau und kleine geometrische Muster. Ihre Kleider stammen aus einer anderen Zeit und sind meist aus Polyester. Das schwarze Haar, noch nicht ganz ergraut, trägt sie in einem Knoten. Sie sieht nicht mehr gut und trägt eine markante Brille in geschwungener Schmetterlingsform, die allerdings schon bessere Zeiten gesehen hat. Wann zuletzt die Sehstärke untersucht wurde, daran kann sie sich nicht erinnern. Oft legt sie den Kopf ein wenig zur Seite, sieht ihr Gegenüber aus den kleinen braunen Augen skeptisch an und wackelt ein bisschen mit dem Haupt. In solchen Momenten denke ich, dass an ihr eine Lehrerin verloren gegangen ist. Noch ein weiteres Accessoire gehört zu Waltraut und ist untrennbar mit ihrer Person verbunden: eine ockerfarbene Bügeltasche aus den Fünfzigerjahren. Während ihres Deutschlandbesuchs essen wir gemeinsam in einer Cafeteria zu Mittag. Alles ist neu für sie. Die bunten Farben, die lichtdurchfluteten Räume und dann die Auswahl an warmen und kalten Speisen, Suppen und Salaten – sie ist sichtlich überfordert und balanciert ihr Tablett unsicher durch den Überfluss einer deutschen Kantine. Am Ende nimmt sie eine kleine Schüssel Suppe und drei Brötchen. Als sie am Tisch sitzt, lässt sie in einem unbeobachteten Moment zwei der Brötchen flugs in ihre Handtasche gleiten. »Man weiß ja nie«, erklärt sie mir hinterher. So viel Essen wie hier habe sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen. »Und so schön angerichtet! Wie im Märchen.« Doch nicht nur Vorräte finden Platz in Waltrauts Handtasche. Eigentlich, so meint sie, sei es ihr ganzes Leben, das dort hineinpasse. Als sie das sagt, will ich alles erfahren – über ihr Leben und ihre Handtasche. Mir wird klar, wie wenig ich bislang überhaupt über das Schicksal der Wolfskinder wirklich weiß. Und ich verstehe, dass ich die Antworten nicht in Deutschland finden werde.
1 Ein Schicksalstag
Vilnius, an einem Donnerstag im Januar 2011. Ich bin erst wenige Tage in der Stadt. Hier treffe ich Valdas Petrauskas. Er war am Ende des Zweiten Weltkriegs selbst noch ein Jugendlicher und erinnert sich an die »vokietukai«, die »kleinen Deutschen«, wie die Litauer beinahe schon liebevoll die Kinder aus Ostpreußen nannten, die hungernd durch das Land streunten. Aber noch wacher werden seine Augen, wenn er sich den Blutsonntag im Januar 1991 ins Gedächtnis ruft. Ein Schicksalstag sowohl für Litauen als auch für die Wolfskinder.
Damals besetzten sowjetische Panzer die Hauptstadt des freien Litauens. International anerkannt war die »Republik Litauen« zu diesem Zeitpunkt freilich noch nicht. Michail Gorbatschow hatte ein Ultimatum gestellt. Das Land sollte seine im Vorjahr ausgerufene Unabhängigkeit zurücknehmen. Die Situation in der noch jungen Republik war durch eine massive Wirtschafts- und Rohstoffblockade Moskaus prekär geworden. Wie schon so oft in der Geschichte des Kalten Krieges sollten Panzer einmal mehr den Zusammenhalt des – bereits zerfallenden – Ostblocks sichern.
Zu den Mutigen dieser historischen Stunde gehörte der eben erst gewählte Parlamentspräsident Vytautas Landsbergis, der sich mit den Abgeordneten in ihrem Dienstgebäude am Ģediminas Prospekt verschanzt hatte. In einer dramatischen Fernsehansprache appellierte Landsbergis an das Volk und bat es um Schutz. Zu Tausenden strömten Menschen zum Parlament und verdrängten so die vom KGB bestellten Demonstranten und Claqueure. Tag und Nacht bewachten sie ihr Parlament – bereit, für die neu gewonnene Freiheit zu sterben. Wie in alten Zeiten begleiteten Priester diesen Kampf, um den Gläubigen die Beichte abzunehmen und letzte Sakramente zu spenden. »Viele Litauer waren unter Stalin in der Verbannung in Sibirien gewesen. Fast jeder kannte solche Fälle aus der eigenen Verwandtschaft«, erzählt Valdas. »Und viele sind auch nicht mehr zurückgekommen.« Die damals vom Schicksal Verschonten hatten in dieser Stunde weit mehr zu gewinnen als zu verlieren. Der Fall der Mauer in Berlin hatte den Eisernen Vorhang einen Spalt geöffnet, und die Litauer schienen nicht mehr gewillt, diese einmalige Chance verstreichen zu lassen.
Nicht nur am Parlament versammelten sich die Menschen. Auch am Sendezentrum der Fernsehanstalt standen sie in dichten Reihen. Dort eskalierte die Situation. Panzer zielten über die Köpfe der Menge hinweg, Soldaten gingen brutal gegen die friedlichen Demonstranten vor, schlugen sie mit Gewehren und Eisenstangen nieder. Schließlich eröffneten sie das Feuer, schossen ohne Gnade. Unvergessen sind bis heute für die Litauer die Fernsehbilder. Angsterfüllt erstattete die Nachrichtensprecherin aus dem von innen verschlossenen Studio Bericht: »Jetzt hämmern sie gegen die Tür!« – Dann brach die Übertragung ab, ein sowjetischer Sender übernahm die Ausstrahlung.
Dennoch gelang es Landsbergis erneut, aus dem Parlament heraus sein Volk um Hilfe zu bitten. Etwa 150 000 Litauer bildeten eine undurchdringliche Mauer um das Gebäude, errichteten Straßensperren und verhinderten die Stürmung. 15 am Sendezentrum getötete Menschen und viele Schwerverletzte besiegelten durch ihr Opfer schließ-lich endgültig die Unabhängigkeit Litauens. Gorbatschow scheute ein weiteres Blutvergießen und zog die sowjetischen Truppen zurück.
An diesem Winterabend 2011 jährt sich der Schicksalstag für das baltische Land zum zwanzigsten Mal. Es ist der Nationalfeiertag. Die ganze Nacht hindurch brennen kleine Feuer in der Stadt, an denen sich die Menschen wärmen können, wie einst auf dem Platz vor dem Parlament und am Sendezentrum. Allgegenwärtig ist heute der verzaubernde Klang zahlloser Chöre. Was damals geschah, nennen sie die »Singende Revolution«, weil ab dem Ende der Achtzigerjahre zahlreiche Folklore- und Tanzgruppen die nationale Identität wachriefen und dadurch den Wandel begründeten.
Die Schatten der Torbögen und Einfahrten in der Altstadt sind furchteinflößend. Am Parlament zeigt mir Valdas die Betonbarrikaden, die zur Mahnung und Erinnerung geblieben sind und noch bis Ende 1992 das Parlamentsgebäude abriegelten. Heute sind sie hinter Glas, wirken mit den Graffiti und Bemalungen von einst wie Kunstwerke einer vergangenen Zeit. Valdas nimmt zum Abschied meine Hand bewegt in die seine. Es ist spät geworden.
Der Blutsonntag von Vilnius war global gesehen eine Randnotiz der Geschichte. Gerade hatte der Krieg am Golf begonnen und stand im Mittelpunkt des medialen Interesses. Doch für eine kleine Gruppe Deutscher, die seit 1945 in Litauen leben musste, öffnete sich erstmals die Tür zu einer Welt, die für sie ebenso weit entfernt wie unbekannt war – ins Land ihrer Väter.
Erst mit dem Ende des Kalten Krieges und der litauischen Revolution hatten die meisten der Wolfskinder überhaupt eine Chance, die abgerissenen Bande nach Deutschland erneut zu knüpfen. Die Hoffnungen waren groß. Die Bundesrepublik erschien als ein Sehnsuchtsort, dessen Name verheißungsvoll und wie das Paradies klang. Sicherlich, so dachten viele, würde man sie mit offenen Armen empfangen. Sie, die verlorenen Kinder, würden endlich ihren Platz finden und wieder dazugehören, denn sie waren ja zweifelsohne Deutsche.
Doch das vermeintliche Vaterland hatte seine Kinder zu diesem Zeitpunkt keineswegs im Blick. Noch waren im Osten Deutschlands 340 000 sowjetische Soldaten stationiert, waren die Zwei-plus-Vier-Verträge vom Obersten Sowjet nicht ratifiziert. Dies zog sich bis in den März 1991, und selbst noch im Juli des Jahres sprach Bundeskanzler Helmut Kohl von der »undifferenzierten Unterstützung der Unabhängigkeit einzelner Sowjetrepubliken« als »gefährlicher Dummheit«.
Es sollte also dauern, bis diplomatische Beziehungen aufgebaut waren. Doch erste Bande wurden geknüpft, und die Suchdienste von Rotem Kreuz und den Kirchen verzeichneten zunehmende Nachfragen.
Die wenigsten Wolfskinder fanden freilich ihre Eltern wieder. Etliche von ihnen waren im Laufe der Jahre bereits gestorben, einige ließen sich wegen Namensänderungen oder aus anderen Gründen nicht ermitteln. Wegen ihres unbegreiflichen Schicksals und seltsamen Auftretens wurden viele Wolfskinder zudem von ihren eben gefundenen deutschen Verwandten als peinlich wahrgenommen und verleugnet. In viele Fälle spielte zudem die Angst hinein, die »neuen armen Verwandten aus dem Osten« künftig versorgen zu müssen. Dabei war Geld für die wenigsten Wolfskinder vordergründig. Ihnen ging es in erster Linie um mehr Klarheit, was ihre Herkunft betraf, um Fotos der Eltern und der Geschwister aus der früheren Zeit.
Die unerwartete Ablehnung traf die Wolfskinder völlig unvorbereitet und traumatisierte sie ein weiteres Mal.
Fast alle von denen, die in Litauen geblieben waren, bewegt bis heute die Frage, wie wohl ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie einst die Flucht nach Deutschland geschafft hätten. Oder, wie es Christel Scheffler, geboren 1939 in Königsberg, formuliert, »wenn ich nicht auf der Schattenseite des Lebens hängen geblieben wäre«.
Doch wie geht es den ehemaligen Wolfskindern, die schon seit Langem in Deutschland leben?
Gerhard Gudovius, der heute am Rande der Schwäbischen Alb lebt, hat viele Jahrzehnte nicht über sein Schicksal gesprochen. Erst als er im Frühjahr 2011 eine Buchbesprechung im Reutlinger General-Anzeiger liest, merkt er auf. Es geht um ein Jugendbuch, das vom Schicksal der Wolfskinder handelt. Doch als er erfährt, dass es keineswegs ein Sachbuch, sondern eine frei erfundene Geschichte ist, ist er enttäuscht. »Das ist ja ein rührseliger Kitsch! Und die Autorin hat nichts davon selbst erlebt!«, regt er sich noch Wochen später auf. Er schreibt einen Leserbrief und sucht auf diesem Weg Kontakt zu anderen »echten« Wolfskindern, die ebenfalls in der Region leben.
Als ich ihn das erste Mal treffe, wird mir schnell klar, dass es auch für ihn eine Frage gibt, die ihn bereits sein Leben lang begleitet. Der damals sechzehnjährige Kriegswaise Gerhard hatte nach einem halben Jahr des Bettelns in Litauen Aufnahme bei einer Bauernfamilie gefunden, die ihn wie den eigenen Sohn behandelte. Die Familie hatte Kinder in seinem Alter, und der halb verhungerte Junge passte sich rasch an. Gerhard erwies sich als geschickt und half tatkräftig in der Landwirtschaft mit. Bald schon wurde ihm eine wichtige Aufgabe anvertraut: Mit Pferd und Wagen brachte er täglich die Milch ins nahe gelegene Kalvarija.
»Fünf Jahre lebte ich dann schon bei der Familie. Sie nannten mich Gerhardas, und außer der Haarfarbe – ich war ein Blondschopf – unterschied mich nichts von ihnen.« Doch im Frühsommer 1951 kommen überraschend zwei Sowjetsoldaten und geben ihm die Order zur Ausreise. Alles geht ganz schnell, Gerhard weiß nicht, wie ihm geschieht. Am folgenden Tag schon soll er abgeholt werden. Als er seiner litauischen Familie vom Besuch der Staatsmacht erzählt, brechen alle in Tränen aus. Gerhard ist gerührt und wird sein Leben lang nicht vergessen, wie emotional der Abschied von der einzigen wirklichen Familie war, die er je hatte – an diesem seinem Schicksalstag.
»Was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich damals in Litauen geblieben wäre?« Doch wer könnte ihm seine Frage beantworten? Ich schlage vor, dass wir gemeinsam die Wolfskinder aus Litauen auf ihrer Deutschlandreise treffen, um dieser Frage nachzugehen. Er sagt ohne Zögern zu.
Gerhard Gudovius lebt seit Mitte der Fünfzigerjahre in Reutlingen. Hier hat er seine Frau Gerlinde kennengelernt, hier kamen die Kinder zur Welt, hier hat er einen kleinen Garten auf der Anhöhe mit Blick über die Stadt. Auch wenn ihm die Schwaben im Wesen immer ein wenig fremd geblieben sind, findet er, dass der Ordnungssinn von Schwaben und Ostpreußen doch ganz gut zusammenpasst. Und dass er eigentlich Glück gehabt hat, am Ende ausgerechnet hierher gefunden zu haben. »Als ich bei der Ausreise hörte, dass es in die sowjetisch besetzte Zone geht, war mir klar, dass das nichts Gutes bedeutet und dass ich schauen muss, dass ich dort wegkomme.«
Seine Frau, die lange Jahre als Mesnerin bei der Kirchengemeinde gearbeitet hat, stammt ursprünglich aus dem Vogtland und ist wie ihr Mann in den Fünfzigerjahren nach Reutlingen gekommen. Gemeinsam hat das Ehepaar die Fremde zur neuen Heimat gemacht. »Wir hatten gute und weniger gute Zeiten«, sagt Gerlinde Gudovius. »Ein ganz normales Leben eigentlich.« Nur manchmal, da sei ihr Mann eben ein bisschen verschlossen gewesen, er habe über früher nicht reden mögen. Vielleicht sei er auch nicht immer ganz gerecht gewesen gegenüber den Kindern und habe mal einen über den Durst getrunken. Doch heute führen sie dem Anschein nach ein zufriedenes Leben. Das kleine Reihenendhaus in ruhiger Lage mieten sie zu einem guten Preis von der Gemeinde. Gemeinsam machen sie gerne Busreisen, um wenigstens im Alter noch ein bisschen von der Welt zu sehen. Es sind bescheidene Menschen, die ich hier treffe, denen es weder an Herzenswärme noch an Tiefe fehlt. »Aber es bleibt ein unbestimmtes Gefühl, das an einem nagt«, sagt Gerhard Gudovius schließlich. »Wäre das Leben, wäre alles vielleicht ein wenig einfacher gewesen, wenn ich damals hätte in Litauen bleiben können?«
Als wir an einem sonnigen Vormittag im Mai aufbrechen, um die Wolfskinder aus Litauen zu treffen, ist Gerhard Gudovius aufgekratzt. Er hat eine schlaflose Nacht hinter sich und versucht immer wieder in Gedanken zu rekonstruieren, wo genau die litauische Familie lebte, die ihn aufgenommen hatte. »Leider kann ich mich an keine Namen erinnern und auch nicht an das Dorf. Ich weiß, es war in der Nähe von Kalvarija, denn dorthin brachte ich ja immer die Milch zur Molkerei. Und dann war da so ein Teich, dort kühlten wir uns im Sommer ab.« Dann schweigt er. »Meinen Sie, dass auch jemand aus Kalvarija dabei ist?«, fragt er mich. Ich weiß es nicht, nehme aber an, dass bei 35 Teilnehmern die Chancen nicht schlecht stehen.
Als wir schließlich in der Nähe von Künzelsau auf die Gruppe treffen, kann er nicht mehr an sich halten. »Ist hier jemand aus Kalvarija?«, ruft er aufgeregt. Doch die Verständigung ist gar nicht so einfach. Die meisten der aus Litauen angereisten Wolfskinder sprechen nur noch wenig Deutsch. »Und wo haben sie ihre Männer gelassen?«, fragt mich Gerhard Gudovius. Es sind überwiegend Frauen, kaum Männer in der Gruppe. Eine nette Dolmetscherin kommt auf ihn zu: »Hier ist eine Frau aus der Nähe von Kalvarija«, sagt sie und stellt ihm Erna Schneider vor. Leider beherrscht diese ihre Muttersprache kaum noch, aber sie freut sich sichtlich, dass jemand in Deutschland die Region in Litauen kennt, aus der sie kommt. Bei Kriegsende, als sie ihre gesamte Familie verlor, war sie gerade neun Jahre alt. Mit den wenigen Angaben, die Gerhard Gudovius macht, kann sie ihm leider nicht weiterhelfen. Er findet aber verschiedene andere Wolfskinder, mit denen er sich, wenn auch begrenzt, austauschen kann. Den Nachmittag verbringt er überwiegend mit Rudi Lindenau, der heute in Šiauliai lebt. Beide sind 1932 in Königsberg geboren, und Rudi hat seit 1991 vielfältige Kontakte nach Deutschland gepflegt, sein Deutsch wieder aufleben lassen. Die beiden unterhalten sich über das alte Königsberg, die Zeit des Hungers und des Bettelns. Wie sie nach Litauen gekommen sind und über die Tricks, die ihnen als pfiffige Jugendliche das Überleben sicherten. Sie entdecken viele Gemeinsamkeiten, doch das Trennende bleibt die Ausreise von Gerhard Gudovius 1951. Rudi Lindenau ist nicht bitter. »Ich habe es immer ganz gut gehabt, auch in schweren Zeiten«, sagt er von sich. Doch auch seine fröhliche Art und sein freundliches Gesicht können Gudovius nicht darüber hinwegtäuschen, dass es kein einfaches Leben war, das Lindenau als Wolfskind in Litauen geführt hat. Besonders schockiert ihn die finanzielle Lage des Rentners. Die Armutsgrenze in Litauen liegt bei 700 Litas, umgerechnet 200 Euro. Kaum eines der Wolfskinder erhält mehr als 400 Litas Rente. Und auch die Frage nach den Männern klärt sich. Viele der Frauen sind Witwen. Die Lebenserwartung der litauischen Männer liegt mit knapp 65 etwa zehn Jahre unter dem deutschen Durchschnitt. Zu den großen Problemen des Landes gehören auch der weitverbreitete Alkoholmissbrauch sowie die höchste Selbstmordrate weltweit, erzählt uns die Dolmetscherin. Mit einem Schlag wird Gerhard Gudovius klar, dass seine Erinnerung an das idyllische Landleben in Litauen nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. »Wahrscheinlich würde ich gar nicht mehr leben«, meint er nachdenklich, als ich ihn nach Hause fahre. Er ist dankbar für diese Begegnungen und hat für sich die vielleicht wichtigste Frage seines Lebens beantworten können.
2 Erinnerung an Königsberg
Was die ehemaligen Wolfskinder in Deutschland und die noch in Litauen lebenden verbindet, ist die Erinnerung – an Ostpreußen, an ihre Kindheit, an die Zeit, als der Krieg ihre Heimat noch nicht erreicht hatte.
Gemeinsam mit ihnen begebe ich mich auf eine Heimatsuche der Seele. Eine solche muss es bleiben, denn die Orte von einst, die wir suchen und nach denen sich die Wolfskinder sehnen, gibt es nicht mehr. Sie existieren einzig noch auf alten Fotos und Landkarten, ansonsten sind sie versunken in der unheilvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts – unwiederbringlich verloren.
Doch diese Suche nach Heimat hat auch etwas Versöhnliches. Marion Gräfin Dönhoff nannte es »lieben, ohne zu besitzen«. Wenn sie von früher erzählen, von Ostpreußen mit seiner Hauptstadt Königsberg, so haben die Geschichten der Wolfskinder eines gemein: Es sind fast ausschließlich schöne Andenken, die sie sich bewahrt haben. Von einem Land der Weite, der Stille und wohltuenden Einsamkeit, das vielleicht die preußischen Tugenden wie Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und Disziplin hervorgebracht hat.
Berühmte wie weniger berühmte Königsberger teilen ähnliche Bilder ihrer Kindheit in der östlichsten Großstadt Deutschlands. Über Generationen hinweg ist es eine Idylle aus Romantik und Biedermeier, die das Königsberg der Kindheitstage wachruft.
Königsberg, die heutige russische Exklave Kaliningrad, liegt an der Mündung des Pregels, der mit zwei Flussarmen die Stadt umschließt. Beide bilden eine kleine innerstädtische Insel, den sogenannten Kneiphof. Etwas westlich davon vereinigen sich die beiden Pregelarme wieder und münden ins Frische Haff und somit in die Ostsee. Um den Kneiphof lag der alte Hafen der Stadt. Von den einstigen fünf Kneiphofbrücken ist einzig die Dom-, auch Honigbrücke genannt, erhalten.
Die Malerin Käthe Kollwitz erblickte 1867 in Sackheim am Alten Pregel das Licht der Welt. In ihren Selbstzeugnissen schrieb sie: »Wir lebten damals auf dem Weidendamm Nr. 9 in Königsberg. Ich erinnere mich dunkel an eine Stube, in der ich tuschte, deutlich aber besinne ich mich auf Höfe und Gärten. Durch einen kleinen Vorgarten kamen wir auf einen großen Hof, der bis zum Pregel reichte. Dort hielten die flachen Ziegelkähne, und die Ziegel wurden auf dem Hof abgeladen und geschichtet, sodass Hohlräume blieben, in denen wir Kinder spielten.«
Gut 60 Jahre später, 1928, wurde der Violinist Michael Wieck in Königsberg geboren. Für ihn war es eine »fast schon Kindertraumstadt, mit dem imposanten Schloss im Zentrum. Davor stand ein gekrönter, säbelhochreckender Kaiser Wilhelm I. Im viereckigen Schlosshof war ein Weinkeller mit dem schauereinflößenden Namen Blutgericht. Gar nicht weit entfernt davon konnte man auf einem lieblichen Schlossteich, mit Schwänen und Enten, Boote für eine Spazierfahrt mieten. Überall spannten sich malerische Brücken über den Fluss Pregel; Ziehbrücken, die uns oftmals zu spät in die Schule kommen ließen und die auf eine im Stadtzentrum gelegene Insel führten.«
Das »Blutgericht« war seinem Ruhm nach vergleichbar mit »Auerbachs Keller« in Leipzig und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Hier gab es die legendären Königsberger Klopse und Königsberger Fleck, eine Art Pansensuppe, ebenso wie das sogenannte Ochsenblut, vor dem sich wegen des Namens ganze Generationen von Kindern gruselten. Dabei war es nur ein Cocktail aus Champagner mit einem Schuss roten Burgunders.
Für Erika Morgenstern, Jahrgang 1939, war das Schloss, »in dem einstmals Preußens Könige gekrönt worden waren, das Schloss aus der Märchenwelt. Unentwegt suchten meine Blicke die hohen Fenster ab in der Hoffnung, einmal eine Prinzessin dahinter sehen zu können, die ein langes weißes Gewand trug, eine Krone auf dem Kopf hatte und ganz sicher eine ganze Tafel Schokolade essen durfte.«
Der 1932 geborene Gerhard Gudovius erzählt so von seiner Kindheit in Königsberg: »Es war eine Großstadt, in der immer etwas los war, es für Kinder auch ständig Neues zu entdecken gab. Ein Ausflug auf dem Pregel war das Höchste. An den Hafenkais konnte man die Dampfschiffe beobachten, wie sie ihre Ladung löschten. Junge Burschen mit Säcken auf den Rücken liefen geschäftig in die Fachwerkspeicher, während im Hintergrund die Straßenbahn bimmelte oder eine Dampflok schnaufte. Baulicher Mittelpunkt der Stadt waren das Schloss und der alles überragende Turm der Schlosskirche. Kastanien und Linden säumten die Wege rund um das Schloss, hier wurde sonntags spazieren gegangen, fand man im Sommer Schutz unter den Bäumen, wenn die Sonne zu sehr brannte.«
Wahrzeichen der alten Hansestadt waren die Fachwerkspeicher auf der Lastadie, wobei sie ab Mitte der Zwanzigerjahre kaum mehr wirtschaftliche Bedeutung hatten. Mit dem Bau des neuen Hafenbeckens am unteren Pregel verlor der Hafen am Hundegatt endgültig seine Funktion. Auf die Kinder übte der Umschlagplatz aber weiterhin seine Anziehung aus. So gab es hier stets güterbringende Eisenbahnen zu beobachten, die beispielsweise den legendären Tilsiter Käse verluden.
Häufig fuhr Gerhard sonntags mit der Straßenbahnli-nie 8 zum Münzplatz, wenn ihm die Großeltern wieder einmal Taschengeld zugesteckt hatten, damit er ins Kino gehen konnte: »Da kam ich mir dann richtig erwachsen vor.«
Auf dem Platz stand auch die schmucklose, obeliskartige »Normaluhr«. Dort trafen sich gerne die jungen Paare, erinnert sich Erika Sauerbaum, geboren 1928 in Königsberg. Von hier aus ließ es sich herrlich durch die Stadt spazieren. »Die linke Uferpromenade entlang des Schlossteichs war eindeutig die beliebtere. Im Café Schwärmer fand sich im Sommer kaum noch Platz auf der Terrasse, aber es war die Hoffnung eines jeden Mädchens, das von einem Kavalier ausgeführt wurde, hierher eingeladen zu werden.« Aber auch die Tanzfläche im Garten des Parkhotels am Promenadenweg war ein sommerlicher Anziehungspunkt. Am nördlichen Ende des Weges rieselte sanft das Wasser des höher gelegenen Oberteichs über die Kaskaden in den Schlossteich. Überhaupt der Oberteich! Hier lernten Generationen Königsberger Kinder schwimmen, denn nicht alle hatten die Möglichkeit, in die Sommerfrische der nahen Ostseebäder Cranz und Rauschen zu fahren.
Auch Burkhard Sumowski, Jahrgang 1936, schreibt in seinen Memoiren über den Oberteich als »dem bedeutendsten Königsberger Gewässer, groß wie ein See, von herrlichen Parks und Promenaden umgeben. In der Nähe des Hauses meiner Großeltern stand nah am Wasser inmitten dichten Gebüschs ein Trafohaus im Stil eines Knusperhäuschens. Um Großmutter ein bisschen zu ärgern, sagte mein Großvater immer, dort wohne der Boshebaubau, der gerne unartige Kinder schnappe.«
Im Süden der Stadt lag der Hauptbahnhof zwischen Haberberg und Nassem Garten, gefolgt von dem Dörfchen Ponarth, einem beliebten Ausflugsziel der Königsberger, die von hier den Ausblick über die Stadt und das Bier der örtlichen Brauerei genossen. Nicht wenige der Wolfskinder stammen aus dieser südwestlichen Ecke der Stadt.
Ostpreußen mit seiner einstigen Hauptstadt Königsberg existiert nicht mehr. Lange schon ist die Region, die an Russland fiel, zur Oblast Kaliningrad geworden. Die einstige Kornkammer Deutschlands, die Hansestadt und die umliegenden blühenden Dörfer wurden im Krieg verwüstet. Wo eben noch Deutsch gesprochen wurde, jahrhundertelang sich Ostpreußen in all seinen Facetten ausgebreitet hatte, verschwanden nach dem Krieg die letzten Spuren dieser einstigen Kulturlandschaft innerhalb kürzester Zeit. Als wir zum Abschied unseres Besuchs ein letztes Mal auf der Honigbrücke stehen, wird mir dies noch einmal bewusst. Wir blicken vom Kneiphof auf die pastellfarbenen Fachwerkhäuser des »Fischdorfes«, wo sich im Sommer die Touristen tummeln. Auf der anderen Uferseite ist ein moderner Glaspalast entstanden, dessen Blick auf Dom und die wiedererstandene historische Kulisse wohl nur dem russischen Geldadel zugänglich ist.
Doch am heutigen Tag zeigt sich Kaliningrad versöhnlich. Die Sonne blinzelt durch die Wolken und schickt ein paar goldene Strahlen, die im Pregel reflektieren. Ein Angler geht still seinem Hobby nach, ein junger Vater spielt mit seiner kleinen Tochter. Sie ist gefangen im Staunen über die Welt und die schillernden Seifenblasen, die der Vater ihr zupustet. Für einen Moment scheint uns hier die Welt wieder in Ordnung.
3 Frieden und Krieg
Das Ende des Ersten Weltkriegs brachte für West- und Ostpreußen schicksalhafte Veränderungen: große Teile Westpreußens, Danzig, die ostpreußische Stadt Soldau und das Memelgebiet wurden aufgrund des Versailler Vertrages ohne Volksabstimmung vom Deutschen Reich abgetrennt und – außer Danzig, das zur »Freien Stadt« wurde, und dem Memelgebiet, das ein Freistaat werden sollte und 1923 von Litauen annektiert wurde – dem 1916 wiedergegründeten Polen übertragen. Für andere Teile Westpreußens östlich der Weichsel und Nogat, die durch den Versailler Vertrag Ostpreußen zugeordnet worden waren, sowie das südliche Ostpreußen bestimmte der Versailler Vertrag, dass die Bevölkerung durch eine Volksabstimmung kundtun solle, ob sie in Zukunft zu Polen oder zu Ostpreußen beziehungsweise zum Deutschen Reich gehören wollte.
In den betroffenen Landesteilen wurden am 11. Juni 1920 die Volksabstimmungen über den Verbleib beim Deutschen Reich angesetzt. Die Ergebnisse hatten auch für die polnische Seite ein wenig überraschendes Ergebnis: In allen Gebieten entschieden sich über 90 Prozent der Wähler für das Reich. Das polnische Staatsoberhaupt Józef Piłsudski erklärte gegenüber dem deutschen Außenminister Gustav Stresemann: »Ostpreußen ist ein unzweifelhaft deutsches Land. Das ist von Kindheit an meine Meinung, die nicht erst der Bestätigung durch eine Volksabstimmung bedurfte. Und dass dies meine Meinung ist, können Sie ruhig Ihren Ostpreußen in einer öffentlichen Versammlung in Königsberg zur Beruhigung mitteilen.«
Mit dem Kernland vereint und doch getrennt: Die geografische Separation von Deutschland bedeutete auch eine wirtschaftliche Isolation, die nur mit großen finanziellen Hilfen aus dem Reichshaushalt auszugleichen war. So diente beispielsweise die 1920 neu gegründete Deutsche Ostmesse Königsberg zum Ausbau der Handelsbeziehungen. Die wirtschaftlich geschwächte Region wurde auf dem Seeweg durch eine neue Verbindung, die kombinierte Personen- und Frachtverbindung Seedienst Ostpreußen von Swinemünde nach Pillau, bedient, die später auf die Danziger Bucht, Travemünde, Kiel und Helsinki ausgedehnt wurde. Darüber hinaus wurde der Schienenverkehr durch den Bau eines Flughafens in Königsberg erheblich entlastet. Dieser erste deutsche zivile Flughafen wurde 1922 mit einem Jungfernflug auf der Strecke Königsberg-Rīga-Moskau eröffnet. Kurze Zeit später folgte die Anbindung an Berlin und Stockholm.
Trotz dieser Maßnahmen und dem ausdrücklichen Willen der Reichsregierung, die Ostgebiete zu stärken, gewann der Nationalsozialismus auch bei der durch die Versailler Verträge gedemütigten ostpreußischen Bevölkerung an Boden. Dabei war der Anklang nationalsozialistischer Ideale nicht ohne Weiteres vereinbar mit den preußischen Tugenden – Bescheidenheit, Gerechtigkeitssinn und Gottesfurcht. Dass eine politische Minderheit offenherzig eine totalitäre Menschenführung verkündete, wurde mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Doch die Menschen in der abgeschnittenen Provinz, die mit den Folgen von Versailles, der Weltwirtschaftskrise und dem Zulauf der Kommunisten konfrontiert wurden, sahen in den lautstarken Versprechungen der Nationalsozialisten einen Ausweg aus ihrer bedrohten Lage.
Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wurde ab 1933 durch die Anfangserfolge der neuen Regierung unter Hitler genährt. Der Osthandel blühte. Die Deutsche Ostmesse Königsberg entwickelte sich rasch zur zweitgrößten Messe des Deutschen Reiches nach Leipzig. Auch außenpolitisch schien sich die Lage für Ostpreußen zu stabilisieren. So wurde 1934 ein Nichtangriffspakt, der sogenannte Freundschaftsvertrag, mit Polen geschlossen. Doch von Freundschaft mit den europäischen Nachbarn hielten Hitler und sein Drittes Reich in Wahrheit nicht viel. Das bekam die Tschechoslowakei spätestens im Herbst 1938 zu spüren, als sie in Folge massiver deutscher Kriegsdrohungen mit dem Sudetengebiet große Teile ihres Landes abtreten musste. Im März 1939 marschierte die deutsche Wehrmacht dennoch in Prag ein und errichtete das Protektorat Böhmen und Mähren – die Tschechoslowakei hörte auf zu existieren. In der verzweifelten Hoffnung, ein ähnliches Schicksal abwenden zu können, gab nun auch Litauen schon eine Woche später das Memelland an Deutschland zurück. Damit schien Hitler alle seine außenpolitischen Ziele erreicht zu haben. Für die Mehrheit der ostpreußischen Bevölkerung lag ein möglicher Krieg in weiter Ferne, und den Kindern dieser Zeit war der Gedanke daran vollkommen fremd.
Ursula Haak wird 1935 als einzige Tochter in eine Landarbeiterfamilie auf Gut Birgen etwa fünf Kilometer von Tilsit entfernt geboren. Sie ist das siebente Kind, ihr jüngerer Bruder Horst kommt ein Jahr später zur Welt und wird das Nesthäkchen der Familie bleiben. Das Gut, auf dem sich die Eltern Anna und Albert verdingen, ist über 100 Hektar groß; zum Besitz gehören 20 Pferde und 70 Stück Vieh.
In der Gutskäserei wird der berühmte Tilsiter Käse hergestellt. Wie andere Familien, die auf dem Gut arbeiten, leben Ursulas Eltern mit ihren Kindern in einer Wohneinheit im Gesindehaus. Dazu gehört ein kleiner Garten, in dem die Familie für den Eigenbedarf Gemüse anbaut und ein paar Nutztiere hält.
Der Vater ist ein hochgewachsener Mann mit blauen Augen, seinem Äußeren nach ähnelt er dem Schriftsteller Thomas Mann. Die Mutter gleicht in ihrem Sonntagsaufzug einer Lehrerin – den Eltern ist es wichtig, dass sie bei aller Bescheidenheit sonntags ordentlich gekleidet zur Kirche gehen und auch ihre Kinder etwas hermachen. Sonn- und Feiertage sind auf dem Gut heilig, und so bäckt Mutter Anna jeden Samstag einen Kuchen, den es am Sonntagnachmittag zum Kaffee gibt. Vor Weihnachten und Ostern wird jeweils ein Schwein geschlachtet.
Die heute in Stockholm lebende Dorothea Bjelfvenstam, geborene Richard, hat eine russische Matrjoschka vor Augen, wenn sie an ihre Kindheit in Königsberg denkt: »Wenn ich sie öffne, finde ich die anderen Figuren in ihr, die immer kleiner werden. Die erste, die kleinste tief drinnen, ist das Kind in Königsberg.« Die Erinnerungen an die ersten Jahre im großbürgerlichen Stadtteil Amalienau sind fragmentarisch: Sandkasten, Laube und Apfelbaum in Großvaters kleinem Garten. Der große Bechstein-Flügel, auf dem der Großvater spielt, während Dorothea unter dem Flügel sitzt und »in der Musik verschwindet«. Dazu noch: »Weihnachten mit Oma, Mutter und Tante. Aber ohne Vati. Kindergarten und Schule, Park und Freundinnen, eine davon Nazi-Oberbürgermeisters Tochter.« Die Nachbarn im Haus gegenüber haben einen kleinen Hund – so klein wie Dorothea selbst.
Auch Eva Briskorn kommt aus Königsberg und ist ebenso alt wie Dorothea. Eva kommt im Januar 1933 kurz vor der Machtergreifung Hitlers als erstes Kind ihrer Eltern Otto und Gisela zur Welt. Es folgen in kurzen Abständen sechs Geschwister. Schon früh hilft Eva als Älteste der Mutter bei den Aufgaben im Haushalt ebenso wie bei der Versorgung der jüngeren Kinder. Das ist ihr einerseits oft lästig, andererseits hat sie ein sonniges Gemüt und freut sich über das Lob, das die Eltern ihrer Großen zuteilwerden lassen. Die Familie lebt in einfachen Verhältnissen im Stadtteil Liep, einem östlichen Vorort von Königsberg. In dem einstigen Fischerdorf aus Ordenszeiten werden die Holzflöße von der Memel über das Kurische Haff und die Deime kommend an der Stadtgrenze angelandet, was Königsberger Großkaufleute 1906 zum Bau einer Zellulosefabrik veranlasst. Der zunehmenden Industrialisierung der Region folgen Siedlungsbauten für die Arbeiter. Bereits im Jahr 1905 wird Liep ins Stadtgebiet eingegliedert, kurz darauf kommt der Anschluss an die Eisenbahn.
Die Zweizimmerwohnung in einem der Siedlungshäuser am Troppauer Weg hat zwar schon ein eigenes kleines Bad und eine Küche, aber mit jedem Familienzuwachs heißt es noch ein wenig mehr zusammenzurücken. Vater Otto ist gelernter Tischler und arbeitet in einer Schreinerei. Eva ist ein Papakind. Sie liebt es, bei ihm auf dem Schoß zu sitzen und sich Geschichten erzählen zu lassen. Bei ihm ist sie nicht Eva, sondern »das Evchen« oder »mein Kindchen«. Otto Briskorn ist mit Leib und Seele Vater. Gerne verbringt er seine Zeit im Kreise der Familie und lässt sich, als der Krieg beginnt, in einer Einheit in der Nähe von Königsberg stationieren, um so oft wie möglich zu Hause sein zu können. Im ersten Kriegsjahr 1939 wird Eva eingeschult. Ein Foto vom ersten Schultag zeigt ein vergnügtes Mädchen mit dunkler Lockenpracht, die mit einem Zopf gebändigt ist. Die Schule macht ihr sichtlich Spaß, und es fällt ihr leicht, lesen und schreiben zu lernen. Sie lernt Sütterlin und erhält für ihre schöne Schrift gute Zensuren. Eva träumt davon, Ärztin zu werden.
Eva besucht die »Horst-Wessel-Schule«, wie alle Kinder hier. Vor dem Sackheimer Tor spielt sich ihr Alltag ab. In der Kupferbadeanstalt am Kupferteich lernen die Kinder beim Bademeister das Schwimmen mittels Schwimmweste an der Angel. Hier gibt es auch einen Sprungturm, von dem aus es sich herrlich ins Wasser platschen lässt.
Unweit davon befindet sich ein kleiner Rummel, dahinter liegen die Schrebergärten am Lieper Weg. Ein Kinderparadies, insbesondere in den Sommermonaten. Hier spielen sie Verstecken, hier kann Eva stundenlang Hüpfseil springen. Auf der anderen Seite der Tapiauer Straße ist der Sportplatz der »Horst-Wessel-Schule«, daneben der Garnisonsfriedhof. Ganz in der Nähe arbeitet auch der Vater. Wenn Eva von der Schule nach Hause kommt, gilt ihre erste Frage oft ihm. »Ist er noch nicht da?«, bedrängt sie die Mutter. Der Antwort folgt stets dasselbe Ritual. Eva pfeffert mit großer Lust die Schultasche in die Ecke, die Mutter seufzt, und schon ist Evchen auf dem Weg, den Vater von der Arbeit abzuholen. Die kurze Zweisamkeit mit dem Vater auf dem Heimweg ist für Eva unersetzlich. Hier hat sie den Papa ganz für sich allein und muss ihn nicht mit den jüngeren Geschwistern teilen. Hier kann sie ihm ihr Herz ausschütten und ihn um Rat fragen.
Wenn im Sommer die warmen Regengüsse Abkühlung verschaffen, läuft Eva am liebsten barfuß den kleinen Hügel bei ihrem Haus hinauf. In der Hand hat sie kleine gefaltete Papierboote, die sie mit ihren Spielkameraden den Rinnstein um die Wette hinuntersegeln lässt. Bei schlechtem Wetter spielen die Kinder oft endlos »Mensch ärgere Dich nicht«. Eva findet, dass man dabei besonders gut lernt zu verlieren. Noch Jahre später wird sie sich an diesen Gedanken erinnern. In den Wintermonaten lieben es die Kinder, Eimer mit Wasser auf die Straße zu schütten, damit es friert und sie so den kleinen Berg hinunterschlittern können.
Im Garten des Wohnblocks hat die Familie einen kleinen Schuppen, in dem sie Brennholz und Kohlen für den Winter lagert. Hier geht Otto Briskorn auch seiner großen Passion nach, der Taubenzucht. Stundenlang kann Eva dem Vater dabei zuschauen, wie er den Verschlag sauber macht, die Tiere füttert, mit ihnen spricht.
Die Mutter näht die Kleider für die Kinderschar selbst. Sie ist begabt in Handarbeit, strickt und stickt auch. Oft kommen die Mädchen, Eva und ihre Schwestern Sabine und Gisela, zur Mutter und betteln, ob sie ihnen nicht ein neues Kleidchen nähen kann. Hat sich die Mutter schließlich bereit erklärt, kräht Sabine, die Jüngste, zumeist: »Ich bin die Kleinste, du musst das erste Kleidchen für mich nähen!« Bis heute ist Eva das letzte Kleid in Erinnerung, das die Mutter für die Mädchen nähte: im Matrosenstil aus blauem Stoff mit weißem Kragen und einer Stickerei.
Ende der Leseprobe