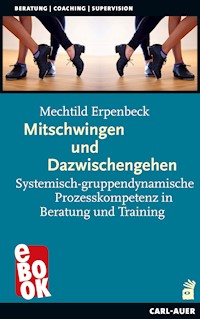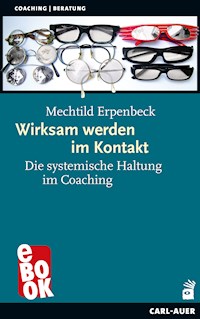
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemische Therapie
- Sprache: Deutsch
Wer Menschen in ihrer Entwicklung begleitet, kommt um eine bewusste innere Haltung nicht herum. Sie ist die Grundlage für die Beziehung zum Gegenüber – von der wiederum der Erfolg jeglicher Beratung abhängt. Wie findet man diese Haltung? Wie sollte sie gestaltet sein? Und wie kann sie, einmal gefunden, dauerhaft lebendig bleiben? Mechtild Erpenbeck führt ihre Leser an ausgewählte Orte, an denen sich die Frage der inneren Haltung immer wieder stellt: Aufmerksamkeit, Verantwortung, Gefühl, Macht, Konflikt lauten einige der Wegmarken. An ihnen wird deutlich: Für alle Motive und Affekte des Gegenübers gibt es stets eine Entsprechung in uns selbst – in unserer Persönlichkeit, in unserer Erfahrung. Unangenehme Selbsterkenntnisse sind auf dieser Erkundungsreise deshalb nicht nur unausweichlich, sondern als Lernerfahrung auch lehrreich und gewollt. Der Blick durch so unterschiedliche Brillen wie Transaktionsanalyse, Schauspiel, Gestalttherapie, Zellbiologie und Psychoanalyse lässt das Phänomen Haltung allmählich klarer werden. Berater und Coachs stärkt das auf eine Weise, wie es kein Tool und keine Technik vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Reihe »Beratung, Coaching, Supervision«
Die Bücher der petrolfarbenen Reihe Beratung, Coaching, Supervision haben etwas gemeinsam: Sie beschreiben das weite Feld des »Counselling«. Sie fokussieren zwar unterschiedliche Kontexte – lebensweltliche wie arbeitsweltliche –, deren Trennung uns aber z. B. bei dem Begriff »Work-Life-Balance« schon irritieren muss. Es gibt gemeinsame Haltungen, Prinzipien und Grundlagen, Theorien und Modelle, ähnliche Interventionen und Methoden – und eben unterschiedliche Kontexte, Aufträge und Ziele. Der Sinn dieser Reihe besteht darin, innovative bis irritierende Schriften zu veröffentlichen: neue oder vertiefende Modelle von – teils internationalen – erfahrenen Autoren, aber auch von Erstautoren.
In den Kontexten von Beratung, Coaching und auch Supervision hat sich der systemische Ansatz inzwischen durchgesetzt. Drei Viertel der Weiterbildungen haben eine systemische Orientierung. Zum Dogma darf der Ansatz nicht werden. Die Reihe verfolgt deshalb eine systemisch-integrative Profilierung von Beratung, Coaching und Supervision: Humanistische Grundhaltungen (z. B. eine klare Werte-, Gefühls- und Beziehungsorientierung), analytisch-tiefenpsychologisches Verstehen (das z. B. der Bedeutung unserer Kindheit sowie der Bewusstheit von Übertragungen und Gegenübertragungen im Hier und Jetzt Rechnung trägt) wie auch die »dritte Welle« des verhaltenstherapeutischen Konzeptes (mit Stichworten wie Achtsamkeit, Akzeptanz, Metakognition und Schemata) sollen in den systemischen Ansatz integriert werden.
Wenn Counselling in der Gesellschaft etabliert werden soll, bedarf es dreierlei: der Emanzipierung von Therapie(-Schulen), der Beschreibung von konkreten Kompetenzen der Profession und der Erarbeitung von Qualitätsstandards. Psychosoziale Beratung muss in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden. Vom Arbeitgeber finanziertes Coaching muss ebenso wie Team- und Fallsupervisionen zum Arbeitnehmerrecht werden (wie Urlaub und Krankengeld). Das ist die Vision – und die politische Seite dieser Reihe.
Wie Counselling die Zufriedenheit vergrößern kann, das steht in diesen Büchern; das heißt, die Bücher werden praxistauglich und praxisrelevant sein. Im Sinne der systemischen Grundhaltung des Nicht-Wissens bzw. des Nicht-Besserwissens sind sie nur zum Teil »Beratungsratgeber«. Sie sind hilfreich für die Selbstreflexion, und sie helfen Beratern, Coachs und Supervisoren dabei, hilfreich zu sein. Und nicht zuletzt laden sie alle Counsellors zum Dialog und zum Experimentieren ein.
Dr. Dirk RohrHerausgeber der Reihe »Beratung, Coaching, Supervision«
Mechtild Erpenbeck
Wirksam werden im Kontakt
Die systemische Haltung im Coaching
Vierte Auflage, 2021
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe »Beratung, Coaching, Supervision«
hrsg. von Dirk Rohr
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlagmotiv: Schwabrillon 2016
Umschlagfoto: © Uwe Göbel
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Vierte Auflage, 2021
ISBN 978-3-8497-0183-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8076-0 (ePUB)
© 2017, 2021 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. + 49 6221 6438-0 • Fax + 49 6221 6438-22
Inhalt
Vorbemerkung
Einleitung
1Aufmerksamkeit
1.1Zuhören
1.2Staunen
1.3Schweigen
2Augenhöhe
2.1Brille Transaktionsanalyse: Okay-Positionen
2.2Brille Schauspiel: Figurenstudium
3Tabuzone Macht
3.1Die Zone der Organisation
3.2Die Zone des Selbst
4Anerkennen, was ist – reloaded
4.1Die Problembeladenen
4.2Die Turbo-Selbstmanager
5Mit Gefühl
5.1Brille Gestalttherapie: Die Seele berühren
5.2Brille Zellbiologie: Semipermeabilität
5.3Brille Schauspiel: Spielbewusstsein
5.4Brille Psychoanalyse: Gegenübertragung
6Verantwortung
6.1Selbstverantwortung
6.2Fremdverantwortung
6.3Exkurs: Coaching versus Therapie
7Hier und jetzt
7.1In Gruppen
7.2Im Einzelcoaching
7.3Mut zum persönlichen Risiko
8Feedback
8.1Komplimente
8.2Konfrontation
9Die Coachperson ist auch eine
9.1Persönliche Offenheit
9.2Methodentransparenz
9.3Person und Rolle
10Konfliktklärung
10.1Exkurs: Juristerei
10.2Neutralität
10.3Allparteilichkeit
10.4Ein gangbarer Weg
11Schluss mit Ethik
11.1Vom Wert der Werte
11.2Ethische Leitideen
12Back Home
Danksagung
Literatur
Über die Autorin
Vorbemerkung
Sich schreibend zum Geschlecht der Wörter zu verhalten ist ein Drahtseilakt. Einerseits will ich mich gegen die selbstverständliche Ordnung wehren, dass das Allgemeine immer männlich ist und damit das Weibliche immer eine Abweichung bleibt, andererseits bereiten mir die verschiedenen zeitgenössischen Usancen, die Sprache politisch korrekt zu gendern, ein beträchtliches Missbehagen. So habe ich mich zu einem unordentlichen Sowohl-als-Auch entschlossen: dem Versuch, sowohl darauf zu achten, dass nicht alle Coachs und Coachees als »er« in Erscheinung treten, als auch, sprachverstümmelnde Klimmzüge möglichst zu vermeiden. Wenn Sie als Lesende (!) dabei gelegentlich die Stirn runzeln müssen, bitte ich Sie, sich einfach die jeweils andere Sprachform vorzustellen.
Einleitung
»Der Erfolg einer Intervention hängt von der inneren Verfasstheit des Intervenierenden ab.«
C. Otto Scharmer nach Bill O’Brien
Wer Menschen in ihrer Entwicklung begleitet, kommt um eine innere Haltung nicht herum. Sie ist Dreh- und Angelpunkt für Handlungswirksamkeit und berufliche Identität. Die meisten Erfahrungen in Coaching, Training und Beratung mit Einzelpersonen und Gruppen, die Begegnungen mit unterschiedlichsten Unternehmen und Organisationen, samt ihren jeweiligen Kulturen und Führungsleitbildern, führen immer wieder zu diesem Punkt zurück.
Wenn man sich im systemischen Ansatz zu Hause fühlt und sich dort nach dem Stellenwert der inneren Haltung umschaut, scheint diese so etwas wie ein Phantom zu sein, eine Art Hausgeist: Man weiß nicht so genau, in welcher Ecke sie wohnt und wann und wie sie sich zeigt, aber im Haus dreht sich ganz viel um sie. Unstete Blicke wandern in die dunklen Ecken der Boudoirs und Salons. Brillen werden hastig aufgesetzt, wenn ein Schatten vorbeihuscht, oder sie werden verstohlen abgesetzt, weil es manchmal besser ist, nicht hinsehen zu müssen. Man versammelt sich zu gediegenen Runden in der Bibliothek und diskutiert wieder und wieder über das Phänomen und seine Implikationen für die Familie und das gesamte Geschlecht. Die einen vertreten in gesetzten Worten den Standpunkt, die Haltung markiere den entscheidenden Unterschied zwischen den verschiedenen Coachingschulen, die anderen streiten mit bemerkenswert ideologischem Ernst darüber, ob es überhaupt so etwas wie eine systemische Haltung gibt. So ein Geist passt nicht immer ins Konzept.
So ist es in diesem ehrwürdigen Hause vielleicht angebracht, in bewährter Manier zu fragen: Was würde sie über sich sagen, wenn sie sprechen könnte, die innere Haltung? Woran erkenne ich, dass sie da ist? Was müsste ich tun, um ihr nachhaltig die Tour zu vermasseln? Woran merken es andere, dass sie grad schwächelt? Was gälte es aufzutischen, wenn man sie als temporären Gast einladen wollte? Wie stylt sie sich zu welchen Anlässen? Wer müsste was tun, um sie in die Flucht zu schlagen? Und vor allem: Was fehlt, wenn sie nicht da ist?
Ist eine innere Haltung gar auf der gleichen Ebene zu verstehen wie eine Neurose oder Krankheit, die man ja bekanntlich in ähnlicher Weise »hat«? Zumindest kann man sagen, dass einen ein solches Geschehen nicht »überfällt« oder »heimsucht« wie eine Krankheit. Jedenfalls ist bislang noch kein solcher Fall schicksalhafter Heimsuchung durch eine innere Haltung ruchbar geworden.
Das, was wir so nennen, konzeptualisieren wir anders, prozesshafter: als etwas, das einem zuwächst, in das man hineinfindet. Man erarbeitet sie sich – vielleicht im Zuge einer Ausbildung –, man nimmt sie an, man formt sie, in ihr bilden sich Lebenserfahrung und persönliche Wertebindung ab. Sie ist das unsichtbare Kondensat des professionellen Könnens.
Instrumente und Techniken anzuwenden ist nicht schwer, das lernt sich schnell. Und da dies der sichtbare Teil im Handeln eines Coachs ist, verwechselt man oft die Kunst mit dem Handwerk. A fool with a tool is still a fool.
Wie aber finde ich denn in eine professionelle Coachinghaltung hinein? Wie steuere ich mich selbst dahingehend? Was daran hat mit dem systemischen Denken zu tun und was nicht? Oder auch: Gibt es ein systemisches Fühlen? Was und wie sollte ich empfinden, wahrnehmen und denken können? Wie kann sich meine Aufmerksamkeit gleichermaßen nach außen wie nach innen richten? Wie spreche ich mit mir, um mich immer wieder neu und mit aufrichtigem, wachem Interesse meinen wechselnden Coachees zu widmen? Wie justiere ich immer wieder neu, ob ich mein Gegenüber innerlich wirklich auf Augenhöhe habe? Wie schaffe ich aus mir heraus eine echte Begegnung, eine gedeihliche Koppelung mit der jeweiligen Person? Wie viel Distanz, wie viel Nähe ist gut? Wie gehe ich mit meinen eigenen Affekten um? Was mache ich ggf. mit Abneigung, Langeweile, Kontrollgelüsten, Angst, Abwertung, Unterlegenheitsgefühl, Verwirrung, Ratlosigkeit, Wertekonflikten oder Anziehung? Welche Verantwortung habe ich? Wie kann es mir gelingen, selber in jedem Moment in der Unmöglichkeit die Möglichkeit im Blick zu haben? Wie kann ich durch mein So-Sein dazu beitragen, dass mein Gegenüber berührt wird und in Kontakt mit sich selber kommt? Wie genau bildet sich die viel beschworene Neutralität als Grundhaltung innerlich ab, wie kann ich sie überprüfen, korrigieren? Wie halte ich bei all dem meine Denkweise elastisch und lebendig?
Der professionelle Umgang mit den hier aufgeworfenen Fragen ist zweifelsohne eine unverzichtbare Grundvoraussetzung für erfolgreiches Handeln. Nur findet sich dafür nicht so leicht eine Sprache. Für all das, was Fragen der inneren Verfasstheit angeht, ist die systemische Begrifflichkeit nicht wirklich gemacht, und das Angebot ist entsprechend mager. Da diese Brille also dem gewünschten Durchblick nicht immer hinlänglich zustattenkommt und die Vielbrillerei ja zu unseren ehrwürdigen Prinzipien gehört, so mag es erlaubt sein, in den folgenden Überlegungen bisweilen auch auf die alten, dicken, klobigen Brillen zurückzugreifen, durch die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon so manches im Berufsfeld der Beratung theoretisch betrachtet wurde. Auch ein paar aktuellere, leichtere und schickere Modelle werden zum Einsatz kommen. Die Erfahrung der Praxis lehrt, dass das situative Tragen all dieser Brillen eine signifikante Erhöhung der Handlungsoptionen bietet. Es gilt, sich aus dieser Kollektion mit Bedacht – je nach den aktuellen Sichtverhältnissen – zu bedienen, und sie einer systemischen Perspektive zur Verfügung zu stellen. Anders gesagt: Die Neubewertung und Inklusion von Theorien, Ansätzen und Werkgeheimnissen unterschiedlicher Professionsfelder kann für eine spannende Reise über viele Denkgrenzen hinweg sorgen.
Diese Reise – oder sagen wir: diese eine von vielen möglichen anderen Reisen – soll im vorliegenden Buch angetreten werden, mit all den erwähnten Brillen im Gepäck.
Stellen Sie sich sozusagen auf eine kleine eklektische Landpartie ein, die zu ausgewählten Orten führt, an denen sich die Frage der inneren Haltung immer wieder neu aktualisiert – gleichermaßen als Problem wie als Lösung. Immer in der Hoffnung, dass sich auf diese Weise unversehens das Rätsel um den berühmten Hausgeist erhellt. Reisen bildet ja, wie man weiß. Der Fairness halber möchte ich für alle dem Unterfangen Zugeneigten hier noch schnell zu bedenken geben, dass die Reiseleitung keinerlei Anspruch auf flächendeckende Landeskenntnis erhebt. Nach aufregenden und weitschweifenden Expeditionen in die verzweigten Gefilde der theorieproduzierenden Fachwelt schärft sich der Blick für die einfachen Dinge, wächst die Achtung vor den vertrauten, unscheinbaren Orten der heimatlichen Umgebung. Die Einsicht, dass viele Schätze schon immer direkt vor der eigenen Nase lagen, hatte zugegebenermaßen Einfluss auf die Reiseroute. Für veritable Abenteurer ist dieser Ausflug also vielleicht nicht das Richtige, eher schon für interessierte Flaneure und notorisch Neugierige.
Beim Schreiben habe ich mir junge Kolleginnen und Kollegen vorgestellt, für die die Tour interessant sein könnte – vielleicht besonders solche, deren systemische Ausbildung noch ganz frisch ist. Aber auch Resonanz bei den alten Hasen im Kollegenkreis ist denkbar, zumal bei jenen, die auf einer ähnlichen Suche sind.
Die mit den Kapiteln vorgegebene Route ist nicht zwingend. Wie bei den Routenvorschlägen eines Reiseführers ist die Abfolge und Komposition der Stationen zwar mit Bedacht gewählt, man kann bei gutem Orientierungssinn den Weg aber auch anders herum gehen, Teilstrecken auswählen oder nur einzelne Stationen besuchen. So können Sie in diesem Buch ganz nach Gusto herumspazieren.
Alles in allem ist das Buch so etwas wie ein Brevier der professionellen Achtsamkeit. Als solches taugt es hoffentlich dazu, dass Sie es hin und wieder aufklappen, um einen Gedanken herauswehen zu lassen, der sich in eine Inspiration oder eine Erinnerung an einen Vorsatz verwandelt.
1Aufmerksamkeit
Beginnen wir also die Reise und sammeln uns am Ausgangspunkt. Alles Gesagte wird von Beobachtenden gesagt. So, leicht abgewandelt, lautet der systemische Hauptsatz. Das kann doch in einer ersten, ganz einfachen Konsequenz nur bedeuten, dass die Beobachtung, die die Weichen für jede Interaktion stellt, unter Beobachtung gehört. Erste Bürgerpflicht für Coachs ist es demnach, die eigene Aufmerksamkeit zu kultivieren und zu professionalisieren. Lange, bevor ich überhaupt handle – sei es sprachlich, sei es nichtsprachlich –, hat sich meine Aufmerksamkeit schon einen Fokus gesucht, eine Perspektive auf das zu beobachtende Geschehen. Was ich in den Blick nehme und was nicht, mit welchen eigenen Erfahrungen ich Wahrgenommenes auflade und in welche innere Schublade es dadurch gerät, das alles sind in der Regel Abläufe in meinem geistig-seelischen System, die sekundenschnell und auch weitgehend unwillkürlich vonstattengehen.1 Und weil das so ist, bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als zum einen die eigene Beobachtung zu beobachten, um gegebenenfalls Einfluss nehmen zu können, und zum anderen die Aufmerksamkeit für alles, was im Außen passiert, so weit wie nur möglich aufzuspannen. Energy flows where attention goes. Es gilt, dafür zu sorgen, so aufnahmefähig und aufnahmebereit zu sein, dass wir immer über mehrere Möglichkeiten des Verstehens verfügen. Je mehr, desto besser. Dazu gehört schon ein gerüttelt Maß an innerer Arbeit.
1.1Zuhören
Ohne die Fähigkeit zuzuhören geht in der Kommunikation gar nichts. Im Coaching noch weniger. Zuhören ist so etwas wie die Grundstellung im Tanz mit den Coachees. Aber schon hier können wir unversehens stolpern. Gäbe es eine Methode, die Gedanken und Gefühle eines Coachs während des stillen Zuhörens in einer beliebigen Coachingsitzung sichtbar zu machen, es ließe sich im Handumdrehen eine Aussage über die Qualität des Coachings machen. Da hat sie noch gar nichts getan. Es wurde noch nichts gesagt, keine Fragetechnik oder Methode angewandt, keine Intervention gesetzt – nichts.
Was geschieht auf unserer inneren Bühne beim Zuhören? Zunächst einmal gilt es, gewahr zu werden, ob sie überhaupt angemessen frei ist. Oder ob dort vielleicht noch ein ganz anderes Stück in vollem Gange ist: turbulente Gedanken und Gefühle aus meinem privaten Erleben, die nachdenkliche Beschäftigung mit der vorhergehenden Coachingsitzung, tiefe Sorge um den Weltfrieden – was immer es sei. Etwas davon ist eigentlich immer da. Schließlich können wir den Strom unserer inneren Bilder, Gedanken und Gefühle nicht abschalten. Wir können nicht nicht denken, solang wir nicht tot sind oder im Koma liegen.
Um das Gewahrsein aus der Beschäftigung mit anderen Dingen herauszuholen, und möglichst plastisch in die Begegnung mit dem Klienten hineinzulenken, hilft es, die Erscheinung dieser Person aufmerksam zu betrachten. Das heißt, von Kopf bis Fuß hinzuschauen. Was strahlt die Person für eine Energie aus? Welchen Unterschied zur letzten Sitzung/zum ersten Händedruck nehme ich wahr? Wie würde ich die Person heute mit einer Metapher beschreiben? Stiller Bergsee, öde Landschaft, brodelnder Vulkan, trauriger Clown, verschreckte Prinzessin, Panzerschrank, zerlaufende Uhr – was auch immer als Erstes kommt. Selbst wenn sich in dieser kleinen gesteuerten Hinwendung zu meinem Gegenüber kein klares Bild formt, so habe ich mich doch wenigstens einen intensiven Moment lang mit meiner Wahrnehmung der Person beschäftigt und kann mir sogar schon mal meine ersten Fantasien bewusst machen. Sich eine solche Betrachtung des Menschen zu erlauben – so, wie man auch ein Kunstwerk aufnehmend betrachtet, es für sich weiterspinnt, es intuitiv für sich übersetzt, sich inspirieren lässt, unwillkürlich Vergleiche und Assoziationen bemüht –, das ist eine vortreffliche mentale und emotionale Rutsche in die angemessene offene Aufmerksamkeit einer Person gegenüber.
Manchmal scheint es, als wenn in Systemikerkreisen die Abneigung gegen jedwede Deutung und Diagnostik dazu führt, dass man den Nutzen der Fantasie und den Reichtum der inneren Resonanz auf Wahrgenommenes tendenziell aus dem Blick verliert – nicht unbedingt in Bezug auf die Klienten, wohl aber in Bezug auf die Professionellen, die Beratenden, Coachs und Therapeuten selbst.
Folgendes ließe sich dazu denken: Wenn man die Sache mit der nicht wirklichen Wirklichkeit ernst nimmt, wenn also all das, was wir für gegeben halten, lediglich unsere Sicht der Dinge spiegelt, dann, ja dann fällt auch bereits dieser Gedanke darunter, denn er konstruiert in seiner Schlüssigkeit eine Realität. Dann gilt das für alle gedachten Gewissheiten – auch die systemischen! Dann sind all unsere »Erkenntnisse« nichts weiter als das, was wir aus unserer jeweiligen Welterfahrung zusammenbauen, um uns zu der Welt unseres Gegenübers ins Verhältnis setzen zu können. Nichts von dem, was wir zu erkennen glauben, hat in diesem Sinne Anspruch auf Gültigkeit. Auch wenn wir gerade besonders schlau darüber nachdenken können. Wie in diesem Moment zum Beispiel. So funktioniert doch konsequent angewandte Rekursivität. Das mag verwirrend und paradox klingen, gleichzeitig haben diese Gedanken etwas sehr Tröstliches: Auch wenn ich mich noch so sehr bemühe, komme ich aus der omnipräsenten Klemme nicht raus. Was tun? Machen wir was daraus! Seien wir so kreativ wie möglich, spielen wir mit Ideen und teilen sie einander mit, erfinden wir, spinnen wir, brauen wir etwas zusammen und prüfen dann gemeinsam, ob’s zu was taugt. Wenn nicht, dann nicht. Diese Haltung in Verbindung mit einem grundsätzlich achtungsvollen Umgang im professionellen Tun kann nur fruchtbar und zieldienlich ist.
In jeder Begegnung wird uns eine Fülle an »Material« geliefert. Von der ersten Sekunde an erhalten wir von unserem Gegenüber eine große Menge an Signalen, sprachliche wie körpersprachliche. Wobei die sprachliche Seite in der Regel relativ bewusst von der Person gesteuert wird, die körperliche hingegen weniger. Es ist für uns also besonders interessant, die Körpersprache der Coachees wahrzunehmen. Der körperliche Ausdruck mit all seinen Bewegungsfeinheiten und die Stimme mit ihrer Modulationsfähigkeit bilden – bezogen auf den Versuch, einen Menschen zu »lesen« – die mit Abstand verlässlichste Datenbasis. Nicht der Text ist wichtig, sondern der Subtext, denn darin ist die wichtigere Botschaft verborgen. Nun machen sich die ganz Eifrigen mit großer Konzentration und Akribie an diese Aufgabe heran. Jedes Wort, jeder Ton in der Stimme, jeder Blick, jedes Augenzucken oder Fußwippen wird genauestens registriert und klassifiziert,2 damit bloß keine verschlüsselte Information verloren geht. Das führt in der Regel dazu, den Kontakt zu der Person eher zu verlieren, als zu gewinnen. Nicht detailversessene Fokussierung, sondern eine gelenkte Defokussierung könnte zieldienlich sein. Gerade weil wir unwillkürlich geneigt sind, in einem Aufmerksamkeitsfokus »einzurasten«, braucht es als Gegenmittel einen entspannten, eher unscharfen Blick, eine weite, schweifende, gleichsam periphere Wahrnehmung. Nicht die einzelnen Bäume sind wichtig, sondern der Wald. Nicht die einzelnen Töne, sondern die gesamte Melodie.
Die Psychoanalytiker nennen das »freischwebende Aufmerksamkeit«. Sie sind Meister in dieser Art des Zuhörens. Allerdings gleicht der Vollzug in der Praxis bisweilen eher dem Beuteflug des Adlers: still in großer Höhe schwebend kreisen und gelassen beobachten, was sich am Boden so bewegt, und plötzlich im Sturzflug nach unten und geschickt die Beute gepackt. Das ist dann eine sogenannte »Deutung«. Und die kann gegebenenfalls fast so sehr wehtun wie die Krallen des Adlers im Nacken der Maus – zumindest dann, wenn sie zu früh vollzieht, was im psychoanalytischen Sprachjargon »einen unbewussten Anteil bewusst machen« heißt.
Dennoch hat der Terminus »freischwebende Aufmerksamkeit« Charme und beschreibt das Gebot der Stunde ausgesprochen plastisch und genau. Es geht um ein achtsames Zuhören, das sich nicht eng und kognitiv auf die Inhalte und ihre Bedeutung konzentriert, sondern eher weit und assoziativ ist – alle Eindrücke einschließend, die mir in dem Moment durch die sprechende Person zuwachsen. Sprachliche und nichtsprachliche Eindrücke zeitigen eine Resonanz in mir. Diese Resonanz stetig wahrzunehmen ist ein wesentlicher Teil der freischwebenden Aufmerksamkeit. Was empfinde ich, wenn ich das höre? Welche Antwort in mir findet der Ton, in dem mein Gegenüber spricht? Welche Bilder, Gedanken, Körperempfindungen entstehen in mir, wenn ich das höre und sehe? Welche »unerhörte« Geschichte erzählen mir die Kopfbewegungen? Was davon möchte ich gern in ein Schatzkästchen bergen, um an geeigneter Stelle daran erinnern zu können? Wie spinne ich unwillkürlich die Geschichten weiter, die nur angedeutet werden? Wie fügt sich das jetzt Gehörte mit schon Vorhandenem zusammen?
Eine volle Aufmerksamkeit hat also genau genommen immer vier Dimensionen:
•Das über meine Sinneskanäle unmittelbar im Außen Wahrnehmbare: Was sehe/höre/rieche/taste/schmecke ich hier und jetzt?
•Die Resonanz in meiner eigenen Innenwelt: Was löst das in mir aus?
•Die Fantasien und Hypothesen zur abwesenden Außenwelt des Gegenübers: Wie stelle ich mir das Erzählte szenisch vor?
•Die Fantasien und Hypothesen zum inneren Erleben meines Gegenübers: Was haben die berichteten Szenen in meinem Gegenüber ausgelöst? Welche Empfindungen, Fantasien, Bewertungen sind wohl für sie/ihn damit verbunden?
Diese Art von »freischwebender Aufmerksamkeit« ist ein zugewandter, der sprechenden Person ergebener, und gleichzeitig sehr freier, kreativer Akt. Ein Oszillieren zwischen dem Abtauchen in die fremde Innenwelt bzw. dem »Mitträumen«3 und einem bewussten Beobachten, Erklären, Einordnen. Eine innere Verfasstheit, die mir alles erlaubt, selbst die schrägsten Assoziationen – sofern ich sie bewusst als Fantasie bzw. Hypothese betrachten und gegebenenfalls als solche zur Verfügung stellen kann. Später auf unserer Reise werden wir an einigen Möglichkeiten vorbeikommen, wie sich solche Interventionen gestalten lassen. Zunächst einmal gilt es, diese Aufmerksamkeit als ein stetes Training für das Bewusstsein zu verstehen, dass es hier zwar um Wahr-Nehmung, nicht aber um Wahr-Heit geht. Also, um mit Gunther Schmidt zu sprechen: um »Wahr-Gebung«.
1.2Staunen
Kleine Kinder können es: vor einem Menschen stehen – z. B. im Gang der U-Bahn –, regungslos, mit großen Augen, völlig entspannten Gesichtszügen und offenem Mund, selbstvergessen in der Betrachtung des Gegenübers. Keinerlei eigene Regung, nicht die Spur einer Reaktion, eines mimischen Kommentars, eines eigenen Affekts. Das pure Staunen. Diese Ur-Form des Schauens ist noch radikaler, geht noch tiefer als die oben beschriebene Art der Aufmerksamkeit, die ja zu eigener Aktivität anregt, zu Fantasien, Gedanken und Assoziationen. Das kindliche Staunen aber ist das vollständige In-sich-Aufnehmen des Anderen, des Fremden. Es ist, als wenn sich der eigene Innenraum einen stillen Moment lang ins Unendliche hinein dehnt, um der unbekannten Dimension eines anderen Universums Raum zu geben.
So pur, wie wir als Kind staunen konnten, so wird es als erwachsener Mensch wohl nie wieder werden. Nur noch selten erleben wir diesen Zustand vollständiger Versenkung. Es müssen schon erhabene Momente sein: ein Naturschauspiel, ein technisches Wunderwerk, ein überwältigendes Zeugnis für die kulturschaffende Kraft der Menschheit. Dann geschieht es einen Wimpernschlag lang doch: dass in uns nichts, aber auch gar nichts anderes ist als die Hingabe an das, was unsere Sinne wahrnehmen. Und da wir offenbar prinzipiell dazu in der Lage sind, müssten wir den Zugang zu der entsprechenden Ressource finden können. So scheint es doch durchaus möglich, sich auch bei kleineren Anlässen diesem inneren Zustand zu nähern – zum Beispiel in der Begegnung mit einem Menschen, der ins Coaching kommt.
Im Coachingdiskurs geistert allenthalben der Anspruch herum, man müsse im Umgang mit den Klienten eine »absichtslose« Haltung einnehmen. Dieser Begriff kann leicht irreführen. Es liegt ihm eine Verwechslung zugrunde: »Eine Absicht haben« muss nicht zwangsläufig gleichbedeutend sein mit »ein eigenes Ziel verfolgen« oder »eigene Interessen haben«. Das intentionale Handeln beginnt an einer ganz anderen Stelle: Sobald ich aktiv werde, etwas sage oder tue, habe ich zwangsläufig irgendeine Leitidee, die mich in der Wahl der Kommunikationsformen und Interventionen orientiert. Insofern habe ich durchaus eine »Absicht«. Und wenn es nur die dem Coaching ganz grundsätzlich innewohnende Absicht ist, Impulse zu setzen, die die Coachees beim Finden ihrer eigenen Lösung unterstützen. So ist es nicht nur unumgänglich, sondern auch notwendig, sich diese Metaabsicht im Bewusstsein zu halten.
Die einzigen Momente echter Absichtslosigkeit sind vielleicht die kurzen Momente des Staunens. Und damit ist auch etwas anderes als die systemisch-professionelle Grundhaltung gemeint, die beschriebenen Phänomene als anerkennenswerte Anpassungsleistungen zu verstehen. Das Staunen kommt sozusagen aus einem anderen inneren Raum.4 Es gibt vieles, worüber es sich im Coaching staunen lässt: zum