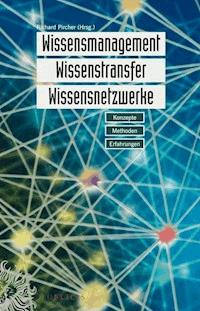
37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch fasst den Stand von Wissensmanagement praxisorientiert zusammen; es richtet sich an Führungskräfte aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen oder Non-Profit-Organisationen, sowie an alle anderen Personen, die sich mit wissensorientiertem Management befassen, zum Beispiel aus HR, F&E, IT, Marketing oder Verwaltung und Controlling. Kompakte Beiträge - geschrieben aus Sicht der Unternehmen - bieten Überblick über Wissens-management, Wissenstransfer, Wissenssicherung, effektives Auffinden von Wissen und Wissenscontrolling/Wissensbilanz. Ein wesentlicher Aspekt liegt in der Darstellung von Querbeziehungen zu verwandten Managementansätzen wie Qualitäts-, Prozess- und Projektmanagement, soziale Netzwerke, Innovation und ethisches Management.
Fallbeispiele zeigen unter anderem auf, wie der Wissensabfluss durch Pensionierungen oder Kündigungen reduziert werden kann, welcher Prozess die effektive Weitergabe von Erfahrungswissen unterstützt, wie Wissen für die Organisation in einem Wiki gesichert wird, wie vorhandenes Wissen schnell aufgefunden werden kann, wie Lernprozesse heute funktionieren, wie die Herausforderungen durch das Internet beantwortet werden oder wie eine Wissensbilanz die Entwicklung des intellektuellen Kapitals einer Organisation misst. Dabei werden auch Aspekte wie das Überwinden von Hürden, erzielter Nutzen, Begleitmaßnahmen und Folgeschritte behandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Wissensmanagement, Wissenstransfer, Wissensnetzwerke
Konzepte, Methoden, Erfahrungen
von Richard Pircher (Hrsg.)
ISBN 978-3-89578-722-5 (EPUB)
Vollständige EPUB-Ausgabe von Richard Pircher (Hrsg.), Führungskompetenz
ISBN 978-3-89578-436-1 (Printausgabe 2014)
Verlag: Publicis Publishing, Erlangen
www.publicis-books.de
© 2014 Publicis Erlangen, Zweigniederlassung der PWW GmbH
Inhaltsverzeichnis
Überblick
1 Organisatorisches Wissensmanagement
Um welches Wissen geht es?
(Wie) Kann Wissen gemanagt werden?
Einführung von Wissensmanagement: Schritt für Schritt
Methoden und Instrumente des organisatorischen Wissensmanagements
Weiterführende Literatur
2 Persönliches Wissen und persönliches Wissensmanagement
Wahrnehmung, Wissen, Handlungsmöglichkeiten
Was bedeutet persönliches Wissensmanagement?
Wie kann persönliches Wissensmanagement umgesetzt werden?
Operative Zielsetzungen
Weiterführende Literatur
3 Änderungsmanagement in einem wissensintensiven KMU
Ausgangssituation, Ist-Analyse, Problemstellung
Umsetzungs-, Implementierungsprozess
Unerwartete Ereignisse, Erfahrungen, Lessons Learned
Erzielter Nutzen
Folgeschritte, Weiterentwicklung, Aussichten
4 Entwicklung und Umsetzung einer Wissensstrategie
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen
Ausgangssituation, Ist-Analyse, Problemstellung
Entwicklung des Wissensstrategieprozesses
Einsatz des Wissensstrategieprozesses
Das Vorgehen im Wissensstrategieprozess
Erläuterung des Wissensstrategieprozesses
Lessons Learned
Erzielter Nutzen
Vorteile des Wissensstrategieprozesses
Andere relevante (Teil-)Projekte innerhalb der Organisation, Koordinationsmaßnahmen
Folgeschritte, Weiterentwicklung, Aussichten
Weiterführende Literatur
5 Marketingwissen schneller finden und vernetzen
Transparenter, effizienter und besser
Ausgangssituation, Ist-Analyse, Problemstellung
Umsetzungs-, Implementierungsprozess
Von der Werbeabteilung zu einer lernenden Marketingorganisation
Die Spielregeln zum Leben erwecken
Loslassen, Quick-Wins umsetzen
Unerwartete Ereignisse, Erfahrungen, Lessons Learned
Erzielter Nutzen
Andere relevante (Teil)Projekte
Folgeschritte, Weiterentwicklung, Aussichten
Anhang
6 Implementierung von Yellow Pages als Ausgangspunkt für eine unternehmensweite Wissensträgerkarte in der Raiffeisen Informatik
Ausgangssituation, Ist-Analyse, Problemstellung
Umsetzungs-, Implementierungsprozess
Unerwartete Ereignisse, Erfahrungen, Lessons Learned
Erzielter Nutzen
Andere relevante (Teil)Projekte innerhalb der Organisation und Koordinationsmaßnahmen
Folgeschritte, Weiterentwicklung, Aussichten
7 Durch Storytelling implizites Projektwissen heben und weitergeben
Ausgangssituation
Die Methode Storytelling im Überblick
Kernerkenntnisse
Erzielter Nutzen
Weiterentwicklung der Methode zu „Storytelling One Day“
Integration in einen Lessons-Learned-Prozess
Weiterführende Literatur
8 Strukturierter Transfer von Erfahrungswissen zur kontinuierlichen Organisationsentwicklung: Methodik in Theorie und Praxis
Unternehmensinternen Wissensfluss optimieren
Ausgangslage
Wissenslücke bei Mitarbeiterwechsel
Optimierte Wissensweitergabe – möglichst kleine Wissenslücke bei Mitarbeiterwechsel
Optimierte Wissensweitergabe: Wissenstransfer bei der Credit Suisse im Detail
Bisherige Erfahrungen und Nutzen
9 Mehrwert schaffen durch interorganisationale Wissensgemeinschaften
Ausgangssituation
Die Wissensgemeinschaft im Überblick
Erfahrungen (Lessons Learned)
Erzielter Nutzen
10 Wissensmanagement powered by „Wiki“: die „Wiki-Landschaft“ der reinisch AG
Ausgangssituation, Ist-Analyse, Problemstellung
Umsetzungsprozess
Anwendungsbeispiele für Wikis in der reinisch-Landschaft
Unsere Erfahrungen, Lessons learned
Erfahrungen aus der Praxis: Aspekte für eine erfolgreiche Einführung
Erzielter Nutzen
Koordinationsmaßnahmen, Folgeschritte
11 Enterprise 3.0: Über die Rolle semantischer Technologien und interoperabler Metadaten
Semantische Technologien und das Semantic Web im Kontext des unternehmerischen Einsatzes
Semantische Suche: Informationsvernetzung statt simpler Suche nach Dokumenten
Corporate Semantic Web – Semantic Web in Unternehmen: Einsatzszenarien und Anwendungsfälle
Use Case 1: Mitarbeiterportal
Use Case 2: Agile Datenintegration und integrierte Sichten auf Geschäftsobjekte
Use Case 3: Content Augmentation
Use Case 4: Market Intelligence
Linked Data als Diversifikationstreiber in Service-orientierten Unternehmen
Ausblick: Die Bedeutung eines globalen, dezentral organisierten Wissensraums für ein Corporate Semantic Web
Weiterführende Literatur
12 Einführung einer Wissensbilanz in einem Profit-Center eines produzierenden Unternehmens
Zielsetzung des Projekts
Ausgangssituation, Ist-Analyse, Problemstellung
Umsetzungs-, Implementierungsprozess
Zielsetzung und Systemabgrenzung
Identifikation strategisch wichtiger Einflussfaktoren aus dem intellektuellen Kapital
Bewertung des Istzustandes der Einflussfaktoren
Analyse von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen
Maßnahmenfindung
Maßnahmendurchführung
Unerwartete Ereignisse, Erfahrungen, Lessons Learned
Erzielter Nutzen
Folgeschritte und Weiterentwicklung
13 Soziale Netzwerkanalyse in Organisationen – versteckte Risiken und Potenziale erkennen
Entstehung der Sozialen Netzwerkanalyse
Organisationale Netzwerkanalyse
Möglichkeiten der Datengewinnung
Praktische Durchführung einer ONA
Anwendungsszenarien
Ausblick
Weiterführende Literatur
14 Optimierung von Global Leadership durch die Analyse sozialer Netzwerke
Fragestellung und Rahmenbedingungen
Zielsetzung
Methode
Ausgangssituation, Ist-Analyse, Problemstellung
Umsetzungsprozess
Unerwartete Ereignisse, Erfahrungen, Lessons Learned
Erzielter Nutzen
Folgeschritte, Weiterentwicklung
Ausblick und Lessons Learned
15 Teamarbeit in einem IT-Unternehmen – die Bedeutung computergestützter sozialer Netzwerke für Kooperationsleistungen
Rahmenbedingungen, Problemaufriss
Umsetzung
Methoden
Ergebnisse
Fazit
16 Innovationsmanagement
Grundlagen des Innovationsmanagements
Kernelemente des Innovations- bzw. Technologiemanagements
Erfolgsfaktoren eines umfassenden Innovationsmanagements
Fazit
Weiterführende Literatur
17 Warum Innovation von innen heraus entstehen muss
Fragen aus der Zukunft
Die Perspektive des Wissens und die Erzeugung neuen Wissens
Innovation als Königsdisziplin der Wissensarbeit
Formen der Innovation im Zusammenspiel
Innovation ermöglichen
Fazit: Innovation emergiert aus dem Inneren heraus
18 Unterstützung von Wissensarbeit und Open Innovation mittels Web 2.0 am Beispiel der Ideenplattform Neurovation
Die Bedeutung der Wissensarbeit
Ideenmanagement 2.0
Die Ideenplattform Neurovation (www.neurovation.net)
Fazit
19 Open Innovation – Nutzung internen und externen Wissens für den Innovationsprozess
Ausgangssituation, Ist-Analyse, Problemstellung
Umsetzungsprozess
Unerwartete Ereignisse, Erfahrungen, Lessons Learned
Erzielter Nutzen
Folgeschritte, Weiterentwicklung, Aussichten
20 Ethik-Management als Instrument der nachhaltigen Wertschöpfung
Das Unternehmen als „öffentlich exponierte Organisation“
Stakeholder-Ansatz und Organisationsethik
Ethik-Management, Wissensmanagement und Nachhaltigkeit
Résumé
Die Autorinnen und Autoren
Quellenverzeichnis
Überblick
Daten und Informationen können als Impulse von außen dazu führen, dass im Inneren Verarbeitungsprozesse ausgelöst werden. Diese Prozesse ermöglichen den Aufbau von Vernetzungen und von inneren Strukturen. Diese Strukturen wiederum bilden die Grundlage für Handlungen und Entscheidungen. Je adäquater Handlungen und Entscheidungen auf die Umwelt abgestimmt werden, und je differenzierter und komplexer das Verhalten deshalb gestaltet werden kann, umso höher ist dessen Erfolgsaussicht.
Dieser Prozess findet laufend im Menschen statt, indem sich durch Stimuli die Neuronen im Gehirn vernetzen. Daten oder Informationen an sich bilden noch keine Grundlage für zielführende Handlungen – sie werden noch nicht gewusst. Erst vernetzte, neuronale Strukturen stellen Erwartungshaltungen der Umwelt gegenüber dar und wirken sich damit auf das Verhalten aus.
Ein ähnlicher Prozess läuft auch in Organisationen ab. Zahlreiche Daten werden erfasst, gefiltert, interpretiert und mit bestehendem Wissen in der Organisation vernetzt. Man leitet daraus Handlungen ab und baut vernetzte organisatorische Wissenstrukturen auf. Dazu gehören beispielsweise geteilte Vorstellungen zu den Wünschen der Kunden, den Strategien der Lieferanten oder den Technologieentwicklungen der nächsten Jahre. Diese organisatorischenErwartungshaltungen sind nicht unabhängig von Menschen, bestehen aber meist weiter, auch wenn Einzelpersonen wechseln.
Bild ADas Zusammenspiel von Lernen und sozialer InteraktionBild BDie Entwicklung neuronaler und sozialer StrukturenKomplexe Fähigkeiten wie Schreiben, Lesen, Radfahren oder die Benutzung einer Software lernen wir meist durch Versuch und Irrtum. Direkt oder indirekt erfolgt Wissenserwerb aber auch immer in der Interaktion mit anderen Menschen, wie beim Unterricht, bei stillschweigendem Nachahmen oder durch andere Hilfestellung (schriftliche Anleitung, Handbuch, Frequently Asked Questions, etc.), die wiederum ein einzelner, „isolierter“ Mensch ohne sozial konstruiertes Vorwissen nicht erstellen könnte. Beim Aufbau von Wissensstrukturen handelt es sich somit in der Regel um das Zusammenspiel von mentalen bzw. neuronalen und sozialen Vernetzungsprozessen (vgl. Bild A).
In zeitlicher Abfolge ergibt sich sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene ein Ablauf aus individuellem Wissensaufbau und sozialen Kontakten und Netzwerken (vgl. Bild B). Diegezielte und strategische Förderung dieses Zusammenspiels individueller und sozialer Wissens-und Vernetzungsprozesse bildet ein Kernthema des vorliegenden Buches.
Besitzt die Organisation die Offenheit und ermöglichenden Rahmenbedingungen, die jene Vernetzungen zulassen und fördern, die notwendig wären, um die Fragen von morgenwahrzunehmen und Antworten darauf zu entwickeln? Erkennt sich die Organisation als Teil eines größeren sozialen und kausalen Netzwerks? Ermöglicht die Organisation Vernetzungen mit Umwelt und Gesellschaft?
•Bild C bietet einen Überblick zu den Inhalten des Buches in der Form der Metapher eines Baumes (vgl. Fokusmetapher Kapitel 2). Den Kernprozessen des Wissensmanagements werden entsprechende Kapitel des Buches zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt nur exemplarisch, weil sich die Kapitel meist auf mehrere Kernprozesse beziehen.Bild CInhaltsverzeichnis in Form der Fokusmetapher „Baum“ (vgl. Kapitel 2)• Entscheidend für die Entwicklung und Produktivität des individuellen und organisatorischen Wissens sind die Rahmenbedingungen, die Wissensarbeiter in Organisationen vorfinden. Ist das organisatorische „Klima“ – z. B. bezüglich Kommunikations- und Fehlerkultur – adäquat für die Ziele der Organisation? Die Gestaltung dieser Rahmenbedingungen wird in Kapitel 1 im Überblick dargestellt und dabei auf die weiteren Kapitel des Buches verwiesen. Die Entwicklung einer Wissensstrategie mit Ableitung von Maßnahmen, sowie die Messung und Steuerung des organisatorischen Wissenskapitals sind Schwerpunkte der Kapitel 3, 4 und 12.• Das persönliche Wissen bildet die Basis und den „Humus“ für jede sinnvolle Handlung in Organisationen. Kapitel 2 thematisiert spezifische Eigenschaften, Herausforderungen und Methoden des Managements des persönlichen Wissens. Eine weitere Grundlage für die Entwicklung organisatorischen Wissens sind Werte, Vertrauensbasis und Kooperationskultur in der Organisation sowie in der Interaktion mit den Stakeholdern, was ein zentrales Thema des in Kapitel 20 skizzierten Ethik-Managements darstellt.• Der Wissenserwerb mit den Schwerpunkten Semantic Web und Integration organisationsexterner Personengruppen wird in den Kapiteln 9, 11, 18 und 19 mit praktischen Beispielen thematisiert.• Die Kapitel 6, 7, 8, 10, 11 und 12 beleuchten unter anderem die Identifikation des in der Organisation vorhandenen Wissens. Dies erfolgte beispielsweise durch ein Verzeichnis des Wissens der Mitarbeiter, die Dokumentation von Lessons Learned aus einem Projekt und den strukturierten Wissenstransfer zwischen Mitarbeitern bei Wechsel und Verlassen des Unternehmens.• Die Repräsentation von Wissen spielt in heutigen Organisationen meist als dicker Ast eine bedeutende Rolle dabei, dass große Früchte entwickelt und bis zur Ernte getragen werden können. Kapitel 5 illustriert die Förderung der Wissensrepräsentation durch die Erarbeitung von „Spielregeln“ in der Form eines ICK-Handbuchs (Information-Communication-Knowledge). Kapitel 10 beschreibt ein Fallbeispiel zum Aufbau einer Wiki-Landschaft.• Für ein dichtes Blätterwerk aus handlungsrelevantem Wissen besitzen Kommunikation und Transfer von Wissen eine entscheidende Funktion. Sie bilden die Schwerpunktthemen der Kapitel 5, 6, 7, 8 und 9. Beispielsweise wird hier der Aufbau einer organisationsübergreifenden Wissensgemeinschaft zur Unterstützung der Wissenskommunikation und Kundenbindung dargestellt.• Wie oben skizziert wurde, üben die sozialen Kontakte und Netzwerke einen wesentlichen Einfluss auf die Bildung von individuellem und organisatorischem Wissen aus. Kapitel13, 14 und 15 widmen sich deshalb der Methode der sozialen Netzwerkanalyse und zeigen auf, wie damit soziale organisatorische Strukturen jenseits der offiziellen Organigramme analysiert, interpretiert und daraus Maßnahmen abgeleitet werden können.• Junge, frische Wissenstriebe und Früchte, die freudige Abnehmer finden, entstehen nur, wenn die Rahmenbedingungen in der Organisation Wissensentwicklung und Innovation fördern. Kapitel 16, 17, 18 und 19 widmen sich diesen Themen unter verschiedenen Gesichtspunkten.• Die Verschiebung der Perspektive vom Shareholder- zum Stakeholderansatz verdeutlicht, dass es für Organisationen immer bedeutsamer wird, ein breiteres Umfeld wahrzunehmen und in die internen Prozesse einzubinden. Die Kapitel 9, 18, 19 und 20 schließen derartige Aspekte – unter anderem unter dem Stichwort „Open Innovation“ – ein.Richard Pircher
„Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.“
Henry Ford
Umsatzeinbruch! Warum und was tun?
Frau Müller hat 17 Jahre Erfahrung als Vertriebsleiterin eines Handelsunternehmens für Spezialmetallwaren. Die Abnehmer sind Hersteller unterschiedlicher Branchen und Handwerkerbetriebe. In den letzten zwei Quartalen sind die Umsätze erstmals seit der Tätigkeit von Frau Müller eingebrochen. In zwei Wochen findet ein Treffen des Führungsteams statt, um die Situation zu analysieren und erste Maßnahmen abzuleiten. Frau Müller sammelt in Vorbereitung für diesen Termin systematisch Daten und analysiert diese. Sie hat rasch bemerkt, dass sie viele Daten ausfiltern muss, weil sie die vorhandene Menge nicht in der verfügbaren Zeit bearbeiten können wird. Obwohl sie sich mit den restlichen Daten tagelang intensiv beschäftigt, kann sie daraus keine eindeutige Gegenstrategie ableiten. Die Daten sprechen keine klare Sprache. Beim Joggen am Wochenende kommt ihr plötzlich ein Gedanke: Sie kann vielleicht über einen Bekannten bei einem Kundenunternehmen hilfreiche Informationen bekommen. Parallel wird sie versuchen, weitere Brancheninformationen zu erhalten und mit Kollegen ihrer Abteilung eine Kreativrunde im Grünen veranstalten. Vielleicht ergeben sich dabei neue Ideen für Ursachen und konkrete Maßnahmen.
Um welches Wissen geht es?
Für die Beantwortung der Fragen braucht Frau Müller einerseits Daten, die sie aus den eigenen Systemen und aus extern bezogenen Studien und Analysen erhält. Diese Daten müssen analysiert werden, um festzustellen, ob daraus glaubwürdige Schlüsse für den Umsatzeinbruch abgeleitet werden können. Die langjährige Praxiserfahrung gibt Frau Müller das Gefühl, ungefähr beurteilen zu können, welche Erklärungen plausibel sind. Aufgrund ihrer Erfahrungen und überlegten Vorgangsweise genießt ihre Meinung bei den Kollegen und der Geschäftsführerin einen hohen Stellenwert.
Welches Wissen und welche Kompetenzen setzen Sie selbst tagtäglich ein, um Ihre Ziele zu erreichen? Wenn Sie sich einige Minuten darüber Gedanken und schriftliche Notizen machen, stoßen Sie vermutlich auf sehr unterschiedliche Arten von Wissen und Kompetenzen. Häufig werden Beispiele genannt wie diese: Fachwissen, Faktenwissen, Kenntnis und Anwendung von Methoden wie Projektmanagement oder Qualitätsmanagement, Praxiserfahrungen, Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenzen, Wissen über die – zum Teil informelle – Organisation, Führungskompetenzen, Intuition, persönliche Kontakte und Netzwerke, Selbstreflexion, etc.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























