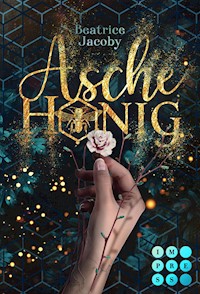5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Der Kampf um die Krone der Hexen hat begonnen** Ophelia beherrscht die Magie der Knochen und kämpft im Geheimen für den Schutz der Menschen. Doch als das Oberhaupt der Magier stirbt, wird der Zauber, der die Dämonen von unserer Welt fernhält, brüchig. Ein nahezu unbesiegbarer Feind hat seinen Weg in die Menschenwelt gefunden und mit ihm beginnt ein Wettkampf um die Krone der Hexen. Nur wer den mächtigsten aller Dämonen besiegt, kann den Thron besteigen. Ein Erbe, für das Ophelia keinerlei Interesse hegt. Bis ihr aufgeht, wer der geheimnisvolle Feind ist, und dass sie ihn auf keinen Fall sterben lassen kann … Eine verbotene Liebe zwischen der potenziellen Thronfolgerin der Magier und ihrem schlimmsten Feind. //»Witches. Die Knochenhexe« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband für alle Fans von coolen Urban-Fantasy-Hexenromanen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Beatrice Jacoby
Witches. Die Knochenhexe
**Der Kampf um die Krone der Hexen hat begonnen**Ophelia beherrscht die Magie der Knochen und kämpft im Geheimen für den Schutz der Menschen. Doch als das Oberhaupt der Magier stirbt, wird der Zauber, der die Dämonen von unserer Welt fernhält, brüchig. Ein nahezu unbesiegbarer Feind hat seinen Weg in die Menschenwelt gefunden und mit ihm beginnt ein Wettkampf um die Krone der Hexen. Nur wer den mächtigsten aller Dämonen besiegt, kann den Thron besteigen. Ein Erbe, für das Ophelia keinerlei Interesse hegt Bis ihr aufgeht, wer der geheimnisvolle Feind ist, und dass sie ihn auf keinen Fall sterben lassen kann …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© Michael Neumann
Die 1992 geborene Münchnerin Beatrice Jacoby absolvierte eine Ausbildung zur Incentive- und Eventmanagerin sowie zur Fremdsprachenkorrespondentin. Sie lebte bereits in Schweden und Frankreich, bevor es sie in ihre Heimat zurückzog. Heute arbeitet sie nachts an ihren Romanen und tags im Eventmarketing. Sie liebt es zu reisen und neue Orte zu entdecken, die ihr stets Inspiration für Szenerien und Geschichten schenken.
Für Domi
Kapitel 1
Ophelia
Da war nicht viel zwischen uns. Bloß ein warmer Schweißfilm und seine nackte Haut auf meiner. Er war der erste, dem ich dabei in die Augen sehen wollte, obwohl ich der Intensität seines Blickes kaum standhielt. Oder besser gesagt: der Intensität meiner Gefühle für diesen Kerl, der je eine Sommersprossengalaxie im Gesicht und auf den Schultern trug, an die ich mich gerade klammerte.
Ohne es zu ahnen, hatte Mordred mir beigebracht mich aufzulösen und gleichzeitig völlig bei mir zu sein. Genauso wenig, wie ich in diesem Moment ahnte, was es mich kosten würde, so zu fühlen. Er wusste es.
Aber anstatt mich zu warnen, hauchte er vor einem weiteren Kuss nur meinen Namen. »Ophelia.«
***
Ich schlief an Mordred geschmiegt so tief, dass ich das Geräusch kaum mitbekam. Sonst hörte ich den klackenden Alarm des Schädels im Billy-Regal sofort. Meine Ohren waren darauf geeicht, als wäre Hamlet eine Stimmgabel und ich ein Instrument. Er klapperte mit den verbliebenen Zähnen, ich antwortete. Normalerweise.
Diesmal musste er regelrecht schlottern, bis ich widerwillig ein Auge öffnete, während mir gleichzeitig der Traum entglitt, in den mein Unterbewusstsein bis eben das Zähneklappern des Totenschädels als Grundrhythmus eines Liedes integriert hatte. Zu fest hatten Mo und der Schlaf mich in ihren Armen gehalten, seit wir uns genauso erschöpft wie glücklich in die Laken gekuschelt hatten.
Aber Hamlet kannte kein Erbarmen.
Er war sicher wieder eifersüchtig. Nur weil er tot war, hieß das ja noch lange nicht zwangsläufig, dass er keine Seele mehr hatte. Und immerhin waren wir Hamlet und Ophelia.
Wenig später stand ich schon neben dem Regal, in dem Hamlet stand, und blickte über meine Schulter hinweg auf den schlummernden Mo. Neben ihm hätte die Welt in Flammen aufgehen können und er wäre nicht aufgewacht. Beneidenswert. Und praktisch, weil ich dadurch weniger in Erklärungsnot geriet.
Ungeduldig klapperte Hamlet weiter.
Ich bin doch schon da, immer mit der Ruhe.
Mit dem Blick noch immer auf Mordred tastete ich das Regalbrett ab. Eine schlechte Idee, wenn man dort neben dem Totenschädel auch noch seine Kakteensammlung aufbewahrte. Autsch.
Okay, jetzt war ich endgültig wach und versuchte dieses Mal auf Knochen statt auf Stacheln zu fassen. Dafür reichte mein Sehvermögen selbst ohne Brille.
Kaum legte ich meine Hand auf den schmalen Spalt in Hamlets Schädeldecke durchströmte jede meiner Poren die darin verbliebene Magie und warnte mich vor einem Dämon, der anscheinend durch die Risse zwischen seiner und unserer Welt geschlüpft war.
Mich gleich wieder an Mos Brust zu kuscheln konnte ich mir also abschminken. Da half auch kein wehmütiger Blick zu meiner verlassenen Liegekuhle, dem Abdruck der gemütlichsten Position der Welt. Die Pflicht rief!
***
Ehe ich es mich versah, gähnte ich am Ernst-Reuter-Platz verstohlen in die sterbende Nacht, wobei mir mein Brombeer-Lolli beinahe aus dem Mundwinkel fiel. Bald würde es an diesem öden, urbanen Umschlagplatz von Leuten auf ihrem Weg zur Arbeit nur so wimmeln. Wir sollten uns also beeilen. Wäre ich nur nicht so verdammt müde gewesen! Ich kniff mir selbst in die Ellenbeuge, in der Hoffnung, dass der leichte Schmerzimpuls mich aufweckte.
Reiß dich zusammen. Je früher du hier fertig bist, desto eher kommst du zurück ins Bett. In die frisch gewaschenen, von Mos Körper vorgewärmten Laken. Weich. Und einladend.
»Ophelia, Augen auf!«
Ich blinzelte meine Freundin und Jagdgefährtin Kotori an, die ich nach dem Aufstehen umgehend alarmiert hatte. Wie konnte man um diese Zeit dermaßen frisch aussehen? Ach ja, ihr Perfektionismus! Zusammen mit ihrer Entschlossenheit peitschte er ihr das Blut in die Wangen, sodass sie auch ohne Make-up rosig strahlten. Vielleicht half es auch, dass sie ihr glattes schwarzes Haar straff in einen hohen Pferdeschwanz gebunden hatte, sodass der ständige Zug sie einfach wachhalten musste. Ob ich meine Frisur hätte strenger binden sollen?
»Wohin?«, fragte Tori ungeduldig. Sie streckte die Nase empor, als könnte sie die Fährte des Dämons aufnehmen. Doch Blutmagier waren schließlich keine Bluthunde.
Ich zog eine traubenrote Schatulle aus meiner Apothekertasche und öffnete sie. Daraus barg ich eine Handvoll sorgfältig ausgewählter Röhrenknochen kleiner Vögel, einen achteckigen Wirbel, nikotingelbe Reißzähne und ein Hühnerbein. Ich schüttelte sie in der geschlossenen Hand und würfelte sie auf die geometrischen Formen am Boden der Schatulle, die einmal meiner Urgroßmutter gehört hatte.
Der Juniwind zupfte feine Härchen aus meinem halb offenen Dutt, mit dem ich versucht hatte meine kastanienbraun gefärbten Haare zu bändigen. Ich konnte die Magie schmecken, die von meinem Knochenmark aus kribbelnd in mein Skelett sickerte. Von dort breitete sie sich in meinen ganzen Körper aus, bis sie bei meinem nächsten Atemzug über das Orakel strömte.
Wie ich dieses Gefühl liebte! Es machte süchtig. Als würde ich erst in diesen Momenten richtig lebendig werden. Ähnlich wie in Mordreds Nähe.
»Was ist?«, weckte Tori mich aus meiner Sehnsucht nach ihm und meinem Bett.
»Nach Süden.«
Sie lächelte mich fragend an, als hätte ich Spanisch gesprochen.
»Da lang.« Ihr Blick folgte meinem Kopfnicken in Richtung S-Bahnhof Savignyplatz.
»Klassiker«, seufzte Tori und rieb sich die Oberarme. »Komm, wir sollten uns beeilen. Ich erfriere.«
»Das kann ich natürlich nicht verantworten.«
Mit der linken Hand fuhr ich in meine Jackentasche und klemmte mir drei dünne Knochen zwischen Zeigefinger und Daumen. Im gleichen Atemzug verschloss ich das Orakel in der Schatulle und steckte es wieder in die Apothekertasche, die stets für Einsätze wie diesen vorgepackt war. Für Momente, in denen Tori und ich unseren Familientradition folgten und uns auf die Jagd machten.
Manche erbten Bäckereien, andere Trustfonds. Unsere Eltern hatten uns Magie vermacht. Sie lag uns einfach in den Knochen beziehungsweise im Blut. Und mit ihr die Fähigkeit, dämonische Monster wahrzunehmen und unschädlich zu machen.
Bevor wir zur S-Bahn-Station aufbrachen, befeuchtete ich meinen linken Daumen, sobald ich genügend Magie in meiner Spucke angesammelt hatte. Eine Frage von Sekunden. Versteckt hinter dem Ziffernblatt meiner Armbanduhr befand sich ein Puder aus gemahlenen Knochen von Kleintieren und jung Verstorbenen, in das ich meinen befeuchteten Daumen tauchte. Damit malte ich zuerst einen Halbmond auf Toris und dann auf meine Stirn. Beim Kontakt mit Magierhaut glitzerte das Gemisch kurz auf. Es dampfte wie frisch aufgebrühter Tee, bevor es ein dunkelviolettes Mal hinterließ.
»Ihr Knochenmagier seid so eklig«, neckte meine Freundin mich.
»Und so hilfreich.«
Das Schutzsymbol verbarg uns vor den Augen Normalsterblicher, die uns ansonsten vielleicht dabei sehen würden, wie wir gegen für sie stets unsichtbare Dämonen kämpften. Das hätte sicher Fragen aufgeworfen, die wir Jungmagierinnen auf keinen Fall beantworten durften.
Tori setzte sich mit zügigem Schritt in Bewegung. Für ihre zierliche Statur war sie verdammt schnell. Und sie war nicht annähernd so verträumt wie ich. Beim Gehen wickelte sie ihren seidigen Pferdeschwanz zu einem Knoten zusammen.
»Zeit, dass die Barriere endlich erneuert wird«, murmelte ich, sobald ich zu ihr aufschloss. »Das ist schon das dritte Mal diese Woche, dass wir so früh rausmüssen.«
»Lieber diese Woche als in der Prüfungsphase. Ich kann dieses Semester nicht wieder nur Zweitbeste werden.«
Ich schmunzelte und rollte mit den Augen. »Übermorgen, nach dem Ritual, sollten wir wieder mehr Ruhe haben«, sagte ich, ein Gähnen unterdrückend.
Liebevoll stieß Tori mich mit dem Ellenbogen an, als wir in eine deutlich »charlottenburgigere« Seitenstraße mit kleinen geschlossenen Läden steuerten.
»Wir haben nicht den Luxus, falsche Müdigkeit vorzutäuschen, Pheli. Unsere aktuelle Bestzeit beträgt zehn Minuten und achtundfünfzig Sekunden. Damit liegen wir knapp zwanzig Sekunden hinter Aarons Rekord, den wir heute brechen werden.«
»Sooo früh am Morgen?« Ich rieb mir die Augen unter der runden Brille.
Klar, zusammen mit Tori Dämonen zu vertreiben war wichtig. Allerdings fiel es mir seit ein paar Monaten besonders schwer, mitten in der Nacht aus dem Bett zu kommen. Nicht weil ich faul geworden war oder weil ich die Knochenmagie nicht mehr liebte. Es lag nicht einmal an den neuen Herausforderungen wenige Wochen vor den Semesterprüfungen. Es lag daran, dass mich ein fast magischer Sog zu jemandem zurückzog. Übermüdet bekam ich die Erinnerung an seinen Herzschlag unter meiner Handfläche einfach nicht aus dem Sinn. Ganz zu schweigen von dem Anblick, wenn er verschlafen durch den Wimpernkranz blinzelte und morgen-heiser und mit einem Lächeln auf den Lippen meinen Namen raunte. Je eher ich die Jagd hinter mich brachte, desto eher konnte ich zu ihm zurück.
Am Eingang der Gleisunterführung an der Haltestelle angekommen blieben wir stehen. Ich ließ meine Apothekertasche aufs Kopfsteinpflaster fallen und ballte die Fäuste.
Ich konnte den Dämon bereits atmen hören. Ich blickte über die Schulter. Nach links. Nach rechts. Dann schob ich mir mit dem Mittelfinger die Brille hoch. »Bereit?«
Tori sah auf ihre Armbanduhr. »Jederzeit.«
Das Prickeln, das von meiner Wirbelsäule ausging, flutete nun wieder alle meine Zellen. Meine Sinne schärften sich. Ich drehte den Brombeer-Lolli, den ich in meiner Wange gebunkert hatte, dreimal nach links. Wie jedes Mal, bevor es losging.
Auch Tori hatte ihr Pokerface aufgesetzt und machte sich an die Arbeit. Mit spitzen Fingern nahm sie den scharfkantigen Anhänger von ihrer Halskette. Nicht die feinste Wimper zuckte, als sie sich damit in die Handfläche schnitt. Eine gerade dunkelrote Linie brach aus ihrer verletzten Haut hervor. Tori ballte die Faust um den schmalen Schnitt. Statt zwischen ihren Fingern hindurch auf den Boden zu tropfen, quoll ihr Blut zäh und kontrolliert heraus. Binnen Sekunden gerann es anwachsend zu einem Stab mit scharfen Kanten. Tori formte ihn durch ihre Blutmagie zu einer langen Sense. Sobald sie die Blutung stoppte, schloss sich der Schnitt wieder. Bei unseren ersten gemeinsamen Jagden war ihr ein paarmal schwindelig geworden, weil sie ihre Fähigkeit zu hastig eingesetzt hatte. Sie hatte viel zu schnell mehr Blut verloren, als sie mit ihrer Magie nachproduzieren konnte. Inzwischen hatte sie genug Übung und den richtigen Rhythmus gefunden.
Tori schüttelte die in Windeseile verheilte Hand aus. Gleichzeitig fing sie mit der anderen die Waffe auf. Dabei warf sie mir einen erwartungsvollen Blick zu, als wollte sie Applaus. Nein, nicht für so was Ekliges!
Die Symbiose unserer beiden Magiergruppen war sinnvoll, ihre jeweiligen Besonderheiten ergänzten sich perfekt und ich hatte meine Freundin irrsinnig lieb. Aber das hieß nicht, dass es für mich weniger bizarr war, was sie mit ihrem eigenen Blut anstellte. Egal wie oft ich ihr schon dabei zugesehen hatte, es schauderte mich auch jetzt wieder.
Dennoch wandte ich meine Aufmerksamkeit nicht völlig von der Dunkelheit der Unterführung direkt vor uns ab, in der sich gerade etwas regte. Nein, nicht irgendetwas. Es war der Dämon, dem wir auf den Fersen waren.
Wie aus einer Nebelschwade erhoben sich lange verzweigte Hörner aus der Dunkelheit, die an ein Geweih erinnerten. Gierige schwarz-goldene Augen folgten über Zähnen, die wegen ihrer Größe teils über das sabbernde Maul hinausragten. Ein verdrehtes Bein nach dem anderen schälte sich aus der Dunkelheit. Mit mindestens zehn davon krabbelte das massige Biest an der Decke entlang auf uns zu.
Es hatte nichts Menschliches an sich. Gut! Denn je menschenähnlicher, desto mächtiger und somit gefährlicher der Dämon, galt die Faustregel. Und manch albtraumhafte Rarität konnte sogar eine Menschengestalt annehmen.
Ich atmete kontrolliert aus. Das hier war reine Routine. So wie der Dämon den Kopf drehte und sich gelassen anpirschte, schien er das gleiche zu denken.
Toris Mundwinkel zuckte kaum merklich. Ihre selbstbewussten ersten Schritte in die Unterführung waren genug, um die Kreatur zu reizen. Mit einem pfeifenden Aufschrei stürzte sie sich vom Gewölbe auf Tori herab.
Sie parierte die plumpe Attacke des Dämons gekonnt wie elegant, wobei sie sich noch ein Stück von der Straße entfernte. Die stabile Magie in ihrer Blutsense hielt dem massigen Körper des Biests mit Leichtigkeit stand. Unter heftigem Schnaufen stieß meine Freundin den Dämon zurück und schnitt ihm dabei mit der Klinge in eines seiner vielen Beine. Ein Punkt für uns! Dachte ich zumindest. Doch als das Biest sich bei seinem Rückzug an die Backsteinmauer heftete, war es unversehrt. Wegen der dicken Adern, die unter seiner Haut hervorschimmerten, hatte ich die Haut des Dämons für dünn und leicht verletzbar gehalten. Ein Trugschluss.
Reflexartig trat ich ein paar Schritte vorwärts, ein Stück unter das Gewölbe. Ich festigte meinen Stand, um den Boden bewusster unter mir zu spüren, aber auch, um mich davon abzuhalten, mich beim nächsten Vorstoß des Dämons vor meine Freundin zu stürzen. Ich hatte einen ausgeprägten Beschützerinstinkt gegenüber den Menschen in meinem Leben, die mir besonders wichtig waren. Eine Eigenschaft, die mir laut meiner Jagdgefährtin öfter im Weg stand. Und natürlich war mir klar, dass Tori auf sich selbst aufpassen konnte – und wollte. Sie hatte das im Griff. Ganz sicher. Solange sie auf den Beinen blieb, war sie schnell genug, um sich zur Wehr zu setzen. Das rief ich mir immer wieder in Erinnerung, um Adrenalin und Puls im Zaum zu halten. Ungebändigte Aufregung machte es schwerer, die Magie zu kontrollieren. Und das konnte ich mir definitiv nicht leisten.
Innerlich etwas leiser fluchend folgte mein Blick dem Dämon, der vor Toris Sense zurück an die Unterführungsdecke flüchtete. Wahrscheinlich positionierte er sich so, um besser auf Tori hinabspringen zu können. Auch bei ihrem nächsten Konter schaffte sie es nicht, ihn zu verletzen. Sie trieb ihn bloß vor sich her, erst weg und nun wieder hin zur Straße, an der ich verharrte.
Mist! Solange ich nicht an sein Blut oder einen Knochen von ihm kam, konnte ich nicht in Aktion treten. Im Gegensatz zu Tori brauchte ich eine Brücke zwischen meiner Magie und dem physischen Dämon, um ihm Schaden zufügen zu können.
Tori knirschte frustriert mit den Zähnen. Mit jedem Schlag, jedem Rückfall, quetschte ich die Knöchelchen in meiner Faust fester, bis diese schließlich zu zittern begann.
Komm schon, Tori!
Ich war drauf und dran, die Knochensäge aus meiner Apothekertasche zu holen und damit einzugreifen. Dass ich mich durch einen Nahkampf mit dem Dämon in Lebensgefahr bringen würde, war mir in diesem Moment völlig egal. Doch da erwischte Tori endlich eine empfindliche Stelle am Hals des Monsters.
Sein zischender Aufschrei schmerzte in meinen Ohren. Ich wich gerade noch rechtzeitig aus, bevor ein Spritzer des mitternachtblauen Dämonenblutes mich erwischen konnte. Eine Narbe am Knöchel erinnerte mich stets daran, dass dieses Zeug auf Menschenhaut fast so sehr ätzte wie die Tränen der Viecher.
Während Toris Sense den Dämon in Schach hielt, nutzte ich die Gunst der Stunde. Geistesgegenwärtig fiel ich auf ein Knie, ließ die Knochen zwischen meinen Fingern durch die schwarze Blutlache auf dem Boden gleiten.
Im selben Moment stürzte Tori, als sie gerade noch rechtzeitig einer Attacke auswich. Dabei wurde die Sense aus ihrer Hand einige Meter in das Graublau der Dämmerung geschleudert. Damit befand sich ihre Verteidigung und einzige Barriere zwischen sich und dem lebensbedrohlichen Gegner außerhalb ihrer Reichweite.
Gerade als der Dämon sich in einer Mischung aus Lachen und Schreien auf sie stürzen wollte, brach ich den ersten der blutgetränkten Knochen mit meinem Daumen in der Mitte durch. Dann zerbrach ich den zweiten. Das Knacken hallte laut in der Leere der Unterführung wider.
Die Magiefunken, die dabei entstanden, waren so gut wie unsichtbar. Aber wenn ich meine Augen schloss, sah ich sie als Lichtreflexe hinter meinen Lidern flackern.
Im Kanon mit den Knöchelchen in meiner Hand brachen erst die Wirbelsäule und dann noch eines der vielen Beine des Dämons. Er war bloß noch eine Handbreit von Tori entfernt, als er kreischend zurückwich. Sofort sprang sie wieder auf die Beine, brachte ausreichend Abstand zwischen sich und den Dämonen und schnappte sich ihre Sense vom Gehweg vor der Unterführung. Bereit dem weitgehend bewegungsunfähigen Ungetüm den Gnadenstoß zu versetzten hob sie ihre Waffe. Doch statt zuzuschlagen, hielt sie inne und warf mir einen Blick zu.
Vorsichtig näherte ich mich den beiden. Anders als Blutmagier, die den Nahkampf nicht scheuten, blieben Knochenmagier wie ich eigentlich lieber auf Abstand. Mit dem Daumen am letzten Knochen, bereit auch ihn einzusetzen, betrachtete ich den nach uns schnappenden und mit den wenigen noch beweglichen Gliedmaßen um sich schlagenden Dämon. Er würde nicht mehr weit kommen. Bei einem Blick in seine goldenen Augen wurde mir klar, dass auch er es wusste.
»Worauf wartest du, Pheli? Bring es zu Ende.«
Sie wollte es zu gern selbst übernehmen. Aber er war meine Beute. Ich hatte ihn kampfunfähig gemacht. Tori hielt sich strikt an diese Jagdetikette, die mir selbst nur wenig bedeutete.
Ich atmete tief ein und aus. Die Magie, die Jagd und der schweflige Geruch des Dämonenblutes, das die Straße tränkte, versetzten mich in eine Art Rausch. Er drängte mich dazu, Toris Forderung zu folgen. Etwas regte sich unter meiner Haut. Es kribbelte in meinen Knochen, wollte, dass ich diese Kreatur tötete. Wollte die Macht über sie spüren.
Doch ein anderer Teil von mir erinnerte mich an das Leben, das in den schwarz-goldenen Augen funkelte. Daran, dass die Bestie aus Instinkten heraus grausam handelte, wenn es seine Beute quälte – und dass ich mich im Gegensatz zu ihm anders entscheiden konnte. Dieser Teil wollte mir meine Menschlichkeit gegenüber diesem Ungeheuer beweisen.
Ich war nicht wie er!
Mein Herz hämmerte gegen meinen Rippenbogen, während ich zwischen Vernunft und Gefühl hin und her gezerrt wurde. Ich war keine Vollblutjägerin wie Tori. Nur eine Zwanzigjährige mit Kakteen-Tick und einer Schwäche für düstere Lyrik, die zufällig als Magierin geboren worden war und die ihrer Pflicht nachkam, die Menschen vor den Dämonen zu schützen.
Das Exemplar vor mir hatte sich an den Rand der Backsteinwand manövriert, sodass er halb im Dunkel der Unterführung, halb in der sterbenden Nacht zuckte.
Statt direkt den letzten Knochen zu brechen, fuhr ich damit ein geometrisches Symbol auf eine seiner bewegungsunfähigen Gliedmaße, die in unsere Richtung ragte. Der Dämon presste sich mit allem, was er mit der gebrochenen Wirbelsäule noch bewegen konnte, strauchelnd gegen die Ecke der Mauer, an der die Unterführung in die Straße mündete. Dabei erwischte eine der mit Säureblut verschmierten Extremitäten beinahe meine Ledertasche und mich. Mit einem Satz nach hinten konnte ich gerade noch ausweichen.
Es wäre ein Leichtsinnsfehler, diese Kreatur jetzt zu unterschätzen und den Kampf bereits für gewonnen zu halten. Einer, der mich den Kopf kosten konnte. Man wusste nie, welche letzten Kräfte Dämonen unter Todesangst entwickelten. Bis zur letzten Sekunde in unserer Welt blieben sie unberechenbar.
»Seine Artgenossen fressen es auf der anderen Seite in diesem Zustand sowieso auf«, murmelte Tori, die ahnte, was ich wieder mal vorhatte.
»Dann ist das ihr Problem, nicht meins.«
»Brauchst du seine Knochen nicht für dein Orakel oder was ihr sonst so damit treibt?«
»Ich hab genug von seiner Sorte.«
Mein Entschluss stand fest. Und wenn das einmal der Fall war, brachte mich fast nichts mehr davon ab, das wusste meine Freundin. Unsere Aufgabe bestand darin, unsere Welt vor Dämonen zu beschützen und solange diese Prämisse erfüllt wurde, ließ Tori mich machen. Wenn auch widerwillig.
Unter dem Schutz ihrer Sense zeichnete ich schlampig das restliche geometrische Symbol auf die Gliedmaße. Dann brach ich darüber den letzten Knochen zwischen meinen Fingern. Prompt schmeckte die Luft nach Eisen.
Der Sog des Portals, das sich mitten in der Luft geöffnet hatte und den Dämon zurück in seine Welt zu zerren begann, fauchte und zischte. Er riss an unserer Kleidung und unseren Haaren. Doch anders als die ersten Glieder des Ungetüms, verschlang er weder Tori noch mich. Die andere Welt nahm nur ihre Emporkömmlinge auf, keine Menschen. Dafür schickte sie uns einen Hauch schwefelhaften Geruchs herüber.
Ich erlaubte mir ein wenig Anspannung aus meinen Schultern weichen zu lassen. Es war vorbei, richtig? In wenigen Augenblicken würde auch der Rest des zeternden Dämons in seine Welt zurückgezogen werden. Dort konnte er niemandem mehr schaden, der mir etwas bedeutete.
»Deine Güte ist löblich, Pheli, aber gefährlich.«
Die Sorge in Toris Stimme spiegelte sich in Falten zwischen ihren Augenbrauen. Fast bekam ich ein schlechtes Gewissen. Ich wollte nicht, dass ihr wegen mir das Herz schwer wurde.
»Deine fehlgeleitete Nettigkeit wird dich irgendwann noch umbringen.« Sie trat bis auf einen Schritt an mich heran und deutete auf die schwindende Kreatur vor uns. »Das sind skrupellose Monster, die keine Sekunde überlegen würden, ob sie dich leben lassen sollen.«
Ich seufzte. Wann würde sie endlich über die Jagd hinaussehen und es verstehen?
»Güte ist, was uns von ihnen unterscheidet, Kotori.«
Mit einem undefinierbaren Geräusch schwang sie sich den Sensenstil über die Schultern und lehnte die Hände darüber, wie so oft nach einer Schlacht. Dieser kurze voreilige Moment ohne Deckung genügte.
Dämonisches Kreischen zerriss mir fast das Trommelfell, als sich das Biest plötzlich noch einmal aufbäumte. Mit aller Kraft stemmte er sich gegen meinen Bann. Und eine seiner verbliebenen Gliedmaßen schlug nach der unachtsamen Tori.
Weit aufgerissene dunkelbraune Augen.
Vor einer Sekunde war die nachtschwarze Kreatur schon fast verschwunden gewesen und nun war sie überall. Ihr massiger Körper schob sich zurück zwischen Tori und mich.
Ich konnte mich nicht bewegen. Alles erschien wie in Zeitlupe. Dabei ging es so schnell. So wahnsinnig schnell.
Ich nahm kaum wahr, wie ich mit einer Hand die Knochensäge aus meiner offenen Ledertasche zog. Wie ich mich mit Knie und Fuß vom dreckigen Boden abstützte. Mich dazwischen warf.
Der Geruch von Blut verdarb die kühle Morgenluft. Dunkle Tropfen malten ein groteskes Muster auf die Straße.
Ich hielt den Atem an. Meine Augen brannten, aber ich konnte nicht blinzeln. Trotz aufgerissener Augen sah ich nichts.
Erst als der Dämonenkörper in die Blutlache stürzte, verstand ich, dass ich schneller zugeschlagen hatte. Die teerartige Flüssigkeit, die von meiner Waffe tropfte, versicherte es mir.
Tori atmete bedacht aus. Wir tauschten einen ernsten Blick. Währenddessen zurrte sich das Monster zischend in sich selbst zusammen. Wie eine fette Spinne, wenn Tori oder ich – je nachdem, wer beim Schnick-Schnack-Schnuck verlor – Putzmittel auf das Tier sprühte. Im Fall des vor uns schrumpelnden Wesens lag es an dem für Dämonen giftigen Pulver aus Auerhahnknochen und Rippen von Dichtern. Man konnte viel Schlechtes über meinen Vater sagen, doch für den Rat zu Beginn meiner Ausbildung, dieses Pulver stets auf eine Knochensäge aufzutragen, war ich ihm dankbarer denn je.
Es war so knapp gewesen, dass Tori und ich uns ein dämliches glucksendes Lachen nicht verkneifen konnten. Dabei war hieran gar nichts Lustiges. Wir waren unaufmerksam gewesen wie blutige Anfängerinnen. Allein der Gedanke, dass Tori beinahe die Quittung dafür bekommen hätte … Mir zog sich die Speiseröhre zusammen, ähnlich wie der letzte Rest des Dämons. Mein Griff um die Knochensäge wurde fester, sodass meine Hand sich verkrampfte und leicht zitterte. Kotori war meine Magierpartnerin. Meine engste Freundin. Wir waren schon in Düsseldorf zusammen in den Kindergarten gegangen, bevor erst meine Familie und dann sie zu Studienbeginn ihres Bruders nach Berlin gezogen war. Tori zu verlieren kam schlicht nicht infrage.
Bevor ich uns eine Standpauke halten konnte, blickte sie schon auf die Uhr. »Mist. Fünf Sekunden zu lahm.«
War das ihr größtes Problem?
Liebevoll schüttelte ich den Kopf. Zu müde zum Diskutieren. Zum Levitenlesen. Zum Rationalsein. Einfach zu müde. Dieses Gefühl kroch in meinen Körper zurück, sobald das Adrenalin in meinen Adern abflaute.
Müde …
Aber noch waren wir nicht fertig. Bloß in Sicherheit. Inzwischen fraß sich das Knochenpulver durch die Haut des zusammengeschrumpelten Dämonenleichnams, wodurch sein Fleisch von seinen Knochen schmolz wie Wachs. Es vermischte sich mit seinem Blut und sickerte in die Rillen im Asphalt und im gepflasterten Gehweg. Dort entstand ein schwarzer, blubbernder See, der mir die Galle den Hals hochtrieb. Die Dämonenjagd waren wir gewohnt. Trotzdem mussten Tori und ich für einen Moment die Ärmel über unsere Nasen drücken. Von dem fauligen Gestank ohnmächtig werden und in die Brühe kippen? Das hätte an diesem perfekten Morgen noch gefehlt.
Als lediglich ein mickriges Skelett zurückblieb, raunte ich in meinen Ärmel: »Wie nervig! Der hatte ja kaum Knochen im Leib.«
»Ich dachte, du hast genug?«
»Na, wenn ich ihn schon mal erlegt habe.«
Ich wiegte den Kopf hin und her, während ich mir Latexhandschuhe überstreifte. Da war nichts zu machen, es war und blieb eine magere Ausbeute. Schade! Ich hatte das Gefühl, mir wären in letzter Zeit besonders viele Inkubusknochen abhandengekommen. Na ja, trotzdem hatten wir Glück im Unglück gehabt. Ich wollte also nicht meckern, sondern mich stattdessen zügig ans Einsammeln machen. Dann konnte ich endlich zurück ins Bett. Ein himmlischer Gedanke, der mich beflügelte.
Weit kam ich jedoch nicht auf meinem Weg über den See aus Dämonenblut und -schleim, der sich auf dem gesamten Gehweg ausgebreitet hatte. Gerade bückte ich mich nach einer abgesplitterten Rippe, die zwischen zwei abgefahrenen Fahrradreifen am Fahrradständer in der Unterführung lag. Da blinzelten mich zwei strahlend grüne Augen aus den Schatten der Unterführung an. Der dazugehörige Mund klappte auf – und zu – und auf – und zu – und auf, genau wie meiner. Ich brachte kein Wort heraus. Die junge Frau in schwarzer, zerrissener Jeansjacke mit Flicken von Punk- oder Indie-Bands, die sich hier die ganze Zeit über versteckt haben musste, auch nicht. Wie Fliegenbeine schlugen überschminkte Wimpern beim Blinzeln um ihre Katzenaugen. Die Aufschrift auf dem übergroßen T-Shirt meines Gegenübers sprach aus, was wir wohl beide dachten: Fuck.
Ihre Hände krallten sich in den Fahrradsattel neben ihr. Meine schnellten von der Dämonenrippe zurück. Wie zwei voreinander erschrockene Spiegelbilder starrten wir uns an. Ich schluckte schwer. Das durfte nicht, nein, konnte nicht sein! Ich wandte mich um, in der Hoffnung, dass mein Gegenüber durch mich hindurchstarrte. Ein Irrglaube. Dass sein starrer Blick jeder meiner noch so kleinen Bewegungen folgte, machte es nur schlimmer.
Der Gesichtsausdruck dieser jungen Frau, deren Plateauschuhe sich in den Boden drückten, während sie rückwärts bis zur Wand strauchelte, sprach Bände. Sie sah mich. Genauso deutlich wie ich sie.
Fuck. Fuck. Fuck. Man konnte es einfach nicht anders sagen.
»Schöne Scheiße«, zischte Tori plötzlich direkt hinter mir. Ja, okay, so konnte man es auch sagen.
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Fuck.
»Sie dürfte uns nicht sehen, sie ist ein gewöhnlicher Mensch«, sprach ich die Gewissheit aus, die Tori und mir bereits die Kehlen zuschnürte.
Es gab nicht viele wie uns, man kannte sich in der kleinen Gemeinschaft, ob man wollte oder nicht. Der Indieband-Fan vor uns, der sich vorher wohl stümperhaft an einem fremden Fahrradschloss zu schaffen gemacht hatte, gehörte ganz sicher nicht dazu.
Tori fasste sich an das Mal auf ihrer Stirn. »Hast du beim Zusammenrühren deines Tarn-Puders was vermasselt?«
»Hey, wer ist hier Klassenbeste ihrer Zunft und wer nur auf dem zweiten Platz?«
»Autsch … Na ja, wo du recht hast.«
Was stammelte die Frau da? »Di… dieses Ding … Was …?«
Sie hatte doch nicht etwa … Oder doch? Nein, unmöglich! Dass sie uns trotz der magischen Symbole auf unserer Haut sah, war schon merkwürdig. Dass sie den lebendigen Dämon gesehen hatte, war einfach ausgeschlossen! Selbst seine Knochen sollten erst in ein paar Stunden soweit Teil unserer Welt sein, dass Menschen ohne magische Fähigkeiten sie sehen konnten. Und trotzdem …
Ein entrücktes Schnauben – oder war es ein Lachen? – lenkte meine Aufmerksamkeit wieder von dem Knochenhaufen zurück auf unsere unerwünschte Zeugin.
Mühsam entrunzelte ich meine Stirn, legte ein möglichst freundliches Gesicht auf – so freundlich, wie es eben ging, wenn sich eine gedankliche Endlosschleife von Flüchen abspulte und man keine Ahnung hatte, was eigentlich vor sich geht.
»Da war nichts«, log ich plump.
Dafür erntete ich einen ungläubigen Laut und eine entgegengestammelte, aber ziemliche genaue Beschreibung des Biests, das eben von uns getötet worden war. Es blieben keine Zweifel, an denen ich mich noch festklammern konnte. Unmöglich oder nicht, sie hatte den Dämon gesehen.
Ein Seufzen lang versuchte ich mich zu fangen. »Du musst keine Angst haben«, versprach ich schließlich und streckte dem unbekannten Häufchen Elend vor mir die Hand entgegen. Die mit Dämonenblut verschmierte, unterm Latexhandschuh schweißnasse Rechte. »Wir tun dir nichts. Die Knochensäge ist nicht giftig für Menschen, nur für Dämonen.«
Dafür erntete ich einen sanften Tritt von Tori.
»Säge bleibt Säge«, würgte unser Gegenüber heraus.
»Da hat sie nicht ganz unrecht …«
»Nicht hilfreich, Kotori!«
»Wa…, wa…, wa… Was war dieses … dieses …« Sämtliche Begriffe schienen von der Zunge der Unbekannten zu fliehen. In ihren aufgerissenen geröteten Augen konnte ich förmlich sehen, wie ihr Verstand sie langsam im Stich ließ. Ich konnte es ihr nicht verübeln. Schließlich war ich mit dem Wissen um Dämonen aufgewachsen und wurde trotzdem nach meiner ersten Begegnung mit einem drei Wochen lang von Albträumen geplagt. Damals war ich ein Kindergartenkind gewesen und das molchartige Biest und seine tausend Augen hatten mich aus einer Toilette heraus angestarrt. Ich hatte geschrien wie am Spieß. Das war der Tag gewesen, an dem meinen Eltern klar geworden war, dass ich die Gabe geerbt hatte. Der Tag, an dem sie mir beigebracht hatten heimlich Symbole mit Wachsmalstiften in die Ecken des Kindergartens zu malen, wenn es auf die Erneuerung der Barriere zwischen unserer und der Welt der Dämonen zuging. Erst später hatten sie mir erklärt, dass die Stifte Knochenstaub enthielten – und von wem diese stammten.
Dass der Beweis für Übernatürliches mit nichts übereinstimmte, was mein Gegenüber bisher für real, geschweige denn sicher gehalten hatte, musste sie in einem höheren Maß überfordern als das Kind, das ich damals war. Umso vorsichtiger tastete ich mich an die Normalsterbliche heran. Ich versuchte mich vor ihr und Tori zusammenzureißen. Um unsere Welt zu erschüttern, bedurfte es eigentlich mehr als eine dahergelaufene Punkerin. Trotzdem tat sie genau das. Sie, die Normalsterbliche, die Dämonen sehen konnte. Obwohl das eigentlich unmöglich war.
Was ging hier bloß vor?
»Wir können dir alles erklären! Sobald du dich beruhigt hast. Keine Sorge. Du bist sicher, der Dämon ist tot.«
»Dämon?«, keuchte sie, ungläubig bis wütend.
Sie tat mir so leid, wie sie dastand und nach Worten und Fassung rang. Schweißperlen rannen ihr über die Stirn, ihre Pupillen zitterten und obwohl ihre Füße weiter strauchelten, schienen ihre Beine ihr nicht zu gehorchen.
Ich wagte noch einen Versuch, meine Hand nach ihr auszustrecken, doch sie schlug mir die Hand weg.
Ich konnte es verstehen. Sie wollte wahrscheinlich nur weg von uns, aber das war schlicht keine Option. Nicht solange wir nicht wussten, was ihre Existenz zu bedeuten hatte. Und nicht bei der Geschwindigkeit, in der die Barriere zwischen unserer und der Welt der Dämonen momentan bröckelte. Allein bei dem Gedanken daran drehte sich mir den Magen um.
Als hätte sie meine Gedanken gelesen, warf sich die Fremde plötzlich zur Seite, krallte sich in einen Sattel und spie sämtlichen Inhalt ihres Magens durch die Speichen eines Fahrrads.
»Nicht schlimm. Lass alles raus«, versuchte ich sie zu beruhigen. »Gleich geht’s dir besser.«
»Wir haben keine Zeit für so was«, flüsterte Tori mir zu.
Sie hatte recht. Aber wir konnten unsere neue Freundin ja nicht einfach an den schlecht gefärbten petrolfarbenen Haaren hinter uns her schleifen. Wie sollte sie uns vertrauen?
Augenrollend gab Tori nach einem kurzen Staring-Contest nach. Sie schwang sich die nicht mehr benötigte Sense von den Schultern. Zwischen ihren Fingern verflüssigte sich das eben noch feste Blut wieder und sickerte zurück in ihre Handfläche.
Das war zu viel für unser Gegenüber. Ihre Augen rollten bei dem Anblick nach hinten, sodass nur noch das Weiß zu sehen war. Dann sackte sie in sich zusammen.
»Wir müssen der Oberrätin Bescheid geben«, sprach mir Tori aus der Seele, hörbar froh sich jetzt immerhin nicht mehr mit den Emotionen der Normalsterblichen auseinandersetzen zu müssen. Mir ging es ähnlich – auch wenn ich mich deswegen zumindest minimal schlecht fühlte. In mir kämpften auch genug eigene Gefühle um die Vorherrschaft.
Frustration.
Irritation.
Verunsicherung.
Ein blödes Bauchgefühl.
Müdigkeit … Nicht in Gedankenstrudeln verlieren. Handeln!
Ich schnappte mir Hamlet aus der Ledertasche und küsste ihn auf die aufgebrochene, tote Stirn.
Tori stieß einen angeekelten Laut aus, als ich ihm zuhauchte: »Ruf meine Mutter an.«
Kapitel 2
Mordred
Als er aufwachte, war die andere Seite des Bettes leer. Er strich über das weiße Laken. Ein bisschen von ihrer Wärme steckte noch darin, zusammen mit dem Duft ihres Parfüms. Mordred schmiegte seine Wange an ihr Kissen und kuschelte sich tief hinein, um den letzten Rest davon in sich aufzusaugen. Schon das dritte Mal diese Woche wachte er neben ihrer verwaisten Bettseite auf. Seufzend rollte er sich auf den Rücken. Hoffentlich war sie vorsichtig da draußen.
Der schmale Mond grinste höhnisch zum Fenster herein. Bei einem Blick an sich herunter verstand Mordred sofort, wofür der Mond ihn verspottete.
Irgendwie gefiel ihm das Ziehen jenseits seines Bauchnabels, bis in den Lendenbereich. Andererseits war es so … unfreiwillig. Und dieses Zelt, dass die dünne Decke dadurch bildete – kein Wunder, dass der Mond ihn auslachte. Menschenkörper waren wirklich seltsam. Er würde sich wohl nie völlig daran gewöhnen.
Mordred knipste beim Aufstehen mit dem Fuß die Stehlampe neben dem Bett an und schmunzelte bei dem Blick auf das Foto von Ophelia und ihm daneben. Dann holte er diesen Körper mit einer eiskalten Dusche zurück auf den Boden der Tatsachen.
Manches hatte das Menschsein dennoch für sich, dachte er, als er sich pfeifend und im flauschigen Bademantel seiner Freundin etwas Cupcake-Frosting aus dem Kühlschrank in der Kochnische neben dem Badezimmer holte. Süßes schmecken zum Beispiel.
Außerdem bot es nicht nur Risiken, ausgerechnet von diesem Menschen nicht loszukommen, egal wie absurd seine Gefühle ihr gegenüber auf den ersten Blick erschienen. Mit Logik kam er bei seiner Verbindung zu Ophelia nicht weiter. Dafür fühlte sie sich sinnvoller und schöner an als alles andere. Darum gab er sich seinen Gefühlen lieber hin, statt über sie nachzudenken. Warum sich den Kopf zerbrechen, statt zu genießen?
Vorfreude trieb seine Zunge über seine Unterlippe.
Zurück im Schlafbereich des Ein-Zimmer-Apartments, den Kakteen und Bücher auf dem Fensterbrett säumten. Dort öffnete Mordred die als Spieluhr getarnte Schachtel, die auf der Fensterbank stand. Mit spitzen Fingern sortierte er die Knöchelchen unter dem doppelten Boden.
Huhn? Nein. Dachs? Nicht schon wieder. Ah!
Seine Reflektion auf der Fensterscheibe ahmte sein hungriges Grinsen nach. Seine Augäpfel färbten sich schwarz und seine Iris nahm das natürliche Gold an, das Mordred sonst hinter einem menschlichen Hellblau verbarg.
Er entschied sich für einen Inkubus-Mittelfingerknochen und tauchte ihn in das Frosting, bevor er ihn verschlang. Hmmmm. Köstlich! Klebrig-süß bis in die letzte Knochenfaser.
Mordred knabberte noch den ein oder anderen Knochensplitter, während er mit der Stirn gegen den Fensterrahmen gelehnt in die sich allmählich aufhellende Nacht schaute.
Wo sie wohl gerade steckte? Wem sie wohl diesmal auf den Fersen war?
Nachdenklich schleckte er die Frosting-Reste von seinen Fingern. Hoffentlich kam sie bald nach Hause …
Zweifle an der Sonne KlarheitZweifle an der Sterne LichtZweifle, ob lügen kann die WahrheitNur am Knochenorakel nicht
- eingestickt in die Schatulle von Ophelias Urgroßmutter
Kapitel 3
Ophelia
Die verknöcherten Bäume im Vorgarten reckten die Hälse bis zum Arbeitszimmer im Erdgeschoss meines Elternhauses in Berlin Pankow, als wollten sie ja nichts von unserem gedämpften Gespräch verpassen. Genau wie meine Mutter in ihrem Sessel. Als ginge ihr womöglich die Lösung des Geheimnisses unserer neuen Bekanntschaft durch die Lappen, wenn sie auch nur ein Wort überhörte. Alles war wichtig, wenn auch nichts Sinn ergab.
Meine Mutter nickte in Zeitlupe zu Toris und meinem Bericht. Ihre Miene war versteinert, fast wie an dem Tag, an dem ich ihr eröffnet hatte später nicht im administrativen Dienst des Magieverbandes, unserer Version einer Gewerkschaft für Hexende, tätig werden zu wollen. Sie gab sich auch jetzt beunruhigend gefasst. Sonst erinnerte sie mit ihren großen Augen, den rotbraunen Haaren, der hektischen Gestik und dem Hang zum Horten von Deko sowie Erinnerungsstücken an ein Eichhörnchen. Eines, das ich trotz seiner unnahbaren Strenge sehr liebte und bei dem sich Neider fragten, wie es den dritthöchsten Posten in unserer Vereinigung ergattern konnte. Natürlich nur, bis sie sahen, mit welcher Präzision meine Mutter Knochenmagie ausübte.
Jetzt verriet lediglich das Schnattern um sie herum ihre Nervosität. Nein, nicht Toris und meine Schilderungen. Das Zähneklappern aller Schädel in den Nussbaum-Regalen. Zwei Zimmerwände präsentierten auf Satinkissen die unzähligen menschlichen, tierischen und vereinzelt dämonischen Totenköpfe.
»Ich versuche Seine Hochwürden, den Großmagis zu kontaktieren«, erklärte meine Mutter uns den offensichtlichen Grund für die Geschäftigkeit der Schädel.
Großmagis! Ein nostalgischer Titel für einen langweiligen Verwaltungsjob mit ein paar Special Features. Doch ausnahmsweise war mir diesmal nicht danach, mich darüber lustig zu machen. Ich wollte bloß in meine – scheinbar unerreichbare – Bettdecke beißen, um die angestaute Frustration zu kanalisieren.
Je öfter ich die Geschehnisse in meinem Kopf durchspielte, desto unwirklicher schienen sie mir. Ein gewöhnlicher Mensch, der Dämonen sah? Hier ging es unmöglich mit rechten Dingen zu!
Während Tori die Ereignisse aus ihrer Sicht schilderte und meine Mutter regelmäßig verstohlen zu den klappernden Schädeln schielte, sah ich aus dem Fenster zu den Bäumen vor dem grimmigen Morgenhimmel. Ich nippte an meinem herben Schmetterlingsbohnen-Tee, dessen Blau einen starken Kontrast zum Blutrot der Vorhänge bildete.
Was, wenn das ein weiterer Nebeneffekt der Risse zwischen den Welten war? Was, wenn das Reich der Dämonen an Kraft gewann? Wir wussten denkbar wenig über diese Kreaturen. Vielleicht erkannten wir es darum erst jetzt. Ja, kurz vor Erneuerung der Barriere durch das erhaltende Ritual, in dem Blut- wie Knochenmagier ihre Fähigkeiten bündelten, krochen vermehrt Dämonen durch feine Risse in unsere Welt. Das war schon lange bekannt. Aber was bedeutete es für den Zustand unseres Schutzwalls, wenn nun auch schon ein Mensch Dämonen sah? Halt.
Alles nur Spekulation. Tief durchatmen. Die Nägel aus der Sessellehne nehmen, bevor meine Mutter merkt, dass ich den Gobelin-Stoff beschädige.
Noch war nichts bewiesen. Für all das gab es sicher eine ganz banale Erklärung. Es musste einfach so sein!
»Womit auch immer wir es hier zu tun haben, ich wittere einen Skandal.« Danke für nichts, Mama! »Es war jedenfalls absolut richtig, mich zu kontaktieren, Mädchen. Bis wir Antwort vom Großmagis erhalten, sollten wir Ruhe bewahren.«
»Was tun wir, wenn sie vorher aufwacht?«, warf ich ein.
»Tja, was macht ihr dann?«, kam eine Stimme aus Richtung Zimmertür.
Wir wirbelten herum.
Im Türrahmen zum Gästezimmer stand leichenblass das Mädchen vom S-Bahnhof. Um sie nicht komplett in Panik zu versetzen, hatten wir sie nicht umgezogen. Sie trug noch immer ihre vom Dämonenblut lädierte Kleidung, als sie sich in den Raum tastete. Alle Blicke ruhten dabei auf ihr.
»Nichts«, erwiderte meine Mutter mit hektischer Mimik. »Sie sind schließlich Gast in diesem Haus.«
»Sie?«, raunte die junge Frau mit den bunten Haaren, die wahrscheinlich ungefähr in meinem Alter war, vielleicht etwas jünger.
»Gar keine Angst mehr vor uns?«, warf Tori mit verschränkten Armen ein. Irgendetwas an der bloßen Anwesenheit unseres Gastes reizte sie. Sonst schaffte das nur Aaron.
»Ihr seht nicht aus, als würdet ihr wegen Geld Leute von der Straße entführen.« Mit diesen Worten hob die Sterbliche den Deckel einer Bonbonschale aus Kristallglas neben ihr an. »In meinem Fall würde ohnehin niemand Lösegeld zahlen …«
Keine Ahnung, was ich darauf sagen sollte. Ich verspürte den Impuls zu widersprechen – aber was wusste ich schon?
Wir belauerten uns alle in angespannter Stille. Niemand wollte dem anderen zu nahetreten, ausnahmsweise nicht einmal meine Mutter. Sie beobachtete schweigend, wie das Mädchen aus der Unterführung sich umsah. Deren Gesicht wurde noch blasser, als ihr Blick über die unzähligen Schädel schweifte. Er blieb an einem Dämonenschädel mit sieben Augenhöhlen hängen. Sie schluckte so schwer, dass ich förmlich den Kloß in ihrem Hals spüren konnte. An ihrer Stelle hätte ich uns wahrscheinlich für Spinner gehalten, die sie irgendeinem Totengott opfern wollten. Wenn sie ähnliche Gedanken hatte, unterdrückte sie ihre Angst gut.
Stattdessen murmelte sie: »Dann habe ich mir das nicht eingebildet?!«
»Es wird alles gut«, log ich, weil ich nichts Besseres zu sagen wusste. Sehr einfallsreich, Ophelia.
Unser Gast schnaubte nur. Da griff meine Mutter ein. Sie räusperte sich, stand auf und hielt der jungen Frau die Hand hin. »Nora Herzsprung, sehr erfreut.«
»Ja, sicher«, raunte ihr Gegenüber abgelenkt. Ich konnte förmlich sehen, wie die Erkenntnis bei ihr durchsickerte, dass sie sich den Vorfall nicht eingebildet hatte. Währenddessen schweifte ihr Blick weiter über die Schädel. Zähneklappern für Zähneklappern. Liderflattern für Liderflattern. Sie riss sich sichtlich zusammen.
Dann starrte sie Mama an, als sei sie eine Art Schutzpatronin. »Wer zur Hölle seid ihr Typen? Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen und dann taucht ihr auf einmal auf. War das Ding, das ihr erlegt habt, wirklich ein Dämon?«
»Keine Ursache, übrigens«, rief Tori rüber, die weiterhin reserviert am Fensterrahmen stand.
»Nora Herzsprung, wie gesagt. Das sind meine Tochter Ophelia, falls sie sich noch nicht vorgestellt hat, und das ist ihre langjährige Jagdpartnerin Kotori. Ich persönlich mag das Wort nicht, weil es nach kitschigem Fantasyroman klingt, aber ganz salopp könnte man uns als Dämonenjäger bezeichnen.«
»Soll das heißen, das war nicht das erste Mal, dass so ein … so ein Teil aufgetaucht ist? So was passiert regelmäßig?« Sie begann zu hyperventilieren.
Als ich die Hand ausstreckte, zuckte sie zusammen. Meine Mutter gab mir mit einem Blick zu verstehen, unserem Gast Raum zu geben.
»Eins nach dem anderen«, atmete sie bedacht aus. »Sie sind hier in Sicherheit. Unser Wohnsitz wird von formidablen Bannzaubern beschützt, die in alter Familientradition weitergegeben wurden. Außerdem sind wir drei hier. Also atmen Sie erst einmal tief durch, Frau ähm …«
»Januschka. Aber alle nennen mich Janus.«
»Januschka, schildern Sie uns bitte ganz genau, was Sie gesehen haben, damit wir Ihnen helfen können.«
»Moment mal. Bevor ich euch irgendwas über mich erzähle, will ich verdammt noch mal erst wissen, was für eine beschissene Sekte das hier ist. Wo bin ich? Was wollt ihr von mir? Danke und so, dass ihr das Ungeheuer erledigt habt, bevor ich sein Frühstück wurde, aber wieso haltet ihr mich hier fest?«
»Ts, Sekte«, lachte meine Mutter entrückt.
»Niemand hält dich fest«, versprach ich. »Wir haben dich hergebracht, weil du ohnmächtig geworden bist und wir dich nicht mit den Erlebnissen allein lassen wollten.«