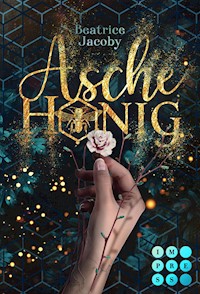5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Keep your friends close and your enemies closer** Alles, was Valentina berührt, verdirbt. Wegen diesem Fluch muss sie fernab der Menschenwelt bei den Fae leben, wo sie eines Tages von der Kuriositätensammlerin Mimosa in deren Kabinett verschleppt wird. Sie sinnt auf Rache und die einmalige Chance, von ihrem verhassten Fluch und dem Kabinett freizukommen, doch scheint ihr Mimosas Neffe, der geheimnisvolle Nekromant Nox, dabei immer wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen. Während Valentina versucht, den Intrigen rund um das Kabinett zu trotzen, erlangt sie einen Blick hinter Nox' blasierte Fassade und kann sich ihrer Faszination für den scharfzüngigen Außenseiter nur schwer entziehen ... Eine Liebe, die allen Widrigkeiten trotzt! Tauche ein in eine magische Feenwelt voller Geheimnisse, Intrigen und Neid. //Dies ist der erste Band von Beatrice Jacobys magischer »Wicked Hearts«-Reihe. Alle Bände der Reihe bei Impress: -- Wicked Hearts 1: Fae Curse -- Wicked Hearts 2: Fae Revenge Diese Reihe ist abgeschlossen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Beatrice Jacoby
Fae Curse
**Keep your friends close and your enemies closer**
Alles, was Valentina berührt, verdirbt. Wegen diesem Fluch muss sie fernab der Menschenwelt bei den Fae leben, wo sie eines Tages von der Kuriositätensammlerin Mimosa in deren Kabinett verschleppt wird. Sie sinnt auf Rache und die einmalige Chance, von ihrem verhassten Fluch und dem Kabinett freizukommen, doch scheint ihr Mimosas Neffe, der geheimnisvolle Nekromant Nox, dabei immer wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen. Während Valentina versucht, den Intrigen rund um das Kabinett zu trotzen, erlangt sie einen Blick hinter Nox’ blasierte Fassade und kann sich ihrer Faszination für den scharfzüngigen Außenseiter nur schwer entziehen ...
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© Michael Neumann
Die 1992 geborene Münchnerin Beatrice Jacoby absolvierte eine Ausbildung zur Incentive- und Eventmanagerin sowie zur Fremdsprachenkorrespondentin. 2022 absolvierte sie außerdem eine Weiterbildung im Bereich Schreibtherapie. Heute lebt und arbeitet sie in Düsseldorf. Sie liebt es, mit ihrem Mann zu debattieren, Buchcharaktere zu illustrieren und bei einer guten Tasse Tee in fantastische Welten abzutauchen.
Für Melanie, Nadine,und für alle Trolltöchter. Willkommen zu Hause
Vorbemerkung für die Leser*innen
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Beatrice Jacoby und das Impress-Team
Prolog
Das Dämmerlicht lockt nicht nur Irrlichter und Glühwürmchen an. Eine hagere Gestalt mit zweigartigem Geweih erscheint auf der von Brombeersträuchern umrankten Lichtung. Ihre Bediensteten folgen ihr auf dem doppelten Hufe wie Schatten. Sie huschen um eine lange Tafel herum, die wie dort hingezaubert mitten auf der Lichtung steht. Als wären die Bäume Gäste, die sich noch nicht trauen, sich zu setzen.
Doch für sie sind all die Köstlichkeiten nicht bestimmt.
Leise summt die gehörnte Frau eine entrückte Melodie und stülpt ihre Mantelkapuze vom Horn-Geweih, während sie Törtchen für Törtchen, Frucht für Frucht auf der Tafel darbringen lässt. Sobald das Werk vollbracht ist, schickt sie ihre Diener mit einem Wink davon.
Allein lässt sie sich wie ein Herbstblatt auf einem Stuhl an der Tafel nieder. Da schüttelt ein Windstoß Irrlichter, Glühwürmchen und Baumkronen. Ein kleiner Luftstrudel bildet sich über einem Pilzkreis auf der Lichtung.
Ein schiefes Lächeln breitet sich auf den schwarz geschminkten Lippen der Gestalt aus.
Sie überschlägt die Beine. Im selben Augenblick verwandeln sich ihre zu etwas Ähnlichem wie Krallen gefeilten Paarhufe in zierliche Füße.
Sie wirft sich eine dunkle, pralle Beere in den Mund und beißt sie auf. Gespannt, was der Pilzkreis auf der anderen Seite eingefangen hat.
Kapitel 1
Staub und Sehnsucht hängen in der Luft. Genau wie der intensive Duft von saftigen Granatäpfeln. Voller Vorfreude knabbere ich an meiner Unterlippe. Dabei weiß ich, dass das Gefühl von Granatapfelkernen daran ebenso wenig real ist wie der Märchen-Mythos aus der Welt meiner Eltern, dass alle Probleme durch den Kuss der wahren Liebe verschwinden. Der Duft ist eine Illusion, die der alchemistisch präparierte Kristall hervorruft, der auf der Stelle zwischen meinen Augenbrauen balanciert.
Der Dielenboden, auf dem ich ausgestreckt liege, riecht sonst harzig und nach alten Buchseiten. Beides wabert nur hintergründig unter der Fantasie. Neben mir ranken sich Dornen aus Stein um die Regale voller Mondsplitter der Anderwelt und Artefakte von der anderen Seite.
Die wie ich aus der Menschenwelt in die Anderwelt entwendeten Relikte in der Kiste da drüben laufen schon nicht weg. Ich kann sie später noch reinigen und im Archiv einräumen. Was kann ich dafür, wenn ich vorher über dieses Schmuckstück von Kristall stolpere? Ich musste ihn einfach ausprobieren!
Man könnte meinen, nach all den Jahren unter Fae wie Trollen, Ningyo, Selkies, Lamia, Pixies und Faunen hätte sich meine menschliche Anfälligkeit für diese Versuchungen abgenutzt. Aber nein. Weder die verlockend duftenden Früchte dieses trickreichen Wunderlands noch die vielen Wunder im Haus des Alchemisten werden für mich jemals ihren trügerischen Reiz verlieren.
Seit über einer Stunde probiere ich mich mit dem Schleifwerkzeug im Atelier daran, die Kristallwelt nach meinen Wünschen zu verändern, statt meiner eigentlichen Aufgabe nachzugehen. Ein Schliff hier, ein Schritt dort verändern die Intensität der Sinneseindrücke und Bilder. Die Mondstaub-Legierung scheint den Rest zu schaffen, auch wenn ich nicht weiß wie. Oder von welchem unserer fünf Monde sie stammt. Noch nicht.
Süßer Saft spritzt aus dem herbeifantasierten Granatapfelkern, als ich zubeiße. Meine Zähne treffen einander, doch ich schmecke jede Nuance der Fantasie. Eine galante Hand mit gefeilten Krallen reicht mir die andere Hälfte des Granatapfels. Der Geruch von Regen mischt sich dazu. Perfekt! Mein Versuch, das Wetter in der Geschichte umzufeilen, hat funktioniert!
Der lila-türkise Stein flüstert mir weiter seine ausgedachten Geschichten zu, die ihm einverleibt wurden. Die Szenen fließen aus ihm in alle meine Sinne. Eine faszinierende Facette der modernen Alchemie. Damit kann man vermeiden Magie zu verwenden und der Sucht zu verfallen, die diese verursacht. Personen, die wie ich zwei Eltern aus der Menschenwelt haben, sind besonders anfällig dafür. Ganz zu schweigen von den realen Versuchungen wie ausgelassenen Tänzen im Sumpfwald, irreführenden Rätseln und wilden Versprechungen, wenn man sie löst. Die charmanten Lippen des erträumten Fae, mit Augen zum darin ertrinken, flüstern mir genau solche zu.
Abenteuern in solchen fiktiven Geschichten nachzujagen ist sicherer für mich und mein Herz. Kristalle wie dieser sind meine temporäre Flucht aus dem Gefängnis meiner limitierten Realität, bis ich mir irgendwann selbst einen Schlüssel schmieden kann. Bis ich mir ein eigenes, unabhängiges Leben aufgebaut habe. Und das werde ich!
Auch wenn ich es schon fast mein ganzes Leben lang bisher erfolglos versuche.
Bis dahin bleibt mir das hauchdünne Säuseln des Kristalls von maskierten Verehrern auf Festen unter pilzbewachsenen Hügeln, unter denen mich Tunnel auf die andere Seite bringen können. Ich war ewig nicht mehr in der Welt, aus der meine Eltern stammen. Wahrscheinlich werde ich das auch nie wieder. Aber durch Artefakte wie diese …
Da lässt ein vertrauter Ruf meine Gedankenblase platzen.
Überrumpelt zucke ich zusammen, wodurch der Kristall von meiner Stirn rutscht.
»Valentina«, donnert erneut die kratzige Stimme meines Lehrmeisters die Wendeltreppe zum Archiv hinauf.
Ich folge seinem Ruf aus dem Dachboden hinunter ins Erdgeschoss. Die Granatapfel-Fantasie echot währenddessen in meinem Herzen, fest eingeschlossen zusammen mit meinen älteren Geheimnissen.
Obwohl es schon über ein Jahr her ist, dass ich Antorius so lange bequatscht und bei Wind und Wetter auf seiner Türschwelle gewartet habe, bis er mich als Lehrling aufnahm, vertrauen wir einander wenig an. Wir leben den Großteil unserer Tage nebeneinander her. Manchmal frage ich mich, ob eine der herzzerreißenden Geschichten in den Kristallen in Wahrheit Antorius’ eigene ist. Vielleicht hat jemand sein Herz zu Stein verwandelt, so wie meine Vergangenheit einen Teil von mir. Ob er darum so an dieser Spielerei der modernen Alchemie hängt? Oder ist es wegen der entführten Menschen-Artefakte, denen in diesem Atelier ein neues, aufregenderes Leben eingehaucht wird?
Für andere mag es hier im Flur nach Qualm und Nelken riechen. Für mich duftet es nach Neuanfang. Die Artefakte kommen wahrscheinlich genauso wenig noch mal in die Menschenwelt wie ich. Dafür bekommen sie hier einen neuen Sinn. Bei diesem Gedanken muss ich wie immer lächeln.
»Valentina, was für einen Unfug stellst du diesmal an, statt zu arbeiten?«
»Bin doch schon da.«
Kaum erreiche ich die letzte Stufe der Wendeltreppe, hinkt mir mein Lehrmeister, das in die Jahre gekommene Herzstück dieser Alchemie-Werkstatt, an seinem Gehstock aus seinem glitzernd verqualmten Atelier in den engen Flur entgegen.
Die Zeit hat den sicherlich früher satten sumpfgrünen Ton seiner Haut stumpf werden lassen und seine spitzen vernarbten Ohren ragen gefühlt jeden Tag höher neben seinem faltigen Gesicht empor. Doch er sieht mich mit einer intensiven Verschlagenheit und Wissbegierde an, als wäre er zwei Jahrhunderte jünger. In seiner freien Hand hält Meister Antorius ein Päckchen. Es ist in leicht transparentes Papier eingewickelt, das Blättern ähnelt.
»Überbringe diese Bestellung an die Adresse, die ich draufgeschrieben habe. Danach kommst du postwendend zurück, verstanden? Keine Umwege.«
Dabei machen die doch am meisten Spaß!
Meister Antorius bedenkt mich mit dem tadelnden Stirnrunzeln und zwirbelt seinen drahtigen Ziegenbart. Genau dieser Blick verfolgt mich vor jeder Alchemie-Prüfung in meinen Träumen.
»Ich meine es ernst, Valentina«, knurrt er, als ich das Päckchen an mich nehme. »Keine. Ausflüge. Schon gar nicht zu diesem tunichtguten Irrlichter-Schwarm. Wer weiß, wo du deine neugierige Nase diesmal einklemmst.«
Ich sehe flüchtig zu ihm auf, obwohl meine Aufmerksamkeit eigentlich auf dem Päckchen liegt, das ich drehe und wende.
»Ist das die blecherne Spieluhr, die die Banshee mit dem Gebirgsdialekt gestern gebracht hat?« Durch die vielen verschnürten Blätter kann ich den Inhalt nicht erkennen. Leicht ist er jedenfalls nicht, trotz seiner Größe.
»Wann wirst du mir beibringen, wie man Metalle von der anderen Seite für Fae ohne oder mit fast keinen menschlichen Wurzeln unschädlich macht? Ich bin so weit, ich versprech’s!«
»Glaubst du eigentlich, die Brücken unserer Stadt wurden auch alle an einem Tag erbaut? Du fängst gerade erst dein zweites Lehrjahr bei mir an.«
»Schon mein zweites«, entgegne ich stolz. Außerdem habe ich ihm schon zigmal heimlich durchs Schlüsselloch bei der Prozedur zugesehen. Ich bin bereit für mehr Vertrauen, für größere Sprünge. Wenn ich den Kristall perfektioniert habe, wird das hoffentlich Beweis genug sein.
Meister Antorius seufzt. Er kann Stroh zu Gold spinnen und Menschenmetalle entgiften. Aber seine durch mich strapazierten Nerven in Drahtseile verwandeln kann er nicht.
»Geduld«, beschwört er eine meiner größten Schwächen. »Alchemie verlangt Geduld von uns. Was ist aus dem Mädchen geworden, das vor einem Jahr tagelang auf meiner Türschwelle ausgeharrt hat?«
Ich kann nicht anders, als aufzulachen. »Du meinst den Sturkopf, der kein Nein zu einer Lehre bei dir akzeptieren wollte? Der ist genau hier. Und ich lasse wieder nicht locker, bis du mir beibringst, wie man Menschenmetalle unschädlich macht.«
Antorius runzelt die Stirn. »Du magst ein Händchen für die Alchemie haben. Du saugst meine Lehrinhalte auf wie ein Schwamm, Valentina. Aber du bist auch unachtsam. Leicht abzulenken. Für das Handwerk, nach dem du fragst, muss man fokussiert sein.«
Antorius kürzt seinen üblichen Vortrag über Geduld und meinen Protest mit einem rasselnden Räuspern ab.
»Unsere Kunden erwarten bei aller Geduld Eile und Pünktlichkeit. Los jetzt.« Er gestikuliert Richtung Tür, als hätte er unglaublich viel zu tun. Dabei wissen wir beide, dass das Geschäft nicht gerade prickelnd läuft. Wozu er zurückkehrt, sobald ich weg bin, sind Fungusschnaps und Schnupfspohren, keine Aufträge. Nur wenige bringen noch aus der Menschenwelt gestohlene Schätze zu uns, damit wir sie für alle Fae brauchbar machen.
»Wenn du früh genug zurück bist«, sagt Antorius mit einem schelmischen Funkeln in den Augen, »dann können wir noch an der Bregonium-Legierung für Kometensplitter arbeiten, wie du es dir neulich gewünscht hast.«
Mein Herz macht einen Satz. »Bin schon weg!«
Ich schnappe meinen knöchellangen senffarbenen Kapuzenumhang von einer der Blätterschnitzereien am Wendeltreppengeländer. Das Päckchen stecke ich in die tiefe Umhangtasche und bin schon zur Tür hinaus.
Draußen empfängt mich der vertraute Sumpfgeruch nach feuchten Pflanzenteilen und Erde. Noch auf dem erhöhten Absatz zur Haustür halte ich inne. Ungewöhnlich viele Fae tummeln sich in unserer sonst beschaulichen Handwerkerstraße am linsenbedeckten Sumpfufer.
Stimmt ja, die Parade! Über meine Arbeit am Kristall und die Traumvorstellung hatte ich sie schon fast wieder verdrängt.
Es kommt nicht oft vor, dass sich ein Mitglied des sogenannten mittleren Sternadels in unseren Sumpf voll unabhängiger Seelen verirrt, statt die Gunst der Höfe oder ihrer Krone zu suchen. Kein Wunder, dass gefühlt die ganze Stadt Amaranthis einen Blick auf sie erhaschen will, wenn sie heute auf der Durchreise eine Parade darbietet. Besonders bei dem Ruf, der dieser Kuriositätensammlerin vorauseilt. In den unabhängigen Gebieten, jenseits der Reichweite von Obera und Titania gelten höfische Titel und Sternadel nicht viel. Aber es reicht für das Versprechen von Tratsch und Spektakel.
Zwei der fünf Monde, Lunarr und ihre blasse Schwester Ecliptis, stehen trotz Tageslicht am Himmel. Es geht also bald los.
Ich schlucke schwer. Da sind sicher mehr Personen unterwegs als Zikaden im Sumpf. Die meisten von ihnen pressen Blumen zum Werfen für die Parade an sich, damit sie nicht zerquetscht oder von den Hörnern anderer lädiert werden.
Aus der Innentasche meines Umhangs angle ich eine kleine Phiole mit glitzerndem Parfüm. Damit hülle ich mich in eine penetrante Duftwolke von Patschuli und Sumpf-Lilien ein. Ich presse die Lippen zusammen und hoffe, dass der Geruch die Passanten wie so oft auf Abstand hält. Dann tripple ich die wenigen Stufen auf die gläserne Straße hinunter, wo mein Plan aufzugehen scheint.
Mein Weg führt über Glasbrücken und -gassen über das mit Wasserlinsen bedeckte Nass, vorbei an den schiefen Häusern aus blassem Holz oder aus luftig leichtem Callantium-Gestein. Über die größtenteils schwimmenden gläsernen Plattformen an den Passanten vorbeizuhuschen, fühlt sich an, als würde ich über das Wasser schweben. Mit einem Lächeln betrachte ich das dunkle Sumpfwasser unter meinen Füßen. Von dieser Illusion des Fliegens werde ich nie genug bekommen.
Leider achte ich dabei für einen Moment nicht auf meine Umgebung. Kurz vor der nächsten Bogenbrücke, über die ich muss, pralle ich gegen jemanden. Der Rückstoß lässt mich stolpern. Mein Herz stolpert mit. Ich spüre die Farbe aus meinen Wangen weichen, untermalt von grollendem Fluchen vom Fae vor mir. Als sein Blumenstrauß auf dem Boden aufschlägt, platzen Blütenblätter welk ab. Weinrot, tiefschwarz und braun liegen sie zu meinen Füßen. Der modrige Geruch ihrer gammelnden Stängel mischt sich mit meinem Parfüm. Doch das scheint niemandem außer mir, die sich darauf fixiert, aufzufallen.
Bis in die dünnen Spitzen seiner Ohren läuft mein Gegenüber vor Zorn an. Eine dicke Ader pocht auf seiner mit Schmetterlingstramenten bewachsenen Stirn.
Wie erstarrt blicke ich von ihm zu seiner überraschten Begleitung und zurück zu den toten Blumen. Der frustrierte Knoten in meinem Magen und der Kloß im Hals haben mir gerade noch gefehlt. Schau nicht mehr zu den toten Blumen, nur nach vorn. Sonst lenkst du die Aufmerksamkeit darauf.
»Tut mir leid«, sage ich bestimmt, aber mit trockenem Mund.
Der Fae holt energisch Luft, sicher um mich anzuschreien. Als ob das Absicht gewesen wäre! Ich beiße mir auf die Zunge. Mir widerstrebt es, mich in Konfrontationen nicht zu verteidigen. Doch wegen der Blumen zu meinen Füßen will ich einfach nur, dass diese Situation endlich vorbei ist. Seine Begleitung unterbricht den Fae zum Glück, indem ihre spinnenhaften Finger seinen Arm zart berühren. Das Flugblatt zur Parade in ihrer Hand raschelt dabei.
»Lass gut sein, Liebster.«
»Dreckspöbel«, lässt er sich nicht nehmen zu schnauben. Ebenso wenig wie den abschätzigen Blick, den ich nur am Rande wahrnehme. Ich bin bloß erleichtert, dass er den kaputten Strauß nicht weiter beachtet. Anders als ich.
Die beiden Passanten straffen ihre Haltung und gehen weiter. Doch was der Fae mit gehobener Nase unnötig laut sagt, ist definitiv noch für meine Ohren bestimmt:
»Darum habe ich deiner Schwester abgeraten, jenseits höfischer Gefilde zu ziehen. In den freien Wäldern und Sümpfen gibt es keinen Anstand. Kein Benehmen. Keine nennenswerten Talente.«
Sie zieht ihn weiter, kichert jedoch, trotz der irritierten Blicke der Passanten, die mitgehört haben. Sie wirft einen Blick über die Schulter zu mir zurück. Als sie die kaputten Blumen auf der Glasstraße entdeckt, bevor ich sie alle mit dem Schuh in den Sumpf schubsen kann, friert ihr Lächeln ein und der Mund voller spitzer Zähne klappt ihr auf. Dann verschluckt sie zum Glück der Strom aus Schwingen, Hörnern und Geweihen.
Obwohl sich bereits niemand mehr um meinen Zusammenstoß schert, schlage ich die Kapuze meines Umhangs über mein weizenblondes Haar. Zur Sicherheit ziehe ich sie noch tiefer in mein Gesicht hinein. Der herauslugende Pferdeschwanz reicht fast bis zu meinem unteren Rippenbogen und glänzt, doch er besitzt nicht das unterschwellige Schimmern wie Fae-Haar, wenn ich nicht extra ein Kristallpuder auftrage. Überraschung, ich bin ja auch keine Fae. Besonders in Amaranthis, dessen erste Brücken vor Jahrhunderten von Wechselbalg-Nachfahren und freien Fae geschlagen wurden, ist das nichts Ungewöhnliches. Auch wenn das Tücken und Versuchungen in der Anderwelt mit sich bringt.
Doch abgesehen davon, verschleiert werden zu können oder anfälliger für Magie zu sein, entscheidet etwas anderes darüber, wie unser Leben verläuft: Die Sterne, unter denen wir geboren wurden.
Nicht Blutlinien bestimmen Talente und magische Fähigkeiten in der Anderwelt, sondern die Sternbilder. Sie verleihen Wesen ihre besonderen Fähigkeiten, sogenannte Sterntalente. Das gilt genauso für Kinder von Wechselbälgern und entführten Menschen, wenn sie hier zur Welt kommen. Manchen verleihen die Sternbilder und Monde wundersame und furchterregende, meist eigenartig spezifische Mächte. Anderen besonders viel Glück beziehungsweise lebenslanges Pech. Selbst die Krone mit dem Titel Obera beziehungsweise Oberon soll nach dem Tod durch die Sterne neu vergeben werden. Keine Ahnung wie genau, ich habe die freien Gebiete nie verlassen. Die Krone verirrt sich nie in diesen unabhängigen Sumpf und wir uns selten in die Hoheitsgebiete ihrer neun Höfe.
Anders gesagt: Der Griesgram von eben kann niemandem hier an der Nasenspitze ansehen, ob dessen Fähigkeiten über das am weitesten verbreitete Talent der Verschleierung hinausgehen. Obwohl er bei mir den Nagel auf den Kopf trifft.
Das Zwicken in meiner Magengegend und die Scham kommen jedoch nicht von seinem abgehobenen Kommentar. Sondern allein vom Anblick der binnen Sekunden verwelkten Blumen, die nun im Sumpf treiben. Die Blumen, die ich getötet habe. Sie erinnern mich an die Sterne, unter denen ich geboren wurde.
Ich schmecke Salz und Eisen, bevor ich bemerke, dass ich mir auf die Innenseite meiner Wangen beiße. Eine Angewohnheit, die mir hilft, die Fassung zu bewahren. Sie ist eines meiner Geheimnisse, von dem nur das leicht vernarbte Gewebe an diesen Stellen und ich wissen.
Der plötzlich ertönende Fanfarengesang kommt wie gerufen. Seine euphorische Melodie schlägt mir die schmerzhafte Erinnerung aus dem Sinn. Mehr als dankbar dafür lasse ich mich davon mitreißen.
Ich sehe Fahnenspitzen heranschweben. Den Rest der nahenden Prozession verdecken die plappernden und jauchzenden Leute, die sich an den Wegbrüstungen sammeln. Antorius sagte, keine Umwege. Aber von einem kurzen Halt war nie explizit die Rede.
Ein Schmunzeln stiehlt sich auf meine Lippen, während ich mich zwischen den Schaulustigen hindurchschlängle, die sich auf der gläsernen Brücke sammeln. Sie zerdrücken mich fast an der Brüstung, um die sich meine Finger in kribbeliger Vorfreude schließen, sobald ich sie erreiche. Nur nicht blinzeln, um ja nichts zu verpassen. Wenn mir die verflixte Kapuze nur nicht beim Gedrängel ständig ins Gesicht rutschen würde.
Die schwimmende Parade ist noch beeindruckender, als ich sie mir in meinen Tagträumen ausgemalt habe, während ich Antorius hätte zuhören sollen. Ich habe heimlich gehofft, sie würde mich an Vorstellungen aus meiner Zeit vor der Alchemie-Lehre, als fahrende Schaustellerin, erinnern. Doch das hier hat nichts damit zu tun, Menschenmärchen für Wechselbälger mit Heimweh und interessierte Fae aufzuführen, bis man weiß, was für eine Geschichte das eigene Leben erzählen soll. Überhaupt nichts.
Auf dem breiten Sumpffluss treibt eine Reihe dunkler glänzender Boote der Brücke entgegen. Das erste trägt als Galionsfigur eine geflügelte Fae-Schnitzerei mit einer Trompete, passend zu den musizierenden Passagieren in Gewändern mit Tulpenärmeln und kunstvollen Steckfrisuren, die reife Beeren verzieren.
Wo der spitze Bug der Gondel das Sumpfwasser wegschiebt, wirbelt Pixiestaub auf, der sich auf dessen Oberfläche und den Wasserlinsen abgesetzt hat. Wie ein funkelnder Sternennebel umfängt er die Boote. Die lebendige geschnitzte Galionsfigur am ersten davon zwinkert mir zu, bevor die Gondel unter die Glasbrücke gleitet. Ich beiße mir vor Begeisterung grinsend auf die Unterlippe, stemme mich auf die Zehenspitzen, um dem Boot mit meinem Blick über die Brüstung zu folgen. Es muss aus uralten magischen Bäumen gefertigt sein, wenn den Schnitzereien Leben eingehaucht ist. Wunderschön! Wie wunderschön Magie aus sicherer Distanz sein kann!
Von der Gondel direkt dahinter erklingen teuer anmutende Zimbeln, und andere, hellere Instrumenten-Raritäten, deren Namen ich nicht kenne. Sie weben sich zu einer edlen Melodie zusammen, die mein Herz flattern lässt. Gleichzeitig transportiert sie eine Schwere, die ich nicht benennen kann.
»Ich habe gehört, dass sogar der Seelie-Hof der Dornen aus den Hochwäldern Interesse an diesem Kabinett hegt«, munkelt ein Nymph hinter mir.
Seine Begleitung atmet harsch ein. »Oberas und Titanias aktueller Günstling?«
Es kichert hell neben ihnen. »Günstling der aktuellen Titania zumindest.«
Die erste und alle acht folgenden Gondeln sind im Sinne eines unserer Sternzeichen gestaltet: Die Geflügelte, der Narr, das Reh, Drillinge, Axtschmied, Sumpfmanguste, Chimera, Libelle und zu guter Letzt Kelpie.
Jede Gondel bezaubert mich und die anderen Umstehenden auf seine Weise mit Musizierenden und artistischen Darbietungen in thematisch auf das jeweilige Sternzeichen angepassten Gewändern. Die begabte Kompanie setzt seltene Tierwesen und kuriose Instrumente mit Musik und außergewöhnlichen Kunststücken in Szene.
Die Kelpie-Gondel wird sogar von einem echten Koloss seiner Art begleitet. Die Präsenz des schwarzen Hengstes zieht bereits aus der Ferne meine Aufmerksamkeit auf sich. Sein Reiter mit mahagonifarbenem Haar schäkert unterdessen lieber mit einigen Darstellenden, als sich groß für seine Darbietung oder das Publikum zu interessieren. Er strahlt diese herausfordernde Haltung aus, sich alles nehmen zu können, was er will, im Gegensatz zur einstudierten Choreo neben ihm. Er ist gelangweiltes Chaos. Fast so hypnotisch wie die Aura des Kelpies, und dadurch sicher nicht weniger gefährlich.
Das muss Mimosas Neffe sein. Nocturian Blackclover. Der, über dessen Eskapaden man sich auf den gläsernen Gassen seit Bekanntgabe ihrer Parade die Münder zerreißt. Oder besser über den dunklen Stern, unter dem er geboren sein soll.
Unvermittelt schießt mir die Fantasie aus dem Kristall von vorhin wieder durch alle Sinne. Nocturian würde die Rolle des unbekannten Fae darin perfekt ausfüllen, inmitten opulenter Beeren, die er mit diesem verführerisch verschmitzten Lächeln darreicht, mit dem er gerade eine Artistin bedenkt. Aus sicherer Distanz und ohne ihn zu kennen, gefällt mir diese verruchte Idee von ihm für einen flüchtigen Moment.
Einige auf den Booten neben ihm und denen davor wirken auf den zweiten Blick nicht so beseelt wie wir Zuschauer. Wenn sie sich für unsere Unterhaltung verbiegen oder Kunststücke auf engstem Raum über dem Sumpf absolvieren, sind viele Augenpaare schlichtweg leer. Andere starren neidisch bis verzweifelt zu uns Schaulustigen. Zu Freiheit und Möglichkeiten. Ich kenne diesen Blick nur zu gut. Er begrüßt mich jeden Morgen im Spiegel, bevor ich ein Lächeln aufsetze.
Vermutlich präsentieren nicht alle in der Kompanie die kuriosen Tierwesen freiwillig, sondern weil sie durch einen Fae-Pakt gebunden sind.
Der mutmaßliche Grund für die sehnsüchtigen Blicke der Darstellenden schwebt mir auf der Gondel direkt hinter dem Kelpie entgegen: Die Direktorin dieses Zirkus. Diejenige, die für die Zusammenstellung dieses Spektakels bewundert wird, ohne selbst einen Finger zu krümmen.
»Mimosa«, huscht ihr Name über die Lippen des hochgewachsenen Nymphs direkt hinter mir.
Mimosas Anblick würde mir den Atem verschlagen, täte es das zunehmende Gedrängel am Geländer nicht schon. Sie erinnert mich an personifiziertes Licht. Ihre Haut wirkt blass, bis auf den rosigen Hauch auf ihren Schultern und Wangen. Ihr silberblondes Haar ist kunstvoll in mehrere Knoten gebunden und mit goldenen Blüten geschmückt.
Mimosa genießt den Blütenregen sichtlich, wenn sie dem Kelpie-Reiter nicht gerade tadelnde Blicke für seinen fehlenden Elan zuwirft. Die filigranen Schnitzereien ihrer Gondel klatschen derweil Beifall, als wäre sie der Hochadel Obera oder Titania selbst. Statt auf einem Thron hat Mimosa ihren kurvigen Körper jedoch auf einem ihrer Sammlerstücke niedergelassen. Das Wesen gleicht einer muskulösen Raubkatze mit ledrigen Drachenflügeln. Sein glänzendes schwarzes Fell ist mit noch dunkleren Flecken versehen, die nur das changierende Licht des aufgewirbelten Feenstaubs preisgibt. Es bleckt seine goldenen Fangzähne, als Mimosa sein Kinn krault.
Mimosa saugt alle Aufmerksamkeit in sich auf. Dabei sieht sie durch alle hindurch. Sie ist wie aus einer anderen, noch tückischeren und noch magischeren Welt. Faszinierend und furchteinflößend zugleich, wie die Melodie der Musizierenden. Als ihr Blick unter gehobenen Augenbrauen direkt durch mich hindurch schweift, fröstle ich. Gleichzeitig wünscht sich ein Teil von mir, so unantastbar und ungebunden zu sein wie sie. Und wieder ein anderer – meine Füße vornehmlich – will, dass ich renne. So weit und so schnell ich kann.
Plötzlich blinzelt Mimosa mit ihren blütenbesetzten Wimpern. Ich glaube wirklich, sie sieht mich gleich an, wenn ihre Gondel unter die Brücke gleitet. In diesem Moment peitscht die Schwanzflosse des Kelpie eine Wasserfontäne empor. Direkt vor meiner Nase. Erschrocken japse ich auf. Mimosas Raubtier auch.
Unter überraschtem Raunen werde ich von der Brückenbrüstung gerissen, als die Leute um mich herum nach hinten weichen.
Ich strauchle rückwärts auf die Brückenstraße, direkt vor eine riesige, purpurne Reit-Nacktschnecke. Sie scheut und bäumt sich auf, samt fluchendem Reiter. Sie taumelt, genau wie ich. Diese Riesenschnecken waren mir noch nie geheuer. Gerade rechtzeitig rette ich mich auf die andere Seite des Bürgersteiges, bevor die Schnecke mich in ihrer Panik erwischt.
Ich atme den Schock weg, ignoriere den kopfschüttelnden Schneckenreiter, und versuche einen neuen Platz an der Brüstung zu ergattern. Worüber drängen sie sich dort alle noch mehr als zuvor? Was soll das Gemunkel? Nichts davon mitzubekommen, macht mich kribbelig. Gerade möchte ich einen neuen Versuch starten, mich zwischen zwei Fae mit Mottenflügeln zu quetschen, da zupft ein seltsames Gefühl an meinem Inneren. Ich spüre Blicke in meinem Nacken. Wieder trete ich auf die Straße, diesmal bedacht. Dabei erhasche ich einen Blick auf ein düster funkelndes Augenpaar jenseits der Brücke. Die schmalen, verkniffenen Lippen darunter kräuseln sich wie üblich in Gram. Buschige Augenbrauen in einem ansonsten wie in Marmor gemeißelten Gesicht ziehen sich kurz zusammen, bevor ihr Besitzer sich abwendet.
Es ist zu spät dafür, dass der große Faun namens August seinen reich verzierten Kragen hochschlägt und sich in die Passanten duckt. Ich habe ihn bereits erkannt.
Neben seinen stets unbehaglich funkelnden Augen umgibt ihn sonst noch ein weiteres Leuchten. Es fehlt dieses wärmere Schimmern, wie wenn Glöckchenklingen eine Farbe hätte. Der Feenglimmer von Augusts Pixie-Mündel. Sie weicht sonst nie von seiner Seite, außer um hierher verschleppte, gegen Wechselbälger ausgetauschte Kinder zu piesacken. Jedenfalls nicht freiwillig.
Der rachehungrige Blick in Augusts Gesicht ist mir leider allzu vertraut. Er heißt in der Regel nur eines: Dass ich Antorius Auftrag ignorieren und schnellstens einen Umweg einschlagen sollte, bevor August sein Ziel zuerst erreicht.
Ich zwinge mir das Gemunkel an der Brüstung und die Parade aus dem Sinn und beschließe, meine Verspätung bei unserer Kundin später auf das Chaos der Schaulustigen zu schieben. Ohne mich noch einmal nach Mimosas Spektakel umzusehen, laufe ich über die Brücke in die entgegengesetzte Richtung, die mir Antorius aufgetragen hat. Runter von den gläsernen Wegen, hinein in den wilden Sumpf, wo die tückischen Irrlichter lauern.
Kapitel 2
Bevor ich mich endgültig von der äußersten Glasstraße herunterwage, schiebe ich je eine Münze aus der Menschenwelt unter meine Schuhsohlen. Das ist unbequem, aber besser als im Moor zu ertrinken, weil ich vom Weg abkomme.
Beherzt hüpfe ich auf den ersten bemoosten Stein des wilden Sumpfes. Das Metall der Münze schwächt Fae-Zauber. Trotzdem wird sie mich allein nicht davor bewahren, von gelangweilten Naturgeistern in die Irre geführt zu werden. Wenn ich es bis zu meinem Ziel schaffen will, muss ich mich an die bläulich fluorisierenden Pilze halten, die einige Steine und schiefe, knochige Bäume zieren.
Yannis, ein Freund unter den Irrlichtern, hat mir dieses Geheimnis verraten. »Halte dich daran und an nichts anderes. Du kannst keinem Licht sonst vertrauen.«
Nicht einmal seiner eigenen Laterne. Irrlichter achten nicht darauf, wen sie in ein nasses Grab locken, wenn sie einmal in der Trance ihres Tanzes sind. Darum setze ich jeden Schritt mit Bedacht, während zunehmend vermeintliche Glühwürmchen meinen Weg kreuzen.
Bei jedem Satz über eine nachgiebige, mit Wasserlinsen getarnte Stelle passe ich auf, bloß gegen keinen Baum zu stolpern. Der Anblick der verwelkten Blumen auf dem Glasweg hat mir für heute gereicht. Komm bloß nichts zu nah, ermahne ich mich. Leider ist das leichter gesagt als getan. Weder Schuhe noch Handschuhe schützen Gewächse. Es geht nicht um die Berührung meiner Haut. Meine unmittelbare Nähe reicht leider, um das Unheil zu wirken.
Endlich erreiche ich den umgestürzten toten Baum, unter dem sich ein Erdhügel auftut, der mit kleinen weißen Blüten bewachsen ist. Erleichtert atme ich aus. Unter diesem Hügel wohnt Yannis’ Irrlicht-Schwarm. Ich plumpse förmlich von der gehobenen toten Wurzel, auf der ich stehe, ins federnde, trittfeste Moos. Bis zu meinem nächsten Schritt ist es bereits verdorrt. Es versetzt mir einen Stich in der Magengegend, aber ab hier kann ich es nicht mehr vermeiden.
Die Irrlichter sind Yannis Familie, seit die Mutter dieses Schwarms ihn aus einer Laune heraus aus der Menschenwelt gepflückt hat. Eigentlich wollte sie ihn wie jede Beute ertränken. Zu seinem Glück brachte sie es aus irgendeinem Grund bei ihm nicht übers Herz. Als Kleinkind muss Yannis niedlicher gewesen sein als heute. Als ich ihn wie üblich auf der anderen Seite des Hügels finde, erwartet mich statt Niedlichkeit der schlaksige Körper eines Heranwachsenden. Man sieht seinen Bewegungen an, dass seine Gliedmaßen schneller gewachsen sind, als er sich daran gewöhnen konnte. Sein dunkles Haar ist wie immer verstrubbelt. Die lange, spitz zulaufende Kapuze seiner Jacke hängt seinen Rücken herunter. Seine knielange Hose mit den Hosenträgern lässt ihn jünger wirken als seine achtzehn Jahre.
Gerade fliegt ein Großteil seiner Irrlicht-Geschwister über dem düsteren Gewässer etwas abseits. Sie tuscheln und kichern beim Tanz über dem Wasser. Für das ungeschulte Ohr klingen sie wie Blätterflüstern. In ihrer Mitte torkelt ein größeres Licht. Es flackert und schwebt planlose Schleifen statt Muster. Ihre Mutter hat wohl wieder zu viel vom Nektartopf genascht. Kein Wunder, dass Yannis meistens derjenige ist, der sich um sie kümmert, statt andersherum. Sie kann sich auch jetzt kaum selbst in der Luft halten, ihre anderen Kinder fangen sie abwechselnd auf. Yannis lässt währenddessen ein Bein vom Ufer über den Sumpffluss baumeln. Sein linker Arm ruht auf seinem anderen Knie, in seiner Hand hält er einen langen Ast mit einer Laterne aus bunten Scherben. Darin tobt wütendes Pixie-Licht.
»Da bist du ja«, rufe ich, obwohl ich ihn schon in wenigen Schritten erreicht haben werde. Yannis reibt sich dramatisch das runde Ohr, als hätte ich durch den halben Sumpfwald geschrien.
»Wo hätte ich sonst sein sollen?«
»In Schwierigkeiten, wie immer?«, antworte ich mit herausforderndem Lächeln.
Yannis zuckt sorgenlos mit den Achseln, nimmt die Laterne wieder fest in beide Hände, weil das Licht darin die Gunst der Stunde nutzt, um stärker zu randalieren.
Ich sinke zu meinem Freund ins Moos – genauer gesagt auf einen großen Stein, der daraus hervorragt. Obwohl ich meine Knie sofort an den Körper heranziehe, komme ich den Pflanzen kurz zu nah. Der moosige Saum um den Stein zieht sich verdorrt zusammen. Erst das Moos eine Handbreit weiter ist in sicherer Entfernung zu mir. Der Ring aus totem Moos zeigt lehrbuchhaft den Radius meiner Wirkung auf Pflanzen.
Yannis legt den Kopf schief und spendet mir einen tröstlichen Blick. Einen Blick, der versteht, wie es ist, der faule Apfel im Korb zu sein. Er als Irrlichter-Sohn ohne eigenes Licht, für das ihn vor allem seine ältesten Geschwister Willow und Jack ständig aufziehen, und ich, naja, siehe verdorrter Moosring. Behutsam streift Yannis dieses Moos mit seiner spitzen Schuhspitze.
»Eine Haut zart wie ein Rosenblütenmeer, den Duft der Blume als ständiger Begleiter trotz menschlichem Stammbaum. Wie kommt es, dass ausgerechnet deine Nähe alle Gewächse verwelken lässt, Valentina?«
»Alle Gewächse, die kein anderes Leben eingehaucht bekommen haben«, korrigiere ich mit triumphierendem Lächeln, das er erwidert. Seine weißen Zähne kontrastieren dabei seine bronzene Haut.
Wäre ja noch schöner, wenn ich auch Dielenböden und Holzstühle morsch werden ließe. Unbeeindruckt von meinem Versuch abzulenken, zieht Yannis eine Augenbraue hoch.
Ich seufze. »Du weißt doch schon warum.«
Er meint es gut, aber egal wie vertraut wir geworden sind, seit er eines Abends mit einem halben trüben Edelstein ins Atelier kam, um seine Laterne alchemistisch zum Leuchten zu bringen. Egal wie viele unsichtbare Narben wir faulen Äpfel miteinander vergleichen können, ohne verurteilt zu werden. Mir wird niemals wohl mit diesem Thema sein. Bei niemandem.
Ich weiche Yannis’ Blick aus und starre auf die dunkle Sumpfoberfläche. Welche Geschichte habe ich ihm aufgetischt? Wenn man sich selbst seit Jahren damit unterhält, jedem unterschiedliche Varianten der Wahrheit zu erzählen, muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Dafür bleiben meine wahre Geschichte und das damit verbundene Gefühlschaos ganz meins.
»So ein vererbter Fluch ist eben hartnäckig. Er wird von Generation zu Generation stärker, wenn Sternkonstellationen ihn festigen.« Kurz durchfährt mich ein kleiner Adrenalinschub. Ich schiele zu Yannis. Er nickt stumm und wissend. Puh! Dann war es wohl die richtige Geschichte.
Irgendwann vergesse ich noch selbst, was wahr ist, weil ich mich nur noch an meine Lügen erinnere. Bei dem Gedanken muss ich schmunzeln. Wäre das nicht schön einfach?
»Na endlich, sie wird müde.« Yannis lächelt stolz.
Sie, das ist die Pixie, die er in der aus bunten Scherben zusammengesetzten Laterne eingesperrt hat. Tatsächlich hat sie inzwischen weniger von einem Alarmsignal und mehr von einem sanften einladenden Schein. Der perfekte Köder – abgesehen von einem echten Irrlicht-Licht natürlich.
Das Leuchten von Yannis’ Ziehgeschwistern, die mich zum Schabernack umschwirren, gleicht einer Flamme hinter Rauchglas. Es ist seltsam hypnotisierend, sodass man ihm folgen und es erkunden möchte. Mir kribbelt es in den Beinen, wenn sie mich so ärgern, und das wissen sie. Bedacht, niemanden zu verletzen, verscheuche ich sie mit meiner Hand. Ich blicke ihren kichernden Leuchtkörpern hinterher und strecke ihnen kurz die Zunge raus. Freche, mordsgefährliche Schelme.
In meiner Brust echot Yannis Wunsch, dazuzugehören. Nicht mehr der faule Apfel im Korb zu sein. Aber auch das dumpfe Schlagen gegen das Innere des Scherbengefängnisses hallt in meinem schweren Herzen wider. Es ist furchtbar, seine Freiheit zu verlieren, sei es durch einen Fluch oder eine Laterne. Yannis Schmerz rechtfertigt nicht, die Pixie einzusperren.
»Du musst sie freilassen«, sage ich bestimmt. »Erstens ist sie eine Person, und zweitens überspannst du mit deinen Streichen irgendwann den Bogen mit ihrem Patron August vollends. Du weißt, wie innig eine Bindung zwischen Pixie und Patron ist, wenn sie mal eine eingeht.«
»Ich dachte, du findest dieses ›Sie binden sich fürs Leben‹-Gesülze genauso kitschig wie ich. Wirst du langsam doch Romantikerin?«, neckt er.
Wir wissen beide, dass diese Bindung nicht zwangsläufig eine romantische ist, dafür aber eine unerschütterliche. Die Sorte, durch deren Vorstellung ich gleichzeitig sehnsüchtig und klaustrophobisch werde.
Yannis hält unbeeindruckt seine Laterne wie eine Angel über den Sumpf. Der Lampenschein lässt seine Gesichtszüge und erwartungsvoll geweiteten Augen fast besessen wirken. Keines meiner Worte dringt zu ihm durch. Trotzdem versuche ich es weiter.
»Ich habe August bei der Parade gesehen. Er sah noch grimmiger aus als sonst. Er sucht seine Pixie. Und es ist kein Geheimnis, wo Elara in der Regel ist, wenn er sie nirgends finden kann.«
Der Faun August hat keinen besonders langen Geduldsfaden und wie die meisten im Fae-Reich ist er nicht zimperlich mit Streichen. Nur dass ich August mehr als die harmlosen Streiche zutraue. August ist jähzornig, außer mit Elara, und er hat dieses Funkeln in seinen Augen, das mir jedes Mal einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Yannis dagegen zuckt nicht einmal mit der Wimper. In der Regel erheitern mich seine harmlosen Streiche, weshalb ich mich gerne in seiner Nähe vom Alltag ablenken lasse. Wie sehr die Fehde mit August und Elara dagegen hochgeschaukelt ist, widerstrebt mir nicht nur. Es macht mir Sorgen.
»Ich kann Antorius bitten, einen neuen Leuchtstein zu kreieren. Dann brauchst du die Pixie nicht.«
Das Wechselbalg-Irrlicht schnaubt belustigt. »Mit was soll ich den alten Alchemisten denn bezahlen? Akzeptiert dein Lehrmeister inzwischen Sumpfleichen für einen Tauschhandel? Für meinen halben Edelstein damals hat er mich ausgelacht, wenn du dich erinnerst.«
Daran erinnere ich mich mindestens genauso gut wie an den Juckknospen-Streich, den Yannis daraufhin ausheckte. Ich habe ihn in seinem Versteck am Fenster gesehen und die Knospen verdorben, bevor er es sich ganz mit Antorius verscherzte. Genau wie den nächsten Streich und den davor, auch wenn ihre zunehmende Kreativität mich belustigt hat. Irgendwann wurde es mehr ein Katz- und Maus-Spiel zwischen uns beiden und daraus ist irgendwie diese Komplizenschaft der faulen Äpfel geworden.
»Vielleicht gefällt Antorius ein Artefakt von der anderen Seite. Halt mal nach seltenen Gegenständen Ausschau.«
»Die ich woran erkenne?«, raunt Yannis skeptisch.
»Dabei kann ich dir helfen. Lass uns zusammen eure Fundkiste durchschauen.«
»Pixie-Licht kommt am dichtesten an Irrlichter heran, Valentina.«
»Das weiß ich doch. Nur was bringt dir das, wenn du es mit Elara und August bald zu weit treibst?!« Wenn er das nicht schon längst hat. Seine Gedankenlosigkeit frustriert mich.
Mein Blick wandert zu dem ausgelaugten Leuchtstein neben Yannis. Lange hat er nicht gehalten, nachdem ich einen ganzen Monatslohn investiert habe, um ihn Yannis zum Geburtstag (dem Tag, an dem er in die Anderwelt kam) zu schenken. Bis dahin hat er sein Anglerglück mit fluoreszierenden Fungi probiert, die meine Nähe regelmäßig ruinierte. Oder mit leuchtenden Kristallsplittern, die im Atelier als Abfall angefallen sind und die ich ihm nach seinem ersten Besuch aus Mitleid heimlich ans offene Fenster gelegt habe. Von Elaras Licht kommt Yannis genauso wenig los wie Menschen vom Irrlichtschein oder ich von dem irrwitzigen Wunsch, meinen unumstößlichen Fluch doch noch loszuwerden. Diese Diskussion ist zwecklos.
Ich setze trotzdem zu einem neuen Argument an. Da unterbricht Yannis mich mit einem harschen Zischen wie aus den dampfenden Nüstern eines schnaubenden Trolls.
Das Wasser blubbert unter der Laterne, die wie ein Totenlicht darüber schwebt.
»Siehst du?« Yannis Stimme überschlägt sich vor Aufregung. »Nichts geht über Pixie-Leuchten!«
Mir zieht es den Magen zusammen. Für Yannis und seine Familie bedeuten die zunehmenden Blasen Beute. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie durch die gestohlenen Objekte. Für mich bedeutet es, dass jemand ertränkt wird. Jemand ist dem Schummerlicht verfallen und ihm über den Rand eines Ufers gefolgt. Wahrscheinlich ist die Person ins Wasser geplumpst wie ein nasser Sack. Zumindest stelle ich es mir unter Frösteln so vor.
Auf der einen Seite atmend untergehen, bedeutet, durch eines der magischen Schlupflöcher unter Wasser auf die Kehrseite der Welt zu gelangen und hier aufzutauchen. Wenn es nach den Irrlichtern geht, ohne Atem.
Während ich meine klammen Fingerkuppen vor Anspannung gegen den Stein drücke und die Zähne fest aufeinanderbeiße, schießen Yannis Geschwister herbei. Sie führen einen morbiden Freudentanz auf, damit die Beute ja nicht entkommt. Ihre Mutter duselt träge hinterher.
Die Luftblasen werden weniger. Mein Magen zieht sich nicht mehr zusammen, er zerreißt gleich. Ich starre krampfhaft auf die Grasnarbe am Ufer statt auf die Sumpfoberfläche, als ginge es um mein eigenes Leben. Katzen jagen auch Mäuse. Irrlichter führen Menschen in die Irre oder ein nasses Grab. Aber das heißt nicht, dass ich mir das gerne ansehe.
Als ich den Kloß schlucken will, der sich in meinem Hals gebildet hat, ertönt ein Klirren, durch das ich mich verschlucke. Ich reiße den Blick hoch, genau wie Yannis. Die Irrlichter sind in alle Richtungen vor den Scherben der zersprungenen Laterne geflohen.
Auf der anderen Flussseite lacht August triumphierend auf, als seine Hufe aus den dunklen Farnen herausstapfen. In seiner Hand baumelt eine Steinschleuder.
Yannis zischt neben mir Flüche durch seine geschlossenen Zähne. Er springt auf und reißt seine Laterne zu sich, um sie zu inspizieren. Doch die Pixie ist schneller.
Elara ist ein in gedimmten Farben schillernder Lichtball. Anders als die Irrlichter hat sie einen tatsächlichen Körper, allerdings scheint sie so hell vor Wut, dass ich nur das Flirren ihres doppelten Flügelpaares erkenne. Sie rettet sich in die aufgehaltenen Hände ihres Patrons. Augusts verbissene Züge werden kurz weich, als er seinen Mündel an sich presst.
Für diesen Schockmoment – oder Freudenmoment, je nach Uferseite – missachten wir alle die Blasen im Sumpf. Erst ein lautes Platschen zieht alle Blicke wieder darauf. Eine junge Frau bricht durch die Wasseroberfläche, die Augen zusammengepresst, den Mund aufgerissen. Sie schlägt orientierungslos und sichtlich erschöpft um sich. Meine Beine wollen sofort abspringen, ins Wasser eintauchen und die Person (kaum älter als ich, wenn überhaupt) ans rettende Ufer ziehen. Ich bin gerade einmal aufgesprungen, da hält mich Yannis zurück. Elara ist bereits über den Sumpffluss geflogen und lässt ihren dank ihrem Sterntalent betäubenden, wie altes Gold schillernden Pixiestaub über sie rieseln. Sobald der Kopf der jungen Frau bewusstlos nach vorne sackt, schwebt ihr Körper ebenfalls durch den Pixiestaub aus dem Wasser empor. Ihr weißes Shirt klebt halb durchsichtig an ihrem kurvigen, sommersprossigen Oberkörper. Während die Pixie die Schlafende zu August herüberschweben lässt, starre ich gebannt auf ihren Brustkorb. Er hebt und senkt sich. Oder? Ja, ganz sicher. Sie lebt. Ich atme auf, wofür Yannis mir einen verletzten Blick zuwirft.
Er schimpft in Richtung der anderen Uferseite, doch ich kann ihn nicht hören. Ich höre bloß das Blut in meinen Ohren rauschen und mein Herz rasen, weil ich mich der Fremden so merkwürdig verbunden fühle, die Elara gerade vor Augusts Füßen fallen lässt. Sie hustet kurz Wasser aus, bevor sie wieder in sich zusammensackt. Kurzerhand schultert der Faun die Bewusstlose wie einen nassen Sack.
Yannis’ Gesicht glüht rot vor Wut. Er scheint keinen Menschen zu sehen, der halb ertrunken in eine ebenso faszinierende wie gefährliche Welt gelockt wurde. Er sieht nur die Beute, die ihm August stiehlt. Die Beute, die seine Familie für die nächste Zeit über die Runden hätte bringen sollen, indem sie die Habseligkeiten dieser Frau als Diebesgut aus der Menschenwelt weiterverkaufen. Er erinnert sich nicht an die andere Seite, im Gegensatz zu mir, er kennt keine andere als die Anderwelt. Obwohl ich fast mein ganzes Leben hier verbracht habe, merke ich in Momenten wie diesen immer wieder, dass ich ein Fremdkörper bin. Dass ein Teil von mir nie ganz Fae sein wird, nicht was das angeht.
August stellt sich breithufig auf und hebt das Kinn samt drahtigem Ziegenbart. »Du hast dich zum letzten Mal mit dem falschen Faun angelegt.« Elara flackert bestätigend auf.
»Du solltest ab jetzt lieber vorsichtig sein, Menschling!« August spuckt das Wort förmlich über den Sumpffluss. Jetzt ist es Yannis, der noch röter aufglüht. Er hasst diese Bezeichnung. Er ist ein Irrlicht. Er ist Teil ihres Schwarms.
Denn zu wem und wohin soll er sonst gehören? Ihr Hügel, ihr Sumpf, ist alles, was er kennt, und die Anderwelt jenseits davon macht ihm ohne Sterntalent oder Magiekenntnisse Angst. Das sollte sie auch.
»Was soll das heißen, he?!«, bellt Yannis wenig einfallsreich zurück.
»Dass in diesen Sümpfen noch kuriosere Dinge passieren, als dass ein Mensch sich einbildet, ein Irrlicht zu sein. Und das, ohne nur einen Tropfen Gewürzwein gekostet zu haben. Wäre es nicht jammerschade, wenn dir etwas zustößt?«
August bekräftigt seine Worte mit einem selbstzufriedenen Schmunzeln unter sich verdunkelnden Augen. Ich kann nur hoffen, dass das bloß heiße Luft ist. Yannis bläht die Brust auf. Er ringt nach Worten, doch Augst dreht sich bereits um. Gut. Mir gefällt es auch nicht, August das Gefühl zu vermitteln, ich wäre kleinlaut. Ihn mit Widerworten weiter zu provozieren wäre jedoch sicher nicht gesund. Die Sterne haben seine Hufe und Hörner zehnmal kräftiger wachsen lassen als bei Faunen üblich, heißt es. Ich würde dieses Gerücht nur ungern prüfen, indem ich diese Hörner zu spüren bekomme.
Ich kann die Augen unterdessen nicht von dem Mädchen nehmen. Ich wünschte, ich könnte etwas dagegen tun, dass August sie sich über die Schulter geworfen hat. Hat sie sich gerade bewegt oder war das der Schwung von den unebenen Schritten des Fauns? Ist sie wach? Ehe ich mich’s versehe, habe ich eine Hand an den Mund gelegt und rufe über den Sumpf.
»Egal was du tust, egal wie hungrig du bist: Iss auf keinen Fall von der Tafel eines Fae!«
Dann ist sie verschwunden und ich kann nichts mehr für sie tun.
Kapitel 3
Iss niemals von einer Tafel der Fae. Sonst gehörst du ihnen und ihrer Welt. Für immer. Das erzählt man Menschenkindern in Märchen und Sagen, mit verschwörerischem Lächeln aus Freude an dem fantastischen Grusel. Jedes Wort davon ist wahr. Wenn das jemand weiß, dann ich.
Ich habe noch nie von einer Tafel der Fae gegessen. Irgendwie bin ich darauf stolz. Dieser Welt und ihren sonderbaren Eigenarten gehöre ich trotzdem. Genau wie Yannis. Genau wie die junge Frau mit den Sommersprossen.
Ich habe keine Ahnung, was August mit ihr vorhat. Ich weiß nur, dass er selten etwas Gutes im Schilde führt, wenn er so breit lächelt wie eben, und dass ein Ausflug in die Anderwelt noch seltener ohne Stolperfallen für Menschen verläuft. Auch damit kenne ich mich leider aus.
Diese Sümpfe sind ebenso eigenwillig schön wie trickreich. Ich kann für die junge Frau und Yannis nur hoffen, dass August schnell spannendere Zielscheiben findet.
Yannis dagegen beunruhigt anscheinend mehr der Spott seiner Geschwister Willow und Jack, die ihn wegen der missglückten Jagd aufziehen. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Sorgen um ihn. Vielleicht beunruhigt das mein Herz so sehr, dass ich mich schlagartig an Antorius Auftrag erinnere, um mich davon abzulenken. Yannis begleitet mich noch ein Stück zurück Richtung Amaranthis. Er biegt vorher ab, um schmollend fluoreszierende Pilze zu sammeln. Ich schlüpfe zurück in das städtische Gewusel, das noch immer im Taumel von Mimosas Parade zu sein scheint. Auch unsere Kundin schwärmt noch davon, als ich das Päckchen schließlich bei ihr abliefere. Sie hat so einen Drang sich darüber auszutauschen, dass ich mich fast nicht wieder von dort loseisen kann.
Auch nach meiner Rückkehr ins Atelier ist das Kabinett Stadtgespräch. Fast alle Kundinnen und Kunden an diesem Nachmittag berichten Antorius und mir eifrig von angeblichen Kuriositäten, die sie Mimosa für ein kleines Vermögen an Edelsteinen oder einen später einzulösenden Gefallen anbieten wollen. Ich mache mir einen Spaß daraus, absurde Ideen zu bestärken und auszuschmücken, wofür mein Lehrmeister mir tadelnde Blicke zuwirft. Er weiß, dass ich lügen kann und schätzt meine Geschichtenspinnerei nicht besonders.
Bis ich nach Mitternacht ohne Abendessen, dafür mit einem großen Schluck Sumpfwasser und einem mulmigen Gefühl im Magen, unter meine kratzige Wolldecke schlüpfe, denke ich nicht wieder an die zersprungene Laterne. Auch nicht an Augusts sicherlich leere Drohung oder an das Sommersprossenmädchen. Dafür nun umso stärker an meine eigene Vergangenheit.
Ich ziehe die Decke über beide Ohren und hoffe auf einen traumlosen Schlaf. Unter meiner Haut kribbeln Erinnerungen, die ich nicht mit in diese Nacht nehmen will.
***
Mir ist, als wäre ich schwerelos. Mein Herz ist federleicht. Es schlägt schneller als meine tapsigen Kinderfüße rennen können. Mein abgeliebtes Dachs-Plüschtier halte ich am Pfötchen. Er muss überallhin mit. Ich weiß nicht, wohin wir rennen, bis ich in einem Kreis aus rotbraunen Pilzen stehenbleibe. Sie sehen kissenweich aus. Am liebsten würde ich mich direkt hineinkuscheln. Der Tau und die Morgensonne verleihen ihnen einen magischen, goldenen Schein. Die Pilze stehen in Reih und Glied, als hätte sie jemand liebevoll einzeln dort eingesetzt, wie meine Kuscheltiere zur Tee-Party gestern. Ich knie mich hin, gehe mit der Nase so nah ran, dass ich schiele und mir etwas schummrig wird.
Als ich wieder aufstehe, bin ich nicht mehr an dem Rastplatz mit den morschen Holzmöbeln am Waldrand, durch den man hindurchschauen kann, weil alle Bäume wie Streichhölzer sind. Plötzlich bin ich in einem Wald, der dem Namen eine völlig neue Bedeutung gibt. Vor Staunen fällt mir beinah mein Dachs runter. Ich presse ihn gegen meine Brust, in der es heftiger wummert – vor Angst und vor Staunen. Die Äste um mich herum biegen sich vor satten dunklen Blättern und wundersamen Früchten. Ihr süßlicher Duft erfüllt die Luft. Papa kauft oft verschiedene Beeren und Obst ein, das wir dann mit Sahne und Zucker essen. Aber die hier sind mir alle fremd.
»Ein Zauberwald«, flüstere ich ins Ohr meines Dachses (er heißt so, Dachse brauchen keinen Vornamen).
»Goldrichtig«, singt eine Stimme hinter mir.
Ende der Leseprobe