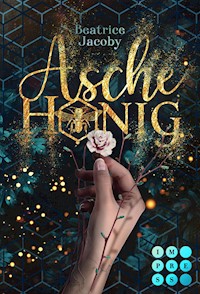
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Wenn Liebe süß wie Honig schmeckt, schmerzt sie wie der Stich einer Biene …** Die Natur hat sich ihr Reich schon lange zurückerobert: Wälder wurden lebendig und verschlangen ganze Städte. Seitdem setzt kein Mensch mehr einen Fuß in die überwucherten, lebensbedrohlichen Gebiete. Bis jetzt. Bienenhüterin Giselle spürt eine eigentümliche Verbindung zu den Geschöpfen des Waldes. Sie sucht nach einer Rettung für die Bienen – und die Zukunft. Gemeinsam mit Alexej, der ihr Herz mit jedem tiefgründigen Blick in Aufruhr versetzt, und zwei Freunden wagt sie sich in das lebendige Dickicht. Doch je tiefer sie in den Wald vordringen, desto größer werden die Geheimnisse, die zwischen ihnen allen stehen … Grandiose Mischung aus Romantasy und Umweltroman Auf einzigartige und sensible Weise verwebt Beatrice Jacoby die berührende Liebesgeschichte einer Bienenhüterin mit großen und wichtigen Umweltthemen. Sie gewährt ihren Leser*innen dabei einen Einblick in die besondere Welt der Bienen und setzt ein Statement für den Schutz unserer Wälder. //»Aschehonig« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Beatrice Jacoby
Aschehonig
**Wenn Liebe süß wie Honig schmeckt, schmerzt sie wie der Stich einer Biene …**Die Natur hat sich ihr Reich schon lange zurückerobert: Wälder wurden lebendig und verschlangen ganze Städte. Seitdem setzt kein Mensch mehr einen Fuß in die überwucherten, lebensbedrohlichen Gebiete. Bis jetzt. Bienenhüterin Giselle spürt eine eigentümliche Verbindung zu den Geschöpfen des Waldes. Sie sucht nach einer Rettung für die Bienen – und die Zukunft. Gemeinsam mit Alexej, der ihr Herz mit jedem tiefgründigen Blick in Aufruhr versetzt, und zwei Freunden wagt sie sich in das lebendige Dickicht. Doch je tiefer sie in den Wald vordringen, desto größer werden die Geheimnisse, die zwischen ihnen allen stehen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© Michael Neumann
Die 1992 geborene Münchnerin Beatrice Jacoby absolvierte eine Ausbildung zur Incentive- und Eventmanagerin sowie zur Fremdsprachenkorrespondentin. Sie lebte bereits in Schweden und Frankreich, bevor es sie in ihre Heimat zurückzog. Heute arbeitet sie nachts an ihren Romanen und tags im Eventmarketing. Sie liebt es zu reisen und neue Orte zu entdecken, die ihr stets Inspiration für Szenerien und Geschichten schenken.
Für Mama
Prolog
Da lag ein Flüstern in der Luft, bevor es losging. Es hätte in jedem beliebigen Moment passieren können, aber es geschah genau an diesem Frühlingsmorgen 2031. Es war diese Art Jahreszeitenwechsel, die die Leute hier im stählernen Geäst der Großstadt kaum spürten. Zwischen toten Steinen und Neonlichtern blies heimlich der Wind, ohne etwas zum Rascheln zu haben. Sein lautloser, ungehörter Warnschrei kündigte es an, was gleich geschehen würde.
Das Echo hallte umso lauter. Wie aus dem Nichts sprang der Asphalt der Fahrbahn im Herzen der Betonwüste auf. Die Stadt schrie in Form von Reifenquietschen und hysterischem Gehupe auf. Autotüren wurden aufgerissen, High Heels und Turnschuhe liefen hektisch auf die Straße – und dazwischen ein bloßes paar Füße, das fror. Die Zehen tippten gegen den frischen Riss im Asphalt wie in Wasser, um die Temperatur zu testen.
Plötzlich schoss etwas aus der kleinen Kluft und die Besitzerin der bloßen Füße sog scharf die Luft ein. Ein Halm. Binnen Sekunden wuchs er zu einer wunderschönen Knospe heran. Unter Raunen ihrer Beobachter schälte sie Blütenblatt für Blütenblatt auf, irgendwas zwischen Er-liebt-mich-Orakel und finalem Countdown.
Als sie ihre volle trügerische Pracht zeigte und der Duft ihres sonnengelben Blütenstaubs sich unter die städtischen Abgase mischte, verursachte dies Gänsehaut auf den bloßen Füßen.
»Es schneit!«, rief jemand in der Nähe unvermittelt und ließ alle Umstehenden zum Himmel blicken.
Fluffige Perlen sanken zu Boden. Schnee! Nein. Pollen! Tausende und Abertausende Pollen, die der Wind hertrug, bedeckten nach und nach Autos, Passanten, Gehwege.
Die Gänsehaut auf den Füßen wurde zu einem Kribbeln, als seine Besitzerin nervös nach der Blume im Asphaltriss trat. Plötzlich zog diese sich zusammen – nur, um kurz darauf ihren Blütenstaub wie in einer kleinen Explosion in die Luft zu schießen.
Das Kribbeln wuchs zu Jucken. Jucken zu Brennen. Es breitete sich überallhin aus. Auf der Haut und darunter. Nichts half. Kein Nägelkratzen, Husten, Herumwirbeln, um Hilfe rufen.
Das Barfußmädchen hielt es nicht mehr aus und riss verzweifelt die Hände in die Luft. Ihre Augen weiteten sich wie zuvor der Asphalt. Die Gänsehaut kehrte vereinzelt zurück. Etwas regte sich darunter, bahnte sich seinen Weg, bis es die dünne Haut schließlich durchbrach. Daraus wuchsen Triebe empor, untermalt von lauten Schreien. Zuerst zwischen den Fingern. Dann – entlang ihrer Pulsadern – weiter und weiter, während sich die Lungen des Mädchens mit Pollen füllten.
Sie riss die Hände höher, ohne Augen für die Menschen um sie herum zu haben, die das gleiche Schicksal ereilte. Auch das blasse Sonnenlicht hinter dem Stadtnebel vertrieb die Triebe nicht, die mittlerweile zu Zweigen herangewachsen waren. Im Gegenteil. Drehen und Wenden im Licht spornte das Wachstum nur noch an …
Und dann sah das Mädchen ihn. Den Wald, der kilometerweit entfernt sein sollte. Der hier nicht hergehörte. Die Wucht, mit der sich der Wald in einem bisher versteckten Eigenleben an die Oberfläche brach, erschütterte die Erde, brach etliche weitere Kluften in die Straßen. Die Wand aus Ranken und Blättern, die sich haushoch aufbäumte, verdunkelte den Himmel. Mattes grün durchbrochen von letzten goldenen Funken der Sonne, die dahinter verschwand.
Wer hätte ahnen können, dass der Beginn von so viel Zerstörung sich so leise anschleichen würde wie ein Blätterrascheln im Wind?
Kapitel 1
Giselle
Hörst du das?
Das Surren, dieses unermüdliche Schwirren? Wie abertausende Flügel, die die Luft zum Beben bringen. Von Blüte zu Blüte huschend in eifriger Zielstrebigkeit. Als würden sie tatsächlich hier herumfliegen, die Bienen. Dabei ist es nur mein Herz, das so heftig schlägt, keine durchsichtigen doppelten Flügelpaare.
Spürst du es auch? Mir ist, als pulsierten die Härchen auf meinen Unterarmen im Takt mit, wenn ich an diesen Tag und an all die Dominosteine zurückdenke, die er zum Umfallen gebracht hat. Einen nach dem anderen.
Du-dum. Du-dum. Du-dum.
Sss-umm.
***
»Hörst du? Alles wird gut!«, beteuerte ich und streichelte sie flüchtig. »Das Feuer kann dir nichts mehr anhaben.«
Das Kissen unter meinen Knien saugte sich allmählich mit der verbliebenen Feuchtigkeit der Wiese voll. Ich fühlte ihre angenehme Kälte durch den abgewetzten Stoff, der zuletzt vor dem Ausbruch der Waldpocken weich und angenehm gewesen war. Behutsam rückte ich der klammen Erde mit einem aufgeschraubten Einmachglas zu Leibe und schaufelte sie damit zur Seite.
»Du vermisst sie bestimmt noch mehr als ich, aber dein neues Zuhause wird dir sicher gefallen«, versprach ich und hob vorsichtig ihre Füße an. Sie waren über und über mit satter schwarzer Erde bedeckt. Die gröbsten Klumpen klopfte ich flüchtig ab.
»Ich bitte Till dich bei sich in seiner Wohnung aufzunehmen, was sagst du dazu?« Nichts natürlich. Immerhin redete ich mit einer Teerose. Trotzdem besser, als Selbstgespräche zu führen. »Vom Dachfenster im Bad aus sieht man bis zum Waldrand und wenn man mutig genug ist sich aus dem Küchenfenster zu lehnen, kann man die Spitzen der Hochhäuser sehen. Till ist ein, ähm … ganz besonderes Exemplar. Aber ich sorge dafür, dass er sich gut um dich kümmert.«
Ihr Köpfchen neigte sich leicht zur Seite.
»Wenn es dir trotzdem nicht gefällt, ziehst du runter zu Babette und mir.«
Vorsichtig setzte ich sie in den Blumentopf neben mir. Erneut stach ich in den Boden, diesmal mit dem Schraubdeckel des Glases, um die Erde zu lockern. Dann wechselte ich das Werkzeug und Einmachglas für Einmachglas schaufelte ich dem Rosenstock ein Bett aus Erde in den Topf. Der Wind wirbelte graue Flocken zu mir herüber. Sie erinnerten mich an Schnee oder den Staub der hinterlistigen Feen, von denen man Kindern erzählte, dass sie im Wald, jenseits der alles überragenden Spiegelmauer ihr Unwesen trieben. Man konnte sich schließlich viele Schauergeschichten ausdenken über ein unheilvolles Gebiet, das zu unserem eigenen Schutz keine Menschenseele mehr betreten durfte. Denn die Mauer sperrte niemanden aus, sondern den Wald ein.
In Wirklichkeit waren die verwehten grauen Flocken, die nun in kleinen Wirbeln um mich herumwehten, weder Schnee noch Feenstaub, sondern Asche. Überreste von toten Pflanzen und der Bienenkästen, die in der Nähe gestanden hatten. Mein Herz wurde bleischwer, wenn ich daran dachte, wie unsere jungen Bienenvölker vorgestern erstickt oder verbrannt waren. Dass die von den Löscharbeiten noch feuchte Asche den Wurzeln meiner Teerose Nährstoffe spenden würde, milderte die Tragik kaum. Immerhin war die Feuerwehr schnell genug eingetroffen, um sie und den Rest der Plantage vor den Flammen zu retten.
Wäre ich an dem Tag doch nur eine Stunde länger geblieben! Ich hätte den Brand mit meiner Jacke im Keim ersticken können oder ich hätte … Unsinn! Egal wie viele Szenarien ich in meinem Kopf durchspielte, das Gras war ohne den lang ersehnten Sommerregen staubtrocken gewesen. Vom nahe gelegenen Brandherd hatte sich das Feuer rasant bis zu den Bienenstöcken am Plantagenrand ausgebreitet. Es musste unglaublich schnell gegangen sein.
Mit mir oder ohne mich. Die Bienen hatten keine Chance gegen die Flammen gehabt. Ganz gleich, wie wertvoll oder beladen mit Hoffnung sie für mich waren.
Ich seufzte schwer. Einerseits, weil es mich anstrengte, in der Nachmittagshitze dieses zum Schmelzen warmen Tages eine Teerose auszugraben. Andererseits, weil unendlich viel Herzblut in die Aufzucht jeder einzelnen Honigbiene geflossen war. Und nun? Nun kniete ich neben dem zusammengekehrten Haufen ihrer grau bestäubten Leichen.
Der Geruch von Rauch war immer noch präsent und rieb mir meinen Verlust geradezu unter die Nase. Doch darunter lag auch noch der Duft von Wachs und schwindelerregend süßem Honig in der Luft. Oder bloß in meiner Erinnerung. Dank der Karamell-Note, die darin mitschwang, lief mir das Wasser im Mund zusammen. Mit jedem Atemzug bildete ich mir ein, den Honig deutlicher zu riechen.
Ich fühlte mich wie einer der Pullover, den unsere sieben Katzen beim Spielen an einem losen Faden gepackt hatten und nun Reihe für Reihe aufdröselten. Und am liebsten wäre ich vor Verzweiflung auch genauso schlaff in mich zusammengefallen. Aber das konnte ich mir nicht erlauben.
Spätestens morgen würde ich mich wieder zusammenreißen. Wieder die gute, gewissenhafte Giselle sein. Eine strebsame Tochter. Eine trotz anhaltendem Bienensterben zuversichtliche Bienenhüterin. Ich würde lernen loszulassen.
Bis dahin gestand ich mir die Albernheit zu, diese Rose mit nach Hause zu nehmen. Außerdem war sie die beste Zuhörerin im Umkreis von zwei Quadratkilometern.
Babette war unter ihrer harten Schale so verständnisvoll, wie ich mir meine Adoptivmutter damals im Heim erträumt hatte. Sie würde es verstehen. Mit den Augen rollen, sicher. Etwas auf Französisch in sich hinein murmeln, vielleicht. Doch sie würde es mir nicht verbieten.
»Sie braucht ein bisschen Zeit, aber sie wird dich in ihr Herz schließen«, versprach ich der Blume vollmundig. »Sie hat schließlich auch erlaubt, dass wir dich am Plantagenrand pflanzen, als wir das erste Volk hier angesiedelt haben. Damals hast du Till übrigens schon mal getroffen, er hat die Bienenbeuten gebaut und aufgestellt. Erinnerst du dich?«
Abrupt hielt ich inne. Alle weiteren Lobeshymnen auf Babette und Till schreckten von meiner Zunge. Auf den zarten gelben Blütenblättern der Rose saß ein kleines schwarzes Insekt. Es besaß einen dichten Pelzkragen, ähnlich dem einer reichen Dame aus dem vorletzten Jahrhundert, eine schmale Taille und emsig suchende Fühler. Sie tasteten über die fragile Blütenoberfläche, dem betörenden Aroma des Nektars hinterher.
Das musste eine Überlebende unserer Bienenstöcke sein! Eine Arbeiterin, die aschebedeckt zu ihrem ausgebrannten Stock zurückkehrte.
Doch sie war weder dunkelgrau noch hinterließ sie Aschespuren auf der Blüte. Von den Facettenaugen bis zum Hinterleib war sie schwärzer als die Sicht durch geschlossene Augenlider. Das war keine unserer domestizierten Honigbienen mit Ruß auf ihrem Körper. Sondern eine echte schwarze Biene. Eine wilde Biene! Dabei galten inzwischen auch die letzten davon, die weniger nach einer ihrer Urarten aussahen, als ausgestorben.
Doch, wenn es diese eine gab, musste es auch einen Bienenstock geben. Mit anderen Worten: mehr von ihrer Sorte.
Mein Herz war sich nicht sicher, ob es stehen bleiben oder Freudensprünge machen sollte. Ich wusste nur eins: Wenn meine Sinne mir keinen Streich spielten, würde das alles ändern!
Du-dumm.
Jetzt nur keine hektischen Bewegungen machen! Gebannt starrte ich das Insekt an. Mein Blick suchte es nach blinkenden Kontrollleuchten und Schweißnähten ab. Fehlanzeige. Da machte sich definitiv keine der ferngesteuerten Drohnen an der Blüte zu schaffen. Deren Prototypen wurden hier auf der Obstplantage getestet, um unsere wenigen verbliebenen Bienenvölker bei der Bestäubung zu unterstützen. Es war eine wirklich lebendige Biene. Bloß, dass dieses Exemplar anders war als alles, was ich jemals mit eigenen Augen gesehen hatte. Denn alle Bienenvölker in Menschenhand glichen sich durch den inzwischen stark dezimierten Genpool extrem.
Für einen Moment hielt ich die Luft an, damit ich die Biene nicht aus Versehen verschreckte. Oder den Wunschtraum, den sie mir vorgaukelte.
Ich riss mich zusammen und befreite mich aus meiner Schockstarre. Mit Deckel und Einmachglas bewaffnet näherten sich meine Hände behutsam der Blume, in der das Tier nach Nektar und Pollen suchte. Gerade als ich das Glas um die Blüte schließen wollte, touchierte mein Unterarm die Pflanze. Die schwarze Biene hob ab. In der darauffolgenden Schrecksekunde verfehlte ich sie – fast! Mit wummerndem Puls schraubte ich den Deckel zu. Das war knapp!
Zum ersten Mal freute ich mich darüber, körperlich nicht sonderlich stark zu sein. Sonst hätte ich das Glas wahrscheinlich vor Anspannung zerdrückt. So nah wie möglich hielt ich es mir vor das Gesicht und betrachtete die Biene. Hatte ich ein Bein eingeklemmt? Eine Antenne abgeknickt?
»Alles in Ordnung«, stellte ich erleichtert fest und zwinkerte der Teerose zu. »Da haben wir aber noch mal Glück gehabt.«
Die Pflanze würde mir als Zeugin nicht reichen, um sicher sein zu können, dass diese schwarze Biene echt war.
Ich musste nach Hause und Babette davon erzählen! Sie hatte immer eine Antwort parat. Bestimmt konnte sie auch dieses Phänomen erklären. Bis dahin würde ich kaum wagen zu hoffen, was mein Fund bedeuten könnte.
So behutsam, wie es das Adrenalin zuließ, packte ich das Einmachglas in meine Jutetasche. Ich wollte schnellstmöglich heim. Vorerst blieb keine Zeit, die Rose in die Erde zurückzusetzen. Es war lächerlich, trotzdem ließ ich sie auch in der irrwitzigen Hoffnung zurück, dass sie hier vielleicht doch noch ein paar geflügelte Freunde vermissen würden. Dass sie weitere dieser fremden Bienen anlocken würde.
In meinen Sohlen juckte es förmlich. Aber ich musste mit meiner kostbaren Fracht vorsichtig sein, also durfte nur mein Puls rasen.
Weil Lebensmittel, die eine natürliche oder künstliche Form der Bestäubung benötigten, fast schon ordinär teuer waren, säumten hohe Stacheldrahtzäune die wertvolle Obstplantage. Während ich schnurstracks zum einzigen Tor in der stählernen Dornenhecke lief, fasste ich an mein linkes Ohr. Genauer gesagt an die filigrane metallische Raupe, die sich darum schmiegte. Mit leichtem Druck auf die Taste aktivierte ich das Kommunikationssystem Com 2050. Doch bei Babette ging sofort die Mailbox ran.
Stimmt ja! Heute spricht sie in der Sitzung des Landwirtschaftsverbandes. Hoffentlich kann sie unsere Kooperationspartner etwas beruhigen.
Ich hinterließ eine Nachricht, wobei ich durch das Laufen etwas außer Atem geriet. Darum schoss ich eine Erklärung hinterher, damit sie sich keine Sorgen machte, wenn sie das abhörte.
Unaufgefordert ließ ich den bewaffneten Wachmann an der Pforte meinen Bienenhüter-Ausweis scannen und eilte hinaus auf die Straße. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zum Elektrobus gerannt war. Vor allem nicht in Gummistiefeln und mit meiner Tasche an die Brust gepresst, um ihren Schwung abzufangen. Als ich schnaufend in das Fahrzeug stolperte, das in Europaes Flaggenfarben dunkelbau und golden lackiert war, sahen mich die Leute verwundert an. Es war mir egal, dass mir die Strähnen auf der schweißnassen Stirn klebten oder dass mir von dem kurzen Spurt bereits das Blut in die Wangen schoss.
Die schwarze Biene im Einmachglas wog alles andere auf.
Selbst den Anblick auf die abgebrannte Plantagenstelle, die der Bus auf dem Weg ins Stadtinnere passierte. Weil er trotzdem in meiner Brust stach, sah ich schnell weg. Die Landstraße, auf der wir fuhren, verlief in Richtung der Ausläufer der Stadt, hinter denen sich einige Hochhäuser des Zentrums aufbäumten. An den Rändern bestimmten rostig-ausgeblichene Container das Panorama. Was dem Betonwald heute wenigstens ein wenig Farbe verlieh, wo Blumen fehlten, hatten die Menschen damals binnen Tagen hochgezogen. Für die Welle an Flüchtlingen aus den Nachbarregionen und bald aus der eigenen Vorstadt. Flüchtende vor dem Wald, der vor zwanzig Jahren urplötzlich alles verschlungen hat, was sich ihm in den Weg gestellt hatte. Der Wald, der stets einen seltsamen Sog auf mich ausübte, sobald ich ihn bei meiner Arbeit auf der Plantage im Nacken spürte. Ich presste meine Tasche fester an mich, senkte den Blick und betrachtete sie. Nach vorne sehen, nicht zurück.
***
Kaum in unserer Erdgeschosswohnung in einem der äußeren Stadtviertel angekommen, schob ich die Kater Catticus und Diggedy vom Küchentisch herunter und stellte das Glas behutsam darauf. Mit einem Spültuch deckte ich es ab, um das Tier zu beruhigen, das seine durchsichtige Zelle auf und ab lief. Währenddessen zog ich, ohne die Biene aus dem Blick zu lassen, die Stricknadel aus dem halb fertigen Schal auf dem Stuhl neben mir und stach damit Luftlöcher in den Blechdeckel.
Fünf unserer sieben Katzen, die entweder bei uns wohnten oder die bloß regelmäßig zum Fressen vorbeikamen, hielten sich gerade hier auf. Ich warf sie hinaus und schwang gleich mit aus der Tür, direkt in den Hausflur.
Babette würde erst in ein paar Stunden heimkommen. Mein kribbeliges Herz und ich konnten aber unmöglich bis dahin mit diesem Wunder allein bleiben. Wie praktisch, dass meine übrigen Lieblingsmenschen ebenfalls in Babettes Haus lebten.
Ich konnte gar nicht schnell genug vom Hochparterre ins Dachgeschoss hechten. Bereits im ersten Stock brannten meine dünnen Oberschenkel. Trotzdem erwiderte ich wie üblich das Pfeifen von Herrn Grundner im vierten Stock, als seien wir Fledermäuse, die sich auf diese Weise, statt mit Worten, verständigten. Doch meine Puste reichte dafür heute nur wenige Stufen aus. Genau bis zum Einsetzen von Herrn Brenners täglicher Fluchtirade, die durch seine windige Haustür schallte:
»Dieser versoffene Tagelöhner und dieser Taugenichts aus dem Ostblock – zur Hölle sollen sie fahren! Mitsamt ihrer Arroganz und ihrer vermaledeiten Schmiererei! Und diesem Flittchen, das ständig bei ihnen ein und aus geht!«
Damit beschrieb er ausgerechnet meine drei besten Freunde: Till, Alexej und Poppy. Mit ihnen verbrachte ich das bisschen Freizeit, das mir unsere verbliebenen domestizierten Bienenvölker noch ließen. Es wäre mir unnatürlich vorgekommen, mit meinem Sensationsfund nicht sofort zu ihnen zu eilen. Keine Ahnung, was sie Herrn Brenners Meinung nach diesmal angestellt hatten.
»Till, Alexej«, rief ich kurzatmig, sobald ich den Türknauf in der Hand hielt und die Wohnung betrat.
»Hi, Giselle, Liebes«, zirpte meine beste Freundin Poppy. Sie stand mir gegenüber am Fenster. Mit nichts bekleidet außer einer Schleife in ihren kinnlangen strohblonden Haaren und dem rosigen Ton ihrer Wangen. Obwohl ich damit gerechnet hatte, sie so vorzufinden, fror ich in meiner Bewegung ein. Im Gegensatz zu Alexej, der mit seinem Pinsel wie mit einem Zauberstab versuchte, Poppys Magie auf eine Leinwand zu bannen. Er war so gefangen von ihr und seinem eigenen für ihn unsichtbaren Zauber, dass er erst verzögert auf mich reagierte.
Er ist Maler. Sie ist seine Muse. Du platzt nicht in irgendeine pikante Situation hinein.
»Es ist nur Kunst«, sprach Alexej mit diesem charmanten ukrainischen Akzent das Mantra aus, das ich in solchen Momenten gedanklich herunterbetete. Dabei schob er seinen Pinsel zusammen mit ein paar seiner kurzen honigblonden Strähnen hinters Ohr, wodurch seine markanten Züge besonders gut zur Geltung kamen.
»Kein Grund, sich zu schämen. Außer dafür, dass du die Kunst störst, Giselle.«
»Zieh sie nicht immer auf«, lachte Poppy über ihre Schulter hinweg. Niemandem stand Nacktheit besser als ihr, das musste ich neidlos anerkennen. Trotzdem war ich froh, als sie sich nun ihren Morgenmantel überwarf. Alexej, der ihr zu meinem Leidwesen mit seinem verträumt-melancholischen Künstlerblick nachsah, während sie auf mich zulief, schien nicht zuzustimmen. Für ein Blinzeln verlor ich mich in der Frage, wie es wohl wäre, so gesehen zu werden. So von diesen unergründlichen blaugrauen Augen betrachtet zu werden.
»Ohne Giselle hättest du gar keine Muse, schon vergessen?« Genau, Poppy, streu Salz in die Wunde …
»Ich habe dich als Aktmodel selbst entdeckt.« Herausfordernd hob Alexej eine Augenbraue.
»Hätte mich Giselle nicht zu dir hochgeschickt, damit ich mir von dir Farbe für meine Demoschilder borge, hätten wir uns nie kennengelernt«, entgegnete Poppy süffisant.
»Schilder für irgendeine Demo sind keine schöne Kennenlern-Geschichte für meine Muse und mich«, raunte Alexej.
»Nicht irgendeine Demo! Es ging um die Ausbeutung und Diskriminierung von Arbeitern in der Bestäubungsbranche. Abgesehen davon, ganz meine Rede: Hätte Giselle mir nicht von diesem malenden Spinner erzählt, der am Vortag bei Till eingezogen war, würdest du jetzt blöd aus der Wäsche schauen. Und vor allem: musenlos.« Sie untermalte den freundschaftlichen Konter, indem sie Alexej kurz die Zunge rausstreckte. Nur bei ihr sah so etwas niedlich aus.
Alexej setzte zu einer dramatischen Feuerrede im Sinne seiner Kunst an, der ich sonst zu gern in einer Mischung aus liebevoller Belustigung und ehrlicher Faszination gelauscht hätte. Doch heute hatte ich dafür keine Zeit.
»Die Kunst muss warten. Ich will euch dreien etwas zeigen. Etwas Wichtiges. Wo ist Till?«
Die Tür zum Zimmer meines Sandkastenfreundes sprang auf.
»Wenn man vom Teufel spricht«, murmelte Alexej mit einem hochgezogenen Mundwinkel, was ein Grübchen verursachte. Poppy knuffte ihn für seinen Kommentar in die Seite.
»Was ist das für ein Krach?«, fragte Till gähnend. »Geht schon wieder die Welt unter?«
Er kratzte sich unter seinem T-Shirt, das gerade zerknittert genug war, um sein Image des kernigen Typs zu wahren und dennoch zu sauber, um verwahrlost zu wirken. Das war die einzige Kunst, die er beherrschte.
Zur Begrüßung schlang Till seine sonnenstudiogebräunten Bärentatzen um mich und brach mir um ein Haar alle Knochen. Seine Restfahne empfing mich weniger herzlich. Ein Glück, dass er seinen Rausch schon ausgeschlafen hatte. Till mochte wie ein Bruder für mich sein. Dennoch war er mir unangenehm, wenn er mal wieder betrunken war. Er packte einen etwas ruppiger an, plauderte zu viel aus, das nur für seine Ohren bestimmt gewesen war, oder brachte einen anderweitig in Verlegenheit. Nüchtern war er mir deutlich lieber.
»Glaubst du, du kannst hier einfach jederzeit ungebeten reinplatzen, nur weil du Babette unseren Mietvertrag aus den Rippen geleiert hast?«, neckte Till mich.
»Exactement.«
»Und den Mietaufschub«, warf Alexej trocken ein.
»Und den davor«, sagte ich.
»Und den davor«, pflichtete Poppy mir bei.
»Fallt mir halt alle in den Rücken.«
»Genug der Höflichkeiten, Leute«, erklärte ich, »es ist wirklich wichtig. Kommt mit runter in unsere Küche!«
Alexejs graublaue Augen blitzten auf, ähnlich undurchdringlich wie ihre durch die Lichtverhältnisse wechselnde Farbe. Er schmunzelte mir zu, als hätte ich eine künstlerische Vision geäußert. Wie er es so oft tat, wie andere sich über das heiße Wetter beschwerten.
Er irrte sich. Ich hatte etwas Besseres gefunden als bloß eine unsichtbare Vision.
***
Vorsichtig stellte ich das Einmachglas auf den Esstisch. Wir versammelten uns darum wie um eine magische Glaskugel. Die schwarze Biene krabbelte gerade am geschlossenen Deckel entlang.
»Das kann man ja gar nicht essen«, murmelte Till enttäuscht. Sein Magen pflichtete seinem Unmut mit einem Grummeln bei. Ich musste später unbedingt ein paar unserer Vorräte in die WG bringen. Nicht dass Till wieder hungerte, weil er seinen Wochenlohn beim Pokern mit seinen Feuerwehrkumpels verzockt hatte.
Poppy beugte sich vor, um die Biene näher zu begutachten. Ihre Augen sahen durch das Glas übergroß aus, wie die einer alten Frau mit Lesebrille. Ihre dichten schwarzen Wimpern schlugen wie Flügel, jedes Mal, wenn unsere Bewegungen die Biene mehr aufregten. Mir tat es leid, das Tier zu stressen. Ich wünschte, ich hätte ihm erklären können, wie viel es mir bedeutete. Dabei schaffte ich es kaum, mich meinen drei besten Freunden verständlich zu machen. Sie waren nun einmal keine Bienenhüter, so wie ich.
Während Poppy den Kopf schief legte, schlang sie im Stehen den Morgenmantel enger um ihren beneidenswert kurvigen Körper. Ich hatte ihr in meiner Eile nicht die Zeit gelassen, ihn gegen richtige Kleidung zu tauschen. Aber das störte niemanden. Jeder im Raum hatte sie entweder bereits nackt gesehen, wollte es oder applaudierte ihr dafür, wie stolz sie auf ihren Körper war.
»Darf ich die Biene mal halten?« Poppy knetete neugierig ihre Finger, traute sich jedoch nicht, das Glas anzufassen. Wahrscheinlich, weil mein ernster Blick es ihr verbot. Das schwarze Insekt war unbezahlbar. Nicht einmal ein ganzes Kilo Honig hätte es aufwiegen können!
»Sie hat den Brand überlebt?« Till, der einen Arm über die Lehne seines Stuhls legte, klang hoffnungsvoller, als ich es erwartet hatte. Es tat gut, wie sehr mein Sandkastenfreund mit mir mitfieberte.
»Ich glaube, sie war nicht einmal dort«, antwortete ich.
»Was meinst du? Gehört sie zu einem anderen eurer Völker?«
»Nein, wir haben solche Bienen nicht. Alle unsere Arbeiterinnen sind golden mit braunen Streifen und weißen Krägen.« Gewöhnliche domestizierte Honigbienen eben.
»Dann eine von den anderen Imkern?«
Bei dem Wort rümpfte ich die Nase, protestierte aber ausnahmsweise nicht gegen den veralteten Ausdruck. Es gab gerade Wichtigeres als meinen Stolz, den das Wort kränkte, weil Bienenhüter wie Babette und ich uns nicht den Honiggewinn, sondern den Arterhalt auf die Fahnen schrieben. Wir wollten die Insekten retten, nicht ausbeuten. Wenn wir doch nur gewusst hätten wie.
Vielleicht wendet sich heute das Blatt, denn …
»Es grenzt an ein Wunder. Niemand in dieser Gegend hat solche Bienen«, verkündete ich den anderen.
»In welchem Umkreis?«, wollte Till wissen.
»Zentraleuropae.«
Als ich es laut aussprach, traf mich die Erkenntnis erneut wie ein nasser Waschlappen. Alle schluckten schwer. Nur ich nicht. Ich war zu perplex.
»Sie muss unheimlich weit geflogen sein«, sinnierte Poppy, die mich nicht ganz verstanden hatte. Trotzdem hatte sie recht, als sie hinzufügte: »Sie ist sicher unheimlich erschöpft und hungrig.«
Ich machte mich an den Küchenschränken zu schaffen, um Zuckerwasser für die mysteriöse Biene anzurühren.
»Warum ist sie so …«
»Schwarz?«, beendete ich Tills Frage, während ich auf Zehenspitzen die Zuckerdose aus dem obersten Regal holte.
»Ja.«
»Ich bin nicht sicher. So etwas habe ich noch nie gesehen. Na ja, mit einer Ausnahme.« Sollte ich es wirklich laut aussprechen? Oder war das ein böses Omen? Andererseits, was hatte ich noch zu verlieren? »Es kann eigentlich nicht sein, aber … sie sieht genauso aus wie eine Urart der wild lebenden Bienen.«
Manchmal recherchierte ich alte Flora und Fauna im Sleeplearning-Programm, einfach, um ein paar Blumen zu sehen. Dabei war ich darüber gestolpert. Ha, von wegen langweiliges nerdiges Hobby, Till! Stolz löffelte ich einen weiteren Haufen Zucker in das Wasserschälchen, das ich vor mir auf den Tisch gestellt hatte.
»Urart klingt wie etwas, das vor ewig und drei Tagen mal existiert hat. Sind nicht die letzten wild lebenden Bienenarten seit letztem Jahr offiziell für ausgelöscht erklärt worden? Das galt doch für sämtliche für uns noch erreichbare Gebiete, oder?«, hakte Till nach.
»Ja. Eigentlich.«
Seine Worte schleuderten mich in der Zeit zurück, zu dem Tag vor einem Jahr, an dem die erschütternde Nachricht verkündet worden war. Die Welt, wie ich sie bis dahin gekannt hatte, existierte seitdem nicht mehr. Das noble Ziel der Bienenhüter, mit dem Arterhalt einen Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten, war gescheitert. Dabei hatte ich mich so sehr gefreut, ausgerechnet von Babette, einer Bienenhüterin, adoptiert worden zu sein! Endlich hatte ich nicht nur ein Zuhause gefunden, ich war mir sogar nützlich vorgekommen! Aber dieses Gefühl war gemeinsam mit den wilden Bienen verschwunden. Dass die Welt nicht zusammen mit meinem Traum von den Bienen eingestürzt war, hatte mich schier wahnsinnig gemacht. Ohne meine drei besten Freunde hätte ich es damals nicht geschafft, diese Hiobsbotschaft zu verkraften.
Bisher hatte auch aus unserer limitierten Perspektive nichts darauf hingedeutet, dass sie sich im lebendigen Wald erholt hatten, nachdem sie bereits vor der Wucherung fast ausgestorben gewesen waren. Was genau hinter der Spiegelmauer vor sich ging, konnte kein Mensch mit Sicherheit sagen, aber auch direkt an der Mauer war nie ein derartiger Fund gemacht worden. Darum waren wir davon ausgegangen, dass die Insekten auch jenseits unserer Reichweite verloren gegangen waren.
»Кошмар! Jetzt sind die Bienen zurück? Wie grässlich«, seufzte Alexej mit theatralisch in die Luft geworfener Hand. Die Formulierung Albtraum hätte für mich nicht weniger zutreffen können. »Der Verlust der wild lebenden Bienen hätte eine große Künstlerin aus dir machen können. Was soll nun aus dir werden, Giselle?«
»Eine Bienenhüterin mit Zukunft.« Ich brachte es kaum über die Lippen, dieses Z-Wort. Dieser Heilige Gral, von dem ich nicht mehr gedacht hätte ihn je zu Gesicht zu bekommen.
Es war noch zu früh, um sich derart zu freuen, trotzdem konnte ich ein breites Lächeln nicht unterdrücken.
Alexej spiegelte meinem beiläufigen Blick verständnislos, fuhr sich durch die wirren Locken und seufzte erneut.
Für ihn bestand der Zauber unserer Bienen darin, dass sie bloß noch domestiziert existierten, während das Bienensterben weiterhin anhielt. Sie waren verloren – behauptete er. Und Alexej liebte verlorene Dinge. Wie linke Socken, Hoffnung und die versunkene Stadt Venedig. Diese Leidenschaft brachte ihn jedoch auch in eine unangenehme Situation. Er selbst hatte nämlich nie etwas Wichtiges verloren. Dabei wüsste doch jeder, wie er oft beteuerte, dass große Kunst nur aus großem Leid wachsen könne. Darum waren seine Werke geprägt von der Sehnsucht nach etwas, dass es wert war, verloren zu gehen. Bis zu diesem Moment hatte Alexej mich also immer um meine ausweglose Situation beneidet.
Was für seinen eigenwilligen Freigeist das Ende dieses Privilegs heraufbeschwor, bereitete mir den glücklichsten Tag seit Langem. Dank des kleinen schwarzen Punkts am Boden seines gläsernen Gefängnisses durfte ich wieder Hoffnung schöpfen. Ich hatte fast vergessen, wie sich das anfühlte.
Unsicher knabberte ich an meiner Unterlippe herum. Schließlich holte ich die Pipette aus dem Besteckfach, die wir sonst verwendeten, um Medizin ins Essen unseres anfälligen Katers Mr Purrington zu träufeln. Gedankenverloren zog ich das frisch angerührte Zuckerwasser für die Biene auf. Dabei drehte ich ihr und meinen Freunden für einen flüchtigen Moment den Rücken zu. Genug Zeit für unseren Kater D’Artagnan aus seinem Versteck zu schießen. Von ihm alarmiert wirbelte ich herum, gerade in dem Moment, als Poppy nicht mehr an sich halten konnte und das Einmachglas an ihre Nase hob. Sie trat einen Schritt zurück, um es mehr ins Licht zu drehen – und stolperte dabei prompt über den nachtschwarzen Kater. Beide schrien erschrocken auf. Mir blieb jeder Laut im Hals stecken. Plötzlich kam mir alles wie in Zeitlupe vor. Pipette und Einmachglas fielen im Kanon zu Boden. Die Pipette blieb heil. Das Glas zerschellte.
Die schwarze Biene schoss in die Höhe.
Ihr Brummen wurde übertönt von Poppys Entschuldigungsrufen, untermalt von Gefuchtel und Miauen. Angetrieben von seinem Jagdinstinkt verfolgte der Kater das unersetzliche Insekt.
»Lass das Rumgehampel, Poppy, du stachelst D’Artagnan nur auf!« Bewaffnet mit dem erstbesten Glas hastete ich zu Alexej, der aufgesprungen war und in Poppys Fuchteln einstimmte, da die Biene ihn umschwirrte. Till bellte irgendwas, ich hörte nicht hin. Ich hörte nur Surren und durch die Luft peitschende Hände. Ich redete beruhigend auf Alexej ein, hob die Hände in einer beschwichtigenden Geste – doch ich war langsamer als seine Reflexe. Ehe ich dazwischengehen konnte, ertönte ein lautes Klatschen.
Das bloße Geräusch fühlte sich wie eine Ohrfeige an.
Plötzlich waren alle still. Sogar der Kater, den Till gerade geschnappt und den ich dumme Gans vorhin in seinem Versteck übersehen hatte, machte keinen Mucks mehr.
Mir blieb das Herz stehen. Ich hatte nicht einmal Zeit, mir noch Hoffnung zu machen. Nicht bei der Art und Weise wie die Flügel der schwarzen Biene zuckten, während sie in einem beinahe poetischen, beschwipsten Tanz zu Boden schwebte.
Obwohl ich wusste, dass zumindest ihr Stachel mit der Giftdrüse herausgerissen worden sein musste, suchte ich dennoch für einen kurzen Moment nach einem Weg, der Biene Erste Hilfe zu leisten. Als ihr regloser Körper die Küchenfliesen berührte, ließ er gleich zwei Stiche zurück. Einen in Alexejs Hand, auf der sich ein weißer Fleck ausbreitete, und einen in meiner Brust. Die Panik in mir wuchs von Sekunde zu Sekunde, genau wie Alexejs Hand.
»Ist das normal?!« Ein schmerzverzerrter Ausdruck zeichnete sich auf Alexejs Gesicht ab.
Ich schüttelte den Kopf, wusste nicht, wohin ich zuerst sehen sollte – auf die Leiche der Biene, unserer letzten Hoffnung, oder auf den aufquellenden Stich. »Keine Ahnung.«, japste ich.
Woher hätte ich das wissen sollen? Niemals zuvor hatte ich gesehen, wie eine Biene jemanden stach. Sie waren viel zu kostbar, als dass wir ohne Schutzanzüge mit ihnen gearbeitet hätten.
Ich sank auf einen der Holzstühle, während Alexej und Till einander überfordert anstarrten. Ausgerechnet Poppy fing sich als Erste. Sie sprintete zum Kühlschrank und kramte im Eisfach herum.
»Zwiebeln«, murmelte ich abwesend. Ein Detail hatte ich mir wohl doch vom Sleeplearning behalten. »Wir müssen eine Zwiebel aufschneiden, die ätherischen Öle darin …«
Alexejs Hand wurde dicker, sodass die Haut darüber vor Spannung bereits glänzte. Allerdings hatten wir seit gestern keine Zwiebeln mehr im Haus.
»Giselle?«
Der vertraute Klang meines Namens brachte mich zurück an die Oberfläche meines Bewusstseins. Genauer gesagt die Hilflosigkeit in Tills rauer Stimme. Richtig. Giselle, das war ja ich. Diese stets gefasste, pflichtbewusste junge Frau. Ich kümmerte mich um Dinge. Hatte mein Leben im Griff. Ich verlor nicht einfach die Fassung. Niemals. Nie.
Der Schock entzauberte die seltene Berührung zwischen Alexej und mir, während ich seine Hand wie in Trance mit Eiswürfeln versorgte, bis Till den Nachbarn eine Zwiebel aus den Rippen geleiert hatte. Irgendwie schaffte ich es, den anderen vorzuspielen, ich hätte alles unter Kontrolle. Dabei hatte ich mich in meinem Leben noch nie so hilflos gefühlt. Nicht einmal bei der grässlichen Nachricht vor einem Jahr.
Wie sollte ich das bloß Babette beibringen? Mein Herz wollte mir förmlich den Brustkorb sprengen, so heftig, wie es pochte.
Du-dum, du-dum, du-dum.
Kapitel 2
Giselle
»Das muss ein Scherz sein!«
Meine Adoptivmutter lehnte im Türrahmen zwischen Küche und Durchgangszimmer und rang nach Fassung. Die frühsommerliche Hitze brachte ihre satte schwarze Haut zum Leuchten. Ungeduldig fächelte sie ihrer schweißbenetzten Stirn mit etwas Luft zu, das stark nach der letzten Mahnung für die Stromrechnung aussah. Lose Strähnchen ihrer zu einem sonst festen Knoten gebundenen schwarzbraunen Locken wehten im Rhythmus des Fächers vor und zurück.
Wie sich Babettes sonst samtig-tiefe Stimme aufrieb, bereitete mir Unbehagen. Wenn sie emotional wurde, verfiel sie gerne in ihre Muttersprache. Wahrscheinlich hörte man ihr Schimpfen auf Französisch durchs ganze Haus. Unsere Katzen hatten sich bereits in die hintersten Ecken der Wohnung verzogen.
Alle, bis auf die Glückskatze Eclair, die auf meinem Schoß saß, einzig, damit ich mich an etwas festhalten konnte. Sie war mein heimlicher Liebling, weil ich sie versehentlich umbenannt hatte. Die Samtpfote wohnte schon länger bei Babette als ich und mit zwölf hatte ich noch kein Französisch gesprochen. Wenn meine neue Mutter also »et Claire?« gefragt hatte, war das für mich ihr Name gewesen. Babette hatte mich zwar ausgelacht, aber wir behielten es auch sieben Jahre später noch so bei. Die Glückskatze schien das nicht so sehr zu stören wie die Tatsache, dass sie nun als Puffer zwischen Babette und mir herhalten musste.
Während meine Adoptivmutter ihrem Frust in Flüchen und Gesten Ausdruck verlieh, konnte ich den Blick nicht von der toten schwarzen Biene nehmen. Wir hatten erneut ein Glas über sie gestülpt. Als ob sie noch irgendwohin fliegen würde.
»Niemand in Europae hält noch solche Bienen und weißt du warum? Weil sie verflixt noch mal ausgestorben sind! Genauso wie alle anderen wild lebenden Bienen. Hast du das etwa vergessen?«
»Vielleicht haben wir uns geirrt?!«
Babette stemmte eine Faust in die Hüfte, was ihre kurvige Figur betonte, und zog herausfordernd eine Augenbraue hoch. Sonst regte sich nichts in ihrem Gesicht. Mit dem improvisierten Fächer deutete sie auf die Bienenleiche.
»Wir wüssten mehr, wenn die hier nicht tot wäre und uns mit einem Peilsender zu ihrem Stock führen könnte.«
Betreten schlug ich die Augen nieder. Dabei biss ich so fest die Zähne aufeinander, dass mir der Kiefer wehtat.
»Glaubst du, das weiß ich nicht selbst? Glaubst du, ich mache mir deswegen keine Vorwürfe?«, blaffte ich Babette unvermittelt an.
Wir beide erschraken. Nicht einmal mitten in der Pubertät hatte ich sie jemals angeschrien. Das war absolut nicht meine Art. Sofort entschuldigte ich mich kleinlaut und schlug dann vor: »Lass uns die Behörden informieren, Babette. Sie könnten …«
»Uns für das Töten eines geschützten, nein, als ausgestorben deklarierten Tieres anklagen? Formidable.«
»Aber es war doch ein Versehen!«
Babette prustete. »Ein totes Insekt bringt niemandem was. Die Behörden werden uns auslachen, wenn wir nicht mehr Beweise liefern können, mon petit papillon. Das Bienenhüten gilt jetzt schon als gescheiterter Berufszweig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Subventionierung komplett eingestellt wird, weil die Bestäuber-Drohnen funktionieren, noch billigere Arbeitskräfte bestäuben oder Forscher nicht mehr nur genmodifizierte, selbstbestäubende Beerensträucher, sondern auch noch Obstbäume züchten. Gib ihnen nicht noch einen Grund, uns für verrückt zu halten. Haben wir nicht schon genug um die Ohren damit, gegen die neuen Mutationen der Varroa-Milbe und die Sauerbrut anzukämpfen?«
»Genau darum geht es mir ja! Wir kämpfen gegen Windmühlen. So können wir nicht mehr weitermachen.«
Glaubte sie wirklich, ich sah nicht hinter ihre starke Fassade? Wer drängte sie denn ständig, besser auf sich zu achten und sich auch mal Zeit für sich zu nehmen? Sie konnte nicht ewig derart unter Strom stehen, um mir und den Bienen gerecht zu werden.
Ich drückte Eclair fester an mich, während ich grübelte. Unsere Chance konnte nicht einfach verloren sein. Es musste doch einen anderen Weg geben, um herauszufinden, woher diese schwarze Biene gekommen war. Und wo ihre Schwestern wohnten. Was, wenn ihre Überlebensstrategie der Schlüssel zur Rettung unserer domestizierten Bienen war? Wenn es uns darüber hinaus gelang, flächendeckend Völker auszuwildern und so freie Bienenvölker zurückzubringen? Wir durften nichts unversucht lassen!
Babette murmelte unterdessen auf Französisch weiter. Dabei kam sie langsam zu mir herüber und setzte sich neben mich.
»Kein Bienenhüter in Europae besitzt schwarze Bienen, weil es diese Urart nicht mehr gibt. Wild können sie nicht leben, denn sie sind ausgestorben«, wiederholte ich nachdenklich. »Aber was, wenn sie gar nicht aus Europae kommt?«
»Sondern? Vom Mond? Aus der Vergangenheit mithilfe ihrer kleinen Zeitmaschine?«
»Was ist mit dem Wald? Ich habe sie auf der Plantage nahe am Sperrgebiet gefunden. Das ergibt Sinn. Was, wenn sie aus den verbotenen Gebieten kommt und sie dort doch weiterexistiert haben? Was, wenn deshalb bisher niemand ihren Stock gefunden hat? Ich könnte sie suchen und …«
»Ah ça non! Kommt nicht infrage!«
»Aber …«
»Keine Diskussion! Diese Gebiete dürfen nicht betreten werden. Du weißt genau warum. Wenn die Biene wirklich von dort kommt, wäre es ein Glücksfall gewesen, sie hier erforschen zu können. Das ist jetzt vom Tisch. Ich lasse nicht zu, dass meine einzige Tochter auf unoriginelle Weise Selbstmord begeht.« Ihre Augen wurden wässrig.
»Ich kann auf mich aufpassen, ich wäre vorsichtig.«
»Nur über meine Leiche, mon petit papillon! Was, wenn dir etwas zustößt? Denk an deine schwache Gesundheit.«
»Ich bin kein fragiler Schmetterling, nur weil du mich immer so nennst.« Dass ich ein kränkliches Kind gewesen war, musste sie irgendwann hinter sich lassen. Selbst wenn ich auch als Erwachsene einen schwächeren Kreislauf hatte und mir öfter etwas einfing als die meisten anderen.
»Wie willst du in dieser menschenfeindlichen Wildnis überleben? Hast du die Waldpocken vergessen? Das heimtückische Dickicht mag nicht mehr vorrücken, der massiven Spiegelmauer sei Dank, aber die giftigen Sporen sind geblieben.«
In den nächsten zwei Stunden stritten und fluchten und bellten wir uns gegenseitig an. Ich sprang zwischendurch auf, weil sie mir weglief. Wir begannen einen zeternden Tanz um den Tisch herum. Die Katzen starrten uns verwundert an, genau wie die toten Facettenaugen der schwarzen Biene. Alle Diskussionen, die ich als Kind nicht mit ihr geführt hatte, holte ich jetzt anscheinend nach.
»Du bleibst hier. Das ist mein letztes Wort!« Entschlossen schlug Babette mit der Faust auf den Tisch. Ich zuckte zusammen und sank zurück auf meinen Stuhl. Eclair hatte beschlossen die Flucht vor uns zu ergreifen. Ich konnte es ihr nicht verübeln. Mir tat es auch weh, die Sorgen meiner Adoptivmutter zu vergrößern. Zwar wollte sie nur mein Bestes, aber das galt auch umgekehrt.
In der unangenehmen Stille, die nun folgte, wrang ich mein T-Shirt. Babette brauchte einen Moment, um wieder auf mich zuzugehen. Sie war ein solches Verhalten von mir nicht gewohnt und sicher tobte in ihr ein ähnliches Gefühlschaos wie in mir, wenn sie das reglose Insekt auf dem Tisch ansah.
Vorsichtig entspannte ich mich, als sie sich wieder neben mich setzte. Sie legte den Mahnungsfächer ab und lehnte sich zurück. Ich wich ihrem Blick aus, als sie fragte:
»Du liebst die Bienen so sehr, mon cœur?« Dass sie mich ausgerechnet jetzt ihr Herz nannte, traf einen empfindlichen Nerv. »Nach deinem jüngsten Vorschlag möchte man meinen, du liebst sie sogar mehr als dein eigenes Leben. Warum also behauptest du trotzdem weiterhin, dass du dieses Tier erschlagen hast? Um den Schönen und das Biest zu schützen?«
»Lass Alexej und Till da raus, bitte. Ich hab doch gesagt, es war ein Versehen, ich wollte das nicht.«
»Pah! Et mon cul c’est du poulet.«
Sonst brachte mich das französische Pendant zu »Das glaubst du doch selbst nicht« zum Schmunzeln, wegen der wörtlichen Bedeutung »und mein Hintern ist aus Hühnchen«. Diesmal nicht. Ich biss die Zähne fest zusammen. Babette anzulügen tat weh, aber ich konnte ihr unmöglich die Wahrheit sagen. Sie hätte Alexej sofort auf die Straße gesetzt. Leider war meine Adoptivmutter ein skeptischer Mensch und witterte, dass etwas an meiner Geschichte faul war.
»Lass mich den Stich sehen.«
Ich erstarrte augenblicklich. Natürlich hatte ihr auffallen müssen, dass der Stachel der Biene fehlte. Vehement schüttelte ich den Kopf.
Mir schoss das Blut in die Wangen, als Babette mir übers Haar strich und sanft fragte: »Es war Alexej, n’est-ce pas?«
»Das hat nichts mit ihm zu tun, Maman.« Meine Hoffnung, dass dieses Wort sie besänftigen würde, ging nicht auf.
»Warum habe ich dann das Gefühl, dass es ausschließlich mit ihm zu tun hat?« Sie seufzte und lächelte milder, als sie es jemals vor anderen Leuten getan hätte. »Liebst du ihn wirklich so sehr, dass du diese Schuld auf dich nimmst?«
Sah man die Hitze, die mir in die Wangen schoss? Lief ich rot an? »Wie kommst du denn darauf? Nein, ich … Alexej ist bloß … Er ist Poppys … und sie ist meine Freundin, ich würde niemals …«
»Da wird dein Bruder«, sie malte spöttisch Gänsefüßchen in die Luft, »aber sehr erleichtert sein.«
Ich rollte mit den Augen. Die Leier schon wieder. Till und ich waren im Heim wie Geschwister aufgewachsen. Das Band zwischen uns war völlig anders als das, was Alexej für mich nicht sein durfte. Oder was seine Muse Poppy dem jungen Maler bedeutete. Aber was hatte es für einen Sinn, es zu leugnen? Ein Blick in Babettes dunkelbraune Augen und mir war klar, dass mein Gestammel mich bloß weiter verriet.
Resigniert lehnte ich meine glühende Stirn an ihre Schulter, obwohl dieser Sommerabend viel zu heiß zum Knuddeln war. Liebevoll tätschelte Babette mir mit der vom Arbeiten aufgerauten Hand den Kopf. Für sie würde ich immer ein kleines Kind bleiben. Was mich sonst nervte, tat in diesem Moment unheimlich gut.
»Mach dir nichts draus, mon petit papillon.« Mit einem Schmetterling verglichen zu werden gab mir gerade kein besonders robustes Gefühl. »Dann hält er sie eben für seine Muse. Eines darfst du dabei nicht vergessen: Immer, wenn sie sich für einen Akt auszieht, wird sie das Bedürfnis haben zu sagen: ›Mal mich wie eines deiner französischen Mädchen‹.«
Ihre scherzhaften Worte entlockten mir ein müdes Lachen. »Babette, ich bin doch auch keine Französin.«
»Was muss ich da hören?« Echauffiert rutschte sie von mir weg. »Du bist durch und durch Französin, wie deine Maman, wie dein Name. Et voilà.«
Damit war auch diese Diskussion vorüber. Babette hatte stets das letzte Wort.
***
Auch wenn Babette mich mehrfach ermahnt hatte, dass die Aufregung meiner schwachen Gesundheit nicht guttäte, ließ mir die schwarze Biene dennoch keine Ruhe. Also zog ich mich dorthin zurück, wo ich am liebsten nachdachte.
Unser Dachgarten glich einem Gewächshaus, nur dass es von Stacheldraht anstelle von Glasfronten gesäumt war, um Diebe und Vandalen abzuhalten. Er beherbergte zwanzig unserer Bienenvölker in einer Konstruktion aus Stein und Holz, die einem überdimensionierten Apothekerschrank ähnelte. Das allgegenwärtige Brummen und Surren vermittelte den Eindruck, dass die Zeit vor einigen Jahrzehnten stehen geblieben war. Damals, als die Bienen noch in Freiheit gelebt hatten.
Die Sonne ging langsam unter und während die Arbeiterinnen in ihre Stöcke zurückkehrten, kauerte ich zwischen den Pflanzen, die wir hier für sie pflegten. Doch selbst zwischen blühenden Kräutern und Beerensträuchern konnte ich nur auf meine Handflächen starren, die ich wie zu einer Schale geformt hielt. Darin lag die leblose schwarze Biene, gekrümmt wie ein Egerling. Es fühlte sich falsch an, sie wegzuwerfen. Aber was sollte ich damit anfangen?
»Wie vergisst man, dass man etwas Unmögliches gesehen hat?«, hallte meine Frage von vorhin in meinen Ohren wider, als ich beim Versorgen seiner Hand einen schwachen Moment Alexej gegenüber gehabt hatte. Selbst in meiner Erinnerung hätte ich die Worte am liebsten wieder in meinen Mund zurückgestopft, doch er hatte mich nicht peinlich gefunden, das hatte mir das schmerzverzerrte Lächeln in seinen Augen versichert.
»Gar nicht«, hörte ich in meiner Erinnerung das Echo seiner wohlig-heiseren Stimme. »Man gibt sich dem Unmöglichen völlig hin und fließt mit seinem Strom.«
Was brachte es, diese Gesprächsfetzen innerlich zu wiederholen, bis mein Herz neue Sprünge bekam? Ich war nicht wie Alexej, der sich in jede Welt träumen oder malen und dortbleiben konnte.
Ich konnte die schwarze Biene nicht ewig herumtragen oder unter dem Glas auf dem Tisch lassen. Sobald ich mit grübeln fertig war, musste ich loslassen. Zurückkehren in meinen Alltag, den ich unbedingt festhalten wollte, obwohl er mit dem unaufhaltsamen Aussterben der Bienen langsam, aber sicher durch meine Finger rann.
An diesem Abend spürte ich allzu deutlich, wie die Ära von Babette und den anderen Bienenhütern allmählich zu Ende ging. Vor allem seit sie so große Fortschritte mit den Drohnen und dem Bestäuberpersonal gemacht hatten. Das ersetzte die Bienen und ihren Platz im Ökosystem keinesfalls, trotzdem gab es den Menschen ein Gefühl von Hoffnung.
Nur uns Bienenhütern nicht.
Diese kleine schwarze Biene hätte alles ändern können. Und ihre Schwestern konnten es noch immer. Wenn Babette nur über ihren mütterlichen Schatten springen und mich gehen lassen würde!
Ich hatte keine Angst vor dem Wald, nur davor, das Leben zu verlieren, das ich so liebte. Davor, unsere Bienen für immer zu verlieren. Und damit auch meine Aufgabe.
Eine merkwürdige Idee schoss mir durch den Kopf. Weil es die erste seit Stunden war, die ich irgendwie greifen konnte, folgte ich ihrem verführerischen Wispern.
Ungelenk stand ich auf. Bei den ersten Schritten merkte ich, wie mir der Hintern vom Sitzen auf dem Beton schmerzte. Ich nahm das Gartenmesser vom Haken neben der Brandschutztür zum Treppenhaus. Damit fuhr ich über die Rinde des Apfelbaumes neben den Bienenkästen.





























