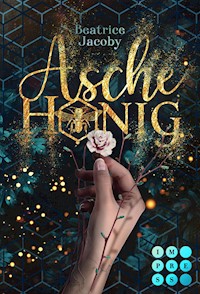2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Meine Teure, für den richtigen Preis kannst du jedes Wunder haben, das dein schrecklich verwöhntes Herz begehrt.« Im Traum reist Klarabell in das Unterbewusstsein anderer. Durch diese angesehene Gabe sieht sie eine fantastische Zukunft vor sich. Bis sie erfährt, dass sie noch vor ihrem achtzehnten Geburtstag sterben wird. Doch ein Kölner Schwarzmarkthändler für Übernatürliches bietet ihr einen letzten Ausweg. Sie soll dem Schicksal ein Schnippchen schlagen und unsterblich werden, wie er. Was sie dafür tun muss, verstößt allerdings gegen sämtliche Regeln der Traumwandler. Klarabell bleibt nicht mehr viel Zeit, um mit ihrem Gewissen zu hadern ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Außerdem von Beatrice Jacoby:
ColourLess – Lilien im Meer (Roman, feelings Verlag)
Der Kunstdieb (Kurzgeschichte, Anthologie The P-Files, Talawah Verlag)
Der unsichtbare Passagier (Kurzgeschichte, BoD – Books on Demand)
Das Gedicht »Mottenkönigin« Seite 280 f. stammt von Ella K. Valentine und wird mit freundlicher Genehmigung der Autorin abgebildet. Es wurde explizit für diesen Roman geschrieben. © 2020 Ella K. Valentine
TRIGGERWARNUNG
Selbstverletzendes Verhalten (SVV) (erwähnter) Kindstod
Für den Fall, dass es bei aller Achtsamkeit auf Dich selbst zu triggernden Situationen kommt, Du Dich unwohl oder überfordert fühlst, leg das Buch beiseite und nimm Dir die Zeit und den Abstand, die Du brauchst, damit es Dir wieder besser geht.
Sprich bitte bei Bedarf mit einer Vertrauensperson, Freunden oder wende Dich an entsprechende Beratungsstellen für seelische Gesundheit, Depressionen, SVV u. ä., die Dir helfen könnten.
Für Rebecca und Annabel
Inhaltsverzeichnis
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
EINS
Schweigend betrat Pares das Zugabteil. Das kratzende Geräusch der Schiebetür reichte aus, um das Mädchen zu wecken, das ausgestreckt auf einer der wie mit Hotelteppich bezogenen abgewetzten Bänke geschlummert hatte. Ihr Kopf war auf eine Armlehne gebettet. Als Decke diente eine gelbe Windjacke mit Rechteck-Muster, die bei diesen Temperaturen eigentlich unnötig war. Die Sonne, die durch die mit einem »Kelvin war hier«-Schriftzug zerkratzte Scheibe brannte, ließ die Hamsterbäckchen des Mädchens dunkelrosa aufleuchten. Der Farbkontrast brachte ihre prompt aufgeschlagenen husky-blauen Kulleraugen besonders zur Geltung.
Sie musterte Pares kopfüber von der Bank hängend, bis sie wach genug war, um sich aufzurappeln. Sie rutschte ans Fenster, schob ihren Krempel zur Seite und zog die Kopfhörer aus den Ohren, obwohl Pares keine Anstalten machte, mit ihr zu reden. Geschweige denn, sich neben sie zu setzen.
Er nahm entgegen der Fahrtrichtung an der Tür Platz und tat so, als würde er nachdenken. Währenddessen verfolgte er aus den Augenwinkeln, wie sie ihre zerzausten Locken notdürftig sortierte.
Sie wirkte desorientiert. Aufgekratzt. Ihre Pupillen waren noch zu geweitet für das lichtdurchflutete Abteil. Er schüttelte enttäuscht den Kopf. Man hatte die Kleine nicht gut genug ausgebildet, als dass sie das nervöse – plus unappetitliche – Nägelkauen unterdrückte, sobald sie mit ihren Haaren fertig war. Sie knabberte auf ihnen herum, als hätten sie mehr als nur die Farbe mit getrockneten Cranberrys gemein.
Ein unerfahrenes Wunderkind ohne die für gewöhnlich obligatorische Affenbande an Bodyguards herumlaufen zu lassen, fiel in die Kategorie »grob fahrlässig«. Pares war versucht, sich den Handballen gegen die Stirn zu schlagen und zu seufzen. Eine Beschriftung mit Edding quer übers Gesicht wäre kaum plakativer gewesen. Alles an ihr schrie »verhätschelter Fall für die Klapse«. Warum steckten sie ihr nicht gleich einen Apfel in den Mund und warfen sie auf ein Silbertablett mit Tomatenröschen?
Das Mädchen – K. M. M. laut den Initialen auf ihrem Goldarmband – rieb sich den Schlaf aus den Augen und den Mascara von den Wimpern. Ihre Lippen zuckten unter Silben, die sie testete. Eine Weile lang schien keine gut genug zu schmecken, um sie auszusprechen. Als sie schließlich kratzige Töne hervorbrachte, bemerkte Pares gleichermaßen entzückt wie mitfühlend die Scham darin. Die Sorte Scham, die man empfand, wenn man unter Beobachtung etwas zum ersten Mal tat, ohne einen blassen Schimmer davon zu haben. Sie versteifte sich dermaßen darauf, gelassen und normal zu wirken, dass sie verkrampfte.
»Sie haben …« Das Mädchen hielt inne. Offenbar wühlte sie in ihrem hochroten Köpfchen nach Worten. Nein, nach Mut. »Sie haben einen Sprung …«
Pares gähnte geräuschvoll und demonstrativ genüsslich, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Dadurch entblößte er das eintätowierte Herz auf seiner langen, belegten Zunge. Kein Herz wie es Sechstklässlerinnen in liebevoller Kleinarbeit über alle ihre »i«-s kringeln, sondern ein Organ. So anatomisch korrekt gestochen, wie es Oberfläche und Platz auf Pares’ Zunge zugelassen hatten.
Er rollte die Zunge ein wie ein Hund beim Gähnen ein und schmatzte dreimal leise, ohne seine Mitfahrerin eines Blickes zu würdigen.
»Entschuldigen Sie.« Das Mädchen klang gereizt unter ihrer Unsicherheit. Die Erwartungshaltung, die von ihren gestrafften Schultern unterstrichen wurde und die aus Pares’ Sicht völlig fehl am Platz war, weckte seine Neugierde.
»Sie haben einen Sprung in Ihrem Glasauge.«
Bedacht legte er den Kopf schief. »Wie bitte?«
Seine Stimme ließ K. M. M. zusammenzucken. Sie riss die Augen auf, als hätte er ihr ein Brett vors Gesicht geschlagen. Ihm glitt ein selbstzufriedenes Schmunzeln in den linken Mundwinkel – überall die gleiche Reaktion.
Eine andere Art von Schweigen als zuvor trat ein. Diese hatte Bedeutung. Sie bestand aus unsichtbar und lautlos in der Luft schwirrenden Worten statt aus betretenem Schweigen.
Pares beugte sich vor, stützte die Ellenbogen auf die überschlagenen Knie und bettete sein spitzes Kinn auf seine verschränkten Hände. Sein Bart strich über die eintätowierten Buchstaben auf seinen Fingerknöcheln.
Zuerst testete er den Blickkontakt des Mädchens. Ihr Wimpernkranz zuckte aufgeregt, aber sie blinzelte nicht.
»Bist du dir aller Konsequenzen bewusst, wenn du das sagst?«
Anders als erwartet wich sie seinem starren, durchdringenden Blick nicht aus.
»Ein Sprung. In Ihrem Glasauge.«
Sie schien sich schnell an die Merkwürdigkeit laut ausgesprochener Worte zu gewöhnen, weil sie ständig dieselben in geänderter Reihenfolge wiederholte.
Pares schnalzte mit der einschlägig tätowierten Zunge – sie wollte es so.
»Ein Sprung?«, raunte er. »Dabei ist es vom besten Flohmarkt in Basel. Eigenartig.«
Der Satz traf das Mädchen unvorbereitet, obwohl sie ihn nicht zum ersten Mal hörte. Wach kam einem alles härter vor als im Traum. Kanten erschienen schärfer, Konturen deutlicher, Geräusche lauter. Ein paar Stunden zuvor hätte sie die Nase krausgezogen und nichts mit diesem Satz anfangen können. Auch jetzt kam er ihr schrecklich seltsam vor. Ein Teil von ihr hatte nicht damit gerechnet, dass es sich als real erwies, worüber sie im Traum eines anderen gestolpert war.
Einige Stunden zuvor
Ein Bauchklatscher vom Dreimeterbrett in 38°C warmes Wasser. Eine einzige, rot brennende Ohrfeige über den ganzen Körper. Zumindest eine Millisekunde lang. Dann die tröstende Umarmung lautloser Wellen. Als Klarabell die Augen aufschlug, war sie trocken, trotzdem spürte sie im Augenwinkel ein Zwicken wie von Chlorwasser. Drei Mal blinzeln, und es war verschwunden.
Sie ließ ihre Finger knacken, einen nach dem anderen, und genoss das Geräusch. Wie es ihr eine Gänsehaut verpasste und wie entspannt sich die Glieder danach anfühlten. Ihre Großmutter Edita hatte bis zu ihrem Tod geschimpft und behauptet, das fördere Gicht, aber das kümmerte sie nicht. Zumindest nicht hier.
Als Nächstes löste sie die pelzige Zunge, die an ihrem Gaumen klebte wie Kaugummi an einer Turnschuhsohle, und schluckte. Es half nichts, der Druck auf ihren Ohren blieb. Genauso wie das hölzerne Gefühl beim Laufen in dem fremden Körper, aus dessen Augen Klarabell den Traum betrachtete.
Es kam manchmal vor, dass sie die Position des eigentlichen Träumers einnahm, wenn sie in ihn hineinstolperte. Bizarr fand sie es trotzdem. Ihr war es lieber, den Schläfer von außen zu beobachten, um ein Gefühl für ihn zu bekommen. Seltsam, oder? Sie stöberte im Unterbewusstsein eines anderen herum und glaubte, das Angesicht-zu-Angesicht-Erlebnis zu brauchen, um die Person zu begreifen.
Obwohl die Umgebung teils verschwamm, wusste sie sofort, welche Straße sie entlangschlenderte: die Schildergasse mitten im Herzen Kölns. Bei einem Blick über die Schulter erkannte sie die Mayersche. Der bunt beleuchtete Schriftzug der Buchhandlung stach als einer der wenigen Orientierungspunkte deutlich aus der verwaschenen Kulisse heraus.
Der Träumer bog in eine unscheinbare Seitengasse ein, in der es nach verwehten Schneeflocken, kalten Abgasen und ein beißendes Bisschen nach Urin roch. Dort, wo die Straße einen Knick machte, hob sich ein renovierungsbedürftiger Kiosk in satten Farben von der Umgebung ab.
Seine abgeschaltete Neonschrift diente Stadttauben den grauweißen Schlieren zufolge nicht nur als gelegentlicher Rastplatz. Breite Spuren getrockneten Straßendrecks sprenkelten das Schaufenster und die Glastür darunter, die mit Zeitungsseiten abgeklebt worden waren. Jemand hatte sie mit einem Schlüssel längs zerkratzt und eine weiße Narbe hinterlassen. Daneben klebte ein Zettel: »Wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen«.
Auf der Stufe vor dem Kiosk saß eine eingemummelte Gestalt. Sie hatte eingefallene Wangen und indigo- bis auberginefarbene Tränensäcke unter den Augen. Der glasige Blick und der Vollbart machten es schwer, das Alter des Mannes zu schätzen. Vielleicht war er Ende dreißig? Mitte vierzig? Wie gerade die Bartkanten rasiert worden waren, stach Klarabell ins Auge, als der Träumer mit ihr vor dem Mann stehen blieb. Ebenso wie seine gepflegten Haare, die unter der löchrigen Skimütze hervorlugten wie Schnittlauch und bis zu seinen Schulterblättern reichten.
Der hagere Kerl zitterte nicht, dabei kletterte Raureif die Decke hoch, die über seinen Schultern lag. Seine fingerlosen Handschuhe entblößten die Tätowierungen auf seinen weiß hervorstehenden Handknöcheln. L-E-F-T stand korrekterweise darauf.
Zum Zeitvertreib schmorte der Mann die Sohlen seiner Mokassins mit einem Feuerzeug an. Wenn rußiger, in der Nase zwickender Rauch aufstieg, klopfte er die aufkeimende Flamme aus. Währenddessen kraulte seine rechte Hand eine Promenadenmischung hinter den Schlappohren. Sie lag auf dem Zipfel seiner Decke zu einem Donut eingerollt – hoffentlich schlafend, möglicherweise aber auch bereits erfroren.
Der Träumer passierte das Pappschild mit der Bitte um Geld, die Spendendose und die verwaiste Mundharmonika, die einen kleinen Schutzwall vor Hund und Herrchen bildeten. Eine Fußlänge vor dem Feuerteufel, dessen Bewegungen sie an einen Stop-Motion-Film erinnerten, hielt er an. Dennoch sah dieser nicht auf, bis ihm ein Pappbecher Kaffee unter die Nase gehalten wurde. Als er desinteressiert seine gezupften Brauen hob, musste Klarabell ihre vorschnelle Alterseinschätzung korrigieren. Er war höchstens Mitte zwanzig.
»Möchten Sie sich etwas aufwärmen?«
Es war nicht Klarabells Stimme, auch wenn sie ihrer ähnelte. Sie konnte nicht kontrollieren, was sie tat oder sagte. Das war nicht ihr Traum und sie war nicht geübt genug, ihn nach ihren Wünschen zu formen, wenn sie ihn in der Position des Schläfers erlebte. Also lehnte sie sich zurück und genoss den Film, in deren Hauptrolle sie festhing.
Der Zündler musterte sein Gegenüber skeptisch, bevor er den Coffee-Shop-Becher annahm. Langsam trank er einen großen Schluck des brühend heißen Getränks, wobei er Blickkontakt hielt. Ein stummes Nicken sollte als Dank reichen.
Anstatt beruhigten Gewissens nach der obligatorischen guten Tat pro Tag von dannen zu ziehen, ging Klarabell in die Hocke. Widerwillig kraulte sie den Hund durch die Hand des Träumers. Sein Fell war speckig und eiskalt, aber zu ihrer Erleichterung atmete der blonde Mischling.
Verzerrte Gesprächsfetzen blubberten aus ihrem geliehenen Mund, unverständlich wie das Nuscheln aus einem Bahnhofsmikrophon. Und dementsprechend verstand Klarabell auch kein Wort.
»Sie heißt Roxane«, hörte sie den vermeintlichen Bettler schließlich antworten.
»Wie die Frau aus Cyrano de Bergerac?«
»Wie die Hündin im Moulin Rouge.«
Der Mann schnalzte mit der Zunge, als hätte er das Wortspiel des Jahrhunderts gemacht. Gemurmelte Silben folgten, kaschiert durch den Schlaf. Die Worte, die Klarabell doch verstand, tat sie als geträumten Unsinn ab.
»Sie haben einen Sprung in Ihrem Glasauge«, sagte sie mit fremder Stimme.
Bei dem Versuch aufzustehen verlor sie das Gleichgewicht. Sie stolperte und fiel – tiefer, tiefer, tiefer.
Bevor sie auf dem Pflaster aufschlug, warf sie der Sturz aus dem Traum.
Verheddert in ihren Laken wischte sie sich mit dem Ärmel ihres Schlafanzuges die kalte, leicht nasse Stirn ab, auf der sich ihre Haare kringelten. Ein übermüdetes Stöhnen rollte aus ihrer Kehle. Schlaftrunken strampelte sie die nach Industrie-Weichspüler riechende Bettdecke weg, damit die frische Aprilluft, die durch das gekippte Fenster hereinströmte, sie abkühlte.
Im Traum im Körper eines Fremden zu stecken war ihr oft unangenehm. Selbst wenn es niemand außer ihr erfuhr.
Das war eines der Dinge, die sie an ihrer Gabe liebte: An das Meiste erinnerten sich die eigentlichen, wildfremden Träumer nach dem Aufwachen nicht mehr. Außerdem durfte sie sich nach Herzenslust austoben, wenn sie nicht an die Position des Träumers gebunden war. Dann konnte sie auf der Spitze des Eiffelturms stepptanzen, wilde Tiere zähmen, die es nicht gab, oder unter Wasser atmen. Ohne Haken. Das Schlimmste, was ihr passieren konnte, war der Tod, der im Schlaf – wie jedes Kind wusste - zu nichts anderem führte als zum Aufwachen. Und in der Realität warteten eine Regenwalddusche, verschiedene Duschgele mit duftenden ätherischen Ölen und ein vorgewärmter Bademantel über der Heizung in dem Bad, das an ihr Internatszimmer angrenzte.
Das wache Leben war langweilig, aber bequem. Sie mochte jeden Zentimeter ihres Elfenbeinturms. So furchtlos sie sich auch in Träumen gab, in wachem Zustand pflegte sie ihre Mauern liebevoll und blieb skeptisch. Wie die meisten Menschen, die davon überzeugt waren, viel zu verlieren zu haben.
Nicht zu wissen, dass man schlief, war anders. Man sprang wie ein Krokus im Frühling aus der Erde und war sofort mittendrin, ohne sich darüber zu wundern. Egal wie grotesk oder surreal die Situation sein mochte. Alles Verdrehte kam einem völlig normal vor.
Klarabell war sich der Träume fast immer bewusst, weil es nicht ihre eigenen waren. Sie träumte nicht auf diese Weise. Niemals. Nur eigene Albträume konnten Menschen wie sie haben. Ansonsten erlebte sie die nächtlichen Fantasien anderer. Sie streifte durch ihr Unterbewusstsein und zehrte von den Bildern in ihren Köpfen. Wie ein Parasit. Ohne es zu wollen oder das Geringste dagegen tun zu können. Sie war eine Schlafwandlerin, die ihr Bett nicht verließ, sondern den eigenen Körper. Als Traumwandlerin drang sie in den Geist anderer ein.
In Gedanken entschuldigte sie sich halbherzig bei der Person, deren Schlaf sie unabsichtlich gestört hatte. Studien zu ihrer Gabe zufolge, fühlte es sich unangenehm für den Träumer an. Mit Zweien war ein Unterbewusstsein schrecklich überfüllt, was sich in Kopfschmerzen und einem unruhigen Schlaf äußerte.
Brav schluckte Klarabell die auf ihrem Nachttisch bereitgestellten Tabletten ohne Wasser und genoss eine extralange dampfende Dusche. Sie pflegte jeden Zentimeter ihres Körpers mit Cremes und Lotionen bis sie roch wie ein kleiner Obstkorb, um einen möglichst großen Teil des taufrischen Morgens zu vertrödeln.
Es war ein Donnerstag, der sich anfühlte wie ein Montag. Er rieb auf der Haut wie ein kratziger Wollpullover und schmeckte nach purer Lustlosigkeit. In Klarabell sträubte sich alles gegen das bevorstehende Prozedere, doch keine Trödelei der Welt würde es verhindern. Für die Insassen dieses Elfenbeinturms - »Empathisch Hochbegabte« lautete der offizielle Oberbegriff - gab es viele Regeln. Das Mädcheninternat in der Severinstraße 222 verschlang einen exorbitanten Anteil des Vermögens ihrer Eltern dafür, dass sie unter den besten Umständen für Wunderkinder wie sie aufwachsen durfte. Dazu gehörte, dass Klarabell den alljährlichen Gesundheitscheck über sich ergehen lassen musste.
Auf dem Programm standen Belastungs-EGK, Rundum-Untersuchung, psychologisches Fachgespräch zu ihrem allgemeinen Empfinden, weitere ärztliche Untersuchungen und zu guter Letzt die obligatorische Sitzung mit einem professionellen Wahrsager.
Davor steuerte sie den ersten Stock an. Abgesehen vom Morgenappell vor dem Gesundheitscheck, zu dem alle Schülerinnen in exakt neunundzwanzig Minuten zu erscheinen hatten, galt es einer weiteren Verbindlichkeit nachzukommen.
Ihre ältere Cousine Cassandra vertrat die Überzeugung, dass es nur eine größere Verpflichtung im Leben einer Empathisch Hochbegabten gab als ihre Gabe für das Allgemeinwohl nutzbar zu machen. Nämlich die Familie. Darum bestand sie darauf, dass ihre Cousinen Klarabell und Morgana sich jeden Morgen vor dem Appell bei ihr trafen.
Was die beiden davon hielten, war eher sekundär. Klarabell hätte es auch nie übers Herz gebracht, Cassandra ihre Meinung zu dem inzwischen lästigen Ritual zu sagen. Diese hätte den Protest ohnehin mit einem engelsgleichen Lächeln nach einem Peitschenschlag mit ihrer spitzen Zunge abgetan.
Klarabell las ihren Fingerabdruck an Cassandras Zimmertür ein, woraufhin ein gelangweiltes Piepsen ihre Zutrittsbefugnis verkündete. Sie kam ausnahmsweise als Letzte. Normalerweise blieb diese Ehre Morgana vorbehalten, die diesmal bereits auf dem Schreibtischstuhl saß.
Das Handy zwischen Schulter und Ohr geklemmt lackierte sie sich die Fußnägel in Metallicrosa. Sie hatte die nackten Füße auf dem fast gruselig ordentlichen Schreibtisch abgelegt und balancierte das Nagellackfläschchen auf ihrem Schoß. Morganas Designerkleidung saß perfekt, ihr Nervenkostüm dagegen war wie so oft leicht überspannt. Ihre Stimme machte aufgekratzte Schlenker, ihre Zehen zuckten unruhig. Offensichtlich verlief das Telefonat zu schleppend für ihren Geschmack. Dann und wann nippte sie an ihrem Kaffee, den sie im Bücherregal neben sich abgestellt hatte. Dabei war sie der letzte Mensch, dessen Gemüt noch Koffein benötigen würde.
Im Vorbeigehen nickte Klarabell ihrer Cousine kurz zu, die wiederum nicht mehr für sie übrighatte als eine schlapp zum Gruß erhobene Hand. Klarabell schaltete auf Durchzug, was angesichts Morganas lautem Gespräch eine echte Leistung war, die viel Übung und Disziplin erforderte.
Mit einem Achselzucken setzte sie sich auf das federnde Bett, wo Cassandra bereits wie gewohnt ein Messing-Tablett mit schlichteleganten Teetassen drapiert hatte. Cassandra goss gerade Tee auf und bedachte Klarabell mit einem warmen Lächeln, das ihre rosigen Wangen hervorhob. Anschließend gab Cassandra ihrer jüngeren Cousine einen Kuss auf die Schläfe wie ihre Großmutter früher. Während sie sich zu Klarabell setzte, murmelte sie, vertieft in ein imaginäres Gespräch.
Wiedermal befand Cassandra sich überall nur nicht in diesem Raum.
Klarabell zuckte nicht. Drehte sich nicht um nach Stimmen oder Lauten, die im Diesseits nicht existierten. Nicht, dass sie ihre Sprache verstanden hätte. Sie tat, was sie gelernt hatte, und versuchte Cassandra so gut wie möglich das Gefühl zu vermitteln, alles sei normal. Sie sei normal.
Abwesend fummelte sich Cassandra in den dunkelbraunen Haaren herum. Als würde sie damit weben, tastete sie die Stelle ab, an der ihr in der letzten Woche eine Pechsträhne entfernt worden war.
Zunächst hatte man es auf Zufälle geschoben, bis das Pech sie so offensichtlich verfolgt hatte, dass sie zur Internatsärztin gegangen war. Pechsträhnen leuchteten nicht grün auf wie nuklearer Müll in Comics. Man machte sie ausfindig, indem man ein spezielles Schwefelpulver über die Haare gab. Es blieb an der betroffenen Stelle hängen und innerhalb weniger Sekunden überzog diese sich mit einem klebrigen schwarzen Film. In der Regel konnte man das Pech dann leicht herausschneiden. Natürlich immer in der Hoffnung, die Frisur nicht zu ruinieren.
Cassandras Strähne hatte im Nacken gesessen, darum war ihr Fehlen leicht zu kaschieren. Aber nach solchen Eingriffen verschlimmerte sich ihr Tick. Klarabell ertappte sich beim schweren Seufzen.
Ähnlich wie Krampfadern waren Pechsträhnen oft genetisch bedingt. Im schlimmsten Fall konnten sie der Grund sein, warum ehemalige Protegés wie Cassandra nach und nach verkamen, sobald sie im Abschlussjahr neben dem Unterricht zu arbeiten begannen. Das Unheil und die schlechte Energie, die sie magnetisch anzogen, schwächten Empathisch Hochbegabte und ihre natürlichen Schutzmechanismen.
Schreckensvisionen, in denen Cassandra nicht mehr war als geistiges Gemüse, flimmerten durch Klarabells Kopf. Sie verdrängte sie sofort. Noch brabbelte Cassandra bloß vor sich hin. Scheinbar harmlos. Sie konnte sich für die Arbeit neben dem Unterricht, in einer kleinen Kanzlei zweier anderer Medien zusammenreißen. Doch privat fiel es ihr oft schwer, die Stimmen abzuschalten, die an ihren Ohren zerrten. Manchmal, auch wenn Cassandra es vehement wegzulächeln versuchte, schien Klarabells zwei Jahre ältere Cousine nicht mehr sicher zu sein, ob sie mit Toten oder Lebenden sprach.
Subtil versuchte sie, Cassandra in ein Gespräch zu verwickeln, um sie von den Geistern abzulenken. Währenddessen trug sie eine Tasse zu Morgana, die weiter ins Telefon nörgelte. Sie wusste, ohne hinzuhören, worum es ging. Das Übliche. Einen der vielen Gefallen, die ihr regelmäßig beim Aufwachen in den Sinn schossen und keine weitere Stunde mehr Zeit hatten. Süßigkeiten, die ihr strenger Ernährungsplan nicht erlaubte, am Besuchstag ins Internat zu schmuggeln. Oder Filme, die sie nicht sehen durfte. Banale Dinge eben. Am anderen Ende der Leitung war immer derselbe: Noah, Morganas Stiefbruder.
Klarabell winkte dem Telefon verhalten zu.
»Klara sagt Hi«, gab Morgana lustlos weiter und entfernte mit einer Kopfbewegung eine ihrer kurzen, wasserstoffblonden Strähnen aus dem Gesicht. Klarabell wollte sich um die Haare kümmern, die sich in den stark getuschten Wimpern ihrer Cousine verklebt hatten. Dafür erntete sie jedoch bloß einen genervten Klaps auf den Handrücken. Augenrollend stellte sie den Tee zu der inzwischen leeren Kaffeetasse ins Bücherregal und zog sich zurück.
»Wieso nicht?«, maunzte Morgana in den Hörer. »Ich hab bestimmt noch was bei dir gut. Gib dir einen Ruck, Noah … Gut … Ja, ja, klar … Danke, du mich auch. Küsschen.« Nachdem sie aufgelegt hatte, machte sie sich nicht die Mühe aufzustehen, sondern rutschte mit dem Drehstuhl zum Bett herüber, auf dem ihre Cousinen saßen.
»Hey, Klara. Becki hat mir geflüstert, dass du gestern nach der Französischprüfung umgekippt bist. Wieso wissen wir nichts davon?«
Sie hob die Augenbrauen und runzelte die Stirn. Obwohl sie nichts anderes wollte, als Klarabell ein bisschen bloßzustellen, klang sie besorgt.
Als sie jünger gewesen waren, hätte kein Blatt Papier zwischen die drei Cousinen gepasst. Siamesische Zwillinge konnten kaum enger zusammenhalten. Sie hatten ihre Namen mit wasserfestem Filzstift auf die Arme der anderen geschrieben und einander das letzte rote Gummibärchen aufgehoben. Manchmal hatten sie sich nur getroffen, um gemeinsam ein Nickerchen zu machen. Klarabell hatte keinen blassen Schimmer, warum das aufgehört hatte. Alles, was sie heute zusammenzuhalten schien, war Cassandras Bedürfnis nach Harmonie und dem Fortbestehen des Trios.
»Weil’s nur eine Lappalie ist«, raunte Klarabell. »Und du brauchst dir keine Hoffnungen zu machen, Mim. Mein Durchschnitt wird trotzdem besser sein als deiner.«
»Seid nicht so schnippisch zueinander.« Was aus Cassandras Mund klang wie eine Bitte von den Lippen eines Engels, war in Wirklichkeit ein Befehl. Ihre Cousinen kannten sie genau.
Verstohlen schmollend betrachteten die beiden ihre Zehenspitzen, wodurch sie wie das Spiegelbild der jeweils anderen wirkten.
»Ein Ohnmachtsanfall also?« Plötzlich befand sich Cassandra ganz im Hier und Jetzt. »Hat das mit deinem Albtraum letzte Woche zu tun?«
»Sicher nicht. Die neuen Schlaftabletten schlagen mir ein bisschen auf den Kreislauf, aber ich nehme nach dem Aufstehen schon Vitamine dagegen. Ich habe einfach vor lauter Lernen für die Zwischenprüfung vergessen, besser auf mich zu achten. Kommt vor.«
»Du würdest es uns sagen, wenn es dir nicht gut ginge, oder?«
»Natürlich.«
Demonstrativ nahm Klarabell einen großen Schluck gesunden Bachblütentee. Etwas beschwichtigt nickte Cassandra ihr zu und schubste zwei Eiswürfel aus einem muschelförmigen Schälchen in ihren Tee, um ihn schneller abzukühlen.
»Versprochen, Sandra.«
Vielleicht war es doch gut, dass sie heute einen Rundum-Check über sich ergehen lassen würde. Dadurch konnte sie ihrer chronisch um ihr Wohl besorgten Cousine beweisen, dass es keinen Grund für die Falte zwischen ihren Augenbrauen gab.
Nur wenige Stunden später wurde sie jedoch eines Besseren belehrt.
ZWEI
Pares' Augen ruhten gelassen auf der ihm gegenübersitzenden, hadernden jungen Frau. Sie hatten nichts Glasiges an sich geschweige denn einen Sprung. Nicht einmal einen Tupfer einer anderen Farbe als leicht gräuliches, dunkles Blau. Sein Blick durchdrang Klarabells Schutzmauern mit links, während sie angestrengt versuchte, selbstsicher zu wirken.
»Möchtest du gern wissen, wer ich wirklich bin?«, fragte er, obwohl er sich gerade vorgestellt hatte. Jede Silbe wog er vorsichtig ab wie bei einer Kontaktjonglage.
Klarabell antwortete mit eindeutigem Kopfschütteln. Ihr saß ein Mann gegenüber, der etwas oder jemanden mit so gravierenden Folgen verwunschen hatte, dass man ihm die Zunge tätowiert hatte. Damit brandmarkte das Strafgericht Personen nach entsprechenden Urteilen als hochgradig gefährlich. Als jemanden, dem dadurch Stimme versiegelt werden musste, weil er mit bloßen Worten und bösem Willen einen Fluch heraufbeschworen hatte. Und trotzdem sprach Pares!
Damit wusste Klarabell bereits über ihn genug, um jeden Zentimeter ihres Körpers unter Hochspannung zu setzen. Sie erinnerte sich bewusst an die Schutzsymbole, die man ihr auf die Haut gestochen hatte. Reflexartig tastete sie das Band aus roten Perlen ab, das ihr Handgelenk als Glücksbringer zierte.
»Du siehst nicht wie eine Ausreißerin aus. Oder als hättest du viele Freunde. Dennoch kennt eine Traumwandlerin unsere Parole. Wagt es sogar, sie laut auszusprechen. Ich rate mal ins Blaue und sage, du hast sie im Schlaf gelernt?«
Sein Grinsen glich einem Zähnefletschen. Er musste sich unheimlich gern reden hören, denn sein Monolog war noch nicht beendet.
»Und du hast es bis hierher geschafft, ohne Reißaus zu nehmen. Ergo kannst du kein allzu helles Köpfchen sein.« Er zuckte gleichgültig mit den Achseln. »Kannst du dir trotzdem ausmalen, was mit dem armen Tropf passiert, der einem Wunderkind unsere Parole verraten hat? Möchtest du es genau wissen?«
Wieder schüttelte sie den Kopf.
»Aber es gibt etwas, das du willst. Du bist sicher nicht gekommen, um den Sprung in meinem Glasauge auszubessern.«
Seinem Schenkelklopfen nach zu urteilen war das ein absolut köstlicher Scherz, der winkend an Klarabell vorbeizog.
»Ich hoffe, du kannst mir helfen nicht zu sterben.«
Sein selbstverliebtes Glucksen verschwand augenblicklich.
»Meine Teure, für den richtigen Preis kannst du jedes Wunder haben, das dein schrecklich verwöhntes Herz begehrt.«
Einige Stunden zuvor
Klarabell wusste nicht mehr, wie sie auf dem Weg in ihr Zimmer normal hatte wirken können. Geschweige denn, wie sie überhaupt zurückgekommen war. Die Bilder in ihrem Kopf schienen so weit entfernt, dass es Erinnerungen an andere Tage hätten sein können. Schließlich war sie oft den vertrauten Weg von den Beratungsräumen zu ihrem Zimmer entlang geschlendert.
Als sie in den Raum geschlüpft war, hatte sie wie ferngesteuert beide Schlösser verriegelt, bevor sie im Badezimmer auch diese Tür hinter sich zusperrte. Hellwach und hypnotisiert zugleich setzte sie sich auf den Toilettendeckel und stemmte die Füße gegen die Tür. Um ihre schweißnassen, kalten Hände zur Ruhe zu zwingen, setzte sie sich auf ihre Finger, bis sie taub wurden. Wiegte sie wirklich wenige Millimeter vor und zurück oder war ihr nur schwindelig?
Der penetrante Geruch von reinigenden Räucherstäbchen hing noch in den Fasern ihrer Bluse, deren enger Kragen ihr auf den Hals drückte.
Was jetzt?
Klarabell wiederholte es ein paar Mal, bis sie merkte, dass sie es laut aussprach. Ihr Kopf war bis zum Bersten gefüllt mit Nichts.
Ein Kloß bildete sich in ihrem Hals, so dick und fest, dass sie einen Frosch darin befürchtet hätte, wären einige ihrer Tattoos nicht erst vor zwei Monaten frisch nachgestochen worden. Sie versuchte vergeblich, die Farbe unter ihrer Haut zu spüren. Über ihren Pulsadern, die während des Termins bei der Wahrsagerin von einem Seidenüberwurf bedeckt gewesen waren, saß ein rotes Perlenarmband. Die verschnörkelte Variante von Fatimas Hand auf der Innenseite ihres linken Oberarms. Sprüche hier und da, geistlich wie weltlich. Die kleine schwarze Zahl 1214 direkt unter ihrem Haaransatz im Nacken. Ein Traumfänger an ihrem Knöchel, der aussah wie mit Wasserfarben gemalt. Schutzsymbole, gestochen mit teurer, von den weltweit renommiertesten Alchemisten hergestellter Farbe. Sie sollten sie vor Unheil wie Fröschen im Hals, den Konsequenzen zerbrochener Spiegel, dem Bösen Blick und mutwilligem oder fahrlässigem Verschreien schützen.
Wie bei Infekten oder Viren gab es auch im Übersinnlichen viele verschiedene Arten von Erregern, wenn man so wollte. Der absolute Schutz existierte nicht, wie Cassandras Hang zu Pechsträhnen zeigte. Aber wenn sie als Wunderkinder nicht mit allem ausgestattet waren, was der legale Markt zu bieten hatte, wer dann? Und trotzdem …
Klarabell schüttelte den Kopf. Schüttelte alle Gedanken der Sorte »Wenn …«, »Hätte …« oder »Sollte …« heraus. Sie hasste sie. Sie machten sie rasend. Sie wollte sie an der Wand zerschmettern und auf ihren Splittern herumtrampeln oder sie die Toilette herunterspülen. Solche Gedanken änderten nichts. Sie unterstrichen bloß, wie falsch alles war. Schlichtweg nicht, wie es sein sollte. Sein durfte.
Es musste ein Irrtum vorliegen. Ja! Das war es. Ein Irrtum.
Aber wem wollte sie etwas vormachen? Keine Sturheit der Welt half ihr jetzt. Diesmal würde sie sich nicht heraus argumentieren können. Niemand würde ihre Probleme für sie lösen. Selbst wenn sie es wollten. Es gab keinen Ausweg. Das hatte ihr die Wahrsagerin mit der kunstvollen Eulenmaske deutlich gemacht. An teuren und renommierten Privatschulen für Empathisch Hochbegabte durfte nicht jede Dahergelaufene die Karten legen. Wenn eine professionelle Wahrsagerin auf diesem Niveau in keiner Variante ihrer Kunst eine Zukunft für sie entdeckte, war es endgültig. Sie würde sterben.
Jetzt verstand sie immerhin, warum man sie und die Wahrsager zu solchen Terminen mit Tiermasken aus Holz, farbigem Glas oder Porzellan versah. Warum man sie darunter bis zur Unkenntlichkeit schminkte und ihre Haare unter Perücken verbarg, ihre Tattoos entweder abdeckte oder überschminkte. In ihr braute sich ein irrationaler Zorn auf ihre Wahrsagerin und deren dämliche Tarotkarten zusammen, dass sie dankbar war, nur ihren Künstlernamen zu kennen. Eine Kunstfigur ohne Identität zu hassen, fühlte sich weniger schäbig an, als einen wildfremden Menschen, der bloß seine Arbeit machte.
Wahrsager wiederholten bloß, was ihnen die Zukunft diktierte. Sie spannen sie nicht selbst.
Frustriert schloss Klarabell die Augen, um die Welt für einen Moment auszublenden.
Wie konnte es denn einfach aus sein? Sie war nicht mal achtzehn Jahre alt. Ihre Mutter hielt sie noch immer für ein Kind, wie konnte sie da schon sterben?
Die Gedanken schwirrten in Klarabells Kopf, ohne dass sie sie greifen oder verarbeiten konnte. Die Erkenntnis sickerte durch und verpuffte wieder. Sie kroch durch ihre glühenden Ohren hinein, wo Verdrängung aus blanker Panik sie verschluckte. Als sie zu hyperventilieren begann, klemmte sie den Kopf zwischen die Knie und atmete bewusst langsam. Atmete. Atmete. Atmete. Und zählte.
Wie viele Atemzüge noch?
Der Gedanke schnürte ihr die Luft ab.
Wie lange noch?
Unvermittelt begann sie zu rechnen, um sich abzulenken. Ein Monat bis zu ihrem Geburtstag am 1. Mai, den die Wahrsagerin trotz mehrerer angestrengter Versuche und Auslegungen der Tatrotkarten nicht sah. Höchstens noch dreißig Tage. 720 Stunden. 43.200 Minuten. 2.592.000 Sekunden. 2.591.999. 998. 997.
Wie oft atmet man in der Minute?
Keuchend, stumm schluchzend und immer noch rechnend stemmte sie die Fäuste gegen die Stirn. Sie tigerte durchs Bad. Verschwendete ihre abgezählten Minuten damit zu versuchen, sie zu sammeln.
Ihre eigenen Worte vom Morgen widerten sie inzwischen an – nur eine Lappalie. Sie wollte sich am liebsten dafür ohrfeigen. Oder besser die ganze Welt. Wer auch immer die Schuld daran trug, dass ihr Ohnmachtsanfall offenbar kein harmloser Anflug von Schwäche gewesen war, sondern der Vorbote ihres unausweichlichen frühen Todes.
Überfordert sehnte sie sich nach Normalität. Sie fasste sich ein Herz und öffnete die Badezimmertür. Wie eine echte Schlafwandlerin wankte sie durch den Raum auf der Suche nach dem Manifest des Alltages, der Chronik der Gewöhnlichkeit: ihrem Tagebuch. Drei weitere Bücher purzelten aus dem Regal, als sie es herausriss. Sie machte sich nicht die Mühe, sie aufzuheben. Keine Zeit.
Sie musste in das Tagebuch schreiben. Es war normal. Es war sicher. Es fühlte sich an, als sei alles in Ordnung. Wie der Geruch von frisch gekochter Marmelade oder Bärchen-Pflaster, die ihre Mutter verwendete und für die sie sich zu alt fühlte.
Weil ihr nichts Besseres einfiel und auch aus purem Trotz, verfasste sie eine Liste anstatt einen Tagebucheintrag. Eine Wunschliste mit Dingen, die sie vor ihrem Tod tun wollte. Hoffentlich gaben sie ihr das Gefühl, nicht um ein komplettes Leben betrogen worden zu sein, sondern nur um ein halbes. Je nachdem, wie viel sie schaffte.
Hauptsächlich schrieb sie Banales. Einiges konnte sie wahrscheinlich nur im Traum umsetzen, so sicher war sie sich nicht. Die Realität außerhalb des Internats war ihr über die Jahre fremd geworden. Konnte sein, dass sie einige Gegebenheiten mit denen aus Träumen verwechselte.
Sie hatte keine Ahnung vom Leben außerhalb ihres goldenen Käfigs, wo man nicht darauf getrimmt wurde, seine seltene Gabe zu trainieren, um später als Traumdeuter oder Schlaftherapeut verbeamtet zu werden. Das war die größte Verschwendung: Sie wusste nicht einmal, was sie verpasste. Bis jetzt.
Klarabell sprang auf. Sie raffte wahllos Gegenstände zusammen, von denen sie dachte, dass normale Frauen sie in ihren Handtaschen trugen, und stopfte sie in ihre Regenjacke. Achtlos strampelte sie ihre straffe Kleidung ab und warf sie auf den Boden. Sie schlüpfte in ihre bequeme Lieblingsjeans, die ihren Wohlstandsspeck leicht über den Bund drückte. Aus dem Wäschekorb schnappte sie sich einen Kaschmirpullover, ohne überhaupt genau hinzusehen. Sie war halb zur Tür hinaus, bevor sie ihn richtig anhatte.
Verbot hin oder her – nach elf langen Schuljahren würde sie Köln endlich auf eigene Faust erkunden. Ohne Anstandsdamen und Bodyguards. Das echte Leben spüren. Wenigstens ein einziges Mal.
Bereits am zweiten Tag fühlte sich dieser April an wie eine völlig neue Welt. Frühlingsduft mischte sich unter den Straßendreck und die Abgase in der Luft. Manche Leute verführten die milden Temperaturen dazu, sich die Jacken auszuziehen, um die letzten Sonnenstunden des Tages auf ihrer vom Winter ausgeblichenen Haut einzufangen. Der Rollsplitt aus den vergangenen Märzwochen, der unter den Schuhen der Passanten knisterte, passte nicht recht zu diesem Bild, das die Ankunft einer neuen Jahreszeit ankündigte.
Klarabell wanderte ziellos an fremden Menschen vorbei, die mit gesenktem Kopf nicht bemerkten, was links und rechts von ihnen geschah. Ihre Handydisplays hypnotisierten sie förmlich. Klarabell beobachtete die Leute in ihrer natürlichen Umgebung. Sie war selten in der Stadt unterwegs und wenn, dann eingekapselt in ihren eigenen kleinen Kosmos. Begleitpersonen kümmerten sich ausschließlich darum, sie abzuschirmen, damit Hinz und Kunz dem wertvollen Wunderkind nicht zu nahe kamen. Massenweise Blicke waren ihr also sonst sicher gewesen. Genauso wie die »Uuuhs« und »Aaaahs« neidischer Mädchen, die dafür getötet hätten, um zu sein wie sie, weil gefährliches Halbwissen aus dem Unterricht an Schulen für Normalsterbliche diese Gaben romantisierte.
Diesmal drehte sich niemand nach Klarabell um oder wich ihr aus. Ohne ihre Entourage war sie unscheinbar, trotz ihrer fuchsrot gefärbten Locken. In ihrer Unbedarftheit vergaß sie das ab und zu und rannte versehentlich in einen älteren Herrn oder durchkreuzte eine Gruppe Teenager.
Sie fügte sich bestmöglich in die Masse der Fußgänger ein und lernte schnell, sich dem Takt der anderen anzupassen. Der Puls der Domstadt war aufgeregt. Klarabell war nie bewusst gewesen, wie gut man den Herzschlag einer Stadt spürte, wenn die Welt sich nicht allein um einen selbst drehte.
In ihren Jackentaschen schloss sie die Hände um die wenigen Dinge, die sie bei ihrem überstürzten Aufbruch hineingestopft hatte. Ihr Handy, Kopfhörer, ihr Hausschlüssel, ein Hustenbonbon und ein Päckchen Taschentücher. Darin befand sich nur ein einziges Papiertaschentuch, dafür aber jeweils ein unsauber zusammengerollter Hundert- und Fünf-Euroschein, die sie auf ihrem Schreibtisch gefunden und eilig eingesteckt hatte. Wo ihr Portemonnaie war, wusste sie nicht genau. Sie zahlte so selten selbst, dass sie regelmäßig vergaß, wo es lag.
Die Domplatte, über die sie gefegt wurde, füllte sich im Nachmittagstrubel. Sie war das Epizentrum des Windes, sein Zuhause, dachte Klarabell. Hier war es immer windig. Als würden Böen und Stürme von dieser Quelle aus in die Welt fließen. Klarabell war vom Clodwigplatz aus den Haltestellen bis hierher gefolgt. Eine Station nach der anderen hatte sie passiert, ohne die bewusste Absicht, ins Stadtzentrum zu gehen. Die frische Luft tat gut und solange niemand nach ihr suchte, konnte sie noch ein wenig draußen bleiben. Dadurch schob sie gleichzeitig heraus, ihr Versprechen Cassandra gegenüber einzuhalten.
Eine schwächelnde Sternschnuppe huschte durch ihre Gedanken – Cassandra würde immer für sie da sein, ironischerweise vielleicht später mehr als jetzt. Ein Glück, dass die Gaben ihrer beiden Cousinen nicht vertauscht waren.
Ein flackerndes Leuchtschild wenige Meter entfernt erregte Klarabells Aufmerksamkeit. Zunächst wusste sie nicht, was der vergilbte Kiosk-Schriftzug, der aus der nächsten Seitengasse lugte, Anziehendes an sich hatte. Sie blieb stehen, neigte den Kopf in verschiedene Richtungen, kniff die Augen zu und riss sie wieder auf, weil ihr dämmerte, woher sie den Anblick kannte.
Bisher hatte sie nicht in Erwägung gezogen, dass das sinnlose Gefasel aus dem vergangenen Traum mehr gewesen war als die natürliche Merkwürdigkeit eines menschlichen Unterbewusstseins. Vielleicht war es eine Erinnerung gewesen, kein frei erfundener Traum. Der Feuerteufel, der räudige Hund, die Unterhaltung – das alles konnte stattgefunden haben. Und Klarabell fiel nur eine Möglichkeit ein, wie das Gefasel von einem Glasauge Sinn machte.
Sie erinnerte sich dunkel an die Gerüchte, die ein von einer Taschenlampe beleuchtetes Gesicht vor Jahren bei einer Pyjamaparty im Internat verbreitet hatte. Sie hatten sich Gruselgeschichten vom Schwarzmarkt im Untergrund erzählt, auf dem allerlei Gerümpel und verbotene Kostbarkeiten gehandelt wurden. Dort bekam man jedes erdenkliche Wunder zum Spottpreis oder für seine halbe Seele – wenn man die Parole kannte.
Klarabells Magen begann, sich in sich zu wringen. Ihr war mulmig, als sie durch die Tür des inzwischen wiedereröffneten Kiosks trat. Ein hysterisches Glöckchen begrüßte sie in dem schmalen, vollgestopften Lädchen.
In der Ecke stand ein Retro-Kaugummiautomat, den man mit Münzen füttern musste, um eine Kugel gefärbten Zucker zu bekommen, die zum Kauen zu hart und zum Lutschen zu groß war. Daneben, über Dosenbier und billigem Modeschmuck, hingen Heilstein-Talismane für unterwegs. Außerdem lag vor der Theke eine Regenbogenpalette reinigender Räucherstäbchen für das Vertreiben böser Geister aus, hinter der sich ein faltiger kleiner Mann eine Zigarette drehte.
Sein Tabak roch selbst unangezündet so extrem, dass Klarabell einen Ärmel schützend über ihre Nase halten wollte. Aus Höflichkeit kämpfte sie den Drang herunter.
Menschen wie sie waren penetrante Gerüche nicht gewöhnt, außer von Räucherstäbchen und –kegeln. Scharfes Essen, Alkohol, Zigaretten und Ähnliches waren tabu. Wunderkinder mussten sich schonen, um ihre Gabe zu erhalten. Unvorsichtige Lebensstile erhöhten die Gefahr der Nebenwirkungen von Traumwandeln, Gedankenlesen und Ferngesprächen ins Jenseits.
Wie bei Cassandra. Der Internatsleiter hielt es für wahrscheinlich, dass ihr Zustand in so jungen Jahren derart schlimm geworden war, weil ihre Eltern jahrelang mit ihr in einer Amsterdamer Kommune gelebt und diese Regeln missachtet hatten.
Etwas daran, wie der Kioskverkäufer seine Hände stillhielt und wie sich seine Augen verengten, verriet, dass Klarabell hier nicht hergehörte. Als hätte der Mann keine Kundschaft erwartet. Oder zumindest nicht welche wie sie.
Ihre Mutmaßung über den Traum nahm weiter Gestalt an.
Sei nicht albern, Klara, schimpfte sie sich selbst.
Aber es ergab Sinn, das konnte sie nicht leugnen.
»Guten Tag.« Der Kioskverkäufer schmatzte beim Sprechen im Kölner Dialekt leicht und kraulte sich das Brusthaar, das aus dem zwei Knöpfe weit offenstehenden Hemd lugte. »Suchst du was Bestimmtes?«
Klarabell antwortete nicht. Sie reckte den Hals, sah sich um, während sie sich an die Theke anschlich, auf der Mäusespeck und Lakritzstangen angeboten wurden. Ihr war mulmig und zunehmend heißer. Wie hatte sie das nicht bedenken können? Natürlich erwartete er, dass sie mit ihm sprach. Wenn sie es nicht tat, verriet sie sich als Empathisch Hochbegabte. Denn ihnen war es verboten, wahllos mit Normalsterblichen zu reden.
Empathisch Hochbegabte, die sich in andere so intensiv hineinfühlten, dass sie beispielsweise ihre Träume teilten, strengte das unheimlich an. Es verursachte bei ihnen Nebenwirkungen wie Schwindel, Erschöpfung und Konzentrationsprobleme. Aber das war das kleinere Problem.
Gedanklich spulte Klarabell halb auswendig gelernte Vorträge darüber ab, wie sich dadurch negative Energie von einer auf die andere Person übertragen konnte. Jemand wie sie galt als besonders anfällig. Wie Kinder, Schwangere und ältere Menschen bei Virusinfektionen.
Das Sprechverbot mit Normalsterblichen hatte einen Sinn, diente es doch dazu sie zu schützen. Allerdings gab es auch einen banaleren Grund, warum sie sonst unter peniblem Schutz stand. Zu viele wussten einiges mit jemandem wie ihr anzufangen, wenn sie allein und hilflos war.
Sich zu erkennen zu geben, war keine Option.
Sie schluckte trocken, bevor sie den Mund öffnete. Zu sprechen brach Regeln, die sie seit ihrer Kindheit heiligte. Doch es schmeckte weniger brenzlig als ihre Identität preiszugeben. Klarabell blieb ohnehin nicht viel Zeit, um unter möglichen Nebenwirkungen zu leiden, die das Sprechen mit Normalsterblichen mit sich brachte. Was machte es also schon?
»Hast du dich verlaufen, Schätzelein?«, fragte der Verkäufer.
Hastig schüttelte sie den Kopf. Der Entschluss zu sprechen war das eine, ihn umzusetzen etwas anderes. Die Laute wanden sich lediglich in ihrer Kehle anstatt herauszukommen.
Ein letzter abwägender Blick über die Warenauslage. Standardprodukte. Stangenware. Minderwertige Steine und Pflanzen, eingearbeitet in günstigen Plastikschmuck. Mit ihren Sonderanfertigungen vom Juwelier konnte hier nichts mithalten. Sie trug zwei Reihen Ohrringe aus Turmalin und Rosenquarz, die sie vor Gedankenlesern wie Morgana schützen sollten. Dazu schmückten sie schmale Ringe an ihren ersten beiden Fingergliedern, ein Tragus- und ein Bauchnabelpiercing. Aber selbst diese wirkten wie Plunder verglichen mit dem Saphir-verzierten Septum ihres Gegenübers, das ihr nun bei genauerem Hinsehen auffiel. Ganz zu schweigen von dem Diamanten über dem Tunnel in seinem linken Ohr, zu dem ihr Blick als nächstes wanderte. Wäre sie nicht von all den Reizen hier überfordert gewesen, hätte sie diese ungewöhnlichen Details vielleicht früher bemerkt. Ein normaler Verkäufer in einem solchen Ramschladen konnte sich unmöglich so kostspielige Talismane leisten. Abgesehen davon – wozu?
Dieser Mann war bis unter den knittrigen Kragen seines Hemdes tätowiert, mit Symbolen, die Klarabell nicht erkannte. Es waren definitiv keine Zeichen für Empathisch Hochbegabte oder Wahrsager. Die indigofarbenen Konturen erinnerten an den Stil osteuropäischer Künstler. Die Bilder an sich sagten ihr nichts. Aber sie waren eindeutig keine Schmuck-Tattoos.
Klarabells erster Impuls war die Flucht. Auf dem Absatz umdrehen, die Beine in die Hand nehmen und rennen. Zurück zum Internat. Drei meditative Räucherstäbchen anzünden und tief durchatmen, bevor sich ein Albtraum in ihr Ohr schlich und sich verbiss. Eine bizarre Idee hatte diesen Weg bereits zurückgelegt. Sie hielt sie an Ort und Stelle.
Was, wenn es einen Grund gab, der sie hierher geführt hatte?
Du hast nichts zu verlieren, versicherte sie sich und knabberte an der Innenseite ihrer rechten Wange.
Keiner der staatlich anerkannten und geprüften Talismane, mit denen man sie schmückte, konnte das vorausgesagte Unheil von ihr abwenden. Die Schulmedizin führte ebenfalls in eine Sackgasse, wenn die Wahrsagerin eindeutig Klarabells Ende vorhersah. Beides hatte eben endliche Kapazitäten.
Aber die Abgründe jenseits der geregelten Wege bieten vielleicht noch eine irrwitzige Chance.
Allen Warnungen und inneren Alarmsignalen zum Trotz musste sie es wohl oder übel darauf ankommen lassen.
»Ich brauche etwas Tiefenreinigendes«, sagte sie so selbstbewusst wie möglich.
Der Verkäufer stand von seinem Hocker auf, der wie ein Stoppschild vor einer schmalen Wendeltreppe in den unbeleuchteten oberen Stock stand. Er legte die Handflächen auf die Theke und beugte sich vor. Mit dem Kopf deutete er zu seiner Linken.
»Das ist alles, was ich habe. Rezeptpflichtiges darf ich nicht verkaufen, dafür musst du in die Apotheke gehen.«
Damit war die Sache für ihn erledigt. Aber nicht für Klarabell.
»Ich brauche es rezeptfrei … Was ist mit dem Bettler und dem Hund? Haben die beiden vielleicht was für mich?«
Der gestauchte Mann runzelte die Stirn. Sein Mund verzog sich zu einem liegenden Fragezeichen.
»Ich weiß nichts von irgendwelchen Bettlern.«
Ihre Schultern sanken enttäuscht nach unten, weil der Kioskverkäufer sich scheinbar abwandte. Als ihr nach der Vorhersage die nächste Tür vor der Nase zugeschlagen wurde, wusste sie nicht, wie ihr geschah. Überfordert huschten ihre Blicke umher. Ihre Finger gruben sich tiefer in ihre Taschen, wühlten nach etwas Brauchbarem, das sie verkaufen konnte. Sie fand es in ihrem Ohr.
Zögerlich öffnete sie den Verschluss ihres Traguspiercings. Das filigran geschliffene Hexagon, das ihre nächtlichen unfreiwilligen Wanderungen von den meisten Albträumen abschirmte, bestand aus reinstem Mondstein. Dänische Handarbeit. Ein Familienerbstück. Klarabell legte das Schmuckstück auf den Tresen.
Der Kioskverkäufer reagierte nicht, bis sie aus einem Bauchgefühl heraus die Parole rezitierte, die ihr im Traum zugeflogen war. »Sie haben da einen Sprung in ihrem Glasauge.«
»Hömma, Schätzelein, das ist vom besten Flohmarkt in Basel.«
Mit diesen Worten nahm der Mann eine Lupe aus der Gesäßtasche seiner etwas zu engen Hose und prüfte ihr Angebot penibel.
Knurrendes Grunzen. Schweres Atmen. Erneut griff er in die Tasche und schob eine Visitenkarte über die Tischplatte. Mit der anderen Hand steckte er zeitgleich die Bezahlung in Form von Klarabells Piercing ein.
»Tut mir leid. Wie gesagt, frag mal in der Apotheke nach.«
Der teuer erkaufte Zettel nannte eine Zugverbindung, ein Abteil und eine Uhrzeit. Ohne ihre Handlungen großartig zu hinterfragen, aus Angst, sie könnte einen Rückzieher machen, folgte Klarabell den Angaben. Ihr blieb nur zu hoffen, dass man sie nicht in die Irre führen wollte. Seit sie den Kiosk verlassen hatte, verfolgte sie ein mulmiges Gefühl.
Vermutlich war es eine Sicherheitsmaßnahme, Mittelsmänner zu haben. Wie Makler. Klarabells wertvolles Piercing war seine Provision für die Vermittlung des perfekten Dealers gewesen.
Sie musste auf den letzten Metern sprinten, um den IC zu erwischen. Das Abfahrtsignal schrie gerade auf, als sie durch die Tür glitt. Der proppenvolle Pendlerzug auf dem Weg nach Dortmund über Düsseldorf roch nach überarbeiteten Menschen und muffigen Polstern. Klarabell kämpfte sich durch die beengten, mit Akten- und Computertaschen zugestellten Gänge bis zu dem Abteil durch, das auf dem Zettel stand, den sie fest in ihrer geballten Faust hielt.
Ein verwaistes Abteil in dem überfüllten Zug vorzufinden, gab ihr die benötigte Bestätigung am richtigen Ort zu sein. Mehrfach prüfte sie die Nummer, stand wie ein Mondkalb vor der Tür, bevor sie eintrat. Erst drinnen atmete sie durch – endlich umgeben von vertrauter Stille, abseits der normalen Menschen, wie sie es gewohnt war.
Sie breitete sich über einer der Bänke aus, streckte ihre verspannten Glieder. Danach entwirrte sie die Kopfhörer aus ihrer Jackentasche und schaltete »Disney’s Greatest Hits« auf ihrem Handy trotz schwindender Akkuladung in voller Lautstärke an, damit sie ihre Gedanken übertönten.
Dann wartete sie.
Und wartete. Und wartete. Während nichts geschah.
Niemand gesellte sich zu ihr, nicht einmal der Schaffner steckte den Kopf ins Abteil. Weil dieser Tag ihre Kraftreserven gierig aufzehrte, glitt sie irgendwann in den Schlaf hinüber, wo sabbernde Albträume schon ihre Zähne und Klauen wetzten. Sie lechzten nach ihr, die gerade den schützenden Mondsteine weggeben hatte.
Als die ungeduldig erwartete Gesellschaft endlich eintrat und Klarabell unvorbereitet aus ihren Fängen befreite, erkannte sie die Gestalt sofort.
Der junge Mann war geduscht, parfümiert, gekämmt, neu eingekleidet und ohne flohverseuchte Begleitung unterwegs, doch er sah keinen Tag älter aus als im Traum. Seine plakativen Tätowierungen an Händen, Hals und in den Handflächen brauchte es nicht, um jeglichen Zweifel seiner Identität auszulöschen. Klarabell erkannte ihn an der stockenden Art, wie er sich bewegte, schnippte und die Nase hochgereckt nach einer unsichtbaren Fährte schnüffelte. Wie eine Kreuzung aus Bluthund und Brotspinne.
Ob Klarabell nach Innenstadt und fremden Menschen stank? Oder nach den vielen Kilometern, die sie vom Internat aus bis zur Schildergasse zurückgelegt hatte? Plötzlich spürte sie die Blasen an ihren Fersen überdeutlich. Kalter Stressschweiß ersetzte Tränen, für die sie noch zu perplex war. Dazu kam der Hitzestau, der noch vom Hechten zum Zug herrührte. Sie hoffte, die vielen Cremes und Lotionen vom Morgen übertünchten all das, während sie die Parole erneut über ihre Lippen zwang.
Pares schnippte ungeduldig. Verwechselte er Klarabell mit einer Gedankenleserin? Anscheinend sollte offensichtlich sein, was er von ihr wollte.
Nicht bereit länger zu warten, zog er Klarabells Hand ungefragt zu sich. Er drehte ihre Handfläche zur Decke und fuhr mit dem manikürten Finger, auf dessen Knöchel ein L stand, über die Linien auf ihrer Haut. Kein Muskel zuckte auf seiner Stirn oder an seinen Mundwinkeln. Gelegentlich verengten sich seine Augen kaum merklich. Das war alles.
Es war zu ruhig, als dass Klarabell ihr hämmerndes Herz hätte überhören können. Die entrückte Melodie ihrer Nervosität machte sie kribbelig. Still zu sitzen und abzuwarten, bis die vernünftigen Gedanken hereinschwappten, juckte in ihren Muskeln. Es rieb ihre Nerven wund.
Unter Pares' Finger, der zu fest in ihre Handfläche drückte, zwickte ihre Haut wie unter heißem Wasser nach einer Schneeballschlacht mit bloßen Händen.
»Ich fürchte, mir ist kein geeignetes Heilmittel für dich bekannt«, erklärte er ohne vom Handlesen aufzusehen.
Als er losließ, blieb eine unterschwellige Kälte in den Linien zurück, die seine Finger nachgezeichnet hatten.
»Und du bist absolut sicher, dass du sterben wirst?«
»Eine Wahrsagerin hat es diagnostiziert.«
Daran gab es nichts zu rütteln. Wäre es die Diagnose eines Arztes oder eines Therapeuten gewesen …
Pares grübelte einige Augenblicke lang. Dabei nickte er sich selbst zu, ohne Klarabell aus den Augen zu lassen. Er zupfte an einer dünnen Strähne, bevor er sie hinters Ohr schob.
»Du hast Glück, dass deine Gabe nützlich sein könnte. Ich bin eventuell bereit, dir einen Handel anzubieten. Allerdings erfordert eine so vertrackte Situation wie deine entsprechend drastische Maßnahmen. Und das kostet. Die Frage ist: Wie weit würdest du gehen, um dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen?«
Bis gerade eben war Klarabell nicht bewusst gewesen, dass das ging - das Schicksal austricksen.
»Wie?«, platzte es aus ihr heraus.
Er lehnte sich vor und rutschte näher an die Sitzkante. Noch näher. Bis sie seinen Atem riechen konnte. Ein verführerischer Hauch aus kaltem Kaffee und Zwiebelkuchen.
»Unsterblichkeit.«
Sie schnappte nach Luft. Unsterblichkeit war unmöglich! Hochverrat an der Natur, der Menschheit selbst! Ein schmutziger Mythos, mit dem man schwache, gierige Seelen in die Irre führte.
Laut prustend fuhr der IC in den nächsten Bahnhof ein. Klarabell wusste nicht, in welchen. Sie hörte nur das Kreischen der Bremsen und sprang auf ihre zittrigen Beine. Hauptsache raus aus dem Abteil, das zu schrumpfen schien. Hauptsache weg.
»Überleg’s dir«, hörte sie Pares rufen. »Solange du noch kannst.«
DREI
Als Klarabell aus dem Zug stolperte, irgendwo zwischen Köln und Dortmund, wusste sie nicht wohin.
Ins Internat? Unmöglich.
Ich kann nicht zurück.