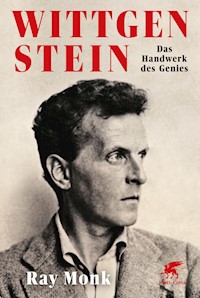
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die beste Wittgenstein-Biographie: überarbeitet und neu aufgelegt Aus der minutiösen Recherche, aus vielen Korrespondenzen und Tagebüchern entsteht das Leben des Philosophen, wie man es so nicht kannte – keine Kultfigur, sondern ein Mensch, der sich einer permanenten Selbstprüfung unterwarf. Durch einzigartiges erzählerisches Geschick fesselt Ray Monk von der ersten bis zur letzten Seite. Er schuf damit die beste Wittgenstein- Biographie überhaupt – nun gibt es sie in einer überarbeiteten Neuausgabe. »Die Biografie versteht zu faszinieren wie der Meister selbst.« Matthias Frings, SFB2 »Nur selten hat man wie bei Monk das Gefühl, dass es einem Biographen gelungen ist, den Motor gefunden zu haben, der das Leben und Schaffen einer Person in Gang hielt.« Michael Hampe, Frankfurter Rundschau »Monk lichtet etwas vom fabulösen Nebel um eine der faszinierendsten Gestalten dieses Jahrhunderts.« Matthias Kross, Der Tagesspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1113
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ray Monk
Wittgenstein
Das Handwerk des Genies
Aus dem Englischen übertragen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Das vorliegende Buch ist die überarbeitete und korrigierte Neuausgabe des gleichlautenden Titels von Ray Monk: Wittgenstein. Das Handwerk des Genies, Stuttgart, Klett-Cotta, 1992.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.deDie Originalausgabe erschien unter dem Titel Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius© 1990 by Jonathan Cape Ltd., London, und The Free Press, New YorkFür die deutsche Ausgabe
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung einer Abbildung aus dem Besitz des Wittgenstein-Archives in Cambridge
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-96485-1
E-Book ISBN 978-3-608-11669-4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einführung
I
1889–1919
1.
Das Labor der Selbstzerstörung
2.
Manchester
3.
Russells Protégé
4.
Russells Meister
5.
Norwegen
6.
Hinter der Front
7.
An der Front
II
1919–1928
8.
Die nicht druckreife Wahrheit
9.
»Ganz ländliche Verhältnisse«
10.
Flucht aus der Wildnis
III
1929–1941
11.
Die Rückkehr
12.
Die »Phase der Verifikation«
13.
Der Nebel lichtet sich
14.
Ein Neubeginn
15.
Francis
16.
Sprachspiele:
Das Blaue Buch
und
das Braune Buch
17.
An die Basis
18.
Bekenntnisse
19.
Finis Austriae
20.
Professor wider Willen
IV
1941–1951
21.
Kriegsbeitrag
22.
Swansea
23.
Die Finsternis dieser Zeit
24.
»Aspektwechsel«
25.
Irland
26.
Bürger ohne Gemeinschaft
27.
Storeys End
Tafelteil
Anhang
Danksagung
Bartleys Wittgenstein und die kodierten Bemerkungen
Bildnachweis
Anmerkungen
1. Das Labor der Selbstzerstörung
2. Manchester
3. Russells Protégé
4. Russells Meister
5. Norwegen
6. Hinter der Front
7. An der Front
8. Die nicht druckreife Wahrheit
9. »Ganz ländliche Verhältnisse«
10. Flucht aus der Wildnis
11. Die Rückkehr
12. Die »Phase der Verifikation«
13. Der Nebel lichtet sich
14. Ein Neubeginn
15. Francis
16. Sprachspiele:
Das Blaue Buch
und
das Braune Buch
17. An die Basis
18. Bekenntnisse
19. Finis Austriae
20. Professor wider Willen
21. Kriegsbeitrag
22. Swansea
23. Die Finsternis dieser Zeit
24. »Aspektwechsel«
25. Irland
26. Bürger ohne Gemeinschaft
27. Storeys End
Personenregister
Für Jenny
Logik und Ethik aber sind im Grunde ein und dasselbe –Pflicht gegen sich selbst.
Otto Weininger(1), Geschlecht und Charakter
Einführung
Von Ludwig Wittgenstein geht eine ungewöhnliche Faszination aus, die sich nicht allein durch seinen gewaltigen Einfluss auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts erklären lässt. Auch wer nichts von analytischer Philosophie hält, spürt den Reiz seiner Person. Über Wittgenstein werden Gedichte geschrieben, er inspiriert Gemälde, sein Werk wird vertont, und er ist die Hauptfigur eines erfolgreichen Romans, der kaum mehr ist als eine literarisch nachempfundene Biographie (The World as I Found It von Bruce Duffy(1)). Zudem gibt es mindestens fünf Fernsehfilme über ihn und zahllose schriftlich fixierte Erinnerungen, deren Verfasser ihn oft kaum kannten. (Zum Beispiel hat F. R. Leavis(1), der Wittgenstein höchstens vier- oder fünfmal sah, 22 Seiten »Erinnerungsbilder« publiziert.) Auch seine Russischlehrerin, sein Torflieferant in Irland, und jener Mann, der ihn kaum kannte, aber zufällig die letzten Fotos von ihm machte, haben Erinnerungen an Wittgenstein veröffentlicht.
Daneben häufen sich die Kommentare zur Philosophie Wittgensteins. Eine neuere Bibliographie der Sekundärliteratur enthält immerhin 5868 Titel. Gewiss sind davon die wenigsten für Laien interessant (oder verständlich); doch ebenso wenige befassen sich mit solchen Aspekten von Wittgensteins Leben und Persönlichkeit, an denen sich die oben erwähnten Autoren delektierten.
Das starke Interesse an Wittgenstein erscheint also unglücklich polarisiert: Die einen erforschen sein Werk abgelöst von seinem Leben, die anderen finden sein Leben faszinierend, sein Werk aber unverständlich. Wer etwa Norman Malcolms(1)Erinnerungen liest, lässt sich gewiss von der dort beschriebenen Person einnehmen und möchte Wittgensteins Werke selbst kennenlernen – nur um festzustellen, dass er kein Wort versteht. Es gibt viele exzellente Einführungen in Wittgensteins Werk, die seine philosophischen Leitmotive und ihre Verarbeitung erläutern. Darin bleibt aber völlig ungeklärt, was sein Werk mit ihm zu tun hat – wie sich die geistige und ethische Suche, die sein Leben prägte, in die scheinbar sehr entlegenen philosophischen Grundfragen seines Werks einfügt.
Mit meinem Buch strebe ich an, diese Kluft zu überbrücken. Indem ich Leben und Werk verbinde, möchte ich deutlich machen, wie das Werk aus diesem Menschen hervorquoll, möchte ich zeigen, was viele seiner Leser intuitiv ahnen: dass Wittgensteins philosophische Suche und sein emotionales und geistiges Leben eine Einheit bilden.
I
1889–1919
1.
Das Labor der Selbstzerstörung
»Warum soll man die Wahrheit sagen, wenn es einem vorteilhafter ist zu lügen?«[1]
Um dieses Thema kreisten die ersten überlieferten philosophischen Reflexionen Ludwig Wittgensteins. Im Alter von acht, neun Jahren blieb er im Haus vor einer Tür stehen, um darüber nachzudenken. Da er keine zufriedenstellende Antwort fand, schloss er, dass es unter solchen Umständen keine Schande sei zu lügen. Später beschrieb er den Vorfall als »ein Erlebnis, welches, wenn nicht richtungsgebend, so doch für mein damaliges Wesen charakteristisch war«.
In gewisser Hinsicht kennzeichnet die Episode sein ganzes Leben. Anders als beispielsweise Bertrand Russell(1), der sich von der Philosophie erhoffte, grundlegende Zweifel durch Gewissheit zu ersetzen, wurde Wittgenstein in sie verstrickt, weil ihn solche Fragen zwanghaft quälten. Die Philosophie kam – könnte man sagen – zu ihm, nicht er zur Philosophie. Er empfand philosophische Probleme als lästige Störungen, als Rätsel, die sich aufdrängten, ihn gefangen hielten, lebensuntauglich machten, bis er sie durch eine befriedigende Lösung überwinden konnte.
Doch in einem anderen Sinne ist Wittgensteins jugendliche Antwort auf gerade diese Frage für ihn ganz untypisch. Sein vorschnelles Hinnehmen der Lüge lässt sich nicht mit dem rastlosen Streben nach Wahrhaftigkeit vereinbaren, für das er als Erwachsener bewundert und gefürchtet wurde. Vielleicht entsprach es auch nicht seinem stark ausgeprägten Gefühl, Philosoph zu sein. »Nenn’ mich einen Wahrheitssucher[2]«, schrieb er später seiner Schwester (die ihn in einem Brief einen großen Philosophen genannt hatte), »und ich will’s zufrieden sein.«
Darin äußert sich nicht bloß ein Meinungsumschwung, sondern eine Charakterveränderung – die erste in einem von solchen Wandlungen geprägten Leben, das an Krisensituationen reifte, getragen von der Überzeugung, dass die Krise im eigenen Selbst wurzelte. Sein Leben erscheint als ständiger Kampf mit der eigenen Natur: Wenn er etwas erreichte, so stets in dem Gefühl, sich gegen die eigene Natur durchgesetzt zu haben. In diesem Sinne wäre es das höchste Ziel gewesen, sich selbst völlig zu überwinden – eine Wandlung, die alle Philosophie überflüssig gemacht hätte.
Viel später, als Norman Malcolm(2) ihm einmal schrieb, G. E. Moores(1) »Unkenntnis der menschlichen Natur« sei diesem »hoch anzurechnen«, wandte er ein: »Dass es ihm ›hoch anzurechnen‹ sei,[3] kindlich zu sein – das kann ich allerdings nicht verstehen; es sei denn, dass es auch einem Kind hoch anzurechnen ist. Denn Du sprichst nicht von der Unschuld, um die ein Mensch gerungen hat, sondern von einer Unschuld, die der naturgegebenen Abwesenheit einer Versuchung entspringt.«
Diese Bemerkung verweist auf eine Selbsterkenntnis. Seine Persönlichkeit – die von Freunden und Studenten als zwingend, kompromisslos und dominant dargestellt wird – war etwas, worum Wittgenstein ringen musste. Als Kind neigte er dazu, lieb und nachgiebig zu sein – wollte gefallen, war bereit, sich anzupassen und, wie wir sahen, die Wahrheit hintanzustellen. In den ersten 18 Jahren seines Lebens rang er, kämpften die inneren und äußeren Kräfte vor allem darum, diesen Wandel zu erzwingen.
Ludwig Josef Johann Wittgenstein wurde am 26. April 1889 als das achte und jüngste Kind einer der wohlhabendsten Familien im Wien der Habsburger geboren. Name und Reichtum der Familie veranlassten manche Biographen, eine Verwandtschaft Wittgensteins mit dem deutschen Adelsgeschlecht Sayn-Wittgenstein anzunehmen. Diese besteht jedoch nicht, denn die Familie führte den Namen erst seit drei Generationen. Er stammte von Ludwigs Urgroßvater Moses Meier(1), der als Gutsverwalter bei der Fürstenfamilie gearbeitet hatte: Aufgrund eines napoleonischen Dekrets von 1808, demzufolge sich auch Juden einen Familiennamen zulegen mussten, wählte er den Namen seiner Arbeitgeber.
Einer Familienlegende nach soll Moses Meiers(2) Sohn – Hermann(1) Christian(2) Wittgenstein – der uneheliche Abkomme eines Grafen gewesen sein (ob aus dem Hause Wittgenstein, Waldeck oder Esterhazy, hängt von der Version ab), aber nichts spricht dafür. Die Legende klingt äußerst zweifelhaft, zumal sie aus einer Zeit zu datieren scheint, als die Familie (erfolgreich, wie wir später sehen werden) versuchte, sich dem Zugriff der Nürnberger Gesetze zu entziehen.
Gewiss hätte die Legende Hermann(3) Wittgenstein(4) gefallen, der den zweiten Vornamen »Christian« annahm, um sich von seiner jüdischen Herkunft zu distanzieren. Er brach alle Kontakte zur Jüdischen Gemeinde ab, verließ seinen Geburtsort Korbach und zog nach Leipzig, wo er ein erfolgreicher Wollhändler wurde, der ungarische und polnische Ware nach England und Holland verkaufte. Hermann(5) heiratete die Tochter einer bedeutenden jüdischen Familie Wiens, Fanny(1) Figdor, die jedoch vor der Hochzeit 1838 ebenfalls zum Protestantismus konvertiert war.
Als sie in den fünfziger Jahren nach Wien umzogen, betrachteten sich die Wittgensteins vermutlich nicht mehr als Juden. Hermann(6) Christian(7) tat sich sogar als Antisemit hervor und verbot seinen Kindern streng, Juden zu heiraten. Die Familie war groß – acht Töchter und drei Söhne –, und die meisten Kinder respektierten das Verdikt des Vaters; sie ehelichten Protestanten aus der Wiener Gelehrtenschicht. So bildete sich ein Netzwerk von Richtern, Rechtsanwälten, Professoren und Geistlichen, auf deren Dienste die Wittgensteins bei Bedarf zurückgreifen konnten. Die Familie assimilierte sich so rückhaltlos, dass Hermanns Tochter Milly(1) ihren Bruder Louis(1) einst fragte, ob die Gerüchte über ihre jüdische Herkunft zuträfen. Darauf er: »Pur sang, Milly(2), pur sang.«
Die Lage entsprach der vieler anderer berühmter Familien Wiens: Wie sehr sie auch in die Wiener Mittelschicht integriert war, wie klar sie mit ihrer jüdischen Herkunft gebrochen hatte – sie blieb auf mysteriöse Weise »durch und durch« jüdisch.
Die Wittgensteins gehörten (anders als beispielsweise die Freuds(1)) keiner jüdischen Gemeinde an – sofern man nicht ganz Wien auf hintergründige, aber bedeutsame Weise als solche ansehen konnte; auch spielte das Judentum in der Erziehung keine Rolle. Kulturell empfanden sie ganz deutsch. Fanny(2) Wittgenstein entstammte einer Kaufmannsfamilie, die eng mit dem kulturellen Leben Österreichs verbunden war. Zu den Freunden ihrer Familie gehörte Franz Grillparzer(1), und bei den österreichischen Künstlern war sie als eine Familie begeisterter, anspruchsvoller Sammler bekannt. Einer von Fannys(3) Neffen war der berühmte Violinvirtuose Joseph Joachim(1), dessen Entwicklung sie und Hermann(8) entscheidend förderten. Sie hatten ihn im Alter von zwölf Jahren aufgenommen und zu Felix Mendelssohn(1) in die Lehre geschickt. Als der Komponist fragte, was er dem Jungen noch beibringen solle, antwortete Hermann(9): »Lassen Sie ihn nur die Luft atmen, in der auch Sie leben!«
Durch Joachim(2) wurde die Familie mit Johannes(1) Brahms(1) bekannt, dessen Freundschaft sie höher schätzte als alle anderen. Brahms(2) gab den Töchtern Hermanns(10) und Fannys(4) Klavierunterricht und besuchte später regelmäßig die Musikabende bei den Wittgensteins. Mindestens eines seiner bedeutendsten Werke – das Klarinettenquintett – wurde dort uraufgeführt.
So lebten die Wittgensteins in einer kultivierten, von Respekt und Behaglichkeit geprägten Atmosphäre, in die nur manchmal der üble Geruch des Antisemitismus eindrang, der sie stets an ihre »nicht-arische« Herkunft erinnerte.
Viele Jahre später griff Ludwig Wittgenstein die Bemerkung seines Großvaters gegenüber Mendelssohn(2) auf, als er einen Studenten in Cambridge, Maurice Drury(1), drängte, die Universität zu verlassen: »In Cambridge gibt es für Sie keinen Sauerstoff.«[4] Er meinte, dass es für Drury(2) besser wäre, in die Arbeitswelt einzutreten, wo die Luft gesünder sei. Angesichts seiner eigenen Entscheidung, in Cambridge zu bleiben, nimmt die Metapher eine interessante Wendung: »Mir macht es nichts aus«, sagte er zu Drury(3), »denn ich produziere meinen Sauerstoff selbst.«
Sein Vater, Karl(1) Wittgenstein, hatte eine ähnliche Unabhängigkeit von der Atmosphäre seiner Herkunft und die gleiche Entschlossenheit bewiesen, eine eigene zu schaffen. Unter den Kindern Hermanns(11) und Fannys(5) bildete er die Ausnahme: Er war der einzige, der sein Leben nicht durch die Erwartungen der Eltern bestimmen ließ. Als Kind war er schwierig, lehnte sich schon früh gegen die starren Formen und autoritären Gesten seiner Eltern auf, widersetzte sich ihren Versuchen, ihn im klassischen Sinne ausbilden zu lassen, damit er den Ansprüchen der Wiener Bourgeoisie genüge.
Mit elf Jahren versuchte er, von zu Hause auszureißen. Mit 17 wurde er der Schule verwiesen, weil er in einem Aufsatz die Unsterblichkeit der Seele geleugnet hatte. Hermann(12) gab nicht auf und versuchte, seinen Sohn mit Privatlehrern auf die Prüfungen vorzubereiten. Doch diesmal riss Karl(2) erfolgreich aus. Nachdem er sich mehrere Monate im Zentrum Wiens versteckt hatte, floh er nach New York, wo er völlig mittellos und mit kaum mehr als seiner Geige in der Hand ankam. Dennoch gelang es ihm, sich mehr als zwei Jahre über Wasser zu halten, indem er als Kellner, Salonmusiker, Barkeeper und Lehrer (für Geige, Horn, Mathematik, Deutsch und was ihm sonst noch einfiel) arbeitete. Durch diese abenteuerlichen Jahre fühlte er sich ganz als sein eigener Herr, und als er 1867 nach Wien zurückkehrte, durfte er – sogar noch ermutigt – seinen praktischen und technischen Fähigkeiten nachgehen, konnte also, statt seinem Vater und den Brüdern in die Vermögensverwaltung zu folgen, Ingenieurswissenschaften studieren.
Nach einem Jahr am Technischen Gymnasium in Wien und einer Lehre in verschiedenen Ingenieursfirmen bot ihm Karl(1) Kupelwieser – der Bruder seines Schwagers – an, als technischer Zeichner beim Bau eines Walzwerks in Böhmen mitzuwirken. Das war Karls(3) große Chance. In der Firma stieg er so atemberaubend schnell auf, dass er schon nach fünf Jahren Kupelwieser(2) als leitenden Direktor ablöste. In den folgenden zehn Jahren wurde er der vielleicht geschickteste Industrielle Österreich-Ungarns. Das Vermögen seines Unternehmens – und natürlich auch sein eigenes – vervielfältigte sich rasant, und im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts war er nicht nur einer der reichsten Männer des Reiches, sondern auch der führende Magnat in der Eisen- und Stahlindustrie. Als solcher wurde er für die Kritiker kapitalistischer Exzesse zum Prototyp des aggressiv erobernden Industriellen. Durch ihn erschienen die Wittgensteins als Österreichs Pendant der Krupps(1), Carnegies(1) oder Rothschilds(1).
Als er 1898 einen gewaltigen privaten Wohlstand begründet hatte, der seine Nachkommen bis heute aller Sorgen enthob, zog sich Karl(4) Wittgenstein abrupt aus dem Geschäft zurück, legte seine Ämter in den Aufsichtsräten aller seiner Stahlunternehmen nieder und investierte sein Kapital in ausländische – vor allem amerikanische – Aktien. (Diese Transaktion erwies sich als äußerst weitsichtig, denn dadurch war das Familienvermögen auch während der Inflation gesichert, die Österreich nach dem Ersten Weltkrieg zerrüttete.) Damals hatte er acht außergewöhnlich begabte Kinder.
Die Mutter von Karl(5) Wittgensteins Kindern war Leopoldine(1) Kalmus. Er hatte sie 1873 – zu Beginn seiner sprunghaften Karriere im Unternehmen Kupelwieser – geheiratet. Durch diese Wahl bestätigte Karl(6) erneut seine Ausnahmestellung in der Familie, denn Leopoldine(2) war die einzige Halbjüdin unter den Schwiegertöchtern Hermann(13) Christians. Allerdings entstammte ihr Vater, Jakob Kalmus(1), zwar einer bedeutenden jüdischen Familie, war aber selbst katholisch erzogen worden; ihre Mutter, Marie Stallner(1), war »rein arisch« – Tochter angesehener (katholischer) österreichischer Gutsbesitzer. Zumindest bis zur Anwendung der Nürnberger Gesetze in Österreich hatte Karl(7) also keine Jüdin geheiratet, sondern eine Katholikin, und damit die Assimilation der Familie an die Wiener Oberschicht um einen weiteren Schritt vorangetrieben.
Die acht Kinder Karls(8) und Leopoldines(3) wurden katholisch getauft und wuchsen als anerkannte, stolze Mitglieder des Wiener Großbürgertums auf. Karl(9) Wittgenstein erhielt sogar das Angebot, sich adeln zu lassen, lehnte aber den Namenszusatz »von« ab, weil er nicht als Parvenü gelten wollte.
Gleichwohl konnte die Familie dank seines immensen Reichtums im Stil der Aristokratie leben. Ihr Wiener Haus in der Alleegasse (heute Argentinerstraße) hieß bei Fremden »Palais Wittgenstein«, und es war tatsächlich ein Palast, Anfang des Jahrhunderts für einen Grafen errichtet. Daneben besaß die Familie ein weiteres Haus, in der Neuwaldeggerstraße am Wiener Stadtrand, und ein großes Landgut auf der Hochreith, wo sie den Sommer verbrachte.
Leopoldine(4) (oder »Poldy«, wie sie in der Familie genannt wurde) war selbst nach höchsten Maßstäben außergewöhnlich musikalisch, räumte aber nicht der Musik, sondern dem Wohlbefinden ihres Mannes den ersten Platz in ihrem Leben ein. Dennoch machte sie das Haus in der Alleegasse zu einem Zentrum der Musikkultur. Zu ihren Soireen kamen unter anderen Brahms(3), Mahler(1) und Bruno Walter(1), der die »durchdringende Atmosphäre von Humanität und Kultur« genoss. Der blinde Organist und Komponist Josef Labor(1) verdankte seine Karriere weitgehend den Wittgensteins, die ihn über alle Maßen schätzten. Ludwig Wittgenstein sagte später gerne, es gebe nur sechs große Komponisten: Haydn(1), Mozart(1), Beethoven(1), Schubert(1), Brahms(4) – und Labor(2).
Nachdem er sich aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, machte sich Karl(10) Wittgenstein auch einen Namen als Kunstmäzen. Unterstützt von seiner ältesten Tochter, Hermine(1) – selbst eine begabte Malerin –, legte er sich eine beachtliche Sammlung wertvoller Gemälde und Skulpturen an, darunter Werke von Klimt(1), Moser(1) und Rodin(1). Klimt(2) nannte ihn seinen »Minister der schönen Künste« – ein Dank dafür, dass Wittgenstein sowohl das Sezessionsgebäude (wo die Werke Klimts(3), Schieles(1) und Kokoschkas(1) ausgestellt wurden) als auch Klimts(4) Wandgemälde Philosophie, von der Universität Wien abgelehnt, finanziert hatte. Als Ludwigs Schwester Margarete(1) 1905 heiratete, wurde Klimt(5) beauftragt, ihr Hochzeitsporträt zu malen.
Die Wittgensteins standen also im Zentrum der Wiener Kultur, als diese zwar nicht ihre ruhmreichste, wohl aber ihre hitzigste Phase erlebte. Die kulturgeschichtliche Epoche vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist in den letzten Jahren zu Recht intensiv erforscht worden. Man nannte sie eine Zeit des »erregten Ruhmes«, womit sich auch das Ambiente beschreiben ließe, in dem die Kinder Karls(11) und Poldys(5) aufwuchsen. Unter der »durchdringenden Atmosphäre von Kultur und Humanität« lauerten in der Metropole ebenso wie in der Familie Zweifel, Spannungen und Konflikte.
Heute fasziniert uns das Wien des Fin de siècle besonders, weil seine Spannungen jene Konflikte vorwegnahmen, die Europa ihren Stempel aufprägten. Aus diesen Spannungen gingen viele geistige und kulturelle Bewegungen hervor, die später Geschichte machten. Wien war nach einem oft zitierten Wort Karl(1) Kraus(2) ein »Labor für das Experiment Weltuntergang« – Geburtsstätte sowohl des Zionismus als auch des Nazismus, der Ort, wo Freud(2) seine Psychoanalyse entwickelte, wo Klimt(6), Schiele(2) und Kokoschka(2) den Jugendstil ins Leben riefen, wo Schönberg(1) die atonale Musik konzipierte und Adolf Loos(1) den streng funktionalen, schmucklosen architektonischen Stil einführte, der die Bauweise der Moderne prägte. In allen Bereichen menschlichen Denkens und Handelns ging aus dem Alten etwas Neues, ging das 20. aus dem 19. Jahrhundert hervor.
Dass dies gerade in Wien geschah, ist umso bemerkenswerter, als sich das Reich dieser Hauptstadt in vieler Hinsicht noch gar nicht vom 18. Jahrhundert gelöst hatte. Ein Symbol dieses Anachronismus war der greise Franz Joseph(1), seit 1848 Kaiser von Österreich und seit 1867 König von Ungarn, der die Doppelkrone bis 1916 trug, als die baufällige Konstruktion aus Königreichen und Fürstentümern der Habsburger rapide zusammenbrach, das Gebiet zwischen den neuen Nationalstaaten Österreich, Ungarn, Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Italien aufgeteilt wurde. Die nationalistischen und demokratischen Strömungen des 19. Jahrhunderts hatten den Zusammenbruch lange zuvor heraufbeschworen, und in seinen letzten rund fünfzig Jahren strauchelte das Reich von einer Krise zur nächsten; nur wer blind für die kommende Flutwelle war, glaubte noch an das Überleben der Monarchie. Wer ihr Überleben wünschte, hielt die politische Lage weiter für »hoffnungslos, aber nicht ernst«.
Dass es in einem solchen Staat zu radikalen Neuerungen kam, ist gar nicht so widersinnig: Wo das Alte offenkundig verfällt, muss sich das Neue durchsetzen. Schließlich bot das Reich dem Genius eine Heimat, und vielleicht war gerade das, wie Robert Musil(1) einmal bemerkte, sein Ruin.
Die Intellektuellen des »Jungen Wien« sahen – darin unterschieden sie sich von ihren Vorfahren – den Verfall rings um sie herum überdeutlich und gaben nicht vor, alles könne beim Alten bleiben. Schönberg(2) stützte sein atonales System auf die Überzeugung, dass die traditionelle Kompositionstechnik ausgespielt habe; Adolf Loos(2) verbannte das Ornament, weil die barocken Verzierungen für ihn nur leere, sinnlose Hülsen waren; Freud(3) postulierte unbewusste Kräfte, weil er erkannte, dass die gesellschaftlichen Konventionen und Sitten etwas sehr Reales und Wichtiges unterdrückten und verleugneten.
Die Familie Wittgenstein(1) trug diesen tiefen Generationskonflikt nur partiell aus. Schließlich repräsentierte Karl(12) Wittgenstein nicht die alte Ordnung der Habsburger, sondern eine Macht, die das Leben in Österreich-Ungarn seltsamerweise kaum beeinflusste: die Welt der materialistisch denkenden, politisch liberalen, aggressiv kapitalistischen Unternehmer. In England, Deutschland – vielleicht besonders auch in Amerika – hätte er ganz als ein Kind seiner Zeit gegolten. In Österreich blieb er Außenseiter. Nach seiner Abkehr vom Geschäft veröffentlichte er in der Neuen Freien Presse mehrere Artikel über die Vorteile des freien Unternehmertums für Amerika, sprach damit jedoch ein Thema an, das in der Politik Österreichs nur eine Nebenrolle spielte.
Da Österreich keine starke liberale Tradition hatte, verlief die politische Geschichte des Landes unbeeinflusst von der anderer europäischer Nationen. Bis hin zum Aufstieg Hitlers(1) konzentrierte sich der politische Kampf auf den Katholizismus der Christlich-Sozialen und den Sozialismus der Sozialdemokraten. Einen Nebenschauplatz zu diesem Hauptkonflikt bildete die Opposition gegen beide Parteien – die auf je eigene Weise am übernationalen Wert der Monarchie festhalten wollten. Hinter dieser Opposition standen die »Alldeutschen« Georg von Schoenerers(1), eingeschworen auf den antisemitischen und völkischen Nationalismus, den sich später die Nazis zu eigen machten.
Da sie weder der alten Garde noch den Sozialisten und erst recht nicht den pangermanischen Nationalisten angehörten, hatten die Wittgensteins wenig zur Politik ihres Landes beizutragen. Doch jene Werte, die Karl(13) Wittgensteins Erfolg als Industrieller begründet hatten, wurden in anderer Weise zum Brennpunkt eines Generationskonflikts, in dem sich die tieferen Spannungen der Zeit widerspiegelten. Als erfolgreicher Industrieller begnügte sich Karl(14) damit, Kultur zu erwerben; seine Kinder, besonders die Söhne, wollten hingegen aktiv dazu beitragen.
Zwischen Hermine(2), dem ältesten, und Ludwig, dem jüngsten Kind Karls(15), lagen 15 Jahre, und man könnte seine acht Sprößlinge zwei verschiedenen Generationen zuordnen: Hermine(3), Hans(1), Kurt(1) und Rudolf(1) der älteren, Margarete(2), Helene(1), Paul(1) und Ludwig der jüngeren. Als die beiden jüngsten Söhne heranwuchsen, hatte der Konflikt zwischen Karl(16) und seiner ersten Kindergeneration bewirkt, dass Paul(2) und Ludwig(1) bereits unter einem ganz anderen Regime standen.
Von seinen älteren Söhnen erwartete Karl(17), dass sie sein Geschäft fortführten. Sie sollten nicht zur Schule gehen (wo man ihnen nur die Flausen der Oberschicht in den Kopf setzen würde), sondern bei Privatlehrern lernen, um sich gezielt auf die geistigen Erfordernisse des Erwerbslebens vorzubereiten. Dann sollten sie im wittgensteinschen Imperium arbeiten, um die für den geschäftlichen Erfolg notwendige technische und kaufmännische Sachkenntnis zu erwerben.
Doch nur einer der Söhne kam diesem Ideal nahe. Kurt(2), nach breitem Konsens das unbegabteste der Kinder, beugte sich den Wünschen des Vaters und wurde rechtzeitig Firmendirektor. Sein Selbstmord war, anders als der seiner Brüder, keine offenkundige Reaktion auf den starken väterlichen Druck. Er(3) erschoss sich viel später, gegen Ende des Ersten Weltkrieges, als ihm seine Truppen den Gehorsam verweigert hatten.
Bei Hans(2) und Rudolf(2) wirkte sich Karls(18) Erziehung katastrophal aus. Beide verspürten nicht die geringste Neigung, Industriekapitäne zu werden. Hätte man ihn ermutigt und gefördert, wäre Hans(3) vielleicht ein bekannter Komponist, zumindest aber ein erfolgreicher Solist geworden. Sogar in dieser sehr musikalischen Familie galt er als hochbegabt – als Wunderkind mit den Talenten eines Mozart(2), als Genie. Schon als kleines Kind beherrschte er Geige und Klavier, und mit vier Jahren begann er zu komponieren. Musik war für ihn kein Interesse, sondern eine Leidenschaft; sie musste im Zentrum, nicht am Rande seines Lebens stehen. Als sein Vater(19) unnachgiebig darauf bestand, dass er Karriere in der Industrie machen sollte, flüchtete er – wie sein Vater vor ihm – nach Amerika, wo er als Musiker leben wollte. Niemand weiß genau, was ihm dort widerfuhr. 1903 hörte die Familie, dass er(4) ein Jahr zuvor in der Chesapeake Bay von einem Boot gesprungen war und seitdem nicht mehr gesehen ward. Der Gedanke lag nahe, dass er Selbstmord begangen hatte.
Wäre Hans(5) glücklich geworden, wenn er sich für eine Laufbahn als Musiker hätte entscheiden dürfen? Hätte ihn der Schulbesuch besser auf das Leben außerhalb der dünnen Luft des wittgensteinschen Heims vorbereitet? Man weiß es nicht. Jedenfalls war Karl(20) durch die Nachricht so erschüttert, dass er seine Erziehungsmethoden bei den beiden jüngsten Söhnen – Paul(3) und Ludwig – änderte, sie auf die Schule schickte und ihnen erlaubte, ihren Neigungen zu folgen.
Für Rudolf(3) kam die Einsicht zu spät. Er war bereits über zwanzig, als Hans(6) verschwand, und hatte einen ähnlichen Kurs eingeschlagen.
Auch er(4) hatte sich gegen die Wünsche seines Vaters aufgelehnt und lebte 1903 in Berlin, wo er am Theater Fuß fassen wollte. Über seinen Selbstmord im Mai 1904 berichtete eine Lokalzeitung. Rudolf sei am Abend in eine Kneipe gegangen und habe zwei Bier bestellt.
Später habe er(5) dem Pianisten einen ausgegeben und ihn gebeten, sein Lieblingslied – »I am lost« – zu spielen. Bei diesen Klängen habe er Zyankali geschluckt und sei zusammengebrochen. In einem Abschiedsbrief an die Familie heißt es, er habe sich umgebracht, weil ein Freund gestorben sei. In einem anderen begründete er seine Tat mit der Sorge, sexuell pervers zu sein. Kurz vor seinem Tod hatte er bei einer Organisation, die sich für die Emanzipation der Homosexuellen einsetzte, um Hilfe nachgesucht, aber – so heißt es in deren Jahrbuch: »Wir konnten ihn(6) nicht vom Weg der Selbstzerstörung abbringen.«[5]
Bis zum Selbstmord seiner beiden Brüder zeigte Ludwig nichts von dem endemischen Selbstzerstörungstrieb, der die Wittgensteins seiner Generation prägte. Bis spät in seine Kindheit galt er als das unbegabteste von allen Geschwistern, ließ keine frühreifen musikalischen, künstlerischen oder literarischen Talente erkennen – begann sogar erst mit vier Jahren zu sprechen. Da ihm der Widerspruchsgeist und die Zielstrebigkeit der anderen männlichen Familienmitglieder fehlten, konzentrierte er sich schon in früher Jugend auf praktische Fertigkeiten und technische Interessen, die sein Vater(21) bei den älteren Brüdern erfolglos zu wecken versucht hatte. Eines der frühesten erhaltenen Fotos von Ludwig zeigt ihn als ziemlich ernsten Knaben, der offenbar gerne an seiner Drehbank arbeitete. Wenn er schon kein besonderes Genie verriet, besaß er doch wenigstens Eifer und beachtliches handwerkliches Geschick. Im Alter von zehn Jahren baute er zum Beispiel aus Holz und Draht ein funktionstüchtiges Modell einer Nähmaschine.
Bis zum 14. Lebensjahr genügte es ihm, von Genies umgeben zu sein, statt sich mitreißen zu lassen. Später erzählte er, wie er einmal um drei Uhr nachts von Klavierklängen geweckt wurde.[6] Er sei ins Parterre gegangen, wo Hans(7) eine Eigenkomposition gespielt habe – manisch konzentriert, schwitzend, völlig versunken, ohne Ludwig überhaupt zu bemerken. Der Anblick blieb für Ludwig stets ein Ausdruck dessen, was es bedeutet, von seinem Genius besessen zu sein.
Heute können wir die Musikbegeisterung der Wittgensteins kaum noch nachvollziehen. Gewiss hat ihre Ausprägung kein modernes Pendant, da sie so eng mit der traditionellen Wiener Klassik verbunden war. Ludwigs musikalischer Geschmack – der, soweit wir wissen, genau dem seiner Familie entsprach – stieß später in Cambridge viele als reaktionär ab: Mit Brahms(5) endete für ihn die Musikgeschichte, doch sogar bei diesem, sagte er einmal, »kann ich schon etwas Maschinenartiges heraushören«.[7] Die »wahren Göttersöhne« seien Mozart(3) und Beethoven(2) gewesen.
Die Musikalität der Familie war außergewöhnlich. Paul(4), der Zweitjüngste nach Ludwig, wurde ein sehr erfolgreicher und bekannter Konzertpianist. Im Ersten Weltkrieg verlor er den rechten Arm, übte aber mit bemerkenswerter Entschlossenheit, nur mit der linken Hand zu spielen, und erreichte darin eine solche Meisterschaft, dass er seine Konzertkarriere fortsetzen konnte. Für ihn(5) schrieb Ravel(1) 1931 das berühmte »Konzert für die linke Hand«. Doch während alle Welt ihn bewunderte, fand Pauls(6) Spiel in der eigenen Familie keinen Anklang. Ihm fehle es an Geschmack, es sei zu extravagant. Gefälliger wirkte der subtile, klassisch dezente Vortrag von Ludwigs Schwester Helene(2). Mutter Poldy(6) kritisierte äußerst streng. Als Gretl(1), vermutlich die Unmusikalischste in der Familie, einmal spielerisch zum Duo mit ihr ansetzte, brach Poldy(7) nach wenigen Takten ab mit dem Ausruf: »Du hast aber keinen Rhythmus!«[8]
Wahrscheinlich hielt die Intoleranz gegenüber zweitrangigem Spiel den nervösen Ludwig davon ab, ein Instrument zu erlernen. Erst mit über dreißig Jahren nahm er – im Rahmen seiner Lehrerausbildung – Klarinettenunterricht. Als Kind ließ er sich aufgrund anderer Tugenden bewundern und lieben: seiner untadeligen Höflichkeit, seines Einfühlungsvermögens und seines Gehorsams. Zudem wusste er genau, dass sein Vater(22) ihn fördern und anerkennen würde, solange er sich für die Technik interessierte.
Auch wenn er später oft betonte, eine unglückliche Kindheit erlebt zu haben, erschien er seiner Familie als zufriedener und heiterer Knabe. Gewiss prägte diese Diskrepanz seine oben zitierten frühen Gedanken über Wahrhaftigkeit. Er verstand unter Lüge nicht bloß, etwas zu stehlen und die Tat zu leugnen, sondern das subtilere Manöver, etwas zu sagen, weil es erwartet wird – nicht weil es zutrifft. Seine Bereitschaft, diese Form der Lüge zu praktizieren, unterschied ihn von seinen Geschwistern – zumindest rückblickend. Zum Beispiel erinnerte er sich daran, dass sein Bruder Paul(7) krank im Bett lag und auf die Frage, ob er nicht lieber aufstehen würde, geantwortet hatte, lieber im Bett bleiben zu wollen. »Während ich im gleichen Fall«,[9] so Ludwig, »die Unwahrheit sagte (ich wollte lieber aufstehen), weil ich die schlechte Meinung meiner Umgebung fürchtete.«
Empfindlichkeit und die schlechte Meinung anderer prägen ein weiteres Beispiel, das ihm unvergessen blieb: Als Paul(8) und er in einen Wiener Turnverein eintreten wollten, sagte man ihnen, dass (wie damals in den meisten Vereinen) nur »Arier« aufgenommen würden. Er selbst sei sofort bereit gewesen, ihre jüdische Herkunft zu verleugnen, um aufgenommen zu werden, Paul(9) dagegen nicht.
Grundsätzlich ging es nicht darum, ob man immer die Wahrheit sagen müsse, sondern ob eine übergeordnete Pflicht bestehe, wahrhaftig zu sein – ob man gegen alle anderen Impulse darauf beharren solle, sich treu zu bleiben. Für Paul(10) war dieses Problem leichter lösbar, weil der Vater nach Hans(8)’ Selbstmord einen Sinneswandel durchgemacht hatte. Er besuchte das Gymnasium und widmete sein ganzes späteres Leben der Musik. Ludwig hatte es schwerer, da der auf ihm lastende Druck, es anderen recht zu machen, nicht nur von außen, sondern auch von innen kam. Unter diesem Druck beließ er die anderen in dem Glauben, sich brennend für die Technik zu interessieren und deshalb den vom Vater erwünschten Beruf zu ergreifen. Er selbst meinte jedoch, weder Neigung noch Talent für den Ingenieurberuf zu haben. Unter den gegebenen Umständen setzte die Familie allerdings beides bei ihm voraus.
Folglich schickte man Ludwig nicht wie Paul(11) ins Wiener Gymnasium, sondern auf die eher technisch als akademisch ausgerichtete Linzer Realschule. Zwar befürchtete die Familie auch, Ludwig würde die strenge Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium nicht bestehen, wichtiger war aber die Überlegung, dass eine technische Ausbildung seinen Interessen besser entspreche.
Die Linzer Realschule ging jedoch keineswegs in die Geschichte ein, weil sie große Ingenieure oder Industrielle hervorgebracht hätte, sondern – wenn überhaupt – weil sie einen Nährboden für Adolf Hitlers(2) Weltanschauung bildete. Hitler(3) besuchte die Schule gleichzeitig mit Wittgenstein und – so liest man in Mein Kampf – lernte dort beim Geschichtslehrer Leopold Pötsch(1), dass das Habsburgerreich eine degenerierte Dynastie sei und dass man unterscheiden müsse zwischen dem hoffnungslosen dynastischen Patriotismus der Habsburger und dem (für Hitler(4)) reizvolleren völkischen Nationalismus der Alldeutschen. Hitler(5) saß zwei Klassen unter dem gleichaltrigen Wittgenstein – jedoch nur im Schuljahr 1904/1905, weil er danach wegen ungenügender Leistungen abgehen musste. Nichts spricht dafür, dass sie je miteinander zu tun hatten.
Wittgenstein besuchte die Linzer Realschule von 1903 bis 1906. Nach seinen Zeugnissen zu urteilen, war er kein guter Schüler: Eine Eins bekam er nur zweimal, beide Male in Religion. Sonst hatte er meist Dreien und Vieren, in Englisch und Naturkunde ab und zu eine Zwei, in Chemie dagegen einmal eine Fünf. Insgesamt zeigte er in den naturkundlich-technischen Fächern also schwächere Leistungen als in den sprachlichen.
Wittgensteins schlechte Noten erklären sich zum Teil daraus, dass er sich in der Schule unglücklich fühlte. Zudem war er erstmals vom privilegierten Umfeld seiner Familie getrennt, und es fiel ihm schwer, Freunde unter den Mitschülern zu gewinnen, die überwiegend Arbeiterkinder waren. Schon auf den ersten Blick war er regelrecht schockiert über ihr ungehobeltes Benehmen. »Mist!«[10] – war sein erster Eindruck. Den Mitschülern dagegen (so erzählte später einer von ihnen Ludwigs Schwester Hermine(4)) erschien er wie ein Wesen von einem anderen Stern. Er siezte sie, was die Kluft noch vertiefte. Sie verulkten ihn mit einem Alliterationsvers, der sein Unglück und seine Isolation parodierte: »Wittgenstein wandelt wehmütig widriger Winde wegen wienwärts.«[11] Er fühlte sich, so erschien es ihm später, in seinem Bemühen, Freunde zu gewinnen, von seinen Klassenkameraden »verkauft und verraten«.
Sein einziger enger Freund in Linz war Pepi(1), ein Sohn der Familie Strigl(2), bei der er wohnte. Während seiner drei Jahre an der Schule erlebte er mit Pepi die Liebe und den Schmerz, die Brüche und Versöhnungen, die für eine schwärmerische Freundschaft zweier Knaben(3) typisch sind.
Diese Beziehung und Wittgensteins Schwierigkeiten mit seinen Klassenkameraden scheinen seine fragende, zweifelnde Grundhaltung noch vertieft zu haben. Seine guten Religionsnoten mögen auf die Milde der Priester zurückzuführen sein, verraten aber auch sein wachsendes Interesse an Grundfragen. Seine geistige Entwicklung während der Linzer Zeit verdankte sich weit mehr diesen Zweifeln als dem Unterricht.
Damals hatten nicht die Lehrer, sondern seine Schwester Margarete(2) (Gretl(3)) den stärksten geistigen Einfluss auf ihn. Gretl(4) galt als die Intellektuelle der Familie, verfolgte immer die neuesten Entwicklungen in Kunst und Wissenschaft und war von allen Geschwistern am offensten für neue Ideen, stets bereit, die elterlichen Ansichten zu kritisieren. Schon früh verfocht sie Freuds(4) Ideen und machte bei ihm eine Analyse. Später war sie eng mit ihm befreundet und half ihm nach dem »Anschluss« (in letzter Minute) bei der Flucht vor den Nazis.
Gewiss wurde Ludwig durch Gretl(5) mit den Schriften von Karl(3) Kraus(4) bekannt. Dessen satirische Zeitschrift Die Fackel erschien erstmals 1899 und hatte im intellektuell verschrobenen Wien sofort großen Erfolg. Wer für sich beanspruchte, die politischen und kulturellen Tendenzen der Zeit zu verstehen, musste sie einfach lesen, und sie beeinflusste fast alle Geistesgrößen, von Adolf Loos(3) bis Oskar Kokoschka(3). Gretl(6) verschlang die Fackel von Anfang an begeistert und bewunderte fast alles, wofür Kraus(5) einstand. (Da Kraus(6) eine sehr schillernde Figur war, konnte man ihm kaum in allen seinen Äußerungen folgen.)
Bis zur Gründung der Fackel war Kraus(7) vor allem durch sein antizionistisches Traktat Eine Krone für Zion bekannt, worin er die Ansichten Theodor Herzls(1) als reaktionär und schismatisch verhöhnte. Die Freiheit der Juden, so Kraus(8), sei nur durch rückhaltlose Assimilation erreichbar.
Kraus(9) war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, und seine Zeitschrift galt in den ersten Jahren ihres Erscheinens (bis etwa 1904) als Sprachrohr für sozialistische Ideen. Meist zielten seine Satiren auf Pointen, an denen auch die Sozialisten ihre Freude hatten. Er griff das heuchlerische Verhalten der österreichischen Regierung gegenüber den Balkanvölkern an, den Nationalismus der Alldeutschen Bewegung, die von der Neuen Freien Presse (zum Beispiel in den Artikeln Karl(23) Wittgensteins) propagierte liberale Wirtschaftspolitik und die Korruptheit der Wiener Presse, die sich stets auf die Seite der Regierung und der Großindustrie stellte. Besonders vehement kämpfte er gegen die verlogene Sexualmoral der österreichischen Oberschicht, die Prostituierte strafrechtlich verfolgen ließ und Homosexuelle gesellschaftlich ächtete. »Ein Sittlichkeitsprozess«, schrieb Kraus(10), »ist die zielbewusste Entwicklung einer individuellen zur allgemeinen Unsittlichkeit …«[12]
Ab 1904 verlagerte Kraus(11) seine Angriffe von der politischen auf die moralische Sphäre. Hinter seiner Satire stand das Eintreten für geistige Werte, die der Ideologie der Austromarxisten fremd waren. Heuchelei und Ungerechtigkeit prangerte er nicht primär an, um sich für das Proletariat einzusetzen, sondern weil er an ein aristokratisch geprägtes Ideal der höheren Wahrheit glaubte. Das kritisierten seine Freunde auf der politischen Linken, darunter Robert Scheu(1), der ihm unverblümt erklärte, er müsse sich zwischen dem untergehenden alten Regime und der Linken entscheiden. Wenn er unter zwei Übeln das kleinere wählen solle, erwiderte Kraus(12) stolz, wähle er lieber keines von beiden. Politik sei, sagte er, alles, was jemand tue, um zu verbergen, wer er sei und was er nicht wisse.
Ähnliches dachte der erwachsene Wittgenstein, der zu vielen seiner Freunde sagte: »Bessere Dich selbst – das ist alles, was Du tun kannst, um die Welt zu verbessern.« Für ihn kam die persönliche Integrität immer vor der Politik. Seine Frage, die er sich mit acht Jahren gestellt hatte, beantwortete er jetzt mit etwas wie dem kategorischen Imperativ Kants(1): Man muss wahrhaftig sein, das ist alles. Dabei spielt das »Warum?« keine Rolle, ist unbeantwortbar. Vielmehr sind alle Fragen von diesem Fixpunkt aus zu stellen und zu beantworten – der unnachgiebigen Pflicht, aufrichtig gegen sich selbst zu sein.
Die Entschlossenheit, nicht zu verbergen, »wer man ist«, rückte ins Zentrum der Lebenseinstellung Wittgensteins. Sie war die Triebkraft für alle späteren Bekenntnisse, die er rückblickend über jene Lebensphasen ablegte, in denen er unaufrichtig gewesen war. Sein erster Läuterungsversuch fiel in die Linzer Schulzeit, als er seiner ältesten Schwester Hermine(5) (»Mining(6)«) manches beichtete. Allerdings wissen wir nicht, was, sondern nur, dass sich Wittgenstein später abschätzig darüber äußerte. Er beschrieb seine Bekenntnisse als ein Manöver, »mit denen es mir gelingt, als ein guter Mensch zu erscheinen«.
Dass er als Schüler in Linz seinen religiösen Glauben verlor, wie er später sagte, scheint konsequent aus diesem Geist der völligen Aufrichtigkeit zu folgen. Er verlor also nicht nur seinen Glauben, sondern musste auch bekennen, dass er gar keinen hatte – dass er nicht an die Mysterien des Christentums glaubte. Möglicherweise hatte er das Mining(7) gebeichtet. Gewiss sprach er aber mit Gretl(7) darüber, die ihn bei diesem philosophischen Problem auf die Werke Schopenhauers(1) hinwies.
Schopenhauers(2) transzendentaler Idealismus, dargelegt in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, schuf die Basis für Wittgensteins früheste Philosophie. Das Buch spricht in vieler Hinsicht besonders Jugendliche an, die ihren religiösen Glauben verloren haben und nach Ersatz suchen. Zwar kennt Schopenhauer(3) »das metaphysische Bedürfnis des Menschen«, betont aber, dass ein intelligenter, ehrlicher Mensch nicht buchstäblich an die Wahrheit religiöser Dogmen glauben muss oder kann. Das zu erwarten, führt er aus, wäre so unzumutbar, als solle ein Riese die Schuhe eines Zwergen anziehen.
Schopenhauers(4) Metaphysik stützte sich auf Kant(2). Wie dieser fasste er unsere alltägliche Sinnenwelt als bloße Erscheinung, hielt aber, im Unterschied zu Kant(3) (für den die noumenale Welt an sich unerkennbar war), die Welt des moralischen Willens für die einzig wahre Realität. Diese Theorie bildet ein metaphysisches Pendant zur Haltung eines Karl Kraus(13) – rechtfertigt sie doch philosophisch die Ansicht, was »draußen« in der Welt geschieht, sei weniger wichtig als die existentielle »innere« Frage danach, »wer man ist«. Wittgenstein gab Schopenhauers(5) Idealismus erst auf, als er begann, Logik zu studieren, und Freges(1) Begriffsrealismus übernahm. Später kehrte er jedoch, in einer schwierigen Phase der Arbeit am Tractatus, zu Schopenhauer(6) zurück, da er meinte, einen Punkt erreicht zu haben, wo Idealismus und Realismus verschmelzen.
Ins Extrem getrieben, mündet die Ansicht, dass die »Innenwelt« der »Außenwelt« vorausliegt, in einen Solipsismus, der jede Realität außerhalb des Selbst leugnet. Wittgenstein wollte mit vielen seiner späteren philosophischen Gedanken zum Selbst das Gespenst des Solipsismus endgültig vertreiben. Eines der Bücher, die er als Schüler las und die seine weitere Entwicklung beeinflussten, war Otto Weiningers(2)Geschlecht und Charakter, worin sich diese Haltung auf verwirrende Weise äußert.
Als Wittgenstein nach Linz kam, wurde Weininger(3) in Wien zu einer Kultfigur. Am 4. Oktober 1903 fand man ihn sterbend im Flur jenes Hauses in der Schwarzspanierstraße, wo auch Beethoven(3) gestorben war. Mit erst 23 Jahren hatte er sich mit bewusst zelebrierter Symbolik im Haus des Mannes erschossen, den er für das größte Genie aller Zeiten hielt. Im Frühjahr zuvor war Geschlecht und Charakter erschienen und insgesamt schlecht aufgenommen worden. Ohne die spektakulären Todesumstände des Autors wäre das Buch vermutlich fast wirkungslos geblieben. Am 17. Oktober brachte Die Fackel jedoch einen Leserbrief August Strindbergs(1), in dem es hieß, Geschlecht und Charakter sei ein ehrfurchtgebietendes Buch, das gewiss eines der schwierigsten Probleme gelöst habe. Der Weininger(4)-Kult war geboren.
Weiningers(5) Selbstmord erschien vielen als die logische Konsequenz seiner Denkweise, und dadurch wurde er im Wien der Vorkriegszeit zu einer cause célèbre. Dass er Hand an sich legte, galt nicht als feige Flucht vor dem Leiden, sondern als moralische Handlung, als mutiger Vollzug tragischer Notwendigkeit. Für Oswald Spengler(1) ging es um einen spirituellen Kampf, eines der edelsten Dramen moderner Religiosität. In diesem Sinne fand Weiningers(6) Selbstmord zahllose Nachahmer. Wittgenstein hingegen schämte sich zunehmend, weil ihm der Mut für diesen Ausweg fehlte und er nicht die Konsequenzen aus seinem Gefühl gezogen hatte, in dieser Welt überflüssig zu sein. In diesem Gefühl lebte er neun Jahre lang und überwand es erst, als Bertrand Russell(2) ihn überzeugt hatte, dass er philosophisch genial war. Wie erwähnt, nahm sich sein Bruder Rudolf(7) sechs Monate nach Otto Weininger(7) ähnlich theatralisch das Leben.
Dass sich Wittgenstein von Weininger(8) mehr als von irgendwem sonst beeinflussen ließ, bindet sein Leben und Werk eng an das Milieu seiner Herkunft. Weininger(9) war ein typischer Wiener. Sein Denken und Sterben stehen streng symbolisch für die gesellschaftlichen, geistigen und moralischen Spannungen im Wien des Fin de siècle, in dem Wittgenstein aufwuchs.
Durch Weiningers(10) Buch zieht sich leitmotivisch das Schwelgen Wiens im Verfall der Moderne. Wie Kraus(14) führte Weininger(11) diesen Verfall auf den Triumph von Wissenschaft und Geschäft, auf den Niedergang von Kunst und Musik zurück, beklagte in typisch aristokratischer Manier den Sieg des Mittelmaßes über die Größe. In einer Passage, die an Vorworte Wittgensteins zu seinen philosophischen Schriften der dreißiger Jahre erinnert, verurteilt Weininger(12) die Moderne als:
… die Zeit, für welche die Kunst nur ein Schweißtuch ihrer Stimmungen abgibt, die den künstlerischen Drang aus den Spielen der Tiere abgeleitet hat; die Zeit des leichtgläubigsten Anarchismus, die Zeit ohne Sinn für Staat und Recht, die Zeit der Gattungsethik, die Zeit der seichtesten unter allen denkbaren Geschichtsauffassungen (des historischen Materialismus), die Zeit des Kapitalismus und des Marxismus, die Zeit, der Geschichte, Leben, Wissenschaft, in der alles nur mehr Ökonomie und Technik ist; die Zeit, die das Genie für eine Form des Irrsinns erklärt hat, die aber auch keinen einzigen großen Künstler, keinen einzigen großen Philosophen mehr besitzt, die Zeit der geringsten Originalität und der größten Originalitätshascherei …[13]
Wie Kraus(15) verunglimpfte er alles, was er an der modernen Kultur am meisten hasste, als jüdisch, führte er die gesellschaftlichen und kulturellen Tendenzen der Zeit auf die Polarität von Männlich und Weiblich zurück. Im Gegensatz zu Kraus(16) biss sich Weininger(13) jedoch wie besessen, fast wahnsinnig, an beiden Themen fest.
Geschlecht und Charakter ist von einer minutiösen Theorie geprägt, die Weiningers(14) Frauenhass und Antisemitismus rechtfertigen soll. Im Zentrum des Buches, so das Vorwort, steht »die Ableitung alles Gegensatzes von Mann und Weib aus einem einzigen Prinzipe« (S. V).
Weiningers(15) Buch hat einen »biologisch-psychologischen« und einen »psychologisch-philosophischen« Teil. Im ersten führt er aus, dass jeder Mensch biologisch bisexuell, eine Mischung aus Mann und Weib ist. Nur die Anteile unterschieden sich, wie die Existenz von Homosexuellen beweise; diese seien entweder weibliche Männer oder männliche Weiber. Den »wissenschaftlichen« Teil des Buches beschließt ein Kapitel über »Die emanzipierten Frauen«, in dem Weininger(16) seine Theorie der Bisexualität gegen die Frauenbewegung richtet. Darin behauptet er, »dass Emanzipationsbedürfnis und Emanzipationsfähigkeit einer Frau nur in dem Anteile an M begründet liegen, den sie hat« (S. 80). Deshalb seien solche Frauen in der Regel lesbisch und damit den meisten anderen überlegen. Maskuline Frauen hätten ein Recht auf Freiheit, aber man dürfe es nicht zulassen, dass ihnen die Mehrheit der Frauen nacheifere.
Der zweite, viel umfangreichere Teil des Buches erörtert »Mann und Weib« nicht als biologische Kategorien, sondern als »sexuelle Typen«, die platonischen Ideen entsprechen sollen. Jeder Mensch sei ein Gemisch aus Männlichkeit und Weiblichkeit, so dass Mann und Frau nur als platonische(1) Ideen existierten. Psychologisch gesehen seien wir dennoch Mann oder Frau. Kurioserweise meint Weininger(17), man könne biologisch männlich und psychisch weiblich sein, aber die Umkehrung sei ausgeschlossen; auch emanzipierte, lesbische Frauen blieben also psychisch feminin. Daraus folge, dass seine Thesen über die Frau durchweg für alle Frauen, aber auch für einige Männer gelten.
Das Wesen der Frau sei »von der Geschlechtlichkeit gänzlich ausgefüllt« (S. 112), »nichts als Sexualität« (S. 113), »die Sexualität selbst« (S. 114). Während der Mann Sexualorgane besitze, sei die Frau von ihren Sexualorganen besessen. Die Frau gehe ganz in der Sexualität auf, während sich der Mann für vieles andere interessiere, etwa Krieg, Sport, Soziales, Philosophie und Wissenschaft, Geschäft und Politik, Religion und Kunst. Weininger(18) erklärt das mit einer speziellen Erkenntnistheorie, die sich auf den Begriff »Henide« stützt. Eine Henide sei ein psychisches Rudiment, aus dem sich Vorstellungen entwickelten. Frauen dächten in Heniden, bei ihnen seien Denken und Fühlen eins. Vom Mann, der in klaren, ausgeformten Vorstellungen denke, erwarteten sie die Klärung ihrer Eindrücke, die Deutung ihrer Heniden. Deshalb verliebten sich Frauen nur in Männer, die klüger seien als sie. Der wesentliche Unterschied zwischen Mann und Weib sei also: »M lebt bewusst, W lebt unbewusst« (S. 130).
Aus dieser Analyse zieht Weininger(19) extrem weitreichende ethische Konsequenzen. Unfähig, seine eigenen Heniden zu verstehen, könne das Weib nicht klar urteilen, so dass ihm die Differenz zwischen wahr und falsch nichts bedeute. Die Frau sei von Natur aus zur Unaufrichtigkeit verdammt. Nicht dass sie dadurch auch unmoralisch wäre; nur sei ihr die moralische Sphäre prinzipiell unzugänglich, da sie keinen Maßstab für Richtig und Falsch habe.
Ohne Sinn für einen moralischen oder logischen Imperativ könne sie auch keine Seele und damit keinen freien Willen haben. Ebenso wie ein Ich fehlten ihr also Individualität und Charakter. Moralisch gesehen sei die Frau ein hoffnungsloser Fall.
Von der Erkenntnistheorie und Ethik zur Psychologie übergehend, unterteilt Weininger(20) die Frauen in zwei weitere platonische(2) Typen: Mutter und Prostituierte. Zwar verbinde jede Frau beides in sich, dies aber unterschiedlich gewichtet. Moralisch seien beide Typen gleichwertig, die Mutterliebe ebenso unüberlegt und wahllos wie die Begierde der Prostituierten, sich jedem Beliebigen hinzugeben. Auf gesellschaftliche und ökonomische Ursachen der Prostitution geht Weininger(21) nicht ein. Für ihn sind Frauen Prostituierte, weil »die Eignung und der Hang zum Dirnentum« tief »in der Natur des menschlichen Weibes selbst« lägen (S. 284). Der Hauptunterschied zwischen den beiden Typen bestehe darin, welche Form ihre sexuelle Besessenheit annehme: Während sich die Mutter ganz auf das Ziel der Sexualität fixiere, sei die Prostituierte vom Geschlechtsakt selbst besessen.
Alle Frauen, ob Mütter oder Prostituierte, teilten eine Eigenschaft, die »echt weiblich und ausschließlich weiblich ist«, den Hang zur Kuppelei (S. 346). Das Weib wolle Mann und Frau immer nur vereint sehen. Zwar interessiere sich die Frau primär für ihr eigenes Sexualleben, aber das sei nur »ein Spezialfall ihres tiefsten, ihres einzigen vitalen Interesses, das nach dem Koitus überhaupt geht; des Wunsches, dass möglichst viel, von wem immer, wo immer, wann immer koitiert werde« (S. 349).
Als Anhang zu seiner Psychologie des Weibes bringt Weininger(22) ein Kapitel über das Judentum. Der Jude sei eine platonische(3) Idee, ein psychologischer Typ, eine Möglichkeit (oder Gefahr) für alle Menschen, die »im historischen Judentum bloß die grandioseste Verwirklichung gefunden hat« (S. 406). Der Jude sei »durchtränkt« von Weiblichkeit – der männlichste Jude immer noch weiblicher als der femininste Arier. Wie das Weib habe auch er einen ausgeprägten Paarungstrieb. Seine Individualität sei schwach ausgebildet und entsprechend stark sein Trieb, die Rasse zu erhalten. Der Jude habe weder Sinn für Gut und Böse noch eine Seele. Er sei völlig unphilosophisch und zutiefst irreligiös (die jüdische Religion nur »eine historische Tradition«, S. 434). Judentum und Christentum stünden im »unermeßlichsten Gegensatz«: Dieses sei »höchster Glaube … höchstes Heldentum«, während der Jude »extrem feige« sei (S. 437). »Christus ist der Mensch, der die stärkste Negation, das Judentum, in sich überwindet, und so die stärkste Position, das Christentum, als das dem Judentum Entgegengesetzteste, schafft« (S. 439).
Weininger(23) selbst war sowohl Jude als auch homosexuell (und somit vielleicht ein psychisch femininer Typ). Daher ließ sich die These, sein Selbstmord sei eine Art »Lösung« gewesen, mühelos in die vulgärsten antisemitischen oder frauenfeindlichen Ideologien einbauen. Hitler(6) soll zum Beispiel einmal gesagt haben: »Dietrich Eckhart erzählte mir, er habe in seinem bisherigen Leben nur einen guten Juden kennengelernt: Otto Weininger(24), der sich umbrachte, als ihm klar wurde, dass die Juden vom Untergang der Völker leben.« Da die Furcht vor der Emanzipation der Frauen und besonders der Juden im Wien der Jahrhundertwende weitverbreitet war, fiel Weiningers(25) Buch auf fruchtbaren Boden, und es wurde extrem populär. Später lieferte es den Nazis passendes Material für ihre Propaganda.
Warum bewunderte Wittgenstein das Buch so sehr? Was lernte er daraus? Die großspurigen biologischen Annahmen sind offenkundig unhaltbar, die Erkenntnistheorie ist blühender Blödsinn, die Psychologie primitiv, die Moral widerwärtig – was also konnte es ihm geben?
Um das zu beantworten, müssen wir Weiningers(26) – rein negative – Psychologie des Weibes verlassen und seine Psychologie des Mannes betrachten. Nur hier finden wir mehr als bigotte Selbstverachtung, Anklänge an Themen, die auch den jungen Wittgenstein beschäftigten (ihn dann sein Leben lang begleiteten), erhalten wir wenigstens Hinweise darauf, was Wittgenstein an dem Buch bewunderte.
Im Unterschied zur Frau, so Weininger(27), kann und muss der Mann zwischen männlich und weiblich, bewusst und unbewusst, Wille und Trieb, Liebe und Sexualität wählen. Jeder Mann sei moralisch verpflichtet, sich stets für die erste dieser Alternativen zu entscheiden, und je mehr ihm das gelinge, desto näher komme er dem höchsten männlichen Ziel: Genie zu sein.
Das Bewusstsein des Genies sei am weitesten vom Henidenstadium entfernt, habe »die größte, grellste Klarheit und Helle« (S. 141). Das Genie zeichne sich durch das beste Gedächtnis, das klarste Urteil und daher den feinsten Sinn für Wahr und Unwahr, Richtig und Falsch aus. Logik und Ethik seien im Grunde ein und dasselbe: »Pflicht gegen sich selbst« (S. 207). »Genialität ist höchste Sittlichkeit, und darum Pflicht eines jeden« (S. 236).
Der Mensch werde zwar ohne Seele geboren, habe aber das Potential, eine Seele auszubilden. Um dieses zu verwirklichen, müsse er sein höheres Ich finden und die Grenzen des empirischen Ich überschreiten. Ein Weg zu dieser Selbstfindung sei die Liebe, durch die »viele Menschen zuerst … von ihrer eigenen Existenz Kenntnis erhalten und … von der Überzeugung durchdrungen werden, dass sie eine Seele besitzen« (S. 324).
In aller Liebe liebt der Mann nur sich selbst. Nicht seine Subjektivität, nicht das, was er als ein von aller Schwäche und Gemeinheit, von aller Schwere und Kleinlichkeit behaftetes Wesen wirklich vorstellt; sondern das, was er ganz sein will und ganz sein soll, sein eigenstes, tiefstes, intelligibles Wesen, frei von allen Fetzen der Notwendigkeit, von allen Klumpen der Erdenheit. (S. 322)
Weininger(28) meint natürlich die platonische(4) Liebe: »Es gibt nur ›platonische(5) Liebe‹. Denn was sonst noch Liebe genannt wird, gehört in das Reich der Säue« (S. 318). Liebe und sexuelle Begierde seien nicht nur grundverschieden, sondern schlössen einander aus. Deshalb bleibe von der Idee der Liebe nach der Heirat nur noch Schein. Da die sexuelle Anziehung mit physischer Nähe zunehme, sei die Liebe am stärksten, wenn die geliebte Person in der Ferne weile. Liebe bedürfe der Trennung, einer gewissen Distanz, solle sie dauern:
Ja, was alle Reisen in ferne Länder nicht erreichen konnten, dass wahre Liebe sterbe, wo aller Zeitverlauf dem Vergessen nichts fruchtete, da kann eine zufällige, unbeabsichtigte körperliche Berührung mit der Geliebten den Geschlechtstrieb wachrufen und es vermögen, die Liebe auf der Stelle zu töten. (S. 317)
Die Liebe zu einer Frau könne dem Mann zwar Wege zu seiner höheren Natur aufweisen, sei aber letzten Endes zum Unglück (wenn er die Wertlosigkeit der Frau erkennt) oder zur Unsterblichkeit verdammt (wenn er an der Vollkommenheitslüge festhält). Bleibenden Wert habe nur die Liebe »zum Absoluten oder zu Gott« (S. 327).
Deshalb solle der Mann keine Frau, sondern seine eigene Seele lieben, das Göttliche in ihm, »den Gott, der in seinem Inneren wohnt«. Er müsse also dem Paarungstrieb der Frau widerstehen und sich gegen den weiblichen Druck von der Sexualität befreien. Auf den Einwand, dadurch wäre die Menschheit zum Aussterben verdammt, erwidert Weininger(29), nur das physische Leben würde enden, der Geist jedoch könne sich voll entfalten. »Die Verneinung der Sexualität tötet bloß den körperlichen Menschen und ihn nur, um dem geistigen erst das volle Dasein zu geben« (S. 458). Er fügt an: »… kein Mensch fühlt, wenn er sich aufrichtig befragt, es als seine Pflicht, für die dauernde Existenz der menschlichen Gattung zu sorgen« (S. 458).
Weiningers(30) Theorie eröffnet eine trostlose, düstere Alternative: Genialität anstreben oder sterben. Wer nur als »Weib« oder »Jude« existieren, sich nicht von Sinnlichkeit und irdischen Begierden befreien könne, habe letztlich kein Recht zu leben. Lebenswert sei nur das geistige Leben.
In der strikten Trennung von Liebe und sexueller Begierde, in der kompromisslosen Haltung, wertvoll sei nur das Werk des Genies, in der Überzeugung, Sexualität sei unvereinbar mit der Ehrlichkeit, die Genialität erfordere, stimmen viele Gedanken Weiningers(31) mit Ansichten überein, die auch Wittgenstein immer wieder äußerte. Das Maß der Übereinstimmung lässt sogar vermuten, dass Weiningers(32) Buch ihn von allen, die er in seiner Jugend las, am stärksten und nachhaltigsten beeinflusste.
Besonders wichtig ist vielleicht, wie Weininger(33) das moralische Gesetz Kants(4) umdeutete, da es in seiner Lesart nicht nur zur absoluten Aufrichtigkeit zwang, sondern auch allen Männern den Weg wies, ihren individuellen Genius zu entdecken. Genial zu werden ist hier nicht bloß ein edles Ziel, sondern das Postulat eines kategorischen Imperativs. Wittgensteins zwischen 1903 und 1912 wiederkehrende Selbstmordgedanken und die Tatsache, dass sie erst schwanden, als Russell(3) ihm Genialität bescheinigt hatte, lassen vermuten, dass er diesen Imperativ in seinem ganzen grausigen Ernst für sich akzeptierte.
So viel zu Wittgensteins geistiger Entwicklung als Schüler, die vor allem durch philosophische Reflexion angeregt und (unter Anleitung Gretls(8)) durch die Lektüre philosophischer und kulturkritischer Texte genährt wurde. Doch wie entwickelten sich seine technischen Interessen – jene Fertigkeiten und Kenntnisse, die er benötigte, um in seinem gewählten Beruf zu reüssieren?
Darüber wissen wir erstaunlich wenig. Die naturwissenschaftlichen Werke, die er als Jugendlicher las – Die Prinzipien der Mechanik von Heinrich Hertz(1) und Ludwig Boltzmanns(1)Populäre Schriften –, verraten kaum Interesse am Maschinenbau oder an theoretischer Physik, sondern eher an Wissenschaftstheorie.
Hertz(2) wie Boltzmann(2) begriffen Wesen und Methode der Philosophie (gleich den oben dargestellten Autoren) primär im Sinne Kants(5). In den Prinzipien der Mechanik erörterte Hertz(3) das Problem, wie man den mysteriösen Begriff »Kraft« in Newtons(1) Physik verstehen könne. Statt die Frage »Was ist Kraft?« direkt zu beantworten, wollte er die Newtonsche(2) Physik reformulieren, ohne »Kraft« als Grundbegriff zu verwenden. Zwar lasse sich das Wesen der Kraft selbst dann nicht exakt bestimmen, wenn alle schmerzlichen Widersprüche gelöst seien – aber unser Geist werde so wenigstens nicht mehr geplagt und höre auf, unzulässige Fragen zu stellen.
Wittgenstein kannte die Passage auswendig und beschwor sie oft, wenn er darstellen wollte, was er unter philosophischen Problemen und ihrer richtigen Lösung verstand. Philosophisches Denken begann für ihn mit »schmerzlichen Widersprüchen« (nicht, wie bei Russell(4), mit dem Wunsch nach Gewissheit); sein Ziel war stets, sie zu lösen und Konfusion durch Klarheit zu ersetzen.
Auf Hertz(4) dürfte er bei seiner Lektüre von Boltzmanns(3)Populären Schriften gestoßen sein, einer 1905 veröffentlichten Sammlung von allgemeinverständlichen Vorlesungen. Darin wird die Wissenschaft, in der unsere Realitätsmodelle unsere Welterfahrung bedingen, und nicht (wie die Empiristen behaupten) aus ihr abgeleitet sind, im Sinne Kants(6) aufgefasst. Diese Sicht war Wittgenstein so vertraut, dass er den Standpunkt der Empiristen kaum begreifen konnte.
Boltzmann(4) lehrte als Physikprofessor an der Universität Wien, und es war im Gespräch, dass Wittgenstein bei ihm studieren sollte. Doch 1906, als Wittgenstein Linz verließ, beging Boltzmann(5) Selbstmord – völlig verzweifelt darüber, dass ihn die etablierte Wissenschaft nicht anerkannte.
Unabhängig davon scheint die Familie jedoch beschlossen zu haben, dass sich Ludwig mehr auf die Technik als auf seine philosophischen und wissenschaftstheoretischen Interessen konzentrieren sollte. Er wurde also – gewiss auf Druck seines Vaters – auf die Technische Hochschule (heute Technische Universität) in Berlin-Charlottenburg geschickt, um Maschinenbau zu studieren.
Über Wittgensteins zwei Jahre in Berlin ist wenig bekannt. Laut Studienbuch immatrikulierte er sich am 23. Oktober 1906, besuchte drei Semester lang Vorlesungen und erhielt, nachdem er das Hauptstudium erfolgreich abgeschlossen hatte, am 5. Mai 1908 sein Diplom. Fotos aus der Zeit zeigen einen gutaussehenden, untadelig gekleideten jungen Mann, der durchaus – wie ein Jahr später aus Manchester berichtet – ein »Liebling der Frauen« hätte gewesen sein können.
Er wohnte bei der Familie seines Professors Dr. Jolles(1), die ihn als ihren »kleinen Wittgenstein« umhätschelte. Viel später – der Erste Weltkrieg hatte ihn tiefer verwandelt als die Ereignisse von 1903–1904 – beklemmte Wittgenstein, welche Intimität zwischen ihm und den Jolles(1)’ entstanden war, und er beantwortete die freundlich herzlichen Briefe von Frau Jolles(2) mit steifer Höflichkeit. Doch in Berlin und noch Jahre danach war er ihnen für ihre warme Zuneigung sehr dankbar.
Es war eine Zeit widersprüchlicher Interessen und Pflichten. Aus Pflichtgefühl gegenüber dem Vater studierte er weiter Maschinenbau und interessierte sich für die damals noch sehr junge Wissenschaft des Flugzeugbaus. Doch ihn bedrängten – meist gegen seinen Willen – zunehmend philosophische Fragen, und er begann, angeregt durch die Tagebücher Gottfried Kellers(1), seine philosophischen Gedanken in datierten Notizbucheintragungen festzuhalten.
Auf kurze Sicht setzte der Vater seinen Willen durch: Wittgenstein ging von Berlin nach Manchester, um sein Studium des Flugzeugbaus zu vertiefen. Langfristig war ihm jedoch gewiss schon damals klar, dass es für ihn nur ein Lebensziel gab – einzulösen, was er sich selbst, seinem Genius schuldete.
2.
Manchester
Wittgenstein war 19 Jahre alt, als er im Frühjahr 1908 mit dem Vorsatz nach Manchester ging, Flugzeugbau zu studieren und dafür sein wachsendes Interesse an philosophischen Fragen zu opfern. Offenbar plante er, ein selbstentworfenes Flugzeug zu bauen und damit zu fliegen.
Es war die Pionierzeit des Fliegens, geprägt durch wetteifernde Gruppen von Amateuren, Enthusiasten und Exzentrikern aus Amerika und Europa. Orville(1) und Wilbur(1) Wright(1) hatten die Welt noch nicht verblüfft, weil sie ganze zweieinhalb Stunden in der Luft blieben. Obwohl noch keine spektakulären Erfolge gelungen waren, Presse und Öffentlichkeit nur belustigt bis höhnisch reagierten, erkannten Wissenschaftler und Regierungen die potentielle Bedeutung dieses Forschungszweiges. Hier wartete auf jede erfolgreiche Neuerung üppiger Lohn, und gewiss fand Wittgensteins Projekt die rückhaltlose Unterstützung seines Vaters.
Er begann seine Forschung mit Experimenten zum Entwurf und Bau von Drachen. Deshalb arbeitete er im Kite Flying Upper Atmosphere Stadion, einer Wetterwarte nahe Glossop, wo man mit Instrumenten bestückte Drachen einsetzte. Ihr Gründer war der erst kurz zuvor emeritierte Physikprofessor Arthur Schuster(1), der sich weiterhin lebhaft für die Arbeit interessierte. Geleitet wurde das Zentrum von J. E. Petavel(1), Dozent für Meteorologie in Manchester, der sich auf Luftfahrt spezialisierte und später eine führende Kapazität auf diesem Gebiet wurde.
Während seiner Arbeit in der Wetterwarte wohnte Wittgenstein im Grouse Inn, einer einsamen Herberge an den Derbyshire Moors. Von dort schrieb er am 17. Mai seiner Schwester Hermine(8), berichtete über seine Arbeitsbedingungen, pries die Einsamkeit des Grouse Inn, klagte aber über den ständigen Regen, das einfache Essen und den desolaten Zustand der sanitären Anlagen. Es falle ihm etwas schwer, sich an all das zu gewöhnen, aber er beginne, sich damit anzufreunden.





























