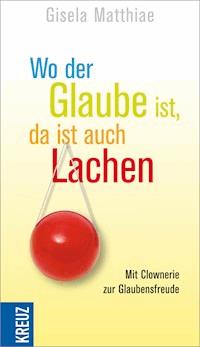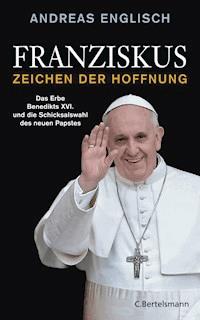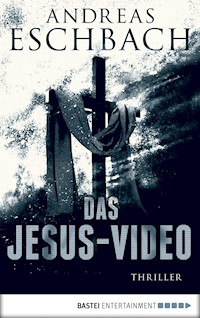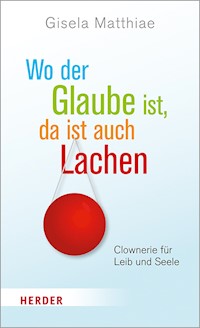
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hat Gott eigentlich Humor? Warum ist ein Sprung eine spirituelle Übung? In diesem Buch eröffnet die Theologin und Clownin Gisela Matthiae einen neuen Blick auf den Glauben. Die Perspektive des Clowns macht vor: Glauben und Lachen sind zwei Seiten einer Medaille. In praktischen Beispielen zeigt sie, wie man sich selbst spielerisch verwandeln kann und das Leben und den Glauben gleich mit. Auch ohne Schminke und Kostüm.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Gisela Matthiae
Wo der Glaube ist, da ist auch Lachen
Clownerie für Leib und Seele
Allen Clowninnen und Clowns aus meinen Kursen,
deren Spiel und Begeisterung mir den Stoff für dieses Buch gegeben haben!
Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe 2019
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, 2019
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bisheriger Titel:
Wo der Glaube ist, da ist auch Lachen. Mit Clownerie zur Glaubensfreude
© KREUZ VERLAG
in der Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2013
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Die Bibeltexte sind entnommen aus:
Dr. Ulrike Bail/Frank Crüsemann/Marlene Crüsemann (Hrsg.), Bibel in gerechter Sprache © 2006, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
E-Book-Konvertierung: de·te·pe, Aalen
ISBN Print: 978-3-451-38535-3
ISBN E-Book: 978-3-451-81842-4
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Verlockung zur Clownerie
Humor und seine Zwillingsschwester, der Glaube
Die Schule der Clowns
Dieses Buch lesen: Mit der roten Nase als Navigationshilfe
1. Hoppla, ich bin’s!
Der Sprung in den leeren Raum
Humor ist, wenn ...
Springen als clowneske und spirituelle Übung
»Verwandlungsreisende« werden
Theologische Pointe: »IchBin«: Gott
Clowneske Reiseapotheke
2. Beziehungsweise: Humor
Wer gibt den Ton an?
»Humor ist, wenn man trotzdem liebt«
Das Lachen und die Macht
Ich bin eine andere! Du auch!
Theologische Pointe: Ironie und Witz in der Bibel
Glaube, Liebe, Humor
Clowneske Reiseapotheke
3. Was ist Komik?
An einem ganz normalen Postschalter
Unpassend oder unangepasst: das Merkmal der Komik
Das clowneske Spiel mit der Komik
Theologische Pointe: Von Gott, einer Eselin und dem Jesuskind
Clowneske Reiseapotheke
4. Leichtsinn
Im Wartezimmer
Der Leichtsinn, der aus Schwermut kommt
Gesundheit!
Theologische Pointe: An Leib und Seele gesund werden.
Unbeschwert ernst
Clowneske Reiseapotheke
5. Worüber fromme Christen lachen
»Laut lachen gab es bei uns nicht«
Zieh keine Grimasse!
Hat Jesus nun gelacht oder nicht?
Kleine Lachgeschichte durch die Jahrhunderte
Theologische Pointe: Sara lachte und Abraham auch
Clowneske Reiseapotheke
6. Leibhaftiger!
Den Glauben verkörpern
Bewegungsfreiheit
Tosende Freude unter den ersten Christen
Theologische Pointe: Der tanzende König
Clowneske Reiseapotheke
7. Wie die Kinder
Die Letzten und die Ersten
Theologische Pointe: Kniefall vor dem Kind
Hochstatus und Tiefstatus
Clownerie, ein Kinderspiel
Clowneske Reiseapotheke
8. Keine gute Figur abgeben
Komische Gänge und Ticks
Seien Sie doch nicht so streng!
Theologische Pointe: Glückselig und ohne Sorge
Vollkommen unvollkommen
Kennen Sie Jona?
Clowneske Reiseapotheke
9. Risiko
Ungeliebte Gleichheit
Biblische und clowneske Provokationen
Das Riskante und Subversive des Humors
Subjekt, wenn auch nicht Herr der Lage
Das Leben ist schön und ganz schön riskant
Was ist schon normal?
Theologische Pointe: Besessen und besetzt
Clowneske Reiseapotheke
10. Trost und Trotz
Rette sich, wer kann
Trotz und Trost des Humors
Theologische Pointe: Trost, nicht Vertröstung
»Ihr seid mir leidige Tröster!«
Abstand halten
Theologische Pointe: Clownin Gott
Einspruch!
Clownerie als Spiel der Möglichkeiten
Clowneske Reiseapotheke
11. Visionär leben
Transzendente Momente
Die Sinne wandeln
Zweite Naivität
Theologische Pointe: Das Paradies am Anfang und die Stadt am Ende
Als ob
Humor und Glaube
Clowneske Reiseapotheke
12. Und immer wieder: Staunen
Nichts als Staunen
Das alltäglich Komische
Sich selbst komisch finden
Das Staunen am Anfang oder am Ende jeder Philosophie?
Braucht es Spektakuläres, um ins Staunen zu geraten?
Theologische Pointe: »... und sie wunderten sich sehr!«
Clowneske Reiseapotheke
Schluss, mit lustig
Heute Ruhetag!
Humor trifft Glauben
Toc
Clowneske Reiseapotheke
Dankeschön!
Literatur
Die Autorin
Einleitung
Die Erinnerung ist ganz klar: Es war an einem meiner ersten Studientage an der Pacific School of Religion in Berkeley, Kalifornien, Spätsommer 1990. Während der allgemeinen Einführung. Obwohl ich schon einige Jahre im Pfarramt war, hatte ich mich noch einmal für ein Studium entschieden. Weit weg von zu Hause. Ich brauchte Abstand zu meiner Kirche. Durch die großen Fensterscheiben des Saals konnte man fast den Pazifik sehen. Holy Hill nennt man den Hügel, auf dem die Hochschule steht, und fast könnte man meinen, man blicke auf das himmlische Jerusalem, wenn man die Hochhaussilhouetten von San Francisco erkennt.
Aber ich hatte keine Augen für diese Aussicht, ich schaute neugierig nach unten, und zwar auf die Zeichnung einer Frau, die neben mir auf dem Boden hockte. Es waren lauter Schuh- und Fußsohlen, die da auf ihrem Blatt entstanden. Große und kleine, spitze und runde, Profile, Zehenunterseiten, dicke und zarte Fersen. Für jeden Fuß ein neues Blatt. Als sie merkte, dass ich ihr interessiert zuschaute, schrieb sie darunter »souls«. So viel Englisch verstand ich und musste aufpassen, dass ich nicht laut hinauslachte. Ausgesprochen klingen sie ja gleich, die Seelen, »souls«, und die Schuhsohlen, »soles«. Mit dem Zuhören war es vorbei.
Ich hing meinen eigenen Gedanken nach. Wo ist überhaupt der Sitz der Seele? Im Hebräischen ist es die Kehle, diese enge Passage, durch die Luft und Nahrung in uns hineingehen und Töne und Klänge heraus. Deshalb singen wir ja auch »Du meine Seele, singe«. Aber die Füße? Diese zarten und doch kräftigen Ausformungen am unteren Ende unseres Körpers, auf denen meist recht viele Kilos balanciert werden? Meine Knick-, Senk- und Spreizfüße mit der unförmigen seitlichen Ausstülpung eines Halux valgus? Diese Füße, die meist unsichtbar in mitunter modisch schicken, aber auch drückenden Schuhen stecken? Die Körperteile, die dem Himmel am fernsten sind, dafür der Erde so nah?
Der Gedanke begann mir zu gefallen, und ich betrachtete meine Füße genauer. Stehen, gehen, rennen, tanzen, schwimmen, bergsteigen, Rad fahren, hochlegen, warm halten, waschen. Sie sind Ausdruck meiner vitalen Kräfte. Sie machen deutlich, dass ich im Unterwegssein lebe. Sie warnen mich vor Erkältungen und sie stinken, wenn ich mich überfordere. War ich etwa auf der Spur einer anderen Theologie von unten? Einer leiblich-irdischen, einer elementaren, einer sinnlichen?
Die Verlockung zur Clownerie
Am Ende der Einführung kamen wir ins Gespräch. Ihren Namen habe ich leider vergessen, aber was sie mir erzählt hat, hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben: sie sei Clownin, unterrichte an Schulen und wolle jetzt noch Theologie dazustudieren. Die Clownerie hätte so viel in ihrem Leben verändert und sie für spirituelle Themen sensibilisiert. Außerdem hätte sie vorher glatte Haare gehabt, jetzt seien sie gelockt.
Das liegt jetzt bald 30 Jahre zurück. Theologin war ich damals schon, aber mein Weg in die Clownerie, der begann genau dort. Meine vielen dicken Haare sind heute übrigens immer noch leicht wellig, aber die grauen werden deutlich lockiger.
Meinen ersten Auftritt als Clownin hatte ich noch in Berkeley, meine Ausbildung absolvierte ich in Deutschland, und die erste weitreichende Verknüpfung von Theologie und Clownerie legte ich 1998 mit meiner Doktorarbeit »Clownin Gott« vor.
Anders von Gott reden, mit dem Unmöglichen rechnen und dabei die Kraft in der Schwachheit spüren, aus den Rollen fallen und neue Geschlechtermuster entwerfen, nicht an meiner Fehlbarkeit zweifeln und trotzig mit Gottes gerechter Welt rechnen – das sind seither Grundlagen meines theologischen und spielerischen Arbeitens. Ich nehme mir die Freiheit, eigenständig theologisch zu denken und zu experimentieren, meinen eigenen Erfahrungen zu trauen, auch den Fragen und Zweifeln. Ich habe Komik in biblischen Texten entdeckt, ich staune über das Unglaubliche ihrer Zumutungen, den Mut und über die Ausreden ihrer mitunter auch komischen Helden. Ich habe gelernt, mich der Geistkraft hinzugeben und so manche Gedankenkonstrukte vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Humor und seine Zwillingsschwester, der Glaube
Das Wichtigste aber ist der Humor. Er ist das Geheimnis einer Clownerie, die ich als schöpferisch, subversiv, befreiend und beflügelnd erlebe. Und gleichzeitig ist Humor für mich zu einem anderen Wort für Glauben geworden.
Von Humor sprechen derzeit viele. Humor in der Medizin, therapeutischer Humor, pädagogischer Humor, Humor in der Bildung, Humor für Führungskräfte, Humor in der Pflege. Humor und sein Effekt, das Lachen, wirken wie ein Stimmungsaufheller, verbessern das Kommunikationsklima und fördern die Lernbereitschaft, lassen auch bei Fehlern nachsichtig bleiben, bauen Ängste ab und verstärken den sozialen Zusammenhalt. Unbestritten, aber diese Effekte sind nicht mit einfachen Maßnahmen zu erzielen.
Denn beim Humor handelt es sich um kein Werkzeug, sondern vor allem um eine Haltung. Humor setzt bei der eigenen Person an, bei ihrer Einstellung anderen gegenüber, ihrer Sicht auf die Dinge, ihrem Umgang mit Meinungen und Positionen. Eine humorvolle Haltung erfordert eine große Wahrnehmungsfähigkeit für Menschen und ihr Leben, für Details und Stimmungen, für Ausgesprochenes und Unausgesprochenes. Es gibt viele Arten, darauf zu reagieren. Die humorvolle Art hat Lust daran, in jeder Situation auch das Auffällige, das Merkwürdige und Widersprüchliche, kurzum: das Komische zu entdecken. Denn sie weiß um unsere Begrenztheiten. Die Tatsache, dass wir eben nicht perfekt sind, hält sie für normal. Deshalb macht sie daraus keine Tragödie, schon eher eine Komödie, aber auf keinen Fall ein Lustspiel auf Kosten anderer. Vielmehr gelingt es ihr, in jeder noch so misslichen Lage eine besondere Wendung, eine andere Perspektive, eine neue Idee zu gewinnen.
Christlich gesprochen, halte ich den Humor für eine gnädige Haltung. Wie der Glaube geht auch der Humor von unserer Fehlbarkeit aus, rechnet sie aber nicht an, sondern entdeckt durch sie und über sie hinaus Möglichkeiten zur Veränderung. Nach der christlichen Lehre von der Rechtfertigung ist es Gott, der die fehlbaren Menschen durchaus kritisch, aber eben auch gnädig, um nicht zu sagen humorvoll anblickt. Dieser Blick befreit zu heiterer Gelassenheit und er lockt zu neuen Sicht- und Handlungsweisen.
Und so gehen beide, Humor und Glaube, von einem Überschuss an Sinn aus, der immer wieder zu erschließen ist. Sprichwörtlich sagt man ja: »Humor ist, wenn man trotzdem lacht.« Im Humor und im Glauben stecken ordentlich viel Trotz. Denn sie jammern nicht über die Verhältnisse oder geraten in eine fatalistische Untergangsstimmung, im Gegenteil: Auch entgegen allen Anscheins und aller Prognosen suchen sie Veränderung. Sie trotzen der Welt und sich selbst noch ganz andere Dimensionen ab, so wie der Glaube darauf beharrt, dass Gottes gerechte Welt schon mitten unter uns ist und doch noch nicht. An diesem Paradox reiben sich Humor und Glauben, sodass es Funken schlägt und manche Vision Wirklichkeit wird.
Die Schule der Clowns
Aber natürlich gelingt das nicht immer. Humor hat man nicht einfach. Und zum Glauben gesellt sich immer schon der Zweifel. Mit Humor wird man nicht einfach geboren und mit Glauben auch nicht. Was man aber haben kann, ist ein Sinn für Humor, und diesen Sinn kann man entwickeln und entfalten. Wer sich im Spiel mit der roten Nase übt, hat ein wunderbares Übungsfeld dafür. Es ist ein Spiel, das alle Sinne schult, in die Bewegung lockt, Emotionen erfasst und überdeutlich zum Ausdruck bringt. Es ist ein Spiel, in jedem Augenblick neu, das von noch so kleinen Impulsen und
der direkten Reaktion darauf lebt. Es ist Neugierde, Entdecken, Staunen, Sich-Wundern, Ausprobieren, Stolpern, Aufstehen und Wieder-neu-ins-Spiel-Kommen. Clownerie ist vielleicht komisches Theater, aber immer ernsthaft bei der Sache und bei den Menschen. So wie sie aber in allem das Besondere und Merkwürdige zu entdecken sucht, ist sie frei von herrschenden Wohl- und Anständigkeiten, schaut hinter die Fassaden und unter die Teppiche und gerät so in manch missliche Lage. Letztlich deckt sie damit Widersprüchlichkeiten auf, holt Verstecktes ans Tageslicht und Ausgeschlossenes wieder mitten hinein. Genau dabei wird es komisch, und das Publikum lacht, aber es lacht über sich selbst, wenn es merkt, dass ihm soeben ein Spiegel vorgehalten wird. Clownerie ist also mehr als Entdecken, sie ist auch Aufdecken und Entlarven und enthält immer eine Aufforderung, genauer hinzusehen und anderen Verhaltensweisen Raum zu schaffen. Niemals ist Clownerie moralisch, eindimensional oder belehrend. Ebenso schließen sich Humor und fundamentalistische Gesinnung aus. Clownerie will demnach nicht nur unterhalten, sie hat auch einen politischen Anspruch. Sie will verschiedene Perspektiven zur Geltung bringen, in den Dialog locken und zielt letztlich auf gerechtere Verhältnisse. Ihr eignet etwas verschmitzt Subversives, das lachend aufgenommen und in eigenes Handeln umgesetzt werden will. Wie ja auch der Glaube Berge versetzen will.
Dieses Buch lesen: Mit der roten Nase als Navigationshilfe
Keine Sorge: Wer sich einmal mit roter Nase ausprobiert hat, braucht nicht ständig damit herumzulaufen. Wie eine Navigationshilfe hilft sie auch so, im Alltag das Komische aufzuspüren und sich damit humorvoll auseinanderzusetzen. Genau dazu möchte dieses Buch anregen: sich in Gedanken beim Lesen selbst eine Nase aufzusetzen und festzustellen, wie sich dabei der Blick auf sich selbst und auf die Welt verändert. Lesend bei der Clownerie in die Schule gehen und viel Komisches selbst in der Bibel entdecken.
Die Reihenfolge der Kapitel orientiert sich an den Grundbausteinen meiner Clownschule, die zugleich als Einübung in die Haltung des Humors gelesen werden wollen. Hier spielen Stichworte wie Präsenz und Authentizität, Beziehung, Status, Emotionen, das clownstypische Stolpern, scheinbare Naivität und pure Spielfreude eine große Rolle. Dazu kommen die Techniken des Improvisationstheaters. Die Einblicke in meine Kursarbeit verdeutlichen, welche Art von Clowntheater ich bevorzuge und welches Verständnis von Humor ich in Abgrenzung zu verwandten Begriffen wie Spott, Ironie, Witz und Spaß etc. habe. Jedes Kapitel beinhaltet in Entsprechung zu den konkreten Körperübungen und Improvisationen philosophische Betrachtungen und biblisch-theologische Reflexionen, die die Verwandtschaft von Glauben und Humor erhellen. Wesentliche Inhalte des christlichen Glaubens, wie Schöpfung, Rechtfertigung, Kreuz und Auferstehung, Heil und Erlösung, Hoffnung und Leben lassen sich von hier aus neu, sinnlich und körperlich spürbar erfassen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse machen ihre Erfahrungen in der Verknüpfung von Clownerie, Theologie und Spiritualität. Die Wirkung auf die eigene ehren- oder hauptamtliche Arbeit in der Kirche ist mitunter verblüffend, schafft Erleichterung und Heiterkeit. Es wäre eine Freude für mich, wenn das Lesen dieses Buches fast genauso viel Spaß machen würde wie der Besuch der Clowneriekurse.
Hoppla, ich bin’s!
Der Sprung in den leeren Raum
Am Anfang meiner Clowneriekurse gehen wir gerne zum Üben auf eine Wiese. Wir legen eine kleine Kiste auf den Rasen, eine Tasche oder einen Blumentopf, was wir eben zur Hand haben. Und dann springen wir darüber. Alle, nacheinander. Hoch und weit, mit ausgebreiteten Armen, fliegenden Haaren und flatternden Hosen. Beim Landen geraten wir in eine Pose, die wir versuchen zu halten. Damit bündeln wir die Energie, der wir sogar noch einen stimmlichen Ausdruck verschaffen: In dem Moment, in dem der Boden berührt wird, rufen wir ein deutliches »Ja!« aus. Und das heißt soviel wie: »Ja, ich bin’s!«, »Hier bin ich!«, »Seht mich an!« oder eben »Hoppla, ich bin’s«.
Nach so einem beherzten Sprung sind sie da, der Clown oder die Clownin. Und schon ist alles verwandelt. Ein Kursteilnehmer konnte einen solchen überraschenden Moment erleben, als er mutig losrannte, absprang, kurze Zeit in der Luft schwebte und schließlich auf beiden Beinen und mit ausgestreckten Armen sicher landete. Aus seinem Gesicht sprachen eine Entschlossenheit und eine Vorfreude auf alles, was da noch kommen mochte. Er gab einen klaren, lauten Ton von sich und schaute uns herausfordernd an. Bislang war er eher schüchtern und zurückhaltend aufgetreten, und nun das. »Ich dachte immer, ich sei ein Reh. Aber jetzt war ich ein Löwe, und das hat sich gut angefühlt«, so sein späterer Kommentar dazu. Freilich ist er im Spiel nicht immer ein Löwe gewesen, ab und zu kam wieder das Reh zum Vorschein, aber sie waren da, die verschiedenen Möglichkeiten, sich zu zeigen und da zu sein.
Clownerie ist Körpertheater und Bewegungstheater, ist Emotionstheater und Improvisationstheater. Jede Bewegung ist klar entzifferbar. Sie drückt eine bestimmte Emotion aus, die sich vom Kopf bis zu den Zehenspitzen ablesen lässt. Ein lautes, angriffslustiges Knurren kann sich in ein Erschrecken verwandeln. Da ist ja das Publikum! Es folgt ein Lächeln wie ein Flirt, und schon landet eine imaginäre Blume, eben schnell gepflückt, bei jemandem auf dem Schoß. So und ähnlich entwickelt sich das Clownspiel. Von einem unplanbaren Moment zum nächsten. Es setzt sich aus lauter kleinen Sprüngen in leere Räume zusammen. In jedem Moment tun sich schier unbegrenzte Möglichkeiten auf. Besonders lustig wird es, wenn sich die Clownin in einer misslichen Lage befindet, und das ist meistens der Fall.
Zwei Spielerinnen stehen auf der Bühne. Diese ist leer, aber sie sehen sich an einem völlig überfüllten Strand, in drückender Hitze und ohne ein freies Plätzchen. Wo sollen sie nur hin? Allein ihr Blick markiert die schmalen Gassen zwischen den Handtüchern und dort das ersehnte Meer. Mit großer Tasche und Liegematte staksen sie los, rempeln hier jemanden an, stolpern da über eine Sandburg und landen schließlich auf Handtuchhälften, die von anderen Badegästen zufällig frei gelassen sind. Hier breiten sie sich nun genüsslich aus, cremen sich ein und nicken mit einem gewinnenden Lächeln dem Besitzer des Strandtuchs auf seiner anderen Hälfte zu. Die Szenerie – wir alle konnten sie sehen – entstand im spontanen Spiel. Nichts war geplant.
Humor ist, wenn ...
… man trotzdem lacht, so lautet die bekannte Kurzdefinition von Humor. Wer lacht in diesem Beispiel? Die Clowninnen, weil sie sich endlich niederlassen konnten? Lachen sie die Handtuchbesitzer gewinnend an? Lachen diese gar, weil sie eine nette Bekanntschaft machen können und es ihnen sowieso langweilig war? Lacht das Publikum, weil ihm eine unerwartete Wendung präsentiert wird? Jede dieser Varianten ist möglich, im besten Fall kommen alle zusammen zu einem humorvollen Vergnügen.
Ob man Humor hat, erweist sich grundsätzlich in misslichen Situationen, in die man selbst geraten ist. Sie bieten Anlass und Gelegenheit, Humor zu beweisen. Denn begegnet man einer solchen Situation auf kreative Weise, überraschend und gewitzt, so vermag sie plötzlich angenehmer zu werden. In vielen Humordefinitionen, wie zum Beispiel auch im Duden, findet man Humor beschrieben als die Gabe eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Aber ist der Humor wirklich eine Gabe, über die nur einige wenige glückliche Menschen verfügen? Und lebt der Humor von einem Gefälle, das hier als Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen beschrieben wird?
Welt und Menschen erscheinen als defizitär vor einem Hintergrund, der, so lässt sich erahnen, nichts Geringeres als Vollkommenheit und Unfehlbarkeit ist. Immer wieder wird Humor in diesen großen Kontrast zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, Wirklichkeit und Ideal und – theologisch gesprochen – Diesseits und Jenseits oder Immanenz und Transzendenz angesiedelt. In dieser vertikalen Anordnung blickt der Humor entweder heiter gelassen von oben nach unten und entdeckt noch im Kleinsten und Widrigsten etwas Besonderes und Liebenswertes. Oder er vermag, von unten nach oben blickend, sich mit den Unzulänglichkeiten in der Hoffnung auf eine Vollendung abzufinden. Solche Gedanken findet man vornehmlich bei Jean Paul (1763–1825). Der Humor als das »umgekehrt Erhabene« würdigt das Kleine und Banale, das Schmerzhafte und Ungereimte und erkennt in ihm durchaus auch Großes. Doch trotz aller Umkehrung bleibt dieses Verständnis von Humor am Vollkommenen ausgerichtet und befördert eine Abwertung aller menschlichen Unzulänglichkeiten. Jean Pauls Ausrichtung am großen Kontrast zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit hat für ein »Totalitäts- und Universalitätspathos und -vokabular« (Sindermann 2009, 69) in den Humordefinitionen nachfolgender Philosophen und Theologen geführt, wie am Beispiel von Peter L. Berger noch ausgeführt werden wird (Kapitel 11). Diese Denkweise findet man dann auch meist unter der Bezeichnung »Großer Humor« (Höffding 1918). Aus der Perspektive des »Großen Humors« ist alles Irdische relativ und muss es auch bleiben, solange uns noch keine Übersicht über das Ganze möglich ist. Es klingt ein bisschen weltverachtend und auch etwas überheblich, so, als könnte man doch jetzt schon etwas aus der Totalen erkennen. Und es ist ein weiter Rahmen, in den der Humor hier eingespannt wird. Das ist gar nicht nötig, um Humor als Haltung zu verstehen und zu praktizieren.
Die »Humorspur«, die ich verfolge, ist eine andere. Und sie trägt auch mein theologisches Denken. Mein Anliegen ist es, die Vertikale in eine Horizontale zu kippen, in der dialektische Denkfiguren möglich sind wie: ein bisschen mehr oder weniger, sowohl und als auch, »schon jetzt« und »noch nicht«. Nicht die Endlichkeit im Lichte einer Vollkommenheit erscheint mir bedenkenswert, vielmehr interessiert mich das Zugleich von glückendem und gutem Leben im Hier und Jetzt bei aller Gefährdung und allem Scheitern.
Humor, wie ich ihn begreife, ist zwischen diesem Mehr oder Weniger angesiedelt, das sich mit dem Philosophen Thorsten Sindermann genauer beschreiben lässt als ein Mehr oder Weniger an Ernst. Zu wenig Ernst versteht er als Unernst, zu viel als Überernst. Mit dem Unernst hat der Humor erstaunlicherweise nichts zu tun. Denn Humor ist keine Haltung, die Konflikte und Misslichkeiten einfach beiseite schieben würde. Sie geht diesen gerade nicht aus dem Weg. Sie geht vielmehr stracks darauf zu, wie unsere beiden Clowninnen am Strand, indem sie, obwohl es aussichtslos erscheint, doch noch ein Plätzchen zum Sonnen suchen. Ihre Haltung kann man so beschreiben: Sie nehmen sich selbst und ihre Situation ernst, aber sie nehmen sie auch nicht zu ernst. Und zwischen ernst und zu ernst tut sich immer ein Spielraum auf, den es zu entdecken gilt. Das vermag der Humor. Er ist eine Haltung und eine Fähigkeit, die auf dem Willen beruht, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. So eine Haltung können wir bewusst einnehmen. Wir können uns für sie entscheiden, wir müssen nicht darauf warten, dass sie uns geschenkt wird. Das bedeutet nicht, dass es einen Zwang zum Humor gibt. Man braucht ihn nicht immer und hat ihn auch nicht immer, aber verändernd und befreiend wirkt er, wenn man ihn genau in der verzwickten Lage anzuwenden versteht, in der man selbst steckt. Beim Humor geht es jeweils um einen selbst, um den je eigenen Sinn für Varianten und andere Perspektiven. Und diesen Sinn kann man trainieren – etwa als Clownin in einer Spielszene am Strand. Man braucht nur zu springen.
Springen als clowneske und spirituelle Übung
Abheben.Wer springt, nimmt Anlauf, verlässt bekanntes Terrain, verliert den Boden unter den Füßen, schwebt für einen Augenblick in den Lüften, und bei der Ankunft – Hoppla! – zeigt er sich auf eine neue, besondere Art und Weise. Verwandlung ist wahrscheinlich. Diese Übung ist eine der herausforderndsten auf dem Weg der Clownerie, und das liegt nicht am Springen selbst. Die viel höhere Hürde, die es zu nehmen gilt, ist der Wunsch, schon vor dem Absprung die Landung vorwegzunehmen. Man hat eine Idee, hält sie für genial und will sie unbedingt umsetzen. Doch leider geht genau das schief. Das, was im Moment der Landung aufscheint, ist nämlich selten kompatibel mit dem geplanten Vorhaben. Im Gegenteil: Setzt dieses sich durch, wirkt die Pose nach der Landung gewollt und aufgesetzt. Und Publikum und Spieler bedauern die vertane Chance … Jedes Clownspiel beginnt mit so einem Abheben, also mit dem Loslassen von Ideen, Konzepten oder Vorstellungen. Nur so öffnet sich ein Spielraum. Jedes Spiel, damit es ein solches ist, lebt von Zweckfreiheit und Ergebnisoffenheit (Harald Schroeter-Wittke 2008, 116). Jedes »Um zu«, jedes Ziel, das verfolgt werden könnte, würde den Sprung überflüssig machen. Daher ist es wichtig, sich selbst leer zu machen und sich ganz auf die Bewegung zu konzentrieren. »Leer«, das bedeutet dann soviel wie planlos, offen, neugierig. In der Sprache der Mystik ausgedrückt, hebt man ab, um in die »Wolke des Vergessens« zu gelangen. Dieses Bild übernimmt Dorothee Sölle von einem unbekannten englischen Priester aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht einem Kartäusermönch (Dorothee Sölle 1997, 83ff.). Hier darf alles wie Ballast von einem abfallen, sodass man umso leichter fliegen wird – oder zumindest steigen. Bereits der Mystiker Dionysius Areopagita (um 500 n.Chr.) spielte dabei auf Mose an, der auf den Sinai stieg »mitten in die Wolke hinein«, aus der ihn Gottes Ruf ereilt hatte (2.Mose 24,18). Auch Mose musste sich aufmachen und konnte nicht wissen, was ihn erwarten würde. Dieses Vergessen ist immer auch ein Selbstvergessen. Wie wird Mose aus der Wolke herauskommen? Das Wagnis des Abhebens ist immer auch ein Wagnis mit sich selbst. In der Sprache der Spiritualität geht es darum, »sich selbst auch überlassen zu können« (Steinmeier 2003, 93). Mit »sich selbst« ist mehr gemeint als die eigenen Gedanken. Es umfasst die ganze Art, sich selbst zu zeigen und zu verstehen. Bisher Eingespieltes wie weibliche oder männliche Rollenbilder, Gesten und Mimik, kurzum: die eigene Identität wird mit dem Abheben aufs Spiel gesetzt.
Nun ist Identität sowieso keine feste Größe. Sie bildet sich mit unseren Lebensweisen, Tätigkeiten und Beziehungen. Was folglich auf dem Spiel steht, ist die derzeitige Ausprägung der eigenen Identität. In soziologischer Sprechweise ist unsere jeweilige Identität das Ergebnis von Konstruktionsprozessen. Wir stellen unsere Identität im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenheiten und Erfordernisse her. Solche Prozesse können aber verändert werden, die Ergebnisse können de-konstruiert werden. Der clowneske Spielraum ist daher auch ein Freiraum, sich selbst auch neu auszuprobieren, sich noch einmal neu und anders kennenzulernen. Theologisch gesprochen, geht es dabei um Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Clownesk gesprochen: »Ich bin auch noch ganz anders, ich weiß es nur noch nicht, aber ich bin gespannt!«
»Wenn es denn so einfach wäre«, möchte man einwenden. Wir sind eingebunden, geprägt, identifiziert, was gar nicht nach Spielraum oder Freiraum klingt. Aber das Clownspiel – und vermutlich jedes Spiel – setzt darauf, dass diese Festlegungen gelockert oder gar aufgebrochen werden können.
Schweben.Chaos – das heißt im Hebräischen Tohuwabohu und im Griechischen gähnender Abgrund, weiter, leerer Raum. Ist das unheimlich? Nun, wenn man den Boden unter den Füßen verloren hat, kann es einem schon mulmig werden. Aber es kann auch ein genussvoller Höhenflug sein zwischen dem Bisherigen und etwas Neuem. Es kann die prickelnde Erfahrung eines »Dazwischen« sein, in der plötzlich alles möglich erscheint. In der Sprache der Rituale nennt man diesen Bereich einen liminalen, einen Schwellen- oder Übergangsraum (z.B. Turner 1989). Es ist ein unerschöpfliches Territorium des noch Ungestalteten, noch Ungeschaffenen.
»Damit ein Erlebnis von einer bestimmten Qualität stattfinden kann, muss ein leerer Raum geschaffen werden. Ein leerer Raum erlaubt das Entstehen von etwas Neuem, denn alles, was mit Inhalt, Bedeutung, Ausdruck, Sprache und Musik zusammenhängt, erwacht erst zum Leben, wenn es als unverbrauchte und neue Erfahrung geschieht«, sagt der Theaterregisseur Peter Brook (Brook 1998, 12). Er weiß darum, dass dieser leere Raum mit einer ebenso notwendigen Selbstvergessenheit korrespondiert. Nur die »panikfreie Leere« (ebd. 36) in einem selbst mache das Spiel lebendig. Die unausgefüllte Leere aber mache in der Regel Angst. Das ist der horror vacui. Daher versucht man sofort, diese Leere zu füllen, etwa indem man etwas tut oder sagt. Besonders uns nervösen und überreizten Menschen fällt es schwer, die Leere auszuhalten, nur da zu sein. »Es bedarf echten Selbstvertrauens, um still zu sitzen oder zu schweigen« (ebd. 35). Selbst wenn man nur auf einem Meditationskissen sitzt, kann einem diese Leere bedrohlich vorkommen.
Das Clowntheater lebt, mehr als jede andere Theaterform, vom Aushalten dieser Leere. Der Clown weiß erst einmal gar nichts, hat keine Ahnung und kann auch nichts. »Der Clown beherrscht nichts, das aber richtig«, so bringt es der Clown Johannes Galli treffend auf den Punkt. Der Clown selbst ist die Verkörperung der Leere. Eine schiere Unendlichkeit lang kann der Clown da stehen und verblüfft in die Welt schauen. Man kennt das von dem Komikerpaar Stan & Laurel, Dick & Doof genannt. Die Momente des bloßen erstaunten Schauens stellen bei ihnen ein wesentliches Stilmittel dar.
Eine schöne Improvisationsübung heißt: »Sich privat wähnen«. Eine Gruppe von Clowninnen kommt von irgendeiner Veranstaltung, tritt aus dem Off auf die Bühne, wo sie sich privat wähnt. Das eben Erlebte findet dort seine Fortsetzung. Kommen sie erschöpft von der Arbeit nach Hause, schmeißen sie alles von sich und lümmeln sich bequem aufs Sofa; waren sie im Bauchtanzkurs, wird das Gelernte gleich weitergeübt. Bis eine nach der anderen das Publikum entdeckt und vor Schreck erstarrt, während die anderen ihr Spiel munter weitertreiben. Es ist wunderbar, wenn dieser Moment so lange wie möglich und ohne jegliches Stirnrunzeln und Lippenblasen ausgehalten wird. Das Spiel wird in der Schwebe gehalten, niemand auf der Bühne und auch nicht das Publikum weiß, wie es weitergehen wird. Im Falle der Bauchtanzgruppe haben sich die Clowninnen gegenseitig die T-Shirts wieder über die Bäuche und sogar bis in die Kniekehlen gezogen und trafen sich schließlich, Schrittchen für Schrittchen, zu einer kleinen Tanzaufführung, bevor sie dann fluchtartig die Bühne verließen.
Landen.Der eine landet als Löwe, die anderen als kleine Tanzformation. Etwas Neues ist entstanden und zeigt sich. Eine kleine Verwandlung hat stattgefunden. Aus dem Chaos, dem Ungestalteten und Offenen hat sich eine neue, wiederum vorläufige Gestalt ergeben. Nun spielt also der Löwe oder spielt die Tanzformation. »Hoppla, das bin ich auch noch!« ist zu einer sicht- und spürbaren neuen Realität geworden. Der Löwe ist los!
In der Schauspielästhetik des Moskauer Dramatikers Konstantin Stanislawski, die bis heute eine führende Rolle spielt, verbindet das »Ich bin« den Schauspieler mit seiner Figur (Friedrich 2001,97). Der Schauspieler ist nun selbst diese Figur. Er spielt sie nicht nur, er verkörpert sie – so wie der junge Mann in meinem Kurs nach seinem Sprung plötzlich ein Löwe war. Seine eigene Persönlichkeit und die des Tieres kommen zusammen in der einen Figur, die plötzlich auf der Bühne präsent ist. Das meint der Begriff der Präsenz, der mehr ist als bloße Anwesenheit. Es ist eben diese Verkörperung, in der die eigene Person mit der Figur eine Einheit bildet und doch beide unterschieden bleiben.
Was sich hier ereignet, ist weniger eine Nachahmung, eine Mimesis, als vielmehr eine schöpferische Verwandlung, eine Metamorphose (ebd.). In diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff der »Geburt« (Brook 1998, 39). Tatsächlich inkarniert sich hier ein Wesen, das es so noch nicht gegeben hat, das aber immer schon möglich war. Figuren werden in diesem Sinne nicht aufgebaut, sie werden in diesem schöpferischen Akt gefunden.
Wer ist hier nun eigentlich das Subjekt, kann man fragen. »Wer spielt denn da, wenn ich in das Spiel gerate?«, fragt Gerhard M. Martin als Theologe und Bibliodramatiker (Martin 2002, 189). Freilich spielt der Spieler selbst. Zugleich wird er auch das Gefühl haben, dass »es« spielt. Denn den Löwen hatte er sich vorher nicht ausgedacht, der hat sich selbst ins Spiel gebracht. Doch hat ihn zugleich niemand anderes ins Spiel gebracht als der Spieler selbst. Zumindest verkörpert er ihn. Das »Ich« ist und bleibt der Aufführungsort (ebd.). Es ist das Eigentümliche an kreativen und spirituellen Prozessen, dass sie in der Spannung zwischen eigener Aktivität und Passivität erlebt werden.
Die Theologie reagiert auf dieses Phänomen mit der Lehre vom Heiligen Geist als einer bewegenden, ebenso unsichtbaren wie unverfügbaren Kraft. Es ist schon sprichwörtlich, dass der Geist weht, wo er will (Johannes 3,8). Doch ob man die Verwandlung nun auf eine göttliche Kraft zurückführt oder auf Erfahrungen in künstlerischen Prozessen, sie setzt immer den Übergang von einer bisherigen Selbstgewissheit über die Selbstvergessenheit hin zu einer neuen Erfahrung mit sich selbst voraus. Ereignet sich dann so etwas wie eine neue Gestaltwerdung, wird das als überraschend und stimmig erlebt und ist sehr beglückend.
Als Theologin finde ich für diese Erfahrungen Resonanzen in der Bibel. Wenn in der Bibel von der neuen Kreatur die Rede ist, dann ist auch da eine Verwandlung gemeint, die einem schöpferischen Akt gleicht. »Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.« (2. Korinther 5,17) Der Vers interpretiert die Auferstehung Jesu von den Toten wie eine Neuschöpfung, an der nun alle Menschen teilhaben können. Das neue Leben oder die neue Kreatur ist gekennzeichnet durch die Liebe Jesu (2. Korinther 5,14). Während das alte Leben von Tod, Leiden, Unterdrückung und Krankheit geprägt war, kennzeichnet das neue Leben Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit. Das Neue Testament spricht davon, dass dieses neue Leben jetzt schon Wirklichkeit ist, und nennt sie »Reich Gottes« oder »Gottes gerechte Welt«. Es handelt sich – trotz allen Anscheins – also nicht um eine virtuelle Welt, sondern eine mögliche, die immer wieder realisiert wird, wo Menschen tatsächlich liebevoll und gerecht miteinander umgehen. Das Christentum hat durchaus auch andere Seiten gezeigt und benötigt immer wieder eine Erinnerung an diese befreiende und zugleich anspruchsvolle Botschaft.
»Verwandlungsreisende« werden
Der Begriff stammt von André Heller und wird von Gerhard M. Martin in seinen ritualtheoretischen und theologischen Überlegungen zum Spiel aufgegriffen. Ich tue es ihm gerne nach und wende es auf das Bild vom Sprung an. Wer zu springen wagt – konkret oder im übertragenen Sinne –, ist verwandlungsreisend. Der Sprung katapultiert von einer bestimmten Wirklichkeit in die Leere, die offen für neue Möglichkeiten ist; von einer bestimmten Ordnung ins Chaos und in eine neue vorläufige Ordnung; vom Wissen ins Nichtwissen und zu neuen Gewissheiten: Clownerie eröffnet einen Spielraum, der auch ein Freiraum und ein Möglichkeitsraum ist. Von hier lässt sich eine Brücke zur Haltung des Humors und des Glaubens schlagen. Auch sie entfalten diesen Möglichkeitssinn. Rechnet der Humor in misslichen Situationen mit kreativen Wendungen, so vertraut der Glaube auf schöpferische Verwandlungen und auf Gottes unausgeschöpfte Möglichkeiten. In der Clownerie und konkret in jedem spielerischen Höhenflug kann ganz körperlich Verwandlung erfahren werden. Sie sind Einübungen ins Reich Gottes.
So kann Clownerie dem Glauben auf die Sprünge helfen und anregen, mehr auf die verwandelnde Begegnung mit göttlicher Geistkraft zu vertrauen. Alle drei – Clownerie, Humor und Glauben – jedenfalls leben von der Unabgeschlossenheit der Bewegung. Und Gott selbst? Auch Gott scheint Sprünge zu machen und neigt zu immer neuen und überraschenden Auftritten. Das zeigt sich schon in seiner beziehungsweise ihrer Selbstvorstellung – die Grammatik kennt nur männlich, weiblich und sächlich, eine für Gott unangebrachte Begrenzung.
Theologische Pointe: »IchBin«: Gott
Gottes Name ist Programm. In der Langfassung lautet er: »Ich bin [für euch] da, als der/die ich [für euch] da bin« (2. Mose 3,14). Nimmt man die Konsonanten des hebräischen Wortes dafür, entsteht das so genannte Tetragramm, das Vierbuchstabenwort JHWH. Es ist der Name Gottes, den jüdische Menschen niemals aussprechen, sondern immer nur umschreiben.