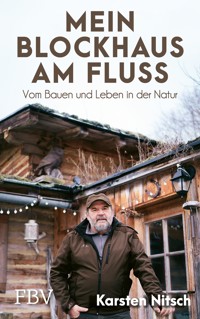5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Lausitz ist eines der größten und artenreichsten Naturgebiete Europas und tief mit der Geschichte der Sorben verwurzelt. Dichter Wald und Heidegebiete wechseln sich ab mit Lichtungen, offener Feld- und Wiesenlandschaft, gefolgt von Dörfern, ehemaligen Braunkohlerevieren, Mooren und Seelandschaften, wo viele Vögel und Insekten leben. Des Nachts hört man Wölfe heulen und kann den Nachtschwalben bei der Jagd zusehen. Von klein auf verbrachte der heutige Naturführer und Fotograf Karsten Nitsch seine Zeit in diesen geheimnisvollen Wäldern und beobachtete Tiere. In seinem Debüt erzählt Nitsch anhand von Begegnungen mit Tieren wie der Nebelkrähe Max, majestätischen Seeadlern oder heulenden Wölfen von der Einzigartigkeit der Lausitz. In all den Jahren hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sein Umfeld für die Wunder der Natur und die Historie der Region zu sensibilisieren, und betont immer wieder, dass wir Menschen Teil dieses natürlichen Kosmos sind. Die Lebensnähe seiner Schilderungen verdeutlicht die Einzigartigkeit und Kostbarkeit der Lausitz und lässt uns in eine faszinierende Welt eintauchen. Spannend, mitreißend und beinahe magisch mit fantastischen Tier- und Naturaufnahmen im Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
»Wo die wilden Tiere wohnen« entführt uns in das sagenumwobene Naturgebiet der Lausitz. Dort lebt Naturführer und Fotograf Karsten Nitsch, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Besucherinnen und Besuchern die Besonderheiten der einzigartigen Flora und Fauna nahezubringen. In seinem Buch erzählt er von seinen Begegnungen mit den Tieren der Lausitz, den Nebelkrähen, Schwarzspechten, Seeadlern und natürlich auch vom Wolf, von der einmaligen Landschaft und seiner täglichen Arbeit. Nitsch möchte sein Umfeld für die Wunder der Natur sensibilisieren und vermitteln, dass alles – Pflanzen, Tier und Mensch – miteinander verbunden ist. Ergänzt wird das Buch mit außergewöhnlichen Natur- und Tieraufnahmen. Wilder und schöner als mit Karsten Nitsch in der Lausitz wird’s nicht!
Der Autor
Karsten Nitsch wurde 1962 in der Lausitz geboren, wo er heute mit seiner Familie in einer selbst gebauten Blockhütte lebt. Er arbeitete unter anderem als Binnenfischer, Waldarbeiter und in der Umweltbildung, bevor er sich entschied, Naturführer zu werden. Nitsch wirkte bei verschiedenen Dokumentationen auf MDR, NDRund ARTE über die Lausitz sowie bei einer Schweizer Filmproduktion über die Rückkehr der Wölfe mit. Seine Naturfotografien erschienen in namhaften Magazinen wie der GEO. Online findet man ihn unter: spreefotograf.de
Karsten Nitsch
Wo die wilden Tiere wohnen
Mein Leben als Naturführer in der Lausitz
Dieses Werk ist ein Sachbuch. Es schildert Geschichten und beruht auf Erfahrungen, Erlebnissen und Aufzeichnungen. Ich gebe hier meine persönliche Sicht wieder, die keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit hat. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Originalausgabe März 2021Copyright © 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenCopyright © 2021 by Karsten NitschUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Fotos von © Karsten NitschBilder im Innenteil: © Karsten Nitsch und © Sascha Höcker (Bild 2)Redaktion: Johanna Ott & Marion PreußMP • Herstellung: kwSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN: 978-3-641-27243-2V002www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Inhalt
Prolog – Der Schwarzspecht ruft
Aller Anfang ist schwer
Aufbruch ins Paradies
Draußen am Fluss
Mein erster Seeadler
Bezahlter Urlaub – Führungen durch die Natur
Übung 1: Frühlingserwachen
Im Frühling mit Blaumännern, Moorochsen und Beutelmeisen
Von nächtlichen Jägern und Laternenträgern
Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
Übung 2: Sommerausflug
Die Schädlinge sind wir
Ein Nagetier beim Frühstück – wie wir Natur wahrnehmen und ihr begegnen
Auf in die Wildnis
Schwester Frieda – eine Gänsegeschichte
Übung 3: Herbststimmung
Keine Angst vor Krabbeltieren
Max, die Nebelkrähe
Von Neubürgern und alten Bekannten
Vom Glück, dem Wassermann zu begegnen
Übung 4: Winterzeit ist Ruhezeit
Epilog – ein ewiger Kreislauf
Kleiner Nachsatz über meine Naturfotografie
Kleine Liste mit Buchempfehlungen
Danksagung
Bildteil
Prolog – Der Schwarzspecht ruft
Nun sitze ich hier vor meiner Tastatur. Aufgewacht bin ich mit dem Gedanken, endlich mein Buch aufzuschreiben, und fest entschlossen wurde der Rechner hochgefahren. Lange hatte ich Zweifel, was das Schreiben angeht, persönlich habe ich mich immer als schreibfaul eingestuft.
»Wie soll ich beginnen?«, überlege ich, während ich aus dem Fenster in den Garten schaue. Im selben Moment höre ich aus den Erlen an der Spree den Grünspecht rufen. Sein laut schallendes »Hie! Hie! Hie!« klingt in meinen Ohren wie Gelächter. Will er mich verhöhnen? Angestrengt lausche ich durch die hellhörigen Wände des Blockhauses, in dem ich lebe. Ist da nicht auch der Schwarzspecht zu hören? Tatsächlich, jetzt vernehme ich deutlich seinen Flugruf, der immer lauter wird. Scheinbar steuert er genau auf die alte Höhle zu, die er im letzten Jahr gezimmert hat.
Das wird hier nichts, ich sollte nicht drinnen sitzen. Tinka, meine schwarze Hündin, ist sofort begeistert, als ich in meine Hose steige und im Hinausgehen mit geübtem Griff das Fernglas vom Regal angle. Vor der Tür atme ich tief ein: Vorfrühlingsluft, der Winter scheint auch in diesem Jahr auszubleiben. Vom anderen Spreeufer begrüßt mich aus den Kiefernkronen eine der Nebelkrähen. Sie brüten dort jedes Jahr. Es sind kluge Vögel, die ein unauffälliges Leben führen. Zu Unrecht dichten wir ihnen manche Schandtat an, und auch heute noch wird ihnen nachgestellt.
Es ist nicht so, dass wir zu wenig über die Natur wissen, eher ist das Gegenteil der Fall. Wir dringen in die entlegensten Winkel vor, tauchen in die tiefsten Tiefen hinab und steigen in die höchsten Höhen hinauf, um alles zu ergründen. Das geschieht aber meist aus reinem Egoismus, wir wollen Wissen anreichern, koste es, was es wolle. Rücksichtslos bedienen wir uns und haben Maß und Gespür verloren, uns abgenabelt in dem Glauben, uns unabhängig und frei machen zu können von der Natur. Ein aussichtsloses Unterfangen, wie wir täglich bemerken.
Seit meiner Kindheit verspürte ich den Drang, draußen unterwegs zu sein, und nicht immer war ich nur der harmlose Beobachter. Einmal, ich war etwa acht Jahre alt, fand ich ein Singvogelnest und habe im Abstand von einigen Tagen jeweils ein Ei geöffnet, um zu schauen, wie weit sich der jeweilige Jungvogel entwickelt hatte. Ich habe mir damals keine Gedanken über die Konsequenzen gemacht – das Gelege war natürlich verloren. Mein Eingriff verursachte bei mir damals auch kein schlechtes Gewissen. Jetzt, ein halbes Jahrhundert später, muss ich oft daran denken und frage mich immer wieder, was mich dazu bewog. Die kindliche Neugier ließ mich Dinge tun, deren Folgen ich nicht bedachte oder überblickte. Inzwischen scheinen die Rollen vertauscht, unsere Kinder halten uns den Spiegel vor, während wir in unserer Naivität und Rücksichtslosigkeit beleidigt aufschrecken.
Mittlerweile ist es meine Berufung, Menschen in die Natur zu führen. Das tue ich hier in der Lausitz, der Region, die geprägt ist von ihren Bewohnern. Die Menschen, die hier leben, haben diese Landschaft der Gegensätze von jeher mitgestaltet. Zwischen eiszeitlichen Sanddünen findet man hier Wälder, Braunkohlereviere und ausgedehnte Teichgebiete, die vor Jahrhunderten angelegt wurden. Dort in der Teichlausitz liegt auch das sorbische Dorf Groß Särchen, in dem ich aufgewachsen bin. Ein altes sorbisches Sprichwort besagt: »Gott hat uns die Lausitz gegeben, und der Teufel hat die Kohle darin vergraben.« Der Braunkohleabbau war für die Region Fluch und Segen zugleich. Er ließ viele sorbische Dörfer verschwinden, brachte aber auch Lohn und Brot. So auch für meine Familie. Die Dörfer, in denen noch meine Großeltern lebten, wurden von der Kohle gefressen, später transportierte mein Vater als Lokführer die Kohle in das Kraftwerk, und meine Mutter arbeitete in der Bergarbeiter-Kantine. Und ich, ich lernte zunächst Elektriker im Tagebau, aber eigentlich wollte ich immer nur draußen sein. Irgendwann schulte ich zum Naturführer um, zog in das Heidedorf Neustadt in ein altes Forsthaus und später in einen Bauwagen direkt am Ufer der Spree.
Inzwischen lebe ich in einer selbstgebauten Blockhütte und habe ein kleines Naturcamp für meine Gäste errichtet, natürlich ebenfalls in Blockbauweise. Bei meinen Führungen und Kursen geht es mir nicht allein darum, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Landschaften, Tier- oder Pflanzenarten zu lenken, sondern auch auf unser Verhältnis zur Natur, unseren Umgang mit ihr, unsere Wahrnehmung und die Art, wie wir ihr begegnen. Mit diesem Buch, in dem ich meine Erlebnisse schildere, möchte ich Sie für die Natur sensibilisieren. Ich möchte Sie verführen, in Ihnen die Lust auf Begegnungen mit Tieren oder Pflanzen wecken und verdeutlichen, dass wir Teil des Ganzen sind. Mein Buch spricht alle an, die Sehnsucht nach mehr Natur verspüren und ihr wirklich begegnen wollen. Besonders empfehle ich es auch all jenen, die mit Kindern zu tun haben, sei es beruflich oder privat. Da ich jahrelang in der Umweltbildung tätig war, möchte ich mein Wissen über einen spielerischen Zugang teilen. Geschichten von meinen Streifzügen durch die Lausitz sollen dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden. Ich möchte aber auch zu einem anderen, besseren Umgang mit unserer Umwelt anregen.
Entdecken Sie die Natur vor Ihrer Haustür im Jahresverlauf, holen Sie sie zurück in Ihren Alltag, in Ihren Garten, in Ihr Leben. Sie müssen dazu nicht in die Lausitz reisen, wenngleich Sie hier herzlich willkommen sind. Natur ist allgegenwärtig. Erleben Sie sie mit allen Sinnen, öffnen Sie sich und lassen Sie Ihre Bedenken hinter sich. Mein Buch will Sie dazu inspirieren, denn Inspiration ist der Antrieb auf dem Weg zu den gesuchten Antworten. Legen Sie los, finden Sie selbst heraus, was in der Begegnung mit unserer Umwelt auf uns wartet. Oder lesen Sie erst einmal dieses Buch.
Ich muss jetzt los, der Schwarzspecht ruft. Deutlich kann ich seine rote Haube sehen, er lugt gerade hinter einer Erle hervor. Er scheint mich zu beobachten, und gerade ist in einem der Nachbarbäume das Weibchen gelandet. Was für ein wunderbarer Morgen. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wo die wilden Tiere wohnen.
Aller Anfang ist schwer
Mein Einstieg in die Umweltbildung passierte eher zufällig, und eigentlich hatte ich ganz andere Pläne. Nach dem Fall der Mauer wurde ich arbeitslos und hielt mich danach mit verschiedenen Jobs über Wasser, fand aber an den Arbeiten keine richtige Freude. Tagtäglich sehnte ich den Feierabend herbei und war froh, wenn dann noch genug Zeit blieb, um vom alten Forsthaus aus eine kleine Exkursion in die Spreeaue zu starten. Irgendwann hörte ich dann von einer geplanten Arbeitsmaßnahme bei der Naturschutzbehörde. »ABM« lautete das Zauberwort in der Nachwendezeit, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Arbeitsamtes. Im Volksmund wurde es mit »Arbeit bis Mittag« übersetzt und tatsächlich oft so gehandhabt. Nicht immer war den in der Maßnahme Beschäftigten der Sinn einer solchen Tätigkeit vermittelbar. Das lag zum einen an der Perspektivlosigkeit, zum anderen aber auch an der völligen Fehlbesetzung der Stellen aus Mangel an geeigneten Arbeitslosen. So wurde ein Schlosser ganz schnell auch mal zum Naturschützer, der eine Orchideenwiese mähen sollte. Die Leute mussten beschäftigt werden, das hatte Priorität, auch wenn sie sonst keinen großen Bezug zur Natur hatten. Sie taten, was man ihnen sagte, und dachten sich ihren Teil dabei. Der in der deutschen Mentalität fest verwurzelte Ordnungssinn war hier natürlich fehl am Platz und nicht selten destruktiv.
In meinem Fall war es eine glückliche Fügung, bekam ich doch zum ersten Mal eine Tätigkeit im Naturschutzbereich zugewiesen. Es sollte eine Gruppe gebildet werden, die für spezielle Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen zum Einsatz kam. Für etwa eineinhalb Jahre hatte ich eine Beschäftigung, die meinen Vorstellungen entsprach. Biotoppflege und Optimierung von Lebensräumen waren der Schwerpunkt unserer kleinen Gruppe. Solche Arbeiten waren allerdings zeitlich begrenzt, und so bewarb ich mich gemeinsam mit einem befreundeten Naturschützer im Naturpark Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, der später zum Biosphärenreservat umgewidmet wurde. Hier sollte eine Naturwacht mit richtigen Rangern aufgebaut werden. Ein Traumberuf, auf den ich all meine Hoffnungen setzte. Leider sollte ich enttäuscht werden, denn Voraussetzung war es, arbeitslos zu sein. Da ich aber zu diesem Zeitpunkt noch in der Landschaftspflegegruppe arbeitete, wurde meine Bewerbung abgelehnt. Für mich brach eine Welt zusammen. Doch ich gab meinen Traum nicht auf und bemühte mich weiter, eine naturnahe Beschäftigung zu finden. Dazu dehnte ich meine Suche auch auf den Nachbarlandkreis aus, sogar im Spreewald versuchte ich mein Glück. Aber alle Bemühungen blieben erfolglos, und man vertröstete mich auf einen späteren Zeitpunkt.
Irgendwann fragte ich in meiner Verzweiflung in einem Kindererholungszentrum nach – was für ein merkwürdiger Name für ein zugegeben nicht besser klingendes ehemaliges Kinderferienlager, dachte ich noch. Hier wurde nur jemand für Disco- und Sportveranstaltungen in der anstehenden Sommersaison gesucht. »Dazu bin ich nicht geeignet«, sagte ich dem Chef und schlug ihm vor, stattdessen etwas in Richtung Naturerlebnis mit Kindern aufzuziehen. Auf die Frage, ob ich denn Erfahrung damit hätte, antwortete ich natürlich mit »ja«, obwohl ich bis dahin kaum mit Kindern gearbeitet hatte. Er ließ sich tatsächlich auf meinen Vorschlag ein, und nun musste ich mir etwas einfallen lassen. Zwei Wochen gab er mir zur Vorbereitung, dann sollte es losgehen. Ich nutzte die Zeit mit dem Studium diverser Literatur und konsultierte auch einen guten Freund, der im Bereich Umweltbildung schon erfolgreich tätig war. Dann wurde es ernst; ich sollte meine erste Naturführung im nahegelegenen Wald absolvieren.
Es war um die Mittagszeit an einem außergewöhnlich heißen Freitag im Mai. Nicht gerade das beste Wetter und auch nicht die geeignete Zeit für meinen Einstieg, aber die Verantwortlichen wollten es so. Ich war unheimlich aufgeregt, aber auch in freudiger Erwartung meiner ersten Schulklasse. Dass es sich dabei um eine achte Klasse aus Berlin-Mitte handelte, die gerade erst angereist war, wusste ich nicht. Mit meinem Rucksack und einem Fernglas ausgerüstet stand ich, gepackt vom Lampenfieber, am Treffpunkt. Die Kinder wies man an, ihre Sachen aufs Zimmer zu bringen und dann schnell zum Essen zu kommen, da es im Anschluss mit einem Förster in den Wald gehe. Noch ahnte ich nicht, was mich erwartete, und so begrüßte ich freundlich die ersten zwei Mädchen, die nach dem Essen bei mir eintrudelten. Sie sahen irgendwie älter aus, als ich erwartet hatte, und machten nicht den Eindruck, als ob sie Lust auf eine Naturwanderung hätten. Geschminkt und im Discolook, also für eine Naturwanderung eher unzweckmäßig gekleidet, wirkten sie auf mich befremdlich. Ich versuchte, meine Verunsicherung zu überspielen und cool zu bleiben. Während sie mich kaugummikauend musterten, fragte die eine:
»Und du bist hier also der Förster?«
»Nein«, erwiderte ich, »ich mache mit euch nur eine Wanderung.«
Darauf fragte die andere, ob es in unserem »Laden« auch einen Kondomautomaten gäbe. Ich war platt. Das konnte nur schiefgehen. Inzwischen kam auch die Lehrerin mit den anderen Kindern hinzu, die Stimmung war eher gelangweilt. Was sollte ich tun? Mir wurde abwechselnd heiß und kalt, und ein mulmiges Gefühl machte sich in meiner Magengegend breit. Ich musste wieder festen Boden unter den Füßen bekommen, und da sich das Eintreffen der Schüler in die Länge zog, blieben mir noch einige Minuten, um nachzudenken. Diese Kinder hatten im Augenblick keinen Bock auf Natur, so viel war klar. Ich überlegte fieberhaft und erinnerte mich an meine eigene Abschlussfahrt in der zehnten Klasse. Einer meiner Klassenkameraden hatte damals eine Weinflasche und Zigaretten aus dem Bestand seines Vaters mitgeschmuggelt; wir wollten damit um Mitternacht eine Fete bei den Mädchen veranstalten.
Wie sollte ich also die Begeisterung der Berliner wecken? Ich rechnete mir keine großen Chancen aus, doch dann hatte ich eine Idee: Ich musste mich in die Situation der Kinder hineinversetzen und die Sache aus ihrer Perspektive betrachten. Also weg vom Erklärbär, der Frontalunterricht macht. Die Kinder sollten die Natur selbst entdecken, also entschied ich mich für ein spielerisches Lernen. Und das ist auch der Ansatz, mit dem ich seither arbeite – mit Großen und Kleinen. Dazu inspirierten mich vor allem die Bücher von Joseph Cornell. Seine Herangehensweise, eben ein spielerischer Umgang mit der Natur, war jetzt genau das Richtige. Anfangs versuchte ich auch noch, seine Spiele eins zu eins zu übernehmen, aber mit der Zeit kamen mir immer mehr eigene Ideen.
Meine Berliner saßen – oder besser lümmelten – also bei meiner Einführung zur ersten und für mich so bedeutenden Führung eher gelangweilt im Schatten am Waldrand. Was ich mitteilen wollte, interessierte nicht, und selbst die Lehrerin saß rauchend und desinteressiert in einigen Metern Abstand von der Klasse entfernt. Zuerst machte ich die Lehrerin auf das Rauchverbot bei Waldbrandwarnstufe vier aufmerksam und forderte sie auf, unverzüglich die Zigarette auszumachen. Damit hatte ich schon mal ein wenig Eindruck bei den Schülern gemacht, die mir nun wenigstens zuhörten. Ich schlug der Klasse folgenden Deal vor: »Ich vermute mal, dass ihr keinen Bock auf diese Veranstaltung habt, aber wir werden das jetzt durchziehen. Wenn ihr einverstanden seid und meine Regeln akzeptiert, haben wir die Sache in eineinhalb Stunden überstanden«, verkündete ich und fügte hinzu, dass nur die unmittelbar bei mir sein sollten, die mitmachen möchten. »Die anderen können an jeder Station etwas abseits im Schatten chillen oder sich mental auf die Disco am Abend vorbereiten«, ergänzte ich noch. Dann brach ich mit den etwa 30 Teilnehmern auf. »Wird schon schiefgehen«, dachte ich bei mir. Schon nach wenigen hundert Metern machte ich den ersten Halt und wollte wissen, wer mitmacht. Nur zwei Jungen aus der ganzen Klasse waren bereit dazu. Also gingen wir noch ein kleines Stück weiter, blieben aber in Sichtweite der Gruppe stehen. Ich erklärte kurz, dass ich zur Einstimmung ein kurzes Partnerspiel machen möchte, in dem es darum geht, einen bestimmen Baum wiederzufinden. Dazu muss sich der eine Junge die Augen mit einem Tuch verbinden. Dieser wird dann vom anderen über Umwege an einen markanten Baum geführt, der nur mit dem Tastsinn ergründet werden soll. Danach wird er ebenfalls über kleine Umwege zum Ausgangspunkt zurückgeführt, darf das Tuch abnehmen und sich auf die Suche nach dem Baum machen.
Es passierte nun genau das, was ich beabsichtigt hatte, schon nach kurzer Zeit kamen vier weitere Schüler und fragten mich, was wir da machten. Ich sagte nur: »Klappe halten und hinsetzen oder Tuch nehmen und mitmachen«, sie entschieden sich für das Tuch, und nach nur etwa zehn Minuten waren alle am Start. Es sollte an diesem Tag nicht bei dem einen Spiel bleiben. Mein persönlicher Höhepunkt war aber, als ich mit den beiden Mädchen, die mir anfangs so provokante Fragen gestellt hatten, mit hochgekrempelter Hose im Bach stand und ihnen zeigte, wie man einen Krebs fängt.
Als wir wieder zurückkehrten, waren fast vier Stunden vergangen. Die Klasse war begeistert, selbst die Lehrerin lächelte still vor sich hin. Bei der Verabschiedung sagte eines der beiden Discomädchen, dass sie nie zuvor so eine »mega« Naturwanderung gemacht hätten. Ich war einfach nur glücklich. Das war es, was ich machen wollte, endlich hatte ich meine Berufung gefunden.
Schon zwei Tage darauf wurde mir mitgeteilt, dass ich meine Probezeit bestanden und zumindest für den Sommer wieder einen Arbeitsplatz hätte. Mit der Zeit wuchs aber die Nachfrage nach meinen Führungen, und sogar in der Zeitung wurde darüber berichtet. Als dann der Herbst kam, wurde mein Vertrag bis zum Ende des folgenden Sommers verlängert. Der Ansturm auf meine Veranstaltungen war immens, und inzwischen war ich fast wöchentlich in den regionalen Zeitungen vertreten. Das blieb auch im Biosphärenreservat nicht unbemerkt, in dem inzwischen ein Umweltbildungsprojekt entstanden war. Tatsächlich bekam ich vom dortigen Team eine Anfrage, ob ich Lust hätte, nach den Sommerferien ins Projekt »Kinder der Dörfer« einzusteigen. Natürlich sagte ich zu und war damit richtig in der Umweltbildung angekommen. Voller Tatendrang arbeitete ich in den nächsten vier Jahren an Schulen, Kindergärten und Horten innerhalb des Reservates mit Kindern und Jugendlichen jeden Alters. Im nördlichen Teil des Reservates teilte ich mir mit einem Mitarbeiter der Reservatswacht eine Naturschutzstation, die unter anderem auch als Basis für meine Freizeitgruppe diente. Hier organisierten wir gemeinsam mit dem Ranger, Zivildienstbeschäftigten und FÖJlern (Freiwilliges Ökologisches Jahr) regelmäßig kleine Feste mit den Kindern, zu denen dann auch Eltern und Verwandte eingeladen waren. In den Sommerferien veranstaltete ich damals jeweils zwei Feriencamps, die immer gut besucht waren, und später gehörte auch Erwachsenenbildung zu meinen Aufgaben. Die Arbeit bereitete mir so viel Freude, und ich genoss die damit verbundene Freiheit. Aber das sollte nicht so bleiben.
Mit der Zeit griff in der Reservatsverwaltung immer mehr das verordnete Behördendenken um sich. So kam der Tag, an dem dankbare Briefe von Lehrern und Eltern oder liebevoll angefertigte Mappen mit Zeichnungen und Fotos sowie umfangreich bebilderte Zeitungsartikel nicht mehr als Nachweis für unsere erfolgreiche Arbeit genügten. Also fingen wir an, Berichte zu schreiben, ein zeitaufwendiges Prozedere, dessen Sinn mir bis heute verborgen bleibt. Mit der Zeit fiel mir auf, dass niemand diese Berichte überprüfte, und so machte ich mir einen Spaß daraus, sie gemeinsam mit einem befreundeten Zivi am Monatsende einfach frei zu erfinden. Nach vier Jahren war es dann so weit: Ich hatte das Gefühl, das Wichtigste in meinem Job sei die Einhaltung der Kernarbeitszeit, so jedenfalls wurde es mir von einer einflussreichen Mitarbeiterin der Verwaltung vermittelt. Also zog ich die Reißleine und kündigte, nachdem ich mein letztes Feriencamp in den Sommerferien abgeschlossen hatte.
Mein Entschluss stand fest, ich wollte von nun an mein eigenes Ding machen und nach dem Millennium den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Ein würdiges Datum, dachte ich damals, wenn auch die Vorstellungen von meiner Zukunft eher schwammig waren. Als freier Fotograf und im Bereich Umweltbildung wollte ich von nun an meinen Lebensunterhalt verdienen. Sehr naiv, aber mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen startete ich im neu angebrochenen Jahrtausend mein eigenes Projekt und habe es trotz so manch schwieriger Phase bis heute keine einzige Sekunde bereut. Wie so oft taten sich schon nach kurzer Zeit neue Möglichkeiten auf. Von nun an war ich endlich frei und konnte selbst entscheiden, welchen Job ich machen wollte – für mich eine unbezahlbare Errungenschaft. Vor allem die Vielfältigkeit der Tätigkeiten war eine Bereicherung, alles, was mir Freude bereitete, konnte ich von nun an in meine Arbeit integrieren. So veranstaltete ich mit der Zeit nicht nur die unterschiedlichsten Feriencamps, ich arbeitete auch weiterhin an Schulen und Kindergärten. Auch Erwachsene gehörten nach wie vor zu meinen Kunden, und in den meisten Fällen waren es Pädagogen, nicht selten auch Lehrer. Oft musste ich dann an meine Schulzeit denken und wünschte mir heimlich die Lehrer von damals herbei. Ich organisierte Seminare und Kurse zu verschiedenen Themen, aber immer stand die Natur im Mittelpunkt.
Als ich meine erste Blockhütte an der Spree gebaut hatte, dauerte es nicht lange, bis sich die ersten Interessenten meldeten. Sie wollten auch so eine Hütte, und ich sollte sie bauen. Aber ich lehnte immer mit der Begründung ab, dass ich ja kein Zimmermann sei und keine Garantien geben könnte. Irgendwann aber entschloss ich mich, einfach einen Blockhausbaukurs anzubieten. Nicht wie man ein Blockhaus baut, das wäre zu vermessen, ich bin schließlich kein Profi. In meinem Kurs habe ich den Leuten nur gezeigt, wie ich es gemacht habe.
Die Themen meiner Angebote waren vielfältig, es ging um Fledermäuse, Kräuter, Lurche und Kriechtiere und vor allem um Vögel – natürlich auch häufig um den Wolf. Die Naturfotografie spielte ebenso immer wieder eine große Rolle. Bis zum heutigen Tag habe ich für alle meine Angebote und Tätigkeiten nie irgendwo einen Nachweis über meine Eignung oder einen Qualifizierungsnachweis einreichen müssen.
Aber halt: Einen kuriosen Fall gab es doch. Auf eine Anfrage hin entwickelte ich für einige Kindergärten und einen Hort in meiner Gegend ein Programm zum Thema »Der Wolf und seine Nachbarn in seinem Lebensraum«. Das Programm lief sehr erfolgreich, war aber auch sehr zeitaufwendig, sodass ich mir nach etwa einem Jahr Verstärkung in Form einer Begleiterin holte. Irgendwann hatte ich so viel zu tun, dass sie das Programm allein übernahm. Das funktionierte bis zu dem Zeitpunkt, als sie schwanger wurde. Nun kam ein gemeinsamer Freund dazu. Er führte mein Programm schon nach kurzer Zeit allein durch – ebenfalls sehr erfolgreich. In dieser Phase wechselte der Träger, der die Veranstaltung finanzierte. Aber alles lief wie gewohnt weiter. Mein Freund ging regelmäßig in die Kindergärten, so lange, bis weitere interessante Nachfragen für Umweltbildungsveranstaltungen auch seine Terminplanung an ihre Grenzen brachten. Zufällig hatte ich genau in dem Zeitraum noch Luft, und so bat er mich um Unterstützung. Ich sagte zu und wollte mich sofort auf die Arbeit stürzen, doch zuerst musste noch der Träger wegen der Finanzierung informiert werden. Schon bald darauf bekam ich Post und staunte nicht schlecht über das Schreiben. Man teilte mir mit, dass ich unverzüglich einen Nachweis einreichen sollte, welcher mir eine ausreichende Qualifizierung für meine Aufgabe bestätigte. Sofort rief ich den zuständigen Sachbearbeiter an, um ihm zu erklären, dass ich quasi der geistige Vater des Programms sei und es samt Inhalt gestaltet und entwickelt hätte. Das spiele in dem Fall keine Rolle, erklärte er mir, zumindest müsse ich Referenzen nachweisen. Ich war tatsächlich sprachlos, musste dann aber herzlich lachen über so viel Bürokratismus. Natürlich hätte ich jede Menge Referenzen vorlegen können, da ich aber grundsätzlich keine Lust habe, mich auf so etwas einzulassen, lehnte ich ab. Für solche Vorgehensweisen habe ich kein Verständnis, und nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, dass allein ein Diplom oder sonst ein Zertifikat nichts über die Qualität der Arbeit aussagt, die der Besitzer eines solchen Schriftstücks zu leisten vermag.
Ich bin Autodidakt und lerne stetig dazu. Der Wunsch nach Zertifikaten trug meinen bisherigen Erfahrungen nach immer zu absurden Situationen bei. Einmal holte man mich in ein Gremium, welches Umweltbildung zertifizieren sollte. Doch keiner der Anwesenden konnte für das Gebiet eine Qualifikation nachweisen, was das ganze Unterfangen in Frage stellte. Kurz danach löste sich das Gremium auf.
All das liegt aber schon Jahre zurück. Ich habe inzwischen meinen Weg gefunden und bin glücklich, Naturführer und in der Lausitz, in der Kiefernheide oder in meiner geliebten Teichlausitz unterwegs sein zu können.
Aufbruch ins Paradies
Ein Fensterbrief war und ist für mich immer etwas Unangenehmes: eine Aufforderung, die Steuererklärung endlich abzugeben, oder die Mitteilung über eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich zum Beispiel mal wieder falsch geparkt habe. Diesmal kommt er von der Gemeinde, und ich ahne, um was es geht. Der Wildwuchs entlang meines Grundstückes, ein schmaler Streifen, etwa einen halben Meter breit, zwischen Straße und meinem Zaun, war anderen Dorfbewohnern schon des Öfteren ein Dorn im Auge, und nun soll ich ihn umgehend entfernen. Ordnung muss sein, nur welche Ordnung, frage ich mich. Auch die Natur kennt Ordnung, nur diese schaut meist anders aus als die von Menschen gemachte.
Zugegeben, das ganze Grundstück hebt sich deutlich von den gut gepflegten Vorgärten im Dorf ab. Das schätzen auch viele hier brütende Vogelarten, das Eichhörnchen, die Kröten und Massen von Insekten auf meiner bunt blühenden Wiese. Vielleicht ist das den Dorfbewohnern nur nicht aufgefallen. Vielleicht wissen sie aber auch nicht, dass natürliche Vielfalt nur da explodiert, wo wir nicht mit ordnender Hand eingreifen. Regelmäßig wird in der Gemeindezeitung darauf hingewiesen, im Dorf auf Ordnung zu achten. Grünflächen sollten gemäht werden, und Straßenränder seien von Unkräutern zu befreien. Schließlich solle unser Dorf für Besucher ein schönes Bild abgeben. Jeden Sonnabend, wenn ich durch das Dorf fahre, sehe ich darum dessen Bewohner, bewaffnet mit Eimern, Schaufeln und Straßenbesen, in reger Betriebsamkeit vor ihren Hofeinfahrten. Was sie hier tatsächlich tun, erschließt sich mir allerdings nicht, denn für meine Begriffe ist ohnehin alles schon sehr aufgeräumt. Trotzdem wird eifrig gefegt. Vielleicht geht es nur darum, dem Nachbarn zu signalisieren, dass man seiner Pflicht nachkommt? Vielleicht sucht man Kontakt und hat keinen plausiblen Grund, nebenan zu klingeln? Wenn man mit den Nachbarn ins Gespräch kommt, hat das ja schließlich auch eine soziale Komponente. Ein Gespräch am Zaun gibt Gelegenheit zu einem frühen Bier, und man erfährt, was im Dorf gerade so läuft. Dagegen ist nichts einzuwenden.
Aber scheinbar bin ich gegen diese Art Ordnung immun. Schon als Kind war ich genervt, wenn ich am Sonnabend den Hof fegen musste. Dieser war mit hartgebrannten dunkelroten Ziegeln ausgelegt, und in den Fugen zwischen den Steinen wuchs grünes Moos. Ein wunderschönes Muster. Ich hielt immer wieder inne, um es zu betrachten, wenn ich mit dem Straßenbesen vorsichtig darüberfegte. Manchmal kniete ich mich hin, um mir die Gewächse aus der Nähe anzuschauen. Kleine samtig grüne Polster, die wie ein weiches kurz geschorenes Fell flach an den Boden geschmiegt wuchsen. Erstaunlich, dass sie hier auf dem alltäglich stark begangenen Weg überhaupt existieren konnten. Meine Großmutter hatte für diese Schönheit keinen Blick. So machte sie sich wenigstens einmal im Jahr daran, die Fugen mit einem alten Küchenmesser vom Moos zu befreien. Nun dauerte es meist nicht lange, bis kleine schwarze Ameisen die Fugen als Straßen nutzten und unter den Ziegeln ihre Wohnstätten errichteten. Auch das war meiner Großmutter ein Dorn im Auge, und sie bekämpfte die winzigen Tiere mit kochendem Wasser, das sie zielsicher in die Fugen goss. Diese Arbeit macht sich heute natürlich niemand mehr, mit Herbiziden und Gasbrenner lassen sich ungewollte Wildwüchse effektiver bekämpfen, und gegen Ameisen sind diverse Insektizide auf dem Markt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: