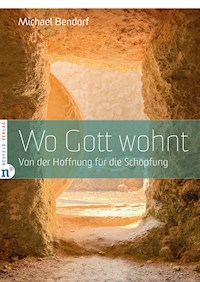
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neufeld Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wer in unserer Zeit auf die Entwicklung der Schöpfung schaut, kann schnell ins Seufzen geraten. Die ganze Schöpfung steckt in einer Krise; die Not vieler Menschen schreit zum Himmel. Mancher befürchtet, dass unsere Erde letztlich den berühmten Bach runtergehen wird. Zugleich aber stimmt die Bibel eine andere Melodie an: eine Melodie der Hoffnung, die sich vom Anfang des Alten bis zum Ende des Neuen Testaments durchzieht. Michael Bendorf begibt sich auf Spurensuche in der Heiligen Schrift und an biblischen Orten in Israel. Er setzt bei Gott an, dem Schöpfer. Ihn bewegt die Frage, wo Gott wohnen möchte und was wir aufgrund seiner Sehnsucht nach der Schöpfung für die Zukunft noch erwarten dürfen. Die Geschichte Gottes mit uns Menschen lässt uns nicht unberührt. Sie betrifft uns, sie verändert uns und sie will uns ermutigen, Hoffnungsträger in der Nachfolge Jesu zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Bendorf
Wo Gott wohnt
Von der Hoffnung für die Schöpfung
Dieses Buch als E-Book: ISBN 978-3-86256-790-4
Dieses Buch in gedruckter Form: ISBN 978-3-86256-183-4
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar
Bibelzitate, soweit nicht anders angegeben, wurden der Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R. Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen, entnommen
Außerdem wurden die folgenden Übersetzungen verwendet:
GNB: Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
HFA: Hoffnung für alle TM, Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.
LUT: Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017
© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
NGÜ: Neue Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen, Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft
Lektorat: Dr. Thomas Baumann
Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson
Umschlagabbildung: Pisit Heng, unsplash.com
Autorenporträt: Alwina Unruh, UNRUH Designbüro, Braunschweig
Satz: Neufeld Verlag
© 2023 Neufeld Verlag, Sauerbruchstraße 16, 27478 Cuxhaven
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
www.neufeld-verlag.de
Bleiben Sie auf dem Laufenden:
newsletter.neufeld-verlag.de
www.neufeld-verlag.de/blog
www.facebook.com/neufeldverlag
www.youtube.com/@neufeldverlag
INHALT
1. Das Tote soll leben
1.1 Erwachendes Leben am Toten Meer
1.2 Die Gegenwart Gottes
1.3 Der Strom des Lebens für eine leidende Schöpfung
1.4 Einwohnungen Gottes im Horizont seines Reiches
2. Jerusalem, die erwählte Stadt der Einwohnung Gottes
2.1 Die Jerusalemer Tempel als Wohnorte Gottes
2.2 Melchisedek, der geheimnisvolle Priester und König von Salem
2.3 Jesus, Sohn Davids und ewiger Priester nach der Weise Melchisedeks
2.4 Die Beziehung zwischen Melchisedek und Jesus
2.5 Der Berg Moria: zwei Vater-Sohn-Geschichten im Angesicht Gottes
3. Die Schöpfung und der Garten Eden
3.1 Die Schöpfung als Zusammenwirken von Vater, Sohn und Geist
3.2 Gott: der Schöpfung gegenüber und doch einwohnend in ihr
3.3 Das Wesen der Schöpfung und des Tempelbergs
3.4 Der Garten Eden als Urtempel und Lebensraum
3.5 Ein Garten mit Zukunftsperspektive
3.6 Das Geheimnis von Eden und der Ruf Gottes
4. Eden im Heiligen Land: Gottes Geschichte geht weiter
4.1 Auf dem Weg nach Hebron
4.2 Hebron, die umkämpfte Stadt
4.3 Gott setzt mit Abraham fort, was er mit Adam begonnen hat
4.4 Die Einheit von Volk, Land und Gott
5. Das Geheimnis der Schechina
5.1 Klagemauer, Western Wall oder schlicht Kotel: Wohnt Gott noch hier?
5.2 Die Schechina auf dem Ölberg
5.3 Die Exilsschechina: Gott als Leidens- und Weggefährte seines Volkes
5.4 Wo ist nun die Schechina?
5.5 Von der Western Wall zur Via Dolorosa: dem Allerheiligsten auf der Spur
6. Jesus, der ganz andere Tempel
6.1 Jesus ist die Schechina
6.2 Das Kreuz als äußerstes Exil der Schechina
6.3 Vater und Sohn zerreißen sich
6.4 Der Gott der Gottverlassenen
6.5 Der Tod Jesu und die Stunde des Geistes für die Schöpfung
7. Die Morgenstunde der neuen Schöpfung
7.1 Auferstehung: zurück in den Garten mit dem Blick nach vorn
7.2 Nicht verwaist!
7.3 Pfingsten: Das israelische Wochenfest erfüllt sich
7.4 Die Schechina in der Gemeinde und im Einzelnen
7.5 Die verwandelnde Kraft und das neue Herz
7.6 Mobile Tempel verströmen sich
8. Das Drängen des Geistes
8.1 Kraftwirkungen im Kontext der neuen Schöpfung
8.2 Hilf doch, Herr, dem Sohn Davids!
8.3 Der Messias und das Goldene Tor von Jerusalem
8.4 „Unsere Zukunft ist nicht verhandelbar!“
8.5 Hoffen für diese Welt
9. Reich Gottes und geschichtliche Eschatologie
9.1 Die Treue des Messias und das neue Bundesvolk
9.2 Der Ölberg zwischen Gericht und Heil
9.3 Jüdischer Messianismus
9.4 Christlicher Millennarismus
10. Das Kommen des Messias
10.1 Die schwangere Schöpfung
10.2 Der Kampf um Jerusalem
10.3 Die Ausgießung des Geistes über das jüdische Volk
10.4 Die Wiederkunft Jesu
10.5 Das messianische Laubhüttenfest
11. Der neue Himmel und die neue Erde
11.1 Schabbat Schalom!
11.2 Auf dem Weg in die neue Schöpfung
11.3 Zum Verhältnis von alter und neuer Schöpfung
11.4 Der Lebensstrom aus dem Thron Gottes und des Lammes
11.5 Ein Seufzen in der Herrlichkeit des Alltags
Literaturverzeichnis
Über den Autor
VORWORT
von Heinrich Christian Rust
Wo treffe ich Gott? Diese Frage ist keineswegs selten in unserer krisengeschüttelten Zeitenwende. Die Sehnsucht nach Gott verstummt nicht. Wo findet sich das Heilige? Wo treffen sich Himmel und Erde? Wo vereinen sich Diesseitigkeit und Jenseitigkeit in Momenten der Ewigkeit? Gibt es noch eine Zukunft auf diesem taumelden Planeten? Hat Gott eine Zukunft für diese Schöpfung, für sein Volk, für seine Kirche, für uns persönlich? Diese Fragen gehen an die Substanz und sie betreffen unsere Existenz. Gibt es Treffpunkte mit Gott?
Um diese Treffpunkte Gottes aufzuspüren, lädt uns Michael Bendorf in den folgenden elf Kapiteln dieses Buches ein, ihn bei seiner spannenden Reise durch das Heilige Land zu begleiten. Wir sind mit ihm am Toten Meer, in Jerusalem, auf dem Tempelberg, auf der Via Dolorosa oder auf dem Ölberg. Die Vision des Propheten Hesekiel vom neuen Tempel und vom Lebensstrom (Hes 47) leuchtet in ihren unterschiedlichen Erfüllungsdimensionen bei dieser Entdeckungsreise immer wieder auf. Dabei bewegt der Autor die Frage, wie Gott in diese Welt kommt und diese Welt zu einem Raum Gottes werden kann. Aus der rabbinischen Theologie übernimmt er den Begriff der Schechina, der die Einwohnung Gottes mit seiner Ruhe und Herrlichkeit aufspürt und kennzeichnet. Wo und wie erfahren Menschen in den unterschiedlichen Heilsepochen diesen Gott der Bibel? Bendorf weist unter Bezugnahme auf den jüdischen Gelehrten und Philosophen Abraham Joshua Heschel darauf hin, dass die Initiative für das Treffen von Himmel und Erde, von Gott und Mensch, von Gott ausgeht. „Die Bibel zeigt uns in ihrer Breite und Weite, dass Gott den Menschen weitaus mehr sucht als umgekehrt“ (S. 74). Nicht nur an den vereinbarten „Treffpunkten“ in der Stiftshütte, auf dem Berg Gottes, im Tempel, sondern auch außerhalb dieser ursprünglichen Gegenwartsräume ist die Schechina Gottes aufzuspüren: Im Volk, in der Thora, im prophetischen Wort oder auch an den Überresten des Tempels an der Westmauer/Klagemauer in Jerusalem. Schließlich offenbart sich seine Präsenz in Jesus Christus, in seinen Nachfolgern und seiner Gemeinde. Ja, selbst im tiefsten Dunkel, im Leiden ist Gottes Gegenwart zu erfahren. Bendorf spricht von der „Gegenwartsschechina“ zur Zeit der Stiftshütte und der Tempel. Mit der Zerstörung des Tempels wandert die Schechina als „Exilsschechina“ und „Offenbarungs- bzw. Erscheinungsschechina“ mit. Eindrücklich beschreibt der Autor die Treue und Liebe Gottes, die am Kreuz Jesu ihren Höhepunkt bekommt. „Genau an diesem Ort seines äußersten Exils soll unser Exil aufhören. Sein Todesschrei ist ein erlösender Schrei für uns alle“ (S. 149).
Es geht Michael Bendorf um die Heilsgeschichte, die im Garten Eden ihren Anfang nahm, in dem Bundesschluss mit Abraham und Israel ihre Fortsetzung findet (Kapitel 1–4) und die in Jesus Christus und der Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden eine weltumfassende, messianische Dimension erhält. Die Kapitel 6–8 stellen in einer solchen heilsgeschichtlichen Sicht dar, wie Gott sich durch Jesus Christus und die Ausgießung des Heiligen Geistes eine Wohnung im einzelnen Gläubigen, in der Gemeinde Jesu Christi ermöglicht. In den drei Schlusskapiteln führt der Verfasser uns zu einer endzeitlichen Sicht vom messianischen Friedensreich auf der Erde, von der Wiederkunft Jesu Christi und schließlich von dem neuen Himmel und der neuen Erde, in der Gott alles in allem sein wird. Damit findet die Schechina eine Vollendung. Gerade diese endzeitliche Zuordnung ist herausfordernd und dringend notwendig, angesichts einer starken Gegenwartsorientierung in der Theologie unserer Zeit.
Die über viele Jahre gesammelten Kenntnisse über das Heilige Land und das Judentum verbindet der Autor mit persönlichen Begegnungen und Geschichten, biblisch-theologischen Überlegungen, wegweisenden und herausfordernden Thesen und nicht zuletzt mit Konkretionen für ein hoffnungsvolles Leben im Hier und Jetzt (S. 270 f.). Der habilitierte Wirtschaftspädagoge Bendorf ist zugleich Theologe und Pastor. Es ist erstaunlich, wie viele Fakten er in diesem Buch zusammenträgt und zugleich darüber hinaus offen ist für eine Sicht, die über diese Faktenlage hinausweist. Selbstkritisch räumt er ein, dass gerade im Heiligen Land wissenschaftliche Erkenntnisse häufig vor den Karren eigener Glaubenspositionen gespannt werden. So wirbt er mit diesem Buch für einen guten Dialog zwischen Archäologie, Geschichtswissenschaft und Theologie, bei dem die Wissenschaft die spirituelle Dimension nicht ausschließt (S. 59). Er unterscheidet zwischen Spekulation, die danach fragt, was denkbar ist, und einer Mystik, die Offenbarung sucht und nicht allein durch die menschliche Logik zu erschließen ist. Es geht bei der Einwohnung, der Schechina Gottes, um ein solches Geheimnis. Gott will uns nicht nur einmal treffen, er will bei uns und in seiner Schöpfung zuhause sein, er will bei uns wohnen. Im Epheserbrief heißt es, dass wir „Hausgenossen Gottes“ sein dürfen (Eph 2,19).
Das Buch von Michael Bendorf lädt nicht nur zu einer Reise in das Heilige Land ein, sondern dazu, sich diesem Geheimnis der Einwohnung Gottes neu zu öffnen. Die Heilsgeschichte hört nicht damit auf, dass Gott sich ein Volk, eine Gemeinde erwählt, sondern dass es hier auf diesem Planeten ein messianisches Friedensreich gibt und in der Vollendung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gott alles in allem sein wird. Dann wird Gott in allem „wohnen“ (Offb 21,3). Diese umfassende heilsgeschichtliche Sicht öffnet Horizonte und erfüllt mit Hoffnung. Gerade das ist in unserer Zeitenwende nötig! Das Buch ist anspruchsvoll, aber auch gehaltvoll. Vor allen Dingen ist es lesenswert, denn es kann dazu führen, dass wir den lebendigen Gott dabei erneut treffen und uns bewusst wird, dass er bei uns wohnen will.
Heinrich Christian Rust,
Braunschweig
Meinen SöhnenLeonard David und Julius Benjamingewidmet
1.
Das Tote soll leben
1.1 Erwachendes Leben am Toten Meer
Es ist schon erstaunlich, welche außergewöhnlichen Reisen wir heute unternehmen können. Darin sind uns kaum noch Grenzen gesetzt. Wurde die Besteigung des Mount Everest von Edmund Hillary im Jahr 1953 als große Sensation gefeiert, so ist dieser Aufstieg zum höchsten Punkt der Erde mittlerweile ein Phänomen des Massentourismus geworden. Aber es geht noch höher: Im Jahr 2021 kam es zu einem Wettlauf der Milliardäre um die ersten privaten Weltraumflüge. Der britische Virgin-Gründer Richard Branson startete mit seinem Testflug am 11. Juli in New Mexico und ist damit dem Amazon-Gründer Jeff Bezos nur wenige Tage zuvorgekommen, der mit seiner Privatrakete am 20. Juli von Texas aus ins All geflogen ist. Beide Milliardäre planen ein Business mit dem Weltraumtourismus; potenzielle Touristen können sich bereits seit geraumer Zeit Tickets reservieren.
Aus der Weltraumperspektive wirkt selbst der Mount Everest klein. Trotz des entstehenden Weltraumtourismus wird er sicherlich nicht an Faszination und Attraktivität verlieren. Er wird ein Tourismusmagnet bleiben. Aber wie wäre es, wenn wir als Kontrast dazu nicht zum höchsten, sondern zum tiefsten Punkt der Erde reisen würden, der weder von Wasser noch von Eis bedeckt ist? Wo würden wir ankommen? Was würden wir dort sehen? Was würde uns dort erwarten? Die Antwort lautet: Wir würden am Ufer des Toten Meeres an der Grenze zwischen Israel und Jordanien stehen.
Schon oft stand ich am Ufer dieses Meeres, dessen Wasseroberfläche mehr als 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. An der Westseite des Meeres ragen die atemberaubenden Steilhänge der Judäischen Steinwüste empor. Immer wieder werden sie von Tälern bzw. Flussläufen, sogenannten Wadis, unterbrochen, die außerhalb der Regenzeiten meistens trocken sind. Auf der Ostseite des Totes Meeres erhebt sich das Abarim-Gebirge, dessen höchster Punkt im Norden der Berg Nebo ist – jener Berg gegenüber von Jericho, auf dem Mose nach 5Mo 32,48–50 das verheißene Land erblicken durfte und dann dort sterben sollte.
Nun stehe ich ein weiteres Mal an diesem Ufer. Einmal mehr bin ich von der Stille dieses Ortes ergriffen. Eigentlich spürt man bereits auf dem Weg von Jerusalem hierher etwas von ihr, wenn man durch die Judäische Wüste fährt, die zwischen Jerusalem und dem Toten Meer liegt. Mit ihren Terrassen, Erhebungen und Steilhängen strahlt die Wüste eine faszinierende Weite aus. Wenn man sich abseits der Straßen in diese Weite hineinbegibt und innehält, kann man eine unglaubliche Ruhe erleben. Man hört absolut nichts. Jedes Geräusch, das man selbst durch die eigenen Schritte oder durch ein Räuspern verursacht, wirkt plötzlich erstaunlich laut. Unten am Ufer des Toten Meeres angekommen, verdichtet sich dieses Erleben. Verstärkt wird dieser Eindruck der Stille durch die Abwesenheit von Leben in diesem Wasser. Abgesehen von einigen Mikroorganismen ist das Tote Meer aufgrund seines hohen Salzgehalts tatsächlich tot. Weder schwimmen Fische im Wasser noch sind darin andere Tiere zu finden. Neben der Wasserfärbung sind lediglich die Salzkristalle zu bestaunen, die sich an den Felsen absetzen. Hier und da finden sich einzelne Orte entlang des Ufers, wo sich durch künstliche Bewässerung oder einzelne Wadis Leben Bahn bricht.
Die Vision des Propheten Hesekiel
Ich glaube, dass diese Abwesenheit von Leben kein Zufall ist, sondern eine tiefere Bedeutung hat. Letztlich hat es etwas mit der Leitung und Leidenschaft Gottes zu tun. Immer, wenn ich am Toten Meer stehe, muss ich an den Propheten Hesekiel denken, der eine atemberaubende geistliche Schau für diesen Ort hat. Und so suche ich mir auch dieses Mal einen schattigen Platz aus, um die Worte des Propheten auf mich wirken zu lassen:
„Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs, und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung; nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus, und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter, und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich: ,Hast du das gesehen, du Mensch?‘ Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir: ,Dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordan-Ebene, dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer, von En-Gedi bis En-Eglajim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll man auch in Zukunft Salz gewinnen können. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie, und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor, und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel.‘“
(Hes 47,1–12; HFA)
Das ganze regionale Ökosystem am tiefsten Punkt der Erde soll nach dieser Prophetie zum Leben erweckt werden. Es soll gesunden, weil es vom Wasser aus dem Jerusalemer Tempel gespeist wird. Dabei legt das Wasser über das Kidrontal einen Weg von über 30 Kilometern zurück und verliert dabei etwa 1 200 Höhenmeter. Wer heute diese Gegend im Nordwesten des Toten Meeres besucht, erlebt so etwas wie Geburtswehen dieser nunmehr rund 2 600 Jahre alten Prophetie. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war folgendes Phänomen zu beobachten: Wenn sich vom Mittelmeer ein Tiefdruckgebiet östlich nach Jerusalem bewegte, stiegen die Wolken aufgrund der Höhe Jerusalems von knapp 800 Metern über dem Meeresspiegel auf, kühlten dabei ab und verloren ihr Wasser in Form von Steigungsregen am Westhang Jerusalems. Was an Regen über den Tempelberg gelangte – Jerusalem liegt direkt auf der Hauptwasserscheide –, floss weitgehend unterirdisch über das Kidrontal, das zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg im Osten Jerusalems liegt, hinunter zum Toten Meer. Dort verband sich dann das lebensspendende Süßwasser mit dem hoch konzentrierten Salzwasser und „starb“. Das Süßwasser war von der Menge her zu gering und zu schwach, um sich gegen das Tote Meer durchzusetzen. Es verlor sich ohne nachhaltige Wirkung in diesem großen Salztopf.
Ein kleines Paradies am tiefsten Punkt der Erde
Als jedoch zum Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Juden in das Land ihrer Vorfahren einwanderten, begannen sie, Wasser aus dem Jordan für ihre Siedlungen und Felder umzuleiten. Dies führte dazu, dass weniger Wasser aus dem Jordan in das Tote Meer floss – mit der Folge, dass der Wasserspiegel des Meeres zu sinken begann und schließlich die darunterliegenden Süßwasserquellen freigab, die seit Jahrhunderten durch das Salzwasser zugedeckt waren. Damit wurde der Weg für das Aufblühen einer neuen Vegetation gebahnt, die an die Vision von Hesekiel erinnert. Die ökologischen Konsequenzen des Absinkens des Toten Meeres werden mit Sorge betrachtet und kontrovers diskutiert. Allerdings kann sich nun aber genau dadurch das Regenwasser aus dem Kidrontal ausbreiten; die Süßwasserquellen können sich frei entfalten. Mitten in der Wüste entstanden im Laufe des 20. Jahrhunderts Teiche, umgeben von einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. Das bekannteste Phänomen ist das Naturschutzgebiet Einot Tsukim (übersetzt: Felsenquellen, arabisch: Ein Fashkha), das im Nordwesten des Toten Meeres liegt (rund drei Kilometer südlich von Qumran) und dessen Südgrenze lediglich zwei Kilometer nördlich vom Kidron-Wadi entfernt ist. Man vermutet, dass dieser Ort mit dem biblischen En Englaiim identisch ist, der auch in der Hesekiel-Prophetie erwähnt wird.
In diesem Naturschutzgebiet gibt es neben archäologischen Ausgrabungsstellen mehrere Süßwasserteiche mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt, zudem auch Süßwasserpools, die für Touristen zum Schwimmen freigegeben sind. Der Park umfasst drei Areale: ein Areal, dessen Zugang ausschließlich Wissenschaftlern vorbehalten ist, ein öffentliches Areal für Touristen und ein sogenanntes „verstecktes“ bzw. „verborgenes“ Areal, das man nur mit einem lizenzierten Guide betreten kann. Es wird „verborgen“ genannt, weil es erst durch das jahrzehntelange Zurückweichen des Toten Meeres entstehen konnte und bis zu Beginn dieses Jahrhunderts tatsächlich nur wenigen Menschen bekannt war; es ist weder von der Straße noch vom öffentlichen Areal direkt einsehbar – ein verborgenes Paradies. Wiederholt hatte ich in den letzten Jahren die Möglichkeit, an der Seite eines Guides dieses verborgene Areal zu besuchen, das mittlerweile etwa 1 500 Dunam (150 Hektar) umfasst. Mit seinen sprudelnden Quellen, seiner reichhaltigen Vegetation und vielfältigen Tierwelt ist es von atemberaubender Schönheit. Selbst majestätische Palmen ragen hier empor, die nicht von Menschen gepflanzt wurden. Die hier arbeitenden Ranger gehen davon aus, dass Vögel und Schakale Dattelsamen hinterlassen haben, durch die diese Dattelpalmen entstehen konnten. Die Teiche sind voll von Fischen, die vermutlich ursprünglich über Fischeier an den Füßen von Zugvögeln hier einen Lebensraum gefunden haben. Wenn früher die Zugvögel aus Europa über Israel hinweg flogen, um im fernen Afrika zu überwintern, so verweilen manche mittlerweile auch an diesem Ort, der in unmittelbarer Nähe zum Toten Meer alles andere als still und tot ist. Am tiefsten Punkt der Erde ist ein kleines Paradies entstanden.
Das Tote Meer ist ein Zeichen für uns
Als mein damaliger Guide Dany Walter, ein gebürtiger Israeli und Naturkundler, meiner Reisegruppe und mir diese Stelle 2009 erstmals zeigte, erlebte ich vor meinen Augen etwas von der Dimension der Prophetie von Hesekiel. Für mich waren es erfahrbare prophetische Geburtswehen; sie wirkten auf mich wie ein prophetischer Appetizer. Für Dany war dieses Phänomen bereits mehr. Während ich an dem größten Fischteich im verborgenen Areal seine geografische Karte vor der Reisegruppe hochhielt und er uns an ihr den Steigungsregen in Jerusalem und den Verlauf des Regenwassers durch das Kidrontal bis zum Toten Meer erklärte, rief er in tiefer Überzeugung aus: „Die Prophetie von Hesekiel hat sich vor unseren Augen erfüllt!“
Für uns alle war dies damals eine bewegende Lehrstunde in diesem verborgenen Areal. Ich war seitdem wiederholt an diesem Ort und habe viel über dessen Bedeutung und die Prophetie von Hesekiel nachgedacht. Was hat es auf sich mit dieser Stelle? Welche Bedeutung hat sie für unsere Zeit? Wie ist die Prophetie von Hesekiel im größeren Rahmen der Geschichte Gottes mit uns Menschen einzuordnen? Was sagt sie uns heilsgeschichtlich? Was sagt sie über Gott selbst und seine Absichten aus? Kann man einfach eine Verbindung zwischen diesem heutigen kleinen Paradies am Nordwestufer des Toten Meeres zur Prophetie aus Hesekiel 47 ziehen? Oder tut man dem Text nahezu Gewalt an, wenn man in dem verborgenen Areal von Einot Tsukim eine Erfüllung von biblischer Prophetie sieht, wie es unser Guide Dany Walter getan hat?
Offensichtlich ist, dass sich an diesem tiefsten Punkt der Erde ein ungeahnter Lebensraum entfaltet hat. Das Sichtbare ist für mich ein natürlicher Vorgeschmack bzw. ein Zeichen, das unsere prophetischen Sinne stärken soll. Ich denke dabei an Paulus, wenn er in 1Kor 15,46 schreibt: „Das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche.“ Ich kann daher in diesem Phänomen bereits etwas vom Herzschlag Gottes für seine Schöpfung erspüren. Das Tote soll nicht das Letzte in dieser Schöpfung sein. Selbst der tiefste Punkt der Erde, der ein toter Punkt ist, soll von der schöpferischen Lebenskraft Gottes erfasst werden. Das Tote Meer ist daher ein Zeichen für uns. Dieser Gott will sich verströmen, und was er berührt, das soll leben!
1.2 Die Gegenwart Gottes
Damit hat sich die Prophetie von Hesekiel bis heute bei weitem noch nicht erschöpfend erfüllt. Die Schau des Propheten vom Strom des Lebens ist eingebettet in eine Vision von einem zukünftigen Tempel. Bewegend ist, dass Gott mit dieser Vision von einem neuen Tempel und dem Wasserstrom gewissermaßen behutsam den Schmerz seines Bundesvolkes berührt. Der Tempel in Jerusalem war zum Zeitpunkt dieser Vision bereits zerstört. Dort, wo Gott wieder und wieder verheißen hatte, mit seinem Namen und damit mit seiner Herrlichkeit zu wohnen, lag alles in Schutt und Asche. Tempelverlust bedeutete dann auch „Herrlichkeitsentzug“. Hesekiel selbst hatte es in Visionen gesehen, wie sich die Herrlichkeit des Herrn vom Tempel wegbewegte und sich schließlich östlich von Jerusalem auf den Ölberg verlagerte.
Diese Erfahrung der Tempelzerstörung und des damit einhergehenden Verlustes der Gegenwart Gottes hat nicht nur zu einer tiefen Krise im Judentum geführt. Sie hat auch zu der grundexistenziellen Frage geführt, wo Gott wohnt bzw. gegenwärtig ist, wenn der Tempel als Ort der Gottesbegegnung nicht mehr da ist. Da ein Gottesmerkmal sicherlich die Allgegenwart ist, erscheint einem die Vorstellung der Gegenwart oder Einwohnung Gottes in einem Tempel bzw. Gotteshaus möglicherweise naiv. Und doch haben wir Menschen ein Verständnis bzw. ein Gefühl für heilige Räume oder Orte entwickelt. Wir erfahren in ihnen auf geheimnisvolle Weise eine göttliche Präsenz. Anders wären die zahllosen Wallfahrtsorte religionsübergreifend kaum zu erklären. Auch wir Christen erwarten in unseren Gottesdiensten die Gegenwart Gottes und erbitten sie im Gebet. Andere würden Gott eher im Himmel und damit einhergehend fern von der Erde verorten. Der Himmel auf Erden ist für manchen ein unzugänglicher, ein unmöglicher Ort.
Die Einwohnung der Herrlichkeit Gottes
Wenn uns in diesem Buch die Frage beschäftigt, wo Gott wohnt, dann ist die Herrlichkeit Gottes und ihre Gegenwart ein zentraler Ansatzpunkt unserer Überlegungen. Im Hebräischen steht für Herrlichkeit das Wort kabod (bzw. kavod), das auch Schwere, Ehre oder Gewicht bedeutet. Es steht für die Erscheinung und Präsenz Gottes an einem bestimmten Ort.1 Von dieser Herrlichkeit wird uns berichtet, als Gott Mose auf dem Sinai begegnete:
„Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des HERRN ließ sich auf dem Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage; und am siebten Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu.“
(2Mo 24,15.16)2
Wir lesen hier, dass sich die Herrlichkeit des HERRN niederließ. Das benutzte hebräische Wort schakan bedeutet im Kern einwohnen bzw. Wohnung nehmen. Dieses Verb wird an dieser Stelle in 1Mo 24 zum ersten Mal auf Gott selbst bezogen. Damit ist der grundlegende Gedanke dieser Textstelle gesetzt: Die Herrlichkeit Gottes will bei seinem Volk, das hier durch Mose vertreten wird, Wohnung nehmen. Gott selbst sucht sich auf dieser Erde einen Ort seiner besonderen Gegenwart. Es ist dabei bezeichnend für das Alte Testament, dass die Herrlichkeit Gottes durch die Wolke mit einer Verdunklung einhergeht.3 Gott spricht aus dem Verborgenen heraus und doch in der Erfahrbarkeit seiner Herrlichkeit. Und so, wie Mose Gottes Herrlichkeit erfahren darf, so soll auch das ganze Volk die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes machen, indem es Gott ein Heiligtum baut. So spricht Gott zu Mose: „Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne“ (2Mo 25,8). Und nahezu parallel zu der Erfahrung, die Mose auf dem Sinai gemacht hat, schließt 2Mo mit der Einweihung der Stiftshütte bzw. des Heiligtums: „Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte die Wohnung“ (2Mo 40,34).
Diese Herrlichkeitserfahrung hat auch der Salomonische Tempel gemacht, dessen Zerstörung Hesekiel so schmerzhaft erleben musste. Auch bei dessen Einweihung lesen wir von einem ähnlichen Phänomen der Inbesitznahme des Heiligtums durch die Herrlichkeit Gottes:
„Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des HERRN; und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus des HERRN.“
(1Kön 8,10.11)
Im Kontext dieser Tempeleinweihung bekommen wir weitere wichtige Hinweise, die uns ein vertieftes Verständnis über die Herrlichkeit Gottes und ihre Einwohnung geben. So werden uns folgende Worte Salomos aus seinem Einweihungsgebet überliefert:
„Doch wende dich zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, HERR, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir betet, dass deine Augen Nacht und Tag geöffnet seien über dieses Haus hin, über die Stätte, von der du gesagt hast: Mein Name soll dort sein, dass du hörst auf das Gebet, das dein Knecht zu dieser Stätte hin betet. Und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, das sie zu dieser Stätte hin richten werden. Du selbst mögest es hören an der Stätte, wo du thronst, im Himmel, ja, höre und vergib!“
(1Kön 8,28–30)
Dieses Gebet drückt eine gewisse Spannung aus: Gottes Name soll im Tempel gegenwärtig sein; er wird an den Tempel gebunden. Gott selbst aber thront im Himmel.4 Die kultische Gegenwart Gottes in seinem Namen ist nicht als Einschränkung zu verstehen.5 Mit seinem Namen ist Gott selbst gegenwärtig, wenngleich er im Himmel thront.
Das Geheimnis der Schechina
Die jüdische Lehre von der sogenannten Schechina versucht, auf diese Spannung eine Antwort zu geben. Das Wort Schechina leitet sich von dem bereits erwähnten hebräischen Verb schakan ab (sich niederlassen bzw. wohnen) und meint die Niederlassung Gottes und seine Einwohnung mit all seiner Fülle und Herrlichkeit an einem bestimmten Ort (Tempel) und zu einer bestimmten Zeit bei auserwählten Menschen, wo er gegenwärtig sein und sich offenbaren möchte.6 In der Forschung wird angenommen, dass der rabbinische Gebrauch der Gottesbezeichnung Schechina auf die Einwohnung der Herrlichkeit Gottes auf dem Sinai nach 2Mo 24 zurückgeht.7 Der Begriff taucht bei den Rabbinen erst nach der Zerstörung des zweiten Tempels 70 n. Chr. auf. Er wird seither bevorzugt gegenüber dem Begriff der Herrlichkeit verwendet, allerdings ursprünglich nicht allgemein bzw. indifferent, sondern nur dort, wo das Herabkommen der Herrlichkeit (kabod) mit dem Heiligtum in Verbindung gebracht wird. Der Begriff der Schechina wurde somit ursprünglich geschaffen, um die im Heiligtum einwohnende Gottheit zu bezeichnen.8 In den späteren rabbinischen Schriften wurde das Verständnis der Gegenwartsschechina ergänzt durch eine (vorübergehende) Erscheinungs- bzw. Offenbarungsschechina.9
Damit wird auch deutlich, dass der Ort der Schechina primär nicht im Himmel, sondern auf der Erde zu finden ist, wenngleich Gott selbst im Himmel thront. So bindet sich der unendliche Gott an einen endlichen, irdischen Raum; er beschränkt sich, er erniedrigt sich selbst und „kriecht“ in wenige Quadratmeter Tempel, die dann Heiligtum und Allerheiligstes genannt werden. Ein Raum der besonderen Präsenz Gottes entsteht. Das bedeutet aber nicht, dass mit einer solchen Herrlichkeitskonzentration die allgemeine und kosmische Gegenwart Gottes angetastet wäre: Er sieht alles und bleibt allgegenwärtig, aber er schafft im Tempel einen Raum der Begegnung und Gemeinschaft mit seinem Volk, das ihn dort anbetet.
Die Selbstunterscheidung Gottes
Wir haben es hier mit einer Selbstunterscheidung Gottes zu tun, der im Himmel thront, aber inmitten seines Volkes wohnt. Mit seiner Gegenwart vereinen sich nach jüdischer Mystik Himmel und Erde. Hier wird die Erde vom Himmel „geküsst“. Das ist die große Sehnsucht Gottes und zugleich die Hoffnung des Gottesvolkes.
Liegt bei der Schechina eine Selbstunterscheidung Gottes vor, dann wird offensichtlich, dass sie keine Eigenschaft Gottes ist, sondern seine Gegenwart selbst. Mit Jürgen Moltmann wollen wir diese Feststellung noch spezifischer fassen:
„Sie ist aber nicht Gottes wesentliche Allgegenwart, sondern eine spezielle, gewollte und verheißene Anwesenheit Gottes in der Welt. Sie ist Gott selbst, an einem bestimmten Ort zu bestimmter Zeit anwesend … Die Herabkunft und Niederlassung Gottes an einem begrenzten Ort, zu bestimmter Zeit, bei gewissen Menschen ist darum von Gott selbst, den auch die Himmel nicht zu fassen vermögen, zu unterscheiden.“10
Diese Selbstunterscheidung in Gott hilft uns, die Frage nach der Wohnung und Gegenwart Gottes differenzierter zu beantworten: Etwas, was den Himmeln nicht möglich ist – Gottes Herrlichkeit zu fassen –, soll auf der Erde durch die freiwillige und hingebende Selbsterniedrigung Gottes in den Beschränkungen von Zeit und Raum möglich werden. Was mit der Logik nicht erklärbar ist, wird im rabbinischen Judentum mit der Liebe Gottes zu seinem Volk begründet.
Der Gedanke der Selbstunterscheidung Gottes wurde bei den Rabbinen und in der Geschichte der jüdischen Mystik differenzierter aufgenommen und diskutiert.11 Konsequenterweise wurde mit ihr die Frage nach der Personifikation der Schechina aufgeworfen: Ist sie Gott in Person? Um den Monotheismus zu bewahren und eine Zwei-Götter-Lehre zu verhindern, wurde diese Frage zurückhaltend beantwortet. Manche Rabbinen und Mystiker, die in der Schechina eine Person gesehen haben, haben zur Bewahrung des Monotheismus angenommen, dass Gott mit seiner Schechina wirklich den Himmel und seine Engel verlassen hat, um auf der Erde zu wohnen: Entweder ist er im Himmel oder auf der Erde.12 Wer ihn aber weiterhin im Himmel thronen sah, stand der Frage nach der Personifizierung oder Hypostasierung der Schechina kritisch gegenüber. Die christliche Trinitätslehre konnte hier mit der Selbstunterscheidung Gottes im Rahmen ihrer Dreieinigkeitslehre theologisch anknüpfen, ohne den Gedanken des Monotheismus aufzugeben. Wir werden später darauf zurückkommen.
Ein bewegendes Beispiel der Personifikation der Schechina im Judentum steht im inhaltlichen Zusammenhang mit der Vision von Hesekiel. Der Prophet sieht, wie die Schechina nach und nach den Tempel verlässt und schließlich östlich auf dem Ölberg steht (Hes 9,3; 10,4.18.19, 11,23). Gott verlässt seinen Wohnort unter seinem Volk – er, der sich doch in seiner ganzen Liebe an diesen Ort und dieses Volk gebunden hat. Dann erfährt Hesekiel, dass die Stadt geschlagen (Hes 33,21) und damit einhergehend der Tempel zerstört ist. Er empfängt aber nach dieser Katastrophe eine neue umfassende geistliche Schau von einem neuen Tempel (Hes 40 ff.). Darin eingebettet sieht und erlebt er zudem Folgendes:
„Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her; und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit … Und die Herrlichkeit des HERRN ging in das Haus hinein … und siehe, die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus. Und ich hörte einen, der aus dem Haus zu mir redete … und er sprach zu mir: Menschensohn, sieh die Stätte meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen, wo ich mitten unter den Söhnen Israels wohnen werde für ewig.“
(Hes 43,2–7)
Diese verheißene Rückkehr des HERRN zu seinem Volk wird nun in einem Midrasch so beschrieben:
„Ähnlich kehrt die Schechina, als sie den Tempel verlassen hatte, zurück und umarmte und küsste die Wände und Säulen des Tempels, weinte und sprach: ‚Friede komme über dich, Haus meines Tempels, Friede komme über dich, Haus meines Königtums, Friede komme über dich, Haus meiner Herrlichkeit! Friede komme über dich! (Von nun an soll Friede sein!)‘“
(Echa Rabba, Peticha 2513)
Der Midrasch will ausdrücken, dass die Schechina zwar als Gericht den Tempel verlässt, diesen Schritt aber nahezu bereut. Das Widerstreben ist ihrer Liebe zum Tempel geschuldet. Sie kehrt – als Person – zurück, um dem Ort ihrer Einwohnung zu versichern, dass die nun anstehende Trennung nicht für immer sein würde. Eines Tages wird sie in ein neuerbautes Heiligtum zurückkehren, um diesem Ort für immer Frieden zu schenken.
1.3 Der Strom des Lebens für eine leidende Schöpfung
Während ich hier am Toten Meer in der Nähe von Einot Tsukim stehe und auf das Wasser blicke, muss ich wieder an die Worte von Dany Walter denken: „Die Prophetie von Hesekiel hat sich vor unseren Augen erfüllt!“ So weit sind wir nach meinem Verständnis noch nicht. Und doch spüre ich, was er meint und was ihn in seinem Innersten bewegt. Wenn ich diese Verse aus Hes 47 auf mich wirken lasse, dann wird mir bewusst, dass diese Prophetie weit mehr aussagt, als dass Gott eines Tages das Tote Meer und seine Umgebung neu beleben möchte. Es geht hier um mehr als um eine lokale Prophetie, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal erfüllen wird.
Die leidende Schöpfung als Wohnort Gottes
Ich glaube nicht, dass es sich bei dieser Vision um eine geistliche Metapher handelt, die losgelöst von ihrem lokalen Kontext vor meinen Augen grundsätzlich geistlich verstanden werden will. Das würde bedeuten, dass Gott lediglich das Tote Meer und den Wasserfluss als Beispiel bzw. als ein Bild nutzen möchte, um zu verdeutlichen, dass er alles Tote in uns und um uns herum wiederbeleben möchte – egal wie dürr, trocken und tot es in unserem Leben aussehen mag. Sicherlich kann man diese Vision als Bild gebrauchen, um seelsorgerlich in das Leben von Menschen hineinzusprechen, die ihre Situation als Steinwüste erleben, in der jeder Hoffnungsstrom letztlich zu versalzen droht. Ihnen zuzusprechen, dass der Geist Gottes in uns hineinströmen möchte, um uns wieder lebendig zu machen, kann sehr ermutigend und kostbar sein, aber damit wäre diese Vision von ihrer Bedeutung und ihrer Aussagekraft her nicht erschöpfend ausgelegt.
Ich glaube vielmehr, dass es sich einerseits um eine konkrete Prophetie für diese Region handelt, die aber zugleich etwas Grundsätzlicheres und Tieferes zum Ausdruck bringen will. Sie hat etwas mit dem Heilswirken Gottes und seiner Geschichte mit uns Menschen zu tun. Hesekiel sieht in seiner Vision, dass die Herrlichkeit Gottes nicht auf den Tempel beschränkt sein will, sondern sich Wege in die Schöpfung bahnt. Es beginnt damit, dass Wasser unter der Schwelle des Tempels hervorquillt. Und je weiter sich das Wasser vom Tempel entfernt, desto höher wird erstaunlicherweise der Pegel. Es müsste eigentlich genau umgekehrt sein: Das Wasser müsste sich mit zunehmender Entfernung vom Tempel verteilen und im Boden versickern. Zugleich ist dieses Wasser von ganz anderer Qualität: Es macht lebendig und hat eine schöpferische Kraft, die über die natürlichen Grenzen der alten Schöpfung hinausgeht: Bäume verwelken nicht; sie bringen dauerhaft genussvolle Früchte hervor und ihre Blätter haben eine heilsame Wirkung.
Die Vision ist von eschatologischer Dimension: Sie hat die Heilung und Vollendung der leidenden und seufzenden Schöpfung im Blick. Da dieses Wasser anderen Gesetzmäßigkeiten folgt und in sich göttliche Kraft hat, die sogar das Tote Meer und das ganze umliegende Ökosystem zum Leben bringt, muss es im direkten Zusammenhang mit der Rückkehr und Einwohnung der Herrlichkeit Gottes im Tempel stehen. Herrlichkeit und Wasser sind einerseits zu unterscheiden, andererseits scheinen sie in der Vision vom Wesen her gleich zu sein. Das Wasser ist offensichtlich ein Bild für den Heiligen Geist und sein Wirken in der Schöpfung.
Damit wird Hesekiels bisherige Sicht für den Wohnort Gottes auf Erden auf eine Weise geweitet, die alle bisherige Vorstellungskraft sprengt. Er sieht in der Vision, dass es zukünftig einen neuen Tempel geben wird, in den Gottes Herrlichkeit einziehen wird. Er sieht aber weit darüber hinaus, dass sich von diesem verherrlichten Tempel aus die Gegenwart Gottes durch seinen Geist ausbreiten will wie ein Strom, der alles Tote erfasst und lebendig macht. Die alte Schöpfung wird in eine Neuschöpfung geführt und damit von ihrer Vergänglichkeit und Hinfälligkeit befreit werden. Folglich wird auch der Tod überwunden werden. Gottes heilsame Gegenwart wird sich zukünftig nicht auf einen Tempel beschränken. Das Hoffen auf Gottes Zukunft ist mehr als die Wiederherstellung des Bisherigen. Es ist eine vom Geist gewirkte Verwandlung des Alten und ein Hineinführen in seine Vollendung. Wenn Gott mit seiner Herrlichkeit zurückkommt, dann wird er nach dieser Vision nicht nur an einem bestimmten Ort erfahrbar sein, vielmehr wird er die gefallene Schöpfung selbst zu seinem Wohnort machen.
So ist diese Vision im Hinblick auf den Tempel und die Ausbreitung des Stroms mit der grundlegenden Frage verknüpft, wo Gott wohnt bzw. wo er wohnen möchte. Wie sich noch zeigen wird, hat sie auch etwas mit den Anfängen der Schöpfung zu tun, zugleich aber auch mit ihrer finalen Heilung und Vollendung. Tatsächlich zieht sich dieses Bild aus Hesekiel 47 wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Die Vision ist damit auch mit unserem Leben und unserem Alltag verbunden – gerade auch im Hinblick auf unsere Klimakrise, die zunehmend zur beherrschenden Krise des 21. Jahrhunderts wird. Letztlich geht es hierin um die Frage, ob wir für unsere Erde noch Hoffnung haben dürfen – von Gott her und damit losgelöst von unseren technischen Möglichkeiten, die befürchtete Klimakatastrophe doch noch abwenden zu können. Wird Gott noch einmal in seine Schöpfung eingreifen und sie heilen, wie es Hes 47 nahelegt? Wie und wodurch aber soll dies geschehen? Und welche Dimensionen und Qualitäten von Gottes Einwohnung in seiner Schöpfung erleben wir bis dahin? Oder geht es uns nur noch um eine himmlische Zukunftsperspektive, die das Schicksal dieser Erde vernachlässigt? Dann könnte diese Erde schlichtweg den Bach runtergehen, weil ihre Zukunft eben nicht unsere Zukunft ist.
1.4 Einwohnungen Gottes im Horizont seines Reiches
Ich möchte mit diesem Buch einen Weg gehen, um diesen Fragen nachzuspüren. Mein Ausgangspunkt ist die Vision vom Tempel und dem Lebensstrom aus Hes 47, der hier am tiefsten Punkt der Erde ins Tote Meer mündet. Zu diesem Weg möchte ich Sie, verehrte Leserinnen und Leser, einladen. Dabei wird uns das Bild aus Hes 47 in unterschiedlichen Erfüllungsdimensionen wiederholt begegnen. Unsere Reise wird uns über die „Väter Jesu“, David und Abraham (Mt 1,1), zu den Anfängen der Schöpfung in den Garten Eden führen. Der Garten ist der Urtempel, und bereits in ihm finden wir die Grundlage dessen, was Hesekiel geschaut hat. Von dort aus möchte ich die tiefere und größere Bedeutung des verheißenen Landes beleuchten, die uns über die Geschichte Israels zu Jesus und seiner Gemeinde führen wird. Darin wird uns wiederholt die Frage nach der Gegenwart und Einwohnung Gottes in seiner Schöpfung beschäftigen. Die Vision aus Hes 47 wird uns abschließend eine Zukunftsperspektive für unsere bestehende und die neue Schöpfung eröffnen.
Eine Heilsgeschichte aus der Perspektive der Wohnungen Gottes
Es geht mir in diesem Buch darum, die Heilsgeschichte aus der Perspektive des Wohnens Gottes bei uns Menschen zu entfalten. Mich bewegt darin die Frage, wie Gott in unsere Welt kommt und diese zu einem Raum Gottes werden kann. Die rabbinische Theologie hat diese Frage insbesondere mit dem Nachzeichnen der Bewegungen und des Ruhens der Herrlichkeit Gottes, der sogenannten Schechina, zu beantworten versucht. Diese Theologie ist von der Hoffnung getragen, dass Gott eines Tages endgültig bei seinem Volk wohnen wird. Sie steht im tiefen Einklang mit dem Finale des Buches der Offenbarung im Neuen Testament: „Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen wohnen, ihr Gott“ (Offb 21,3).
Unseren Weg dorthin möchte ich im Horizont des Reiches Gottes bedenken, das mit Jesu erstem Kommen angebrochen ist und mit seiner Wiederkunft vollendet werden wird. In diesem Verständnis geht es letztlich um die eschatologische Vollendung der befreienden Herrschaft Jesu in der Geschichte und damit auch in unserer Schöpfung. Diese befreiende Herrschaft ist schon jetzt durch den Geist Jesu erfahrbar und durch Zeichen und Wunder wiederholt sichtbar; sie zeigen diese neue Wirklichkeit an. Das angebrochene Reich bleibt allerdings bis zu seiner Vollendung angefochten, umkämpft und oftmals verborgen. Die Geschichte des Reiches Gottes ist eine Geschichte, die geprägt ist von Hoffen, Warten und noch ausstehenden Verheißungen. In der Theologie spricht man daher vom sogenannten eschatologischen Vorbehalt. Mit der Wiederkunft Jesu wird dieses Reich unter der Herrschaft des Messias offenbar. Diese eschatologische Spannung beschreibt Jürgen Moltmann so:
„Die befreiende Gottesherrschaft kann darum als die Immanenz des eschatologischen Reiches und das kommende Reich als die Transzendenz gegenwärtig geglaubter und erfahrener Gottesherrschaft verstanden werden. Dieses Verständnis verbietet es, die Gottesherrschaft in das Jenseits totaler Beziehungslosigkeit zum irdischen, geschichtlichen Leben zu verbannen. Es verbietet es aber auch, das Reich Gottes mit vorhandenen oder gewollten Zuständen der Geschichte zu identifizieren.“14
Das Reich Gottes darf demnach weder in die Zukunft verbannt werden noch darf es in der vollendeten geschichtlichen Verwirklichung aufgehen. Zudem geht es über die Grenzen von Kirche und Gemeinde hinaus, weil das Wirken des Geistes nicht auf den Raum der Kirche reduziert werden darf. Das Reich Gottes erschöpft sich nicht in der Kirche, auch wenn sich diese in ihrer langen Geschichte immer wieder als das messianische Reich verstanden hat. Der Geist Gottes ist in der ganzen gefallenen Schöpfung zu finden und wirkt darin mit seinen Kräften der Neuschöpfung.
Die Zukunft der Schöpfung ist keine andere als Christus selbst. Sie erwartet den Kommenden, der bereits durch seinen Geist in ihr gegenwärtig ist. Durch ihn ist das erfahrbar, worauf letztlich alles abzielt: „Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden – das, was im Himmel, und das, was auf der Erde ist“ (Eph 1,10; NGÜ). Dieser schmerzhafte und gewaltige Riss zwischen Himmel und Erde, den wir jeden Tag wahrnehmen und erleben, soll in Jesus zusammengefügt und geheilt werden. Die Herrlichkeit der himmlischen Welt soll mit der Bedürftigkeit einer notvollen und leidenden Schöpfung verbunden werden. Darauf soll alles hinauslaufen. Diesen Weg dorthin möchte ich in diesem Buch beschreiben. Es soll angesichts dieser gebrochenen Schöpfung von einer Melodie der Hoffnung getragen sein. Mögen wir auch als ganze Schöpfung seufzen, wie Paulus es in Röm 8,22 zum Ausdruck bringt: Es ist ein Seufzen auf Hoffnung!
Auf diesem Weg werde ich wiederholt unterschiedliche Orte in Israel aufsuchen, wie es ja auch schon mit meinem Besuch am Toten Meer angeklungen ist. Vielleicht wird dieses Buch manchem von Ihnen ein bereichernder Begleiter auf Ihrer Reise im Heiligen Land werden? Und so möchte ich meine Reise mit Ihnen beginnen. War unser Ausgangspunkt das Tote Meer, so wollen wir uns nun nach Jerusalem aufmachen.
1 Vgl. Schäfer, P.: „Denn ich will unter ihnen wohnen“: Die Schechina der Rabbinen 119.
2 Es ist bezeichnend, dass Gott Mose am siebten Tag zu sich rief. Dieser Tag erinnert uns an den Sabbat. Am sechsten Tag wird der Mensch von Gott erschaffen. Der erste Tag nach seiner Schöpfung bzw. der siebte Tag dient ihm zur Ruhe in der Gemeinschaft mit Gott. Damit er diese haben kann, erfährt er die Niederlassung der Herrlichkeit des HERRN in seinen Lebens- und Erfahrungsbereich. Diese beiden Verse geben uns bereits an dieser Stelle einen Einblick in die endzeitliche Herrlichkeit des kommenden Gottes und in den ewigen Sabbat der Neuschöpfung, wenn sich Himmel und Erde neu vereinen und der Mensch in die Ruhe und ungeteilte Gemeinschaft mit seinem Schöpfer geführt wird.
3 Vgl. auch 1Kön 8,12: „Damals sprach Salomo: Der HERR hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will.“
4 So auch im Wallfahrtslied Ps 123,1: „Zu dir hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst.“
5 Vgl. Janowski, B.: Die Einwohnung Gottes in Israel. Eine religions- und theologiegeschichtliche Skizze zur biblischen Schekina-Theologie 14.
6 Vgl. ausführlich Goldberg, A. M.: Untersuchungen über die Vorstellung von der Schekhinah in der frühen rabbinischen Literatur 439 ff.
7 Vgl. Schäfer, P., a. a. O. 119.
8 Vgl. Goldberg, A. M., a. a. O. 455.
9 So spricht z. B. der Midrasch Schemot Rabba (haggadische Auslegung von 2Mo) bei der Offenbarung Gottes gegenüber Mose im brennenden Dornbusch von der Schechina: Midrasch Schemot Rabba 34.
10 Moltmann, J.: Geist des Lebens 61.
11 Vgl. ausführlich Scholem, G.: Von der mystischen Gestalt der Gottheit 145 ff.
12 Vgl. ausführlich: Schäfer, P., a. a. O. 121 ff.
13 Zitiert nach Schäfer, P: a. a. O. 133.
14 Moltmann, J.: Kirche in der Kraft des Geistes 214 f.
2.
Jerusalem, die erwählte Stadt der Einwohnung Gottes
2.1 Die Jerusalemer Tempel als Wohnorte Gottes
Wieder einmal bin ich in Jerusalem angekommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mich bei meiner ersten Jerusalemreise der Altstadt vom Westen her näherte und auf das Jaffator und die beeindruckende Länge der Mauer blickte. Ich musste mir damals bewusst machen, dass ich wirklich an dem Ort war, von dem der deutsch-israelische Lyriker Yehuda Amichai einmal gesagt hat: „Die Luft über Jerusalem ist geschwängert mit Gebeten und Träumen.“ Diese spezifische Luft kann man hier nahezu atmen. Man kann sie kaum neutral atmen. Juden, Christen und Muslime verbinden mit diesem Ort zentrale Elemente und Ereignisse ihres Glaubens. Jerusalem ist aus religiöser Perspektive wie keine andere Stadt dieser Welt ein Ort, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft(serwartungen) untrennbar miteinander verbunden sind. Diese Stadt umschließt wie keine andere Nostalgie und Prophetie. Ihre Besucher wenden sich einerseits sehnsüchtig vergangenen Gegenständen oder Ereignissen zu, andererseits versuchen sie hier Zukünftiges zu erspüren – in der sichtbaren und unsichtbaren Welt.
In der Altstadt wird diese Spannung zwischen Nostalgie und Prophetie besonders vor der Klagemauer bzw. der Western Wall spürbar, hinter der die goldene Kuppel des Felsendoms emporragt. Wer innerlich in dieser Stadt ankommen will, findet auf der Western-Wall-Plaza vor der Mauer einen guten Ausgangspunkt. Und so suche auch ich diesen Ort auf, der so bedeutsam ist für die Prophetie aus Hes 47 und für die Frage nach dem Wohnort Gottes in dieser Welt. Nachdem ich die Sicherheitskontrolle vor dem Platz durchschritten habe, stoße ich nach wenigen Metern auf folgendes Schild, dessen Inhalt es zweifelsohne in sich hat:
„Die jüdische Tradition lehrt, dass der Tempelberg der Mittelpunkt der Schöpfung ist. Im Zentrum des Berges liegt der Gründungsstein der Erde. Hier wurde Adam erschaffen. Hier dienten Abraham, Isaak und Jakob Gott. Der erste und der zweite Tempel wurden auf diesem Berg erbaut. Die Bundeslade wurde auf den Gründungsstein gesetzt. Jerusalem wurde von Gott erwählt als Wohnort seiner Herrlichkeit (Shechinah).“
(übersetzt aus dem Englischen)
Als ich vor Jahren das erste Mal diese Sätze las, war ich irritiert und verwundert zugleich. Diese großen Themen der Hebräischen Bibel bzw. des Alten Testaments muss man erst einmal auf diese Weise zusammenbringen. Handelt es sich hier um ein raffiniertes Marketing der Western Wall Heritage Foundation, die für die Verwaltung aller Angelegenheiten rund um die Klagemauer zuständig ist? Zweifelsohne erhöhen diese Aussagen die Attraktivität dieses Platzes; diesen Ort muss man einfach besucht und gesehen haben! Sollte hier wirklich der Gründungsstein der Erde liegen? Wurde hier Adam erschaffen?
Die Davidsstadt
Die anschließenden Aussagen über den ersten und zweiten Tempel lassen sich sicherlich biblisch und archäologisch leichter bestätigen. Im Hinblick auf die Existenz des zweiten Tempels kann die Archäologie im Umfeld der Klagemauer zahlreiche Entdeckungen beisteuern. An der Südseite des Tempelberges befindet sich eine beeindruckende Ausgrabungsstätte, die im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr Funde freigeschaufelt und hervorgebracht hat: Der Jerusalemer Archäologische Park, auch Davidson Center genannt, den man gleich hinter dem Dung-Tor an der Südmauer der Jerusalemer Altstadt besichtigen kann. Hier kann man bis in die Zeit des ersten Tempels zurück zahlreiche Funde besichtigen, die helfen, die Geschichte Jerusalems zu rekonstruieren So wurde erst vor wenigen Jahren ein Wasserableitungskanal ausgegraben, der unterhalb der Altstadtmauer den Tempelberg mit der alten Davidsstadt verbindet und mittlerweile auch für Besucher zugänglich ist.
Die alte Davidsstadt liegt nur wenige hundert Meter südlich unterhalb des Höhenrückens, der zum Tempelberg hinaufführt. An ihrem Ort befindet sich heute der City of David National Park, in dem man neben einigen Residenzüberresten Mauern und Türme sehen kann, die zum Schutz der Stadt errichtet wurden. Die zentrale Attraktion des Nationalparks ist der über 500 Meter lange und etwa 2 700 Jahre alte Hiskija-Tunnel, der die außerhalb der Altstadtmauer befindliche Gihonquelle mit dem Siloa-Teich, der innerhalb der Davidsstadt lag, verbindet und somit die Trinkwasserversorgung der Einwohner bei Belagerung sicherte. Heute können Touristen diesen nach König Hiskija benannten Tunnel von der Gihonquelle aus durchschreiten. Nasse Füße sind garantiert; allzu große Platzangst sollte man nicht haben. Auch gibt es keine Ausweichmöglichkeiten; ein Umkehren ist für ängstliche Personen nicht möglich. Zudem braucht man eine Taschenlampe, um Licht auf dieser erfrischenden Zeitreise zu haben. Den Besucher erwartet ein kurzweiliges und spannendes Tunnelerlebnis, bei dem ich, ehrlich gesagt, auch etwas erleichtert war, als ich den Siloa-Teich erreichte, der übrigens erst 2004 entdeckt wurde.
In der alten Davidsstadt findet Zion seinen Ausgangspunkt; hier hat alles begonnen. Zion war ursprünglich die Bezeichnung für die Turmburg bzw. Bergfeste der Jebusiter (2Sam 5,7), die König David um 1050 v. Chr. einnahm und an deren Stelle er seine Stadt errichtete. Sie wurde fortan auch Zion genannt. Auf diesen schmalen Bergkamm, der nicht mehr als rund 400 Meter lang und 150 Meter breit war, holte König David die Bundeslade, die von den Leviten getragen wurde:
„Und David tanzte mit aller Kraft vor dem HERRN, und David war mit einem leinenen Efod gegürtet. So brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des HERRN hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall … Und sie brachten die Lade des HERRN hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte.“
(2Sam 6,14–17)
All dies geschah damals in dem Bewusstsein, dass sich Jahwe als der Bundesgott Israels mit seinem Namen an diese Bundeslade gebunden hatte, in der sich die Bundestafeln befanden, die Mose auf dem Berg Sinai von ihm empfangen hatte. Die Bundeslade war die Lade Gottes, „über die der Name des HERRN, der Name des HERRN der Heerscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist“ (2Sam 6,2). Während Davids 33-jähriger Herrschaft als König über ganz Israel und Juda stand das Bundeszelt in dieser Davidsstadt.
Von der Davidsstadt zum Tempelberg
Als sein Sohn Salomo um 1000 v. Chr. auf dem höher gelegenen nördlichen Nachbarhügel den Tempel errichten ließ, wurde der Begriff Zion von der Davidsstadt auf den Tempelberg übertragen und damit zum „Wanderbegriff“. Von der Überführung der Bundeslade zum Tempelberg in den neu erbauten Tempel lesen wir in 1Kön 8:
„Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Oberhäupter der Stämme, die Fürsten der Geschlechter der Söhne Israel zum König Salomo nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des HERRN heraufzuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion … Und die Priester brachten die Lade des Bundes des HERRN an ihren Platz in den Hinterraum des Hauses, in das Allerheiligste … Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des HERRN, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus des HERRN.“
(1Kön 8,1–11)
Mit der Einweihung des Tempels und der Einwohnung Jahwes als Bundesgott Israels wurde Zion zum Synonym für den Wohnsitz Jahwes und damit auch zum theologisch gefüllten Begriff für den Tempelberg bzw. die ganze Stadt Jerusalem. Durch die Einwohnung Gottes in der Davidsstadt und später auf dem Tempelberg war Jerusalem ohne diesen Gott Israels nicht mehr zu denken. So preist der Psalmist Gott mit Blick auf den Tempelberg, der nördlich oberhalb der Davidsstadt liegt: „Groß ist der HERR und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Sein heiliger Berg ragt schön empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion, im äußersten Norden, die Stadt des großen Königs“ (Ps 48,3).
Dieser Tempelberg trägt auf Hebräisch den Namen har habajit: Berg des Hauses (Gottes). Wir lesen von dieser Bezeichnung bei den Propheten Jesaja und Micha, die mit diesem Berg des Hauses eine zukünftige Vision verbinden. Sie soll an dieser Stelle kurz erwähnt werden, wir werden sie später ausführlicher behandeln: „Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des HERRN fest stehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel; und alle Nationen werden zu ihm strömen“ (Jes 2,2 bzw. Micha 4,1).
In dieser Prophetie finden wir die im Alten Testament am häufigsten gebrauchte Bezeichnung für den Tempel: Haus des HERRN. Oftmals wird auch vom Heiligtum gesprochen (hebräisch: miqdash), das auch als erste Bezeichnung für den Wohnort Gottes diente. So sprach Gott zu Mose: „Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne“ (2Mo 25,8). Ursprünglich war damit die Stiftshütte gemeint; der Begriff wurde aber später auch auf den Tempel übertragen (vgl. 1Chr 22,19). Das Heiligtum war durch die Gegenwartsschechina bestimmt.
Der zweite Tempel
Ich blicke hinüber zur Klagemauer und sehe viele Juden, die dort ihre Gebete sprechen. Sie suchen diesen Ort auf, weil sie zutiefst davon überzeugt sind, was ich auch auf dem Hinweisschild lesen kann: „Der erste und der zweite Tempel wurden auf diesem Berg erbaut.“ Der erste Tempel wurde 586 v. Chr. durch die Babylonier zerstört. Nachdem das Babylonische Reich 539 v. Chr. durch den Perserkönig Kyrus erobert wurde, verfügte dieser ein Jahr später in einem Edikt die Rückkehr des jüdischen Volkes in seine Heimat und den Neuaufbau des Tempels. Die Hebräische Bibel greift mit ihrem Abschluss in 2Chr 36 dieses Ereignis auf:
„Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, damit das Wort des HERRN durch den Mund Jeremias erfüllt wurde, erweckte der HERR den Geist des Kyrus, des Königs von Persien. Und er ließ einen Aufruf ergehen durch sein ganzes Königreich und auch schriftlich bekannt machen: So spricht Kyrus, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der HERR, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der HERR, sein Gott! Er ziehe hinauf!“
(2Chr 36,22.23)
Es ist bewegend, dass die Hebräische Bibel mit diesem offenen Aufruf endet. Daran knüpft sich bis heute die alte jüdische Hoffnung an, dass eines Tages Volk, Land und Gott wieder vereint sein werden – verbunden mit der Neuaufrichtung eines neuen bzw. dritten Tempels.
Dieser Aufruf „Er ziehe hinauf!“ ist in die traditionelle jüdische Trauzeremonie eingeflossen. Im Rahmen des letzten Aktes der Trauung unter der Chuppa bzw. dem Traubaldachin zertritt traditionell der Bräutigam ein auf dem Boden liegendes Glas. Diese Handlung soll symbolisieren, dass das Brautpaar auch im Augenblick seines höchsten Glücks über die Zerstörung des Tempels trauert. Jerusalem liegt noch danieder; das Brautpaar befindet sich damit noch in der Diaspora und will nicht aufhören, für die Rückkehr des Volkes nach Jerusalem zu beten. Der anwesende Rabbiner ruft begleitend Ps 137,5 aus: „Wenn ich deiner vergessen sollte, Jerusalem, möge meine rechte Hand verdorren …“; der Bräutigam wiederholt den Vers. Abschließend wünschen alle Anwesenden dem Brautpaar „Mazel tov“ (wörtlich gutes Glück). Damit ist die Trauzeremonie abgeschlossen.
Der von Kyrus ermöglichte Neubau des Tempels ist unter der Leitung des jüdischen Statthalters Serubbabel und des Hohepriesters Jeschua umgesetzt worden. Serubbabel war der Enkel von Jojachin, dem letzten König von Juda (1Chr 3,16–18; vgl. auch Mt 1,12). Er übernahm nach der Rückkehr als Statthalter (vgl. Hag 1,1) der nun persischen Provinz Juda die politische Leitung des Volkes. Matthäus erwähnt ihn zu Beginn seines Evangeliums im Stammbaum Jesu, womit deutlich wird, dass er, obwohl er nur das Amt eines Statthalters innehatte, tatsächlich der rechtmäßige Thronfolger von König David war und aus seiner Linie eines Tages der Messias als Sohn Davids kommen sollte.
Die zweite zentrale öffentliche Person dieser Zeit des Aufbaus des zweiten Tempels war der Priester Jeschua (bzw. Josua oder Joshua). Er war ein Sohn Jozadaks und zugleich ein Enkel von Seraja, dem letzten Hohepriester des ersten Tempels. Seraja wurde hingerichtet (2Kön 25,18–21), sein Sohn Jozadak wurde nach Babylon verschleppt (1Chr 5,40–41). Damit war Jeschua der rechtmäßige Hohepriester beim Wiederaufbau des Tempels. Im Buch Esra lesen wir, dass Serubbabel und Jeschua im siebten Monat des ersten Jahres nach der Heimkehr aus Babylon den Altar auf seinen alten Fundamenten aufgerichtet und darauf den Opferdienst wieder eingeführt haben. In diesem Zusammenhang heißt es: „Und sie begingen das Laubhüttenfest“ (Esr 3,4).
Die zeitliche Anbindung der Altaraufrichtung an das letzte Jahresfest des Volkes Israel ist von entscheidender Bedeutung, um die geistliche Dimension und Intention zu verstehen. Beim Laubhüttenfest wird zum einen das Einbringen der letzten Jahresernte gefeiert. Auch wird an diesem Fest um Regen für die anstehende Herbstzeit gebetet, damit die Böden für eine neue Saat gut fruchtbar gemacht werden können. Zum anderen steht dieses Fest für die Einwohnung Gottes in der Mitte seines Volkes. Wenn Serubbabel und Jeschua den Altar genau auf seinen alten Fundamenten aufbauen und dies feierlich zum Laubhüttenfest begehen, dann bringen sie ihre Hoffnung und Erwartung zum Ausdruck, dass Gott zum Zion zurückkehren wird, um dort wieder zu wohnen. Um diesen Altar herum legen sie dann auch die Grundmauern bzw. -steine für den neuen Tempel (vgl. Esr 3,10 ff.).
Mit dem Neuaufbau des Tempels und dem Feiern des Laubhüttenfestes besann sich das Volk auf seine geistlichen Wurzeln. Nach der Torah sollte das Laubhüttenfest als Wallfahrtsfest gefeiert werden: „Sieben Tage sollst du für den HERRN, deinen Gott, das Fest feiern an der Stätte, die der HERR erwählen wird. Denn der HERR, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Tun deiner Hände, und du sollst wirklich fröhlich sein“ (5Mo 16,15). Mit dem erneuten Feiern dieses Festes in Jerusalem, der von Gott erwählten Stätte, drückte das Volk die Hoffnung aus, dass auch sein Bundesgott hier wieder wohnen wird. Nur seine Gegenwart macht das Haus aus Steinen zum Tempel und das Laubhüttenfest zu einem Fest der Einwohnung Gottes in der Mitte seines Volkes. Ohne ihn ist all ihr Tun und Feiern sinnlos.
Wo aber Volk und Gott wieder zusammenkommen, muss auch der Boden für einen kommenden König bereitet werden. Und so erweckte der Hohepriester Jeschua auch den Lobpreis- und Anbetungsdienst, wie ihn König David in der Davidsstadt praktizieren ließ und ihn auch sein Sohn Salomo für den ersten Tempel übernommen hat:
„So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des HERRN. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten, mit Trompeten, und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, den HERRN zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem HERRN: Denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des HERRN wegen der Grundsteinlegung zum Haus des HERRN.“
(Esr 3,10.11)
Diese feierliche Einsetzung des Lob- und Anbetungsdienstes, der auch eine prophetische Dimension beinhaltete, da die Anbetungsleiter bei König David prophetisch begabt waren (vgl. 1Chr 25), war einerseits eine geschichtliche Rückbindung an das alte davidische Königtum, das nunmehr über 500 Jahre zurücklag. Damals wurde ihr Dienst vor der Bundeslade – und damit vor dem HERRN – in der Davidsstadt ausgeübt. Mit der Wiederbelebung dieser Tradition wurde andererseits auch die Hoffnung geweckt, dass zukünftig der Sohn Davids aus der Linie Serubbabels kommen werde, mit dem ein neuer Königsmessianismus entstehen würde. Die messianische Hoffnung ist wiederum mit dem Laubhüttenfest verbunden: In der jüdischen Tradition erwartet man das Kommen des Messias zum Laubhüttenfest, um als König in der Mitte seines Volkes zu wohnen (vgl. Abschnitt 10.5).
Der Tempelbau wurde schließlich nach langjährigen Unterbrechungen und großem Widerstand aus der umliegenden Nachbarschaft um 516 v. Chr. vollendet. Unter König Herodes wurde er ab 21 v. Chr. so umfassend umgestaltet, dass er auch als Tempel des Herodes bezeichnet wurde. 70 n. Chr. wurde der Tempel durch die Römer zerstört. Das Hinweisschild auf der Western-Wall-Plaza erinnert an beide Tempel als Wohnorte Gottes.





























