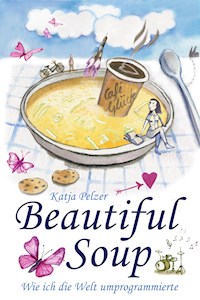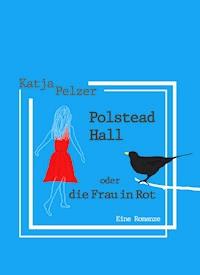Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo dieses Glück denn eigentlich ist, fragt sich auch Alice, die täglich für andere da ist – als Pflegekrankenschwester in einem Luxus-Seniorenheim. Aber für ihr eigenes Glück zu sorgen, das fällt ihr schwer. Alice verliebt sich meist in Männer aus ihren Lieblingsserien auf Netflix. Je unrealistischer ihre Schwärmerei, desto besser, dann bleibt sie ohne Konsequenzen. Vor der richtigen Liebe fürchtet Alice sich, seit sie ihre liebsten Menschen verloren hat. Dann lernt sie den Geflüchteten Mazi kennen, der aussieht, als sei er einer ihrer Lieblingsserien entstiegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katja Pelzer
Wo ist denn eigentlich dieses Glück?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Kapitel Siebenunddreißig
Kapitel Achtunddreißig
Kapitel Neununddreißig
Kapitel Vierzig
Kapitel Einundvierzig
Kapitel Zweiundvierzig
Kapitel Dreiundvierzig
Kapitel Vierundvierzig
Kapitel Fünfundvierzig
Kapitel Sechsundvierzig
Kapitel Siebenundvierzig
Kapitel Achtundvierzig
Kapitel Neunundvierzig
Kapitel Fünfzig
Kapitel Einundfünfzig
Letztes Kapitel
Liebe Leserin, lieber Leser,
Impressum neobooks
Kapitel eins
The noblest art is that of making others happy
(P.T. Barnum)
Er geht auf sie zu.
Ganz langsam.
Beinahe in Zeitlupe.
Wie geschmeidig sein Gang ist.
Sein schwarzer Anzug unterstreicht seine kraftvolle Statur.
In seinen Augen leuchtet etwas Dunkles, Warmes.
Erwartungsvoll schaut sie ihn an.
Er bleibt vor ihr stehen.
Er neigt seinen Kopf herab.
Und dann. Endlich ...
Küsst er sie.
„Endlich“, seufze ich. „Oh Gott, endlich!“
Es war wirklich kaum auszuhalten gewesen! Über vierzig Folgen meiner türkischen Lieblingsserie musste ich durchstehen – mit unendlich vielen Intrigen, die diesen Kuss immer wieder verhindert haben.
Ein paarmal hätten die Beiden sich sogar endgültig verloren, wären tot und für immer getrennt gewesen.
So viel Drama, dass mir manchmal die Puste weggeblieben ist, vor Entsetzen und Verzweiflung. Und das alles auf Türkisch. Mit deutschen Untertiteln. Auf Netflix. Meinem einzigen Zugeständnis an die Erfindung Internet.
Und jetzt küsst Kamran Feride! Endlich!
Erleichtert schließe ich die Augen und kurz habe ich das Gefühl, als hielten Kamrans starke Arme mich.
Mich! Alice, ausgebildete Krankenschwester, weder klein noch sonderlich groß. Ich halte mich für ein bisschen zu dick. Meine Freundinnen finden das weiblich. Meine Locken sind kastanienbraun, schulterlang und meist in einem Dutt zusammengefasst. Meine Haut ist im Kontrast dazu hell und sommersprossig. Meine Augen gleichen dunkelblau-weiß gesprenkelten Murmeln, sagt Iris, meine Nachbarin, Freundin und Buchhändlerin. Ich finde mich blass, Iris findet mich schön. Aber wahrscheinlich möchte sie einfach nur nett sein und erreichen, dass ich mich wohlfühle. Ich kann ohnehin schlecht damit umgehen, wenn jemand etwas Positives über mich sagt. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Das habe ich nicht gelernt. Meine Eltern haben mich zur Bescheidenheit erzogen, denn sie waren selbst bescheidene Menschen. Eitelkeit hatte da keinen Platz.
Jedenfalls halten die Arme des attraktiven türkischen Schauspielers natürlich nicht mich, sondern die schöne zarte Schauspielerin mit den dunklen Mandelaugen, den rabenschwarzen Haaren und der Wespentaille. Sie sind mittlerweile auch in der wirklichen Welt verheiratet. So ein schönes Paar! Was sind die beiden doch für Glückspilze!
Wenn in der Fiktion alles aussichtslos zu sein scheint und sie einfach nicht zueinander finden, beruhigt mich jedes Mal, dass sie sich in Wirklichkeit ja längst bekommen haben.
Kapitel Zwei
Meine Realität ist weniger romantisch. Genaugenommen überhaupt nicht romantisch. Ich arbeite viel und bin von Berufs wegen von morgens bis abends für Andere da.
Jetzt gerade befinde ich mich auf dem Weg zur Arbeit. Zu Fuß.
Vor mir geht ein alter Mann die Straße entlang. Er stützt sich auf einen Stock. Sein Pullover ist am Rücken ein ganzes Stück hochgerutscht und lässt sein Karohemd hervorschauen. Das ist so natürlich nicht gedacht. Dieses Verrutschte, Unperfekte rührt mich, rührt aber irgendwie auch an meinen Ordnungssinn. Dabei kenne ich den Mann ja gar nicht. Wahrscheinlich ist er alleinstehend und reicht mit dem Arm nicht bis zu seinem Rücken, denke ich. Vielleicht hat er es auch gar nicht bemerkt. Aber ich wünsche mir immer, dass es allen gut geht und kann irgendwie nicht aus meiner Haut. Ich schließe also zu dem Mann auf und ziehe seinen Pullover rasch, aber sanft herunter. Flugs geht das. Aber der Mann fährt so ruckartig herum, dass er aus dem Gleichgewicht gerät und gegen mich taumelt. Ich fange ihn auf. Mit beiden Armen, und stemme meine Beine in den Boden, um nicht umzukippen.
„Verzeihung, aber Ihr Pullover war verrutscht!“, sage ich mit leicht belegter Stimme.
Oh Gott, wie ist mir das peinlich!
Der Mann schaut mich ziemlich verdutzt, aber nicht unfreundlich an.
„Alles in Ordnung?“ frage ich, während ich am liebsten im Boden versinken möchte. Was habe ich mir nur dabei gedacht?
Der Mann nickt, schaut mich aus kleinen freundlichen blauen Augen an und sagt beinahe entschuldigend: „Ich dachte, jemand wollte mir mein Portemonnaie stibitzen.“
Lächelnd schüttele ich den Kopf. „Aber nein.“
Jeder rechnet immer direkt mit dem Schlimmsten. Dabei brauchen sie doch alle nur Zuwendung. Ganz viel Zuwendung!
Ich lasse den Mann wieder los und auf seinen eigenen Beinen stehen.
„Wirklich alles in Ordnung?“, wiederhole ich meine Frage.
„Ja, danke. Sie sind sehr liebenswürdig.“
Ich strahle ihn an. War wohl doch gut, dass ich seinen Pullover in Ordnung gebracht habe.
„Schönen Tag!“ sage ich und winke ihm noch einmal zu.
„Danke“, sagt der Mann noch einmal „Ihnen auch.“
Dann eile ich weiter.
„Krieg macht Flucht“ hat jemand mit gelben Lettern irgendwo auf die steinerne Oberfläche des Bürgersteigs gesprüht, ganz akkurat, sicher mit Hilfe einer Schablone. Ich gehe darüber hinweg, obwohl diese gelben Worte mich keineswegs kalt lassen. Aber ich muss nun mal weiter, komme sonst zu spät. Was hätte ich auch tun sollen? Etwa darunterschreiben – „gefällt mir“?
Eine Frau mit Einkaufstüten rempelt mich im Vorübergehen an. Ich rufe „Entschuldigung.“
Sie hat, wohlgemerkt, nicht auf ihr Handy geschaut, während sie mich angerempelt hat. Nein, sie hat mich sehenden Auges umgerannt. Das passiert mir ständig, als würde ich einen Umhang tragen, der mich unsichtbar macht. Und ja, ich gehöre auch zu den Menschen, die sich selbst für Sachen entschuldigen, für die sie gar nichts können. Beinahe im selben Moment denke ich jetzt allerdings wie bescheuert das ist.
Ich laufe weiter. Einen Fuß vor den anderen. So wird ein Weg draus.
Ich bin eigentlich kein hektischer Mensch, aber irgendwie dennoch immer schnell unterwegs. Als sei jemand hinter mir her. Ich selbst bin es vermutlich. Oder meine hohen Ansprüche an mein Tagespensum.
So, da bin ich...
Ich straffe meinen Rücken, nehme eine positive Haltung ein und öffne die Tür des Seniorenheims, in dem ich als Pflegeschwester arbeite. In Schichten. Immer acht Stunden. Wie ein Uhrwerk.
Der Bau ist aus Glas und viel Holz, modern und leicht gebaut, als wollte er die Schicksale kontrastieren, die in seinem Inneren in ihre letzte Phase treten.
Ich gehe den hellen Flur des Eingangsbereichs entlang, grüße Christel, die am Empfang sitzt und mich freundlich zurückgrüßt und betrete den langen, etwas weniger hellen Flur zu unserem Aufenthaltsraum.
Aus der Kantine kriecht ein Geruch nach Sauerkraut und gepökeltem Schweinefleisch. Er hat bereits große Teile des Flurs erobert, obwohl es erst neun Uhr morgens ist.
Eine der Nachtschwestern kommt mir entgegen, grüßt knapp und sagt emotionslos:
„Herr Schroer ist heute Nacht um eins gestorben.“
Wo täglich gestorben wird, sind Emotionen Luxus.
Ich nicke, während leichter Ekel in mir hochsteigt, als ich kurz das teigig-bleiche Gesicht von Herrn Schroer vor meinem geistigen Auge sehe. Sofort schäme ich mich dafür. Aber es ist so, dass Herr Schroer ziemlich große Hände hatte, mit denen er uns Schwestern gerne an sich gezogen hat. Wahllos, wen er eben zu packen kriegte.
„Schwesterchen“ hat er mich immer genannt.
„Setz dich doch zu mir!“, hat er gerufen, wenn ich auf der Pflegestation nach ihm gesehen habe.
Er hat immer sehr laut gesprochen, weil er schlecht hörte. Aber natürlich habe ich mich nicht zu ihm aufs Bett gesetzt. Also bitte!
Hin und wieder habe ich ihm mal über den Kopf gestreichelt. Oder den Oberarm. Das hat mich natürlich auch ziemliche Überwindung gekostet, weil ich keine weiteren Erwartungen in ihm wecken wollte. Aber alte Menschen brauchen eben besonders viel Zuwendung. Gleichzeitig bekommen sie meist am wenigsten. Einer dieser Widersprüche im Leben.
Jetzt ist Herr Schroer also tot. Diesen Weg gehen sie hier alle. Auch die Netten, Charmanten, Lebenslustigen. Zu diesen gehörte Herr Schroer nicht. Aber über Tote spricht man nicht schlecht. Daher würde ich meine Meinung über den Alten natürlich nie laut äußern. Obwohl ich weiß, dass ich mit dieser Ansicht nicht allein bin.
Stattdessen frage ich die Nachtschwester: „Weiß seine Tochter Bescheid?“
„Wir dachten, dass du vielleicht anrufen könntest. Du hast so eine nette Art“, antwortet die Nachtschwester.
Ach ja, meine nette Art. Das meiste bleibt an mir hängen. Ich seufze innerlich. Irgendwie hat immer jemand eine Bitte, ein Anliegen. Und ich sage dann eben nicht nein.
Gerade wundere ich mich, warum die diensthabende Schwester es nicht einfach selbst getan hat, dann wäre es längst erledigt. Aber dann schlucke ich die Frage herunter, bevor sie aus meinem Mund heraustreten und im Raum stehen kann. Ich komme mir direkt kleinlich vor, dass ich das überhaupt denke. Das ist schon in Ordnung, dass ich den Anruf mache. Das erledige ich am besten direkt, damit es abgehakt ist.
„Habt ihr die übrigen Vorkehrungen getroffen?“, frage ich stattdessen.
„Er ist bereits abgeholt worden“, antwortet die Nachtschwester.
Erleichtert atme ich auf. Ich hätte den Tag nur ungern mit der Leiche eines kauzigen, übergriffigen, alten Mannes begonnen. Wenigstens das bleibt mir erspart.
Wie so oft wird mir gerade vor Augen geführt, dass unser Tun im Seniorenheim sich durch eine gewisse Vergeblichkeit auszeichnet. Egal, wie wohl sich jemand hier fühlt. Egal wie unglücklich oder glücklich jemand in seinem Leben gewesen ist – am Ende werden sie alle abgeholt.
„Schwester Alice“, die Stimme in meinem Rücken gehört Doktor Benno Franzen. Sie ist tief und weich und treibt mir Röte und Wärme ins Gesicht. Außerdem besitze ich plötzlich Knie aus Gummi. Schrecklich. Ich hasse es, dieses lebende Klischee zu sein. Denn ja, natürlich bin ich in den Doktor verknallt. Ein bisschen zumindest. Na gut, ziemlich. Aber hoffnungslos. Schließlich ist er verheiratet und hat zwei Kinder, so viel ich weiß.
Ich wende mich um und schaue ihn erwartungsvoll an. Wird er mich endlich, endlich in die Arme nehmen und küssen?
Leider ist mir kurz entgangen, dass ich gerade nicht in einer meiner Lieblingsserien unterwegs bin.
„Könnten Sie bitte mal in der Drei nachsehen! Frau Eberhard braucht ihre Hilfe“, nüchtern sagt er das. Ohne den geringsten Hauch von Charme.
„Aber natürlich, Herr Doktor“, sage ich und lächele ihn an. Doch da hat er sich schon wieder umgedreht und ist weiter den Gang hinuntergeeilt.
Und ich muss in die entgegengesetzte Richtung. Zu Frau Eberhard.
Dr. Franzen sieht tatsächlich immerhin so aus wie die Männer aus meinen türkischen Lieblingsserien und Bollywood-Filmen, die ich Dank Netflix sehen kann. Sie sind meist dunkelhaarig, tragen Dreitagebärte oder einen Schnauzbart und haben wunderbar geformte, starke Arme. Allein bei dem Gedanken an diese Arme, wird es in meiner Körpermitte ganz weich, warm und sehnsüchtig. Aber genug geträumt. Weiter geht’s, immer weiter. Zur Drei, zu Frau Eberhard.
Das Seniorenheim „Zum kleinen Apfelbaum“, in dem ich nun immerhin schon fünf Jahre arbeite, gehört übrigens zu den besseren Einrichtungen seiner Art. Die Einwohner können ihre eigenen Möbel mitbringen und ihren ganzen Nippes noch dazu und sie in die zwischen zwanzig und siebzig Quadratmeter großen Appartements stellen – je nach Geldbörse. Das ist prima für die Privatsphäre, hat der Träger der Einrichtung beschlossen. Zu jeder Wohnung gehört ein Balkon, manchmal sogar eine Terrasse. Die Bewohner können uns Schwestern rufen, wann immer sie etwas auf dem Herzen haben – so eine Art betreutes Wohnen ist das hier. Auch so schauen wir regelmäßig vorbei – für routinemäßige Untersuchungen, wie Blutdruckmessen oder Herz abhören. Außerdem achten wir darauf, dass die etwas Vergesslicheren ihre Medikamente pünktlich einnehmen. Einige von uns, ich gehöre dazu, leisten den Menschen auch immer mal Gesellschaft, wenn sie sonst nicht viel Besuch bekommen. Wir spielen Uno oder Mensch ärgere dich nicht mit ihnen, oder was sie sonst für Spiele im Wohnzimmer Schrank haben. Cluedo war auch schon dabei, aber da gehören mehrere Spieler dazu. Oder das Spiel mit der Burg, ich habe gerade den Namen vergessen. Frau Eberhard spielt das so gerne. Allerdings ist sie eine totale Pfuscherin. Wenn ihr die gewürfelte Zahl nicht gefällt, würfelt sie einfach noch mal. Oder sie würfelt so, dass der Würfel unter den Tisch fällt. Sie hebt ihn dann auf und legt die Zahl nach oben, die ihr in den Kram passt.
Ich finde das okay, ich muss nicht immer Recht haben. Hauptsache, sie hat ihren Spaß. Und sie ist eine echt schlechte Verliererin. Ich lasse sie daher eh meistens gewinnen.
Eigentlich sind wir hier eher Kümmerer, als Schwestern und Pfleger. So lassen sich die letzten Lebensjahre jedenfalls gut verbringen, da sind wir uns hier alle einig – Kümmerer wie Bewohner.
Ich habe schon ganz andere Zustände erlebt.
Teilweise waren wir in anderen Heimen so unterbesetzt, dass ich die Bewohner regelmäßig dehydriert und apathisch vorgefunden haben, mit Maden unter den Achseln.
Es war wirklich abscheulich dort und menschenunwürdig. Für die Einrichtung absolut beschämend.
Ich habe dort versucht überall gleichzeitig zu sein und jedem Einzelnen genug Aufmerksamkeit zu schenken. Aber das konnte mir natürlich nicht gelingen und irgendwann bin ich in meinem Hamsterrad regelrecht durchgedreht. Ich war so ausgebrannt, dass ich gehen musste, um nicht auch noch vor die Hunde zu gehen. Das fiel mir schwer, denn ich habe ja die lieben alten Leutchen ihrem Schicksal überlassen. Ich hatte große Schuldgefühle deswegen. Ich habe dann aber einsehen müssen, dass ihre Leben nicht von mir abhingen. Es musste sich grundsätzlich etwas ändern in der Einrichtung.
Meine Therapeutin, Frau S., sah natürlich noch viel mehr in meinem Verhalten, als das vergebliche, sisyphosartige Anrennen gegen schlimme Zustände. Sie ist schließlich Therapeutin und balanciert meist über die Metaebene.
Sie sagte mir, ich würde nicht damit klarkommen, dass ich den Tod meiner Eltern nicht hätte verhindern können. Im Heim hätte ich versucht, alles Menschenmögliche zu geben, um all die dort Lebenden zu retten oder ihnen zumindest ein wertes Leben zu ermöglichen. Aber das sei illusorisch und zum Scheitern verurteilt gewesen. Ich sei an meinen eigenen Ansprüchen zerbrochen.
Na ja, ich habe es jedenfalls überlebt.
Nach einem Jahr Schonzeit habe ich mich dann im Seniorenheim „Zum kleinen Apfelbaum“ beworben. Der Name erschien mir so hoffnungsvoll und lebensbejahend, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es dort ähnlich menschenverachtend zugehen könnte, wie an meinem vorherigen Arbeitsplatz. Und genauso ist es.
Ich habe das Gefühl, dass in diesem Heim die Menschen noch gesehen werden, und nicht einfach nur auslaufende Nummern sind.
Auch die zuständigen Ärzte sind fähig und freundlich. Vor allem natürlich Doktor Franzen. Aber er sieht dazu auch noch umwerfend aus. Finde ich jedenfalls.
Es gibt neben dem Seniorenheim übrigens nicht nur einen kleinen Apfelbaum, sondern gleich eine ganze Streuobstwiese. Zwischen den Apfelbäumen mit alten Sorten wie Berlepsch und Topaz steht auch der eine oder andere Birnenbaum. Bewohner, die noch können und Schwestern, die Lust dazu haben, sammeln die Früchte gemeinsam im Laufe des Spätsommers. Dann gibt es frischen Apfelsaft aus der großen Presse, die der Koch angeschafft hat.
Frau Meier, eine Bewohnerin des Heims, kocht köstlich-zimtiges Apfelkompott und macht es ein. Ich backe gedeckten Apfelkuchen, nach einem Rezept meiner Mutter. Und auch unter den Bewohnerinnen ist immer eine, die ein leckeres Kuchenrezept kennt und Kuchen beisteuert.
So, jetzt bin ich bei der Nummer Drei angekommen. Und auch wenn Herr Dr. Franzen mich nicht explizit darum gebeten hätte, wäre ich als erstes bei Frau Eberhard vorbeigegangen. Sie ist einer meiner Lieblingsschützlinge. Wenn ich das so sagen darf. Denn natürlich sollte ich für alle gleich gerne da sein. Aber ich bin eben auch nur ein Mensch. Und jeder Mensch hat so seine Vorlieben und Lieblinge. Frau Eberhard berührt mich jedenfalls auf ganz besondere Art.
In diesem Moment erwartet sie mich bereits in ihrer Appartementtür, auf ihren Rollator gestützt, aber dabei ganz aufrecht. Sie trägt ein schönes, dunkelblau-weiß-gestreiftes Seidenkleid, mit goldenen Knöpfen, auf die kleine Anker geprägt sind.
Frau Eberhard hat noch immer einen auffallend guten Stil, finde ich. Ihr liebes Gesicht leuchtet auf, als sie mich sieht.
„Oh Schwester Alice, wie schön! Danke, dass sie vorbeikommen. Ich brauche bitte Milch für meine Katzen.“
Ich lächele verständnisvoll und nicke der zarten kleinen Frau wohlwollend zu.
„Na, dann werde ich gleich mal welche holen“, antworte ich und versuche, dabei munter zu klingen. Munter ist hier wichtig.
Auch wenn Frau Eberhards Katzen reine Hirngespinste sind. Die Dreiundachtzigjährige leidet nämlich unter Parkinson und zu den schubweisen Lähmungserscheinungen gesellen sich immer wieder höchst lebendige Halluzinationen. Regelmäßig ruft sie nachts um Hilfe, weil sie ganze Partygesellschaften in ihrem Wohnzimmer wähnt. Wenn ich nachts im Dienst bin, schicke ich die unerwünschten Gäste einen nach dem anderen nach Hause. Auf Frau Eberhards kindlich-hübschem Gesicht breitet sich dann selige Entspannung aus und sie schläft rasch wieder ein, als wenn nichts gewesen wäre.
Jetzt schaut sie mich erwartungsvoll an. Und ich mache auf dem Absatz kehrt, um in der großen Hauptküche Milch zu holen.
Doch als ich wenige Minuten später mit der Milch zurückkomme, schaut Frau Eberhard mich nur erstaunt an und sagt. „Aber Schwester, Sie wissen doch genau, dass ich keine Milch mag!“
So ist das meistens. Ich lächele, streichele über eine von Frau Eberhards Hände, die schmal, knochig und von Altersflecken übersät auf den Griffen ihres Rollators liegen.
„Weiß ich doch!“, sage ich. „Ich wollte sie Herrn Arnold bringen. Der möchte sie für seinen Kaffee.“
„Ach so“, sagt Frau Eberhard. „Dann bestellen Sie dem Herrn Arnold mal charmante Grüße und wohl bekomm’s!“ Sie knipst mir kess ein Auge zu, während sie das sagt.
Herr Arnold hat nämlich eine große Schwäche für Frau Eberhard. Aber sie mag ihn auch. Das hat sie mir mal anvertraut. Außerdem sehe ich die beiden an sonnigen Tagen manchmal nebeneinander auf ihren Rollatoren unter einem der Apfelbäume sitzen. Auch schon mal Händchen haltend und die Köpfe tuschelnd oder schmusend zusammengesteckt. Mich rührt der Anblick dieser beiden reizenden Alten so sehr, dass er mir ins Herz zwickt. Ich denke dann an meine Eltern und dass sie zusammen haben alt werden wollen.
Kapitel Drei
Meine Eltern waren gläubige Menschen. Sehr gläubige.
Jeden Sonntag schleiften sie mich in die Kirche. Schon in einem Alter, in dem mir die Worte von der Kanzel wie eine Fremdsprache erschienen.
Mein Vater hieß Paul und als ich ein kleines Mädchen war, engagierte er sich hin und wieder in der Gemeinde. Er las während der heiligen Messe manchmal das Evangelium, holte die Hostien aus dem Tabernakel und verteilte sie gemeinsam mit dem Pastor. Wenn der Pastor während der Wandlung dann Papst Paul dankte und für ihn betete, war ich überzeugt, dass mein Vater der Papst war, schließlich machte er ja die ganze Zeit all diese sinnvollen Dinge während des Gottesdienstes. Und er hieß Paul. Mir kam das sehr schlüssig vor.
Eines Tages, nach der Messe, fragte ich ihn. Weil ich so davon überzeugt war, kam die Frage, vermutlich eher rhetorisch rüber, nach dem Motto: „Du bist doch der Papst, oder!?“
Ich habe meinen Vater noch nie so lachen sehen. Vorher nicht und nachher nicht. Und als er es Sekunden später meiner Mutter erzählte, weil ich die Frage nicht besonders laut gestellt hatte, lachte auch meine Mutter schallend. Erst war ich leicht beleidigt. Dann freute ich mich aber, dass ich sie so zum Lachen bringen konnte. Und dann sah ich auch ein, dass mein Vater ja gar keine Zeit hatte, der Papst zu sein, weil er eigentlich als Jurist bei einer Firma gearbeitet hat. Meine Mutter war seit meiner Geburt zu Hause geblieben. Vorher hatte sie als Sekretärin in derselben Firma gearbeitet wie mein Vater.
Alice heiße ich, weil meine Mutter Lewis Carroll liebte. Sie war selbst eine große Geschichtenerzählerin. Und Lewis Carroll war für sie sozusagen der Urvater der Fantasy. Sie nahm mich einmal mit ins Kino in den Disney-Trickfilm Alice im Wunderland. Ich habe nur ihr zu Liebe durchgehalten. Am liebsten wäre ich schreiend rausgerannt. Vor allem die Herzkönigin und ihre Garde waren mir als Kind zu unheimlich. Meine Mutter hat mir einmal gesagt, dass sie mich Alice genannt hat, weil sie hoffte, dass ich für mich auch eine Art Wunderland finden würde, in dem ich mich würde behaupten können, in dem ich schrumpfen, wachsen und schließlich ich selbst werden könnte – ein richtig guter Mensch. Mit lustigen Freunden und ganz viel Glück Aber es ist gar nicht so einfach ein guter Mensch zu sein, und gleichzeitig glücklich.
Den frühen Tod meiner Eltern konnte ich jedenfalls weder verhindern noch verwinden. Sie sind bei einem Busunglück ums Leben gekommen, als sie sich einmal alleine eine Reise gönnten. Da war ich gerade mit der Schule fertig und achtzehn Jahre alt. Lange hatten sich meine Eltern auf diese Fahrt nach Slowenien gefreut. Sie hatten schon so viel über die unberührte Natur dort gehört und mein Vater war ein leidenschaftlicher Fliegenfischer. Er stand dann in Slowenien mit seinen wasserdichten Hosen und hohen Gummistiefeln in den wilden Flüssen. Die meisten Fische, die er fing, ließ er wieder frei. Nur zwei Regenbogenforellen ließen er und meine Mutter sich in ihrem Hotel zubereiten. Sie hatten eine wunderbare Zeit. Das erzählten sie mir am Telefon.
Ich habe sie nie wiedergesehen.
Der Bus war an der Steilküste in einer Kurve mit einem Lkw kollidiert, der viel zu schnell unterwegs gewesen war. Der Bus war in Flammen aufgegangen und meine Eltern hatten sich nicht mehr rechtzeitig aus dem brennenden Bus retten können.
Das ist schon eine ganze Weile her.
Aber so kommt es, dass ich noch immer dort lebe, wo ich aufgewachsen bin. In der Wohnung meiner Eltern. So kann ich ihnen auch weiterhin nah sein und mich auf eine Art sicher fühlen, wie ich es nicht tue, wenn ich mich außerhalb meiner Komfortzone bewege.
Ich habe dann doch nicht Literatur und Sprachen studiert, wie ich es eigentlich vorgehabt hatte.
Das ging nicht. Mir fehlte einfach das Geld. Eine Ausbildung schien mir vernünftiger. Krankenschwestern wurden immer gebraucht. Und nach dem Tod meiner Eltern, hatte ich das Bedürfnis zu helfen. Das war beinahe organisch. Eines hat sich aus dem anderen ergeben. Ich habe diese Entscheidung später nie hinterfragt. Wahrscheinlich habe ich irgendwann auch keine andere Wahl mehr gehabt. Also bin ich jetzt Schwester und Kümmerin Alice.
Kapitel Vier
Als ich nach der Arbeit nach Hause komme, steht Iris im Hinterhof vor ihrer Wohnung und raucht eine ihrer langen eleganten Zigaretten.
Iris ist groß und schlank und hat fast schwarze Haare, die sie in einem sehr akkuraten Pagenschnitt trägt. Ihr Pony endet mitten auf der Stirn. Dort bleibt er seit Jahren. Weil sie ihn konsequent einmal in der Woche Millimeter genau selbst nachschneidet.
Noch bevor ich bei Iris ankomme, schießt ihre Zwergschnauzer-Hündin Nelly auf mich zu, schwänzelt um mich herum und springt an mir hoch. Sie stellt ihre flauschigen Pfoten auf meine Knie, schaut mich aus langbewimperten braunen Augen steinerweichend an und lässt sich ausgiebig von mir begrüßen. Dankbar streichele ich ihr weiches schwarz-silbernes Fell. Das ist nach so einem Arbeitstag die beste Therapie.
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich liebe meine Arbeit. Aber natürlich ist sie auch anstrengend. Da ist es gut, dass das Nachhause-kommen, wie die Fahrt auf eine Insel oder in eine Oase ist. Still ist es hier. Ein großes Tor schottet uns abends von der Außenwelt ab.
Unser Hinterhof besteht aus vielen kleinen Gärten. Die meisten Bewohner haben ein echtes Händchen für alles Blühende. Iris ist eine davon. Vor dem ebenerdigen Eingang zu ihrer Wohnung wächst eine Eiche. Drumherum hat sie Narzissen und Tulpen gepflanzt, aber auch Spätblühendes, damit hier das ganze Jahr über Blumen wachsen. Außerdem hat sie mehrere Salat- und Kräutersorten gesetzt.
An den Wochenenden stellt sich Iris manchmal einen Stuhl nach draußen und liest im Schatten ihres Baumes die Zeitung oder ein Buch. Manchmal setze ich mich zu ihr und wir erzählen uns von unserer Woche, von den Menschen, die uns begegnet sind und überhaupt, was alles so passiert ist, in der Welt.
Iris versorgt mich immer mit den neusten Liebesromanen aus dem Buchladen, in dem sie seit ihrer Jugend arbeitet. Sie ist etwas älter als ich. Ihr Sohn ist längst aus dem Haus und ihr Mann noch länger. Wenn sie heute Kontakt zu ihm hat, dann nur, um mit ihm über ihren Sohn zu sprechen oder um der alten Zeiten willen. Heute verbindet sie kaum noch etwas sonst mit ihm. Aber sie sind sich auch nicht mehr böse. Die Menschen, derentwegen sie auseinander gegangen sind, gehören ebenfalls längst ihrer Vergangenheit an.
Zugegeben – es ist auch nicht immer nurstill bei uns im Hof. Denn hinterm Haus verlaufen Bahngleise. Aber es ist ein relativ gleichmäßiges schnurrendes Geräusch, das die vorbeifahrenden Züge verursachen. Wenn auch Schlafen bei geöffnetem Fenster unmöglich ist.
Aber Grün ist es bei uns. Der Bahndamm – wild bewachsen mit Brombeerbüschen, Kirschbäumen und Sommerflieder – ist das reinste Biotop. Hier brüten viele Vögel.
„Hast du schon die Sache mit Piet gehört?“ fragt Iris mich.
Ich schüttele den Kopf. Was er wohl jetzt wieder angestellt hat?
Piet ist ein weiterer Nachbar und gleichzeitig der Vermieter und Verwalter des Gebäudes, in dem meine Eltern einst unsere Wohnung gekauft haben. Piet ist eigentlich gelernter Schreiner und hat seine Werkstatt ebenfalls in unserem Hinterhof. Er hat von seinen Eltern verschiedene Immobilien geerbt, die er verwaltet und von deren Mieteinnahmen er ganz gut leben kann.
Piet ist aber auch Umweltaktivist. Er ist Mitglied bei sämtlichen Organisationen von Avaaz über change.org bis hin zu Sumofus. Und natürlich bei Greenpeace. Er unterschreibt jede Woche mindestens eine Petition. Für die Orang Utans in Borneo, die Elefanten in Afrika oder gegen den Plastikmüll. Häufig startet er auch eigene Aktionen. Dabei kommt er manchmal mit dem Gesetz in Konflikt.
Iris versorgt ihn mit Büchern von Alain de Botton, Schätzing oder Precht. In meine Gedanken hinein erzählt sie mir von Piets neustem Projekt:
„Er hat tonnenweise leere Pappbecher aus den Mülltonnen in der Innenstadt zusammengetragen und sie mit seinem Sprinter vors Rathaus gekippt. Dann hat er sich selbst als Riesenpappbecher verkleidet und mit ein paar Freunden und Plakaten gegen die Verschwendung und die Riesenmüllberge protestiert, die wir mit unserem wahnwitzigen Coffee-to-go verursachen. Das kam nicht so gut an. Dabei hat er ja Recht!“, erzählt Iris mir. „Er hat mir vorgerechnet, dass die leeren Becher nur eines Jahres, würde man sie übereinanderstapeln, bis zum Mond reichen würden.“
„Das ist schon ein echter Wahnsinn“, sage ich und muss kurz an den schönen Bambusbecher mit den bunten Blumen und den schön hin geschnörkelten Worten All you need is love