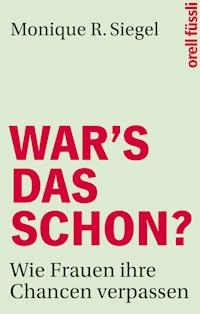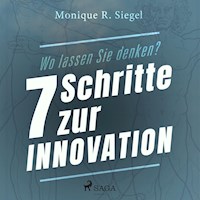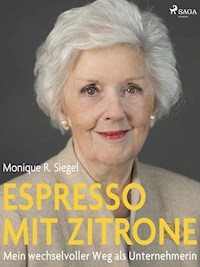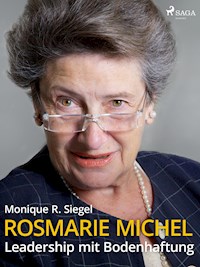Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein unterhaltsames Essay, dass unsere Denkgewohnheiten mit jenen von Leonardo da Vinci konfrontiert.Zu Anfang scheint es sich bei diesem Werk um eine literarisch unterhaltsame Untersuchung zu handeln, doch nebenbei ist es auch eine Anleitung für neue Denkweisen. Ist es möglich Denken selbst zu einem sinnlichen Vergnügen zu machen? Mit Siegels sieben Schritten und Thinking-Tools zu neuen Denkansätzen auf jeden Fall! Und dazu bringt sie dem Leser auch noch bei eine Unternehmenskultur des kreativen Denkens nicht nur zu entwickeln sondern auch zu verwirklichen. Denn jedes Business startet mit einer Idee, die nur richtig umgesetzt werden muss.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monique R. Siegel
Wo lassen Sie denken?
7 Schritte zur Innovation
Saga
Wo lassen Sie denken? - 7 Schritte zur Innovation Copyright © 2006, 2019 Monique R. Siegel und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726071276
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Denken: delegierbare Pflichtübung
oder sinnliches Vergnügen?
Kreativität ist eine Haltung.
Dazu gehören Neugierde, Kritikfähigkeit, Mut und auch so etwas wie Lebensfreude.
Lothar Späth
Sie ist nie mein Lieblingsbild geworden, diese Mona Lisa, und ich finde ihr viel besungenes Lächeln weder so aufregend noch so geheimnisvoll, dass ich mich länger damit beschäftigen möchte. Dass Kunstkritiker bis heute darüber rätseln, wer denn nun das Vorbild für dieses Porträt aller Porträts gewesen ist, hat mich eher erstaunt als fasziniert; es ist ja nicht das einzige Porträt, dessen Original nicht bekannt ist. Als ich dann endlich im Louvre vor ihr stand, fand ich es schwierig zu begreifen, warum dieses relativ kleine Bild hinter Glas das einzige war, zu dem man einen größerem Abstand halten und für dessen Besichtigung man anstehen musste.
Auch das berühmte «Abendmahl», das sich jetzt in restauriertem Zustand den Besuchern von Mailands Kirche Santa Maria delle Grazie präsentiert, hat in mir keine Euphorie erzeugt. Während jedes Werk von Michelangelo mich auf Anhieb begeisterte, konnte ich seinem Zeitgenossen Leonardo die längste Zeit nur ein lauwarmes Interesse entgegenbringen.
Das begann sich zu ändern, als ich die Zeichnung, die sich die Firma Manpower zu ihrem Logo erkoren hatte, mit ihm in Verbindung brachte. Eine nähere Beschäftigung damit vermittelte Einsichten in den Zeichner Leonardo. Doch die eigentliche Explosion in meinem Kopf fand statt, als das Zürcher Landesmuseum im Jahre 2000 Leonardo da Vinci eine große Ausstellung widmete, in der sie den Fokus nicht auf die Malerei, sondern auf den Erfinder, den Renaissancemenschen, den großen Geist richtete. Ich begriff schlagartig, warum er als Genie aller Zeiten betrachtet wird: Es ist der Wissenschaftler, Ingenieur, Forscher, Erfinder und Entdecker Leonardo, der mich fasziniert. Es sind die ungeheuer präzisen Zeichnungen und Studien von Dingen, die damals noch nur in seinem Kopf existierten. Es ist die Akribie, mit der er den menschlichen Körper in seinen Bewegungsabläufen oder ein Tier im Sprung immer wieder untersucht und festhält, die mich mit Bewunderung erfüllt. Und es sind die bekannten Rötelzeichnungen, die mir den Zeichner und Maler viel näher bringen als das wohl berühmteste Porträt der Kunstwelt.
Produkte einer anregend-anstrengenden Epoche
Renaissancemensch: eine Metapher für Männer (bei Frauen scheint das weniger erwähnenswert zu sein, vielleicht, weil Vielseitigkeit ohnehin zu ihren tradierten Eigenschaften gehört?), die, vielseitig interessiert, über Talent, Können und Wissen auf ganz verschiedenen Gebieten verfügen.
Viele italienische Künstler, die zwischen Beginn des 14. und Ende des 16. Jahrhunderts leben, sind Multitalente, gleichzeitig erfolgreich in Architektur, Bildhauerei und Malerei. Eine Reihe von ihnen leistet Pionierarbeit als Ingenieure im Bauwesen; andere versuchen sich in Poesie oder hinterlassen Spuren als Musiker. Unternehmerisches Denken, Zeitmanagement und die Führung von großen Ateliers müssen ebenso zu ihren Talenten gehören wie Verhandlungsgeschick im Umgang mit großzügigen, aber äußerst fordernden Auftraggebern. Sie leben in einer Zeit, in der es plötzlich Universitäten und Banken gibt, in denen das respektierte Rittertum zum gefürchteten Raubrittertum verkommt, Ketzer zwar noch verbrannt werden, aber nicht, bevor sie ihr Saatgut hinterlassen können, das die Spaltung der katholischen Kirche in zwei christliche Religionen einleitet. Die Renaissance, die mit den Werten der kirchlich zentralgesteuerten Welt des Mittelalters bricht und so vieles neu andenkt, fördert die Künste ebenso wie den Handel. Die Epoche war urban, international und zukunftsorientiert – und gleichzeitig politisch turbulent, unsicher und oftmals grausam.
Nirgendwo ist das pointierter zusammengefasst als in dem Filmklassiker «Der dritte Mann», der auf einer Romanvorlage von Graham Greene beruht. In der Auseinandersetzung des verbrecherischen Protagonisten, gespielt von Orson Welles, und seinem Antagonisten, Joseph Cotton, antwortet der amoralische «Held» auf die Vorhaltungen und Anklagen seines ehemaligen besten Freundes: «Sei nicht so trübsinnig. Es ist alles halb so schlimm. Denk daran, was Mussolini gesagt hat: In den dreißig Jahren unter den Borgias hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr.» Nun, es waren nicht die Schweizer, sondern die Schwaben, die dieses wertvolle Kulturgut in die Gesellschaft eingebracht haben, aber abgesehen von der geographischen Fehlangabe enthalten diese Zeilen brisanten Stoff zum Nachdenken.
Nachdenken? Wenn Sie jetzt überlegen müssten, was das ist, wäre dieser Vorgang nicht Nachdenken. Nach-denken setzt Denken voraus, basiert auf Wissen und ist ohne eine Vorstellung von Kontext nicht möglich. Nachdenken ist Einordnen, Evaluieren, Entscheiden ebenso wie Lernen, Begreifen und Erkennen. Nachdenken führt in vielen Fällen zu einer anderen Dimension des Urteilens und Handelns, erhellt Zusammenhänge und löst häufig den viel zitierten Aha-Effekt aus. Das alles fordert einen gewissen Zeitaufwand – und damit wären wir der Erklärung einen Schritt näher, warum unsere Zeit keine Chance hat, Renaissancemenschen zu produzieren, obwohl es noch nie in der Geschichte der Menschheit einen so leichten Zugang zu Wissen gegeben hat. Wer in dieser hektischen globalisierten Wirtschaftswelt nimmt sich heute schon genügend Zeit zum Denken?
Wir leben in einer Wissensgesellschaft. O ja?
Historiker sind klug genug, Epochen immer erst aus sicherer Distanz zu etikettieren. Wirtschaftsleute hingegen scheinen es besser zu wissen: Gemäß ihrem Diktum leben wir nämlich zurzeit entweder in der «Informationsgesellschaft» oder, noch bemerkenswerter, in der «Wissensgesellschaft». Und flugs haben sie eine neue Kategorie im Management geschaffen: Wissensmanagement. Fataler Irrtum oder gelungener Witz? Managen (= verwalten) kann man doch nur etwas, was vorhanden ist …
Dass sich Führungskräfte mit Wissen auseinander setzen, wäre allerdings mehr als angebracht: Wissen oder, richtiger, der Umgang mit Wissen ist das wichtigste Kapital in der superschnellen, extrem wettbewerbsorientierten globalisierten Wirtschaft. Die entsprechende Währung dieses Kapitals heißt Denken. Um eine nie zuvor vorhandene Datenmenge zu nutzen, braucht es weitaus mehr als ein paar Mausklicks, nämlich Menschen, die dank ihrem agilen Gehirn Daten zu Information und Information zu Wissen verarbeiten, um dann dieses Wissen gezielt einsetzen zu können. Wie aber soll das bewerkstelligt werden, wenn Schulen, Berufslehren, weiterführende Bildungsinstitute sowie Fachhochschulen und Universitäten das Fach «Denken» nicht in ihrem breiten Angebot führen?
«Wo lassen Sie denken?»
Ohne diese Basisfähigkeit des menschlichen Gehirns kann man nicht planen, evaluieren oder entscheiden. Oder doch? So wie es zurzeit in den Führungsetagen einst renommierter Firmen aussieht, könnte man meinen, dass manche Führungskräfte der Ansicht sind, ab einem gewissen Status in einem Unternehmen müsse Denken nicht mehr selbst ausgeführt werden, sondern könne delegiert werden, analog anderen lästigen Aufgaben wie Führen oder der Auswahl der wichtigsten Mitarbeiter.
In den Zeiten vor Armani, Boss oder Calvin Klein, als sich der Mann von Welt seine Anzüge noch von einem Herrenschneider maßanfertigen ließ, wurde er, wenn der Schneider sehr gut war, öfter bewundernd gefragt: «Wo lassen Sie arbeiten?» Heute drängt sich in manchen internationalen Führungsgremien die Frage auf: «Wo lassen Sie denken?». Die eklatanten Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen der letzten Jahre lassen vermuten, dass Denken nicht zu den populärsten Aktiviäten in den so genannten Chefetagen gehört.
Noch immer betrachten die meisten Führungskräfte einen übervollen Terminkalender als Statussymbol. Er manifestiert ihrer Meinung nach, dass sie als Entscheidungsträger unentbehrlich sind, dass ohne sie «der Laden nicht läuft», dass sie, die Armen, einfach von Termin zu Termin hetzen müssen. Wie aber können sie entscheiden, ohne sich die nötige Zeit zum Denken zu nehmen? Wann gewähren sie sich Denkraum, um gestern Erlebtes zu reflektieren, in ihren heutigen Erfahrungsschatz einzuordnen und diese Aha-Erlebnisse in die Entscheide von morgen mit einzubeziehen?
Innovation: Neues denken wollen
Reflexion gehört zur Kategorie Nachdenken, einer unerlässlichen Voraussetzung für Entscheidungen, die die Zukunft betreffen. Vordenken ist ebenfalls etwas, was man von den BewohnerInnen der Führungsetagen erwarten darf. Schließlich verlangen sie ja Mitdenken von ihren MitarbeiterInnen. So erwartet zum Beispiel Heinrich von Pierer, der CEO von Siemens , einem der größten deutschen Industrieunternehmen, von den dort Arbeitenden «jeden Tag neue Ideen», wie es in einem Artikel heißt. Ziel dieser Forderung soll das sein, was alle Unternehmen und Organisationen heute dringender denn je brauchen: Innovation, das ersehnte Resultat kreativer Denkprozesse, das die Konkurrenten, blass vor Neid, auf den zweiten oder dritten Platz verweist, wenn auch oft nur für eine sehr kurze Zeit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden qualifiziert und befördert gemäß ihrer Fähigkeit, innovativ zu denken. Wie aber können Menschen kreativ bzw. innovativ denken und handeln, wenn die gelebte Unternehmenskultur ihnen keine Zeit dafür einräumt, sondern Schnelligkeit und messbare Performance belohnt?
Jedes Business beginnt mit einer Idee. Sie muss nicht originell sein, ist oft sogar die Kopie einer bestehenden Idee, die so lange bearbeitet wird, bis sie für die Kunden interessant wird. Wenn das Business jedoch einmal floriert, scheint man vergessen zu haben, dass es immer noch Ideen sind, die das Kapital vermehren. Neuen Ideen für Produkte, Dienstleistungen, Strategien oder nur schon administrative Abläufe begegnet man mit Misstrauen: Sobald es etwas zu verlieren gibt, ist Risikofreudigkeit, die ja Vorausetzung für Neuerungen ist, kaum noch ein Thema; lieber geht man auf Nummer Sicher, und das heißt meistens: fixiert sein auf Probleme, die man – auf Effizienz eingeschworen – standardmäßig angeht.
Dass sogar gestandene Unternehmer, die bereits ihre Innovationsfähigkeit unter Beweis gestellt hatten, mit ihren Ideen bei ihrem unmittelbaren Umfeld anecken können, beweist eine Geschichte aus dem anekdotisch reichen Umfeld Henry Fords:
1914 hatten Arbeiter in der Autoindustrie einen Tageslohn von $ 2,34 – bis zu dem Tag, da Henry Ford beschloss, ihnen mehr als das Doppelte, nämlich $5,00 zu zahlen. Ford hatte gute Gründe dafür, die nichts mit Philanthropie zu tun hatten. Aber sein Umfeld verstand diese Gründe nicht, bewarf ihn mit Kritik und beschimpfte ihn als «Sozialisten». Die USA sind voll von Geschichten, in denen eine oder ein zuerst Verspottete(r) am Ende ihre oder seine Kritiker vor Neid erblassen lässt, und diese Geschichte gehört dazu. Was waren seine Gründe für diesen ungewöhnlichen Schritt? Das, was man wohl am besten mit «aufgeklärtem Eigennutz» bezeichnen kann:
Fazit: Innerhalb von nur zwei Jahren konnte die Ford Motor Company ihren Gewinn verdoppeln, von 30 auf 60 Millionen Dollar.
Die echte «Nummer Sicher» wäre jedoch etwas ganz anderes: Mitarbeitenden Freiraum zu gewähren, das zu tun, was man auf Englisch thinking outside the box nennt. Der Ausdruck bezieht sich natürlich auf die bekannte Kreativitätsübung, bei der man neun Punkte, in drei Dreierreihen untereinander angeordnet, mit vier Strichen verbinden muss, ohne den Stift abzusetzen. Das geht, wie wir alle irgendwann einmal herausgefunden haben, nicht, ohne dass man die vorgegebene Grenze überschreitet. «Vorgegebene» Grenze? Ist es nicht eher die «selbst auferlegte», die imaginäre Grenze, die uns davon abhält, auf Anhieb mit vier Strichen diese neun Punkte miteinander zu verbinden? Oder ist es am Ende wieder einmal unser Schulsystem, das uns zum Denken in zu engen Grenzen anhält? Sicher liegt hier die Basis dieses Problems; einer meiner Lieblings-Cartoons drückt es so aus: Ein bedrückt aussehender Mann sagt zu einer Kollegin: «Als Kind wurde ich immer kritisiert, weil ich außerhalb der Linien malte. Jetzt wundert sich mein Chef, warum ich immer in festgetretenen Pfaden denke.»1 1
Die «Gang of Three»
Probleme werden ohnehin nicht durch effiziente, sondern durch lösungsorientierte Menschen aus der Welt geschafft. Neue Lösungen für unser immer komplexeres Zusammenleben sind das, was überall vonnöten ist, und neue Lösungen brauchen nun mal neue Sicht- und Denkweisen. Das scheint jedoch noch ein wohlgehütetes Geheimnis zu sein.
Die Situation ist alltägliches Vorkommnis in den meisten Firmen, und Sie selbst haben sie sicher schon x-mal als Opfer oder Zeuge erlebt: An einer Sitzung präsentiert jemand eine neue Idee. Die anderen SitzungsteilnehmerInnen hören aufmerksam zu, der oder die Präsentierende ist sich zunehmend ihres Interesses, wenn nicht sogar schon ihrer Zustimmung sicher. Zufrieden, sogar leicht euphorisch, setzt er oder sie sich und harrt der Reaktionen auf den soeben präsentierten genialen Vorschlag – und hat sich insofern nicht getäuscht, als wirklich alle aufmerksam zugehört haben.
Aber seit dem Moment, wo sie erkannt haben, dass hier etwas bahnbrechend Neues präsentiert wird, haben alle nur noch mit halbem Gehirn hingehört, um mit der anderen Hälfte ihre Gegenargumente formulieren zu können. Kaum endet die Präsentation, hageln die Killerphrasen von allen Seiten auf die oder den Wagemutige(n) hinab.
Seien Sie nicht überrascht, schon gar nicht irgendjemandem böse – in unserer Kultur und Erziehung wäre jedes andere Verhalten außerhalb der Norm. In einer groß angelegten Abhandlung hat sich das deutsche «manager magazin» 1993 mit Kreativität im Unternehmen auseinandergesetzt.2 2 Darin gibt es auch ein langes Interview mit dem Psychoanalytiker, Denker, Unternehmensberater und Autor Rolf Berth , der als Dozent am Internationalen Management-Institut in Genf arbeitete und eine Langzeitstudie über Innovation in Deutschland erstellt hat.
Auch er ist sich der Hemmschwelle für Neues im deutschsprachigen Raum bewusst und nennt die schlimmsten Fehler in Sachen Innovation schonungslos beim Namen: «Erstens die Überschätzung der Erfahrung, die wertvoll ist, aber auch blockiert. Zweitens das fehlende Wissen über Innovation. Drittens die Unfähigkeit, Ideen weiterzuentwickeln. Das muss eine Kulturkrankheit sein, dass wir auf Neues so negativ reagieren, während das Wiederkäuen des oft Gesagten große Befriedigung hervorruft.» 3
Der Hirnforscher und Psychologe Dr. Edward de Bono, weithin als führende Autorität auf dem Gebiet des Denkens angesehen, legt die Basis dieser «Kulturkrankheit» offen: Westliches Denken geht zurück auf die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles, die «Gang of Three», wie er sie nennt. Von diesen Autoritäten, die vor rund 2400 Jahren lebten, haben wir gelernt, alles Neue generell kritisch zu hinterfragen (Sokrates), die Suche nach der Wahrheit ad absurdum zu betreiben, um dennoch nie richtig daran zu glauben zu können, dass wir sie gefunden haben (Platon), oder – dafür sind wir ganz besonders begabt – kritisch-argumentativ an Neues heranzugehen (Aristoteles). Dem anderen zu beweisen, dass er sich irrt, ist wichtiger geworden, als seine Ideen unvoreingenommen zu prüfen. (Irre ich mich, oder haben Sie jetzt gerade Ihre Stirn gerunzelt? Dann denken Sie mal an die Rechtsprechung, besonders die amerikanische, wo es oft nicht mehr darum geht, jemandem seine Schuld nachzuweisen, als vielmehr der Gegenpartei einen Fehler zu beweisen.)
The «Gang of Three»
Sokrates (469–399 v. Chr.)
• Alles hinterfragen
Platon (427–348 v. Chr.)
• Suche nach Wahrheit
• Misstrauen
• Kritisches Denken
Aristoteles (384–322 v. Chr.)
• Urteilen, kategorisieren
• Systematisieren
• Entweder/Oder
• Recht haben
Dieses Denken – so Herbert Pietschmann , Professor für theoretische Physik an der Universität Wien, der Manager lehrt, ihre westliche Form des logischen Denkens zu begreifen – mag 2000 Jahre lang genügt haben, bis sich im 17. Jahrhundert Wissenschaftler daran machten, neue allgemein gültige Regeln zu finden. «Wissenschaftliche Rationalität ist also sinnvoll – die Frage ist nur, ob wir auch weiterhin ausschließlich mit dieser Art des Denkens arbeiten wollen.» Er plädiert dafür, eine «neue europäische Rationalität» zuzulassen, in der «ein Widerspruch oder ein Konflikt kein Fehler, sondern eine Chance für Weiterentwicklung [ist]». Und auch er sieht darin eine Aufgabe fürs Management: «Widersprüche müssen gepflegt werden. Schwierig ist nur zu unterscheiden, welche Widersprüche ganz einfach Fehler und welche notwendig zur Weiterentwicklung sind. Und das herauszufinden, ist die Aufgabe des Managers.» 4
Analyse und Paralyse
Wenn etwas nicht in unser Denkschema passt, sind wir sehr gut in der Abwehr. Alle reden von Change, kaum jemand will sich aber wirklich damit auseinander setzen. Wie viel Energie wird täglich eingesetzt, um jemandem zu beweisen, dass seine/ihre Idee nicht realisierbar ist! Querdenker werden in vielen Stelleninseraten gesucht; wehe ihnen aber, wenn sie mit ihrem anderen Denken anfangen und damit die meisten ihrer Kollegen und Vorgestzten nerven! Die gängige Einstellung ihrer Umwelt ist: «Hier kommt etwas Neues. Überzeugen Sie mich, dass ich das brauche.» Wie viel Mehrwert – und Wertschöpfung ist ja eines der wichtigsten Anliegen in einer börsenorientierten Wirtschaft – liegt jedoch in einer anderen Denkweise:
Hier kommt etwas Neues.
Welchen Wert, welche Chancen kann ich darin erkennen ?
Innovation entsteht nun mal nicht aus «mehr vom selben», aus Kopieren des Gehabten. Nicht umsonst heißt ein amerikanischer Kalenderspruch: «Die gleiche Sache auf immer die gleiche Weise machen und trotzdem andere Ergebnisse erwarten – das ist die beste Methode, um beim Arbeiten verrückt zu werden.» 5 Merke: Karikaturen, Kalendersprüche und Bürowitze werden nur dann von jesder und jedem im Betrieb begriffen, wenn sie sich auf den herrschenden Normalzustand beziehen … Aufgabe der Unternehmen und Organisationen – denn NGOs, kirchliche oder kulturelle Institutionen brauchen Innovation genauso dringend wie «die Wirtschaft» – wäre es, den dafür nötigen Freiraum zu schaffen. Das passiert nur in seltenen Fällen, am ehesten wohl dann, wenn Not herrscht: an Manpower, an Geld, an Zeit. Das hat der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth erfahren, der unter großem Erfolgsdruck stand, als er sich entschloss, der Politik Adieu zu sagen und fortan als Top-Sanierungsmanager des einstmals berühmten Unternehmens Zeiss Jena zu wirken.
In einem Interview zum Thema «Kreativität in Wirtschaft und Politik» äußerte er sich zu den Anfängen seines neuen Laufbahnabschnitts: «In der Wirtschaft können Sie sich Kreativität am besten leisten in einem Unternehmen im Umbruch wie dem, in dem ich gelandet bin. Wenn sowieso alles durcheinander ist, lässt man auch unkonventionelle Ideen gelten. Wir haben einen riesigen Vorteil: Unsere Tradition ist weg – wir können nicht die Vergangenheit analysieren und darauf aufbauen. Was uns geblieben ist, sind technologisches Know-how und Menschen, die hoch motiviert sind. Und wenn Sie denen Impulse geben, haben Sie gute Chancen. Insofern habe ich also ein Umfeld, in dem ich mir Kreativität leisten kann. Und diejenigen, die glauben, sie sich nicht leisten zu können, werden sie sich leisten müssen, weil sie sonst das Innovationstempo nicht durchhalten werden.» 6
Das sind Gedanken, die ein gutes Jahrzehnt später nichts an Brisanz und Gültigkeit verloren haben, weil sie offensichtlich nicht von einer genügend großen Anzahl deutscher Politiker und Manager beherzigt worden sind. Lothar Späth ist zwar als Prestige-Referent zu Höchsthonoraren an vielen Veranstaltungen zu hören, aber auch er scheint weitestgehend ein Rufer in der Wüste zu sein. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends befinden wir uns in einem anderen, für Deutschland besonders dramatischen Wirtschaftsumfeld; vielleicht kann der Rufer jetzt eher auf ein Echo hoffen, wenn er über seine Erfahrung mit Kreativität und Innovation spricht.
Was wir in unserem europäischen Erziehungssystem, auf das wir ja so stolz sind, unter anderem nicht lernen, ist eingehende Exploration und gezielte Evaluation neuer Ideen; Denken als «skill», als universell einzusetzende Währung auf der Suche nach neuen, tragfähigen Lösungen, wird nirgendwo gelehrt. De Bono spricht von «recognition thinking»: Wir sind ach-so-gut in der Analyse – bis hin zur Paralyse, wie wir wissen. Das heißt, wir begnügen uns mit dem Identifizieren von Standardsituationen, denen wir mit Standardantworten begegnen. Darum sind wir in dem, was wir mit «Ausbildung» bezeichnen, in Bezug auf Technik und Technologien sehr gut, in Bezug auf Denken jedoch cirka 300 Jahre hinterher. Die Vergangenheit lässt sich allenfalls erklären (Analyse), die unbekannte Zukunft hingegen muss gestaltet werden (Design). Rechthaberei, Selbstüberschätzung und Angst vor möglichem Versagen lassen uns eher in der Vergangenheit graben als in die Zukunft denken. Andere Kulturen handhaben das anders: Für Inder zum Beispiel heißt «Forschen nicht Wissen sammeln, sondern mit dem Unbekannten jonglieren und mit dem Nichtwissen tanzen», wie es ein Inserat einmal so poetisch ausgedrückt hat.
Denken als sinnliches Vergnügen
Denken als sinnliches Vergnügen also, als Erfindergeist, als Entdeckerfreude, so wie uns zum Beispiel Bertolt Brecht hier seinen Galileo präsentiert. «Ich glaube an den Menschen, und das heißt, ich glaube an seine Vernunft!», sagt der Forscher zu seinem Freund. «Ja, ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können ihr auf die Dauer nicht widerstehen.» Und euphorisch setzt er hinzu: «Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse.» Der Wissenschaftler, der das sagt, ist ein Mann des 17. Jahrhunderts, das, von der Renaissance infiziert, dem Zeitalter der Aufklärung entgegenstrebt. Der Stückeschreiber, der ihn das sagen lässt, ist ein ebenso besessener Denker gewesen: Denken war für Brecht ein sinnliches Vergnügen, vielleicht das sinnlichste überhaupt – und das will bei ihm etwas heißen, denn in Sachen Sinnlichkeit war er ein absoluter Gourmand.
In dem «sinnlichen Vergnügen» stecken eben auch die Erfolgserlebnisse, die sich beim Erkennen von (komplexen) Zusammenhängen einstellen. Das berühmte Aha-Erlebnis, wie bei uns das griechische «Heureka!» genannt wird, braucht Denken, das Zusammenhänge erkennt, ihre Wichtigkeit anerkennt und in Entscheidungen einbezieht. «Vernetztes Denken» nannte Frederic Vester das, ein Schlagwort, das in den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts sehr populär war, aber leider nicht weit über den Schlagwort-Charakter hinausgekommen ist.
In einem Zeitalter, das als Wissensgesellschaft in die Geschichte eingehen möchte, muss Denken die gängige Währung sein. Anstatt Wissen managen zu wollen (eine absurde Idee!), sollte Denken als skill geschult werden. Skills sind Fertigkeiten, nicht Fähigkeiten, und jeder Handwerker, jede Künstlerin oder nur schon jede(r), der Auto fährt, weiß, dass man Fertigkeiten immer wieder verfeinern kann. Denken als entwicklungsfähige Fertigkeit anzuschauen und in Firmenschulung nachzuholen, was im eigentlichen Schulsystem versäumt worden ist, wäre für die Kapitalträger unserer Wirtschaft – um Missverständnissen vorzubeugen: das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein echter Aktivposten in ihrer beruflichen Weiterbildung:
Allerdings braucht es dafür andere Unternehmenskulturen. Dieses Buch will aufzeigen, wie man Mitarbeitende zu anderem Denkverhalten veranlassen kann, indem man ihnen sowohl das dafür nötige Handwerkszeug – thinking tools - als auch das ebenso nötige Umfeld – thinking pools sozusagen – zur Verfügung stellt.
Auf den folgenden Seiten werden Sie dem Denker aller Zeiten, Leonardo da Vinci, begegnen. Lassen Sie sich ein auf die Bekanntschaft, geknüpft über fünf Jahrhunderte hinweg. Schauen Sie sich an, wie dieser Renaissancemensch par excellence die Denkkultur unserer Tage beurteilen könnte. Reflektieren Sie, wie weit entfernt von seinem umfassenden Denken und Wissen unsere Gesellschaft heute ist, aber entdecken Sie auch, wie viel davon wir noch in unser Jahrhundert hinein retten könnten, wenn wir dem Denken den Raum zugestehen, den es in unserem Leben einnehmen sollte.
Die bedeutende Schweizer Kulturzeitschrift «du», die sich an denkende Menschen im deutschsprachigen Raum richtet, hat in den letzten Jahren mit dem Bild eines Schimpansen geworben, mit dem wir, gemäß neuesten Forschungsergebnissen, 99 Prozent unserer genetischen Basis gemeinsam haben sollen. Daneben steht: «Verkleinern Sie die Ähnlichkeit.»
Denken Sie auch darüber mal nach?!
Sieben Schritte zur Innovation
Leonardo da Vinci: Prototyp des Innovators
Das Geheimnis all derer, die Erfindungen machen,
ist, nichts für unmöglich anzusehen.
Julius von liebig
Als Leonardo in dem kleinen toskanischen Dorf Vinci 1452 das Licht der Welt erblickt, befindet sich diese Welt gerade mitten in einem gigantischen Umbruch:
Es ist eine aufregende Zeit in einem der aufregendsten Jahrhunderte, und sie wird uns in der Erinnerung noch aufregender erscheinen, weil am 15. April 1452 ein Knabe geboren wird, von dem man später sagen wird, er sei das vielleicht größte Genie der Weltgeschichte. Er wird den größten Teil der zweiten Jahrhunderthälfte in Bezug auf Geistesgröße mitprägen, und wenn er 1519 im Alter von 67 Jahren stirbt, wird die Epoche, die wir als Renaissance kennen und schätzen, in voller Blüte sein.
Leonardo kommt mit dem Makel der unehelichen Geburt zur Welt: Er ist die Frucht einer Beziehung seines Vaters Ser Piero mit Caterina, einer Bauerntochter aus der Umgebung. Die Affäre des 25-jährigen wohlhabenden Notars und Treuhänders wird wohl eine Mesalliance gewesen sein, was den Großvater jedoch nicht hindert, sich über seinen Enkel «Lionardo» zu freuen und ihn eine Zeit lang mit zu erziehen. Noch im selben Jahr heiratet der Vater eine Sechzehnjährige (die erste von drei Eheschließungen) und im Jahr darauf die Mutter einen Töpfereibesitzer, mit dem sie in einem Nachbardorf wohnt. 1454 wird sie Mutter einer Tochter und beschert damit Leonardo das erste von fünf Geschwistern mütterlicherseits. Sein Vater wird diese Zahl mit den dreizehn Kindern, die er ab 1477 mit seiner dritten Ehefrau haben wird, um einiges übertreffen.
Leonardo pendelt in den ersten paar Jahren zwischen den Häusern seines Großvaters und seines Vaters, wo er den größten Teil seiner ersten siebzehn Jahre verbringt: ein wissbegieriger Junge, der durch die toskanische Landschaft streift, alles hochinteressant und untersuchungswürdig findet und vieles mit nach Hause bringt. Er legt sich – Albtraum jeder Mutter – eine Sammlung furchterregender Tiere zu, aus denen er später in seiner Fantasie das furchterregendste Tier kreieren und damit den Schild eines Auftraggebers schmücken wird. Sein Vater wird den dann für hundert Dukaten verkaufen – und zwar nicht an den ursprünglichen Auftraggeber, dem er einen anderen Schild anfertigen lässt, sondern an eine Gruppe von Kunstkennern, die ihn später für ein Dreifaches an den Herzog weiterverkaufen wird. Das furchterregendste aller Tiere ist also die erste Honorararbeit des jungen Künstlers.