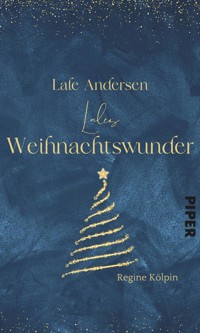Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Als Tania Lewalder einen Brief aus der Vergangenheit erhält und der Überbringer einen Tag später tot aufgefunden wird, übernimmt Kommissarin Kenza Klausen die Ermittlungen. Die Spur führt sie nach Polen. Was ist dort bei Kriegsende mit Tania Lewalders Mutter passiert? Dann gibt es einen zweiten Mord an einer alten Frau. Ihr Tod scheint mit dem ersten Fall in Verbindung zu stehen. Nach und nach verdichten sich die Hinweise auf ein grausames Verbrechen in der Vergangenheit, das bis heute vertuscht werden soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Regine Kölpin
Wohin die Schuld uns trägt
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Susanne Tachlinski
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ganzen_op_een_modderige_landweg,_Bestanddeelnr_252-1294.jpg
ISBN 978-3-8392-6618-2
Topolno in Westpreußen, September 1944
Topolno war Musik. Die Musik des Windes, der über die Wiesen der Weichsel strich, als streichle er das Grün zum letzten Mal, bevor der Ton schärfer wurde. Marek war gegangen, hatte aber den Duft seiner Haut und den weichen Klang seiner Stimme hinterlassen. Das war es, was Eva für immer hören wollte. Nicht nur hier. Nicht nur jetzt. Immer. Doch das war unmöglich. Sie musste das annehmen, was ihr das Leben vorgab.
Als sie den Blick wandte, stolzierte ein Storch am Ufer, nicht mehr lange und er würde fortfliegen. Vielleicht kam er im nächsten Jahr zurück, wenn er die Sonne jenseits der Gebirge genossen hatte. Hierher, wo sich der Sommer nicht immer an sein Versprechen hielt. Die junge Frau blinzelte in die Sonne, die schon hoch am Himmel stand. Der September war viel zu warm. Lediglich die vielen Spinnweben zeugten davon, dass der Altweibersommer bereits Einzug gehalten hatte. Es war wie das Aufbegehren einer schönen Zeit, die noch lange nicht bereit war zu gehen.
Ein paar Schwalben sammelten sich bereits auf den vereinzelten Drähten, andere machten sich dicht über dem Boden auf die Jagd nach Insekten. Das Wetter würde also nicht andauern. Es wurde Zeit, in ihre Welt zurückzukehren. Eine Welt, die nichts mit dem gemein hatte, was sie hier, an diesem Ort, empfand. Auf dem Hof warteten Berge von ungewaschener Wäsche, ein Mittagsmahl, das zubereitet werden musste. Grobe Hände, die sie schlugen, wenn sie nicht das tat, was von ihr verlangt wurde, und eine herrische Stimme, die sie demütigte, wann immer es ging.
Die Kirchenglocke schlug elf Mal. Eva stand auf, denn sie musste nun wirklich gehen. Und dabei mit jedem Schritt das zurücklassen, was sie glücklich machte.
Den Rest der Woche wollte sie von der Erinnerung zehren. Daran denken, wie die leisen Wellen des Flusses ans Ufer rollten, wie der Bussard majestätisch seine Kreise zog oder der Reiher, einem Standbild gleich, auf seine Beute wartete. All das verschmolz in ihren Gedanken zu einem Bild, in das sich auch Mareks zärtliche Hände mischten und die Lippen auf ihrer Haut. Sie hatten lange gegen ihre Liebe gekämpft, nachdem sie vor so vielen Jahren schon schwach geworden waren. Aber Liebe konnte man nicht besiegen, sondern sie nur leben.
Eva wollte immer hierbleiben, die Weichsel nie verlassen. Sie wollte die Sonne genießen, die Regentropfen fallen hören. Verdrängen, was um sie herum geschah. Krieg. Tod. Gerüchte. Grausamkeiten. Nichts war gut, auch nicht, wenn sie die Augen schloss. Nein, in Zeiten wie diesen hatte der Tod das Sagen. Hass und Angst regierten.
Ein kühler Luftstrom wehte über Eva hinweg, strich über ihren Arm und bewirkte, dass sich die blonden Härchen aufstellten. Sie fröstelte, und das lag nicht an diesem leichten Lüftchen. Der Wind frischte plötzlich mit großer Wucht auf. Vereinzelte Böen drückten das hohe Gras wie in Wellen nieder. Eva ordnete ihren Rock und zupfte das Haar zurecht. Bis sie auf dem Hof angekommen war, würde auch ihr noch immer erhitztes Gesicht seine normale Farbe wieder angenommen haben und ihr kleiner Schatz der Erinnerung würde es ihr leichter machen, das zu tun, was das Leben von ihr verlangte. Sie selbst erwartete nicht mehr viel. Nur mehr diese eine gestohlene Stunde, wann immer es möglich war.
Als sie den Fuß auf die Straße setzte, kündigte ein Grollen das herannahende Gewitter an. Die Vögel verstummten nach und nach. Eva musste sich beeilen, wollte sie trockenen Fußes nach Hause kommen. Als die ersten Tropfen fielen, genoss sie aber auch die auf ihrer Haut, zeigten sie doch, dass sie lebte, dass sie fühlte und atmete. Egal, was sie gleich auf dem Hof erwartete. Egal, was das Leben noch für sie bereithielt. Diese eine Stunde hatte sie gelebt.
Der Regen durchweichte ihre Kleidung. Nichts war mehr zu spüren von der eben noch kräftigen Sonne. Die Natur war ein ebensolches Wechselspiel wie das Leben. Schon bald würden Herbst und Winter das Regiment übernehmen und damit änderte sich auch die Melodie des Windes. Er würde schärfer werden und kälter. Wie kalt, wusste die junge Frau an diesem Tag nicht. Es war ihr letzter Sommer.
1
Der September war in diesem Jahr viel zu warm. Lediglich die vielen Spinnweben zeugten davon, dass der Altweibersommer bereits Einzug gehalten hatte. Tania Lewalder pustete sich eine ihrer kurzen grauen Strähnen aus dem Gesicht. Das schöne Wetter hatte sie dazu verleitet, das Frühstücksgeschirr entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit eine Weile stehen zu lassen, und sie war zuerst eine Runde durch Jever spaziert, um die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers auszukosten. Der Winter in Friesland war lang und trübe genug, da war es wichtig, sich an der Helligkeit zu erfreuen, solange sie noch da war, damit man all die dunklen Monate davon zehren konnte.
Nun stand Tania in der Küche und kämpfte mit dem Abwasch. Sie besaß keine Spülmaschine, für sie allein lohnte das ihrer Meinung nach nicht, und so hatte sie keine weitere angeschafft, als die alte kaputtgegangen war. Ihr war heute Morgen so sehr nach heißer Milch mit Honig gewesen, aber dann war ein Anruf gekommen. Dabei war die Milch erst übergekocht und dann auf dem Topfboden angebrannt. Tania schrubbte ihn nun, die Hände mit gelben Gummihandschuhen geschützt. Es war ein beinahe hoffnungsloses Unterfangen.
Sie stellte den Topf ab und presste die Lippen fest zusammen. Ihr Herz klopfte und sie hatte einen dicken Kloß im Hals, doch wie immer war es ihr nicht vergönnt zu weinen. Seit damals ging es einfach nicht mehr. Nicht mehr seit …
Tania atmete tief ein. Sie wollte sich nicht erinnern, und doch häuften sich in der letzten Zeit die schlimmen Gedanken.
Tania hasste Probleme, brauchte das seichte Plätschern des Lebens. Alles sollte einfach seinen Gang gehen. Wogen und Stürme hatte es in ihrem 78-jährigen Leben schon genug gegeben.
Nach dem Tod ihres Mannes Jürgen und dem Selbstmord ihrer Tochter Claudia war ihr nur noch ihre Enkelin Malin geblieben. Sie lebte auch in Jever und die beiden hielten sich aneinander fest. Nein, das war wohl nicht der richtige Ausdruck: Tania hielt sich an Malin fest.
Ihre Enkelin schaffte es trotz allem, das Leben mit einem breiten Lächeln zu durchschiffen, als gäbe es weder Klippen noch Untiefen. Obwohl Malins Mutter sich das Leben genommen hatte, obwohl Malin bereits geschieden war, obwohl sich ihr Vater schon in früher Kindheit abgesetzt hatte und seitdem kein Kontakt bestand. Malin lächelte alle Schwierigkeiten weg.
Ihr sonniges Gemüt und ihr unerschütterlicher Optimismus holten Tania immer wieder ins Leben zurück, wenn sie dabei war, in diese kaum zu bändigende Schwermut zu verfallen, die sie heimlich ihre schwarze Katze nannte, weil sie rücklings und ohne Vorwarnung angriff. Und dabei brutal ihre Klauen in Tania schlug.
Sie sah auf die Uhr. Malin hatte versprochen, später noch vorbeizukommen. Sie würde den Topf einweichen müssen, sonst bekam sie das Eingebrannte nicht weg.
Tania fächerte sich etwas Luft zu. Es war wirklich drückend warm heute. Vielleicht würde es helfen, ein wenig frische Luft hereinzulassen.
Sie machte einen Schritt auf das Fenster zu und hielt plötzlich inne, als sie einen Blick auf die Straße warf. Auf dem Gehweg gegenüber stand ein alter Mann, bekleidet mit einem armselig anmutenden Anzug, der ihm zudem viel zu groß war. Er beobachtete ihr Haus, taxierte jeden Stein, als müsse er sich vergewissern, dass das, was er sah, seine Richtigkeit hatte. Tania versteckte sich hinter der Gardine, sodass sie ihn beobachten, er sie aber nicht sehen konnte.
Verstohlen zerrte der Mann mit zitternden Händen einen Zettel aus der Tasche, studierte, was darauf vermerkt war. Dann machte er einen Schritt auf das rot geklinkerte Einfamilienhaus zu. Seine Bewegungen waren zögernd, als könne er sich nicht recht entschließen, das Grundstück zu betreten. Überhaupt wirkte er gebrechlich und müde.
Vorsichtig betrat der Mann den Vorgarten und stolperte über das Pflaster in Richtung Briefkasten. Rasch warf er etwas hinein, wandte den Blick zum Fenster und verließ mit schlurfendem Schritt das Grundstück. Gebückt, als trage er die gesamte Last dieser Welt auf seinen dünnen Schultern.
Tania schluckte. Sie hatte für einen Augenblick seine Augen gesehen. Tief wie ein See, in dem sich die Sonnenstrahlen brachen. Dabei dieser Blick! Wissend, und doch unergründlich und warmherzig.
Beides hatte sie schon einmal gesehen. Vor langer, langer Zeit. Aber das konnte nicht sein! Solche Augen hatte nur ein Mensch auf dieser Welt und egal, wie alt er auch war: Sie würde ihn daran jederzeit wiedererkennen.
Für Tania stand außer Zweifel, dass es sich bei dem Mann um Matteusz handelte. Aber wie zum Teufel sollte der nach all den Jahren nach Jever gekommen sein?
Wir trennen uns nie, Tania. Ich bin dein Freund. Immer und ewig.
Tania setzte sich auf den nächstbesten Stuhl und strich sich über die Stirn. Hatte sie wegen des vielen Alleinseins schon Halluzinationen?
»Ich muss zu ihm und herausfinden, ob er das wirklich war«, flüsterte sie, schaffte es aber nicht, sich aus der Erstarrung zu lösen und dem Mann zu folgen.
Wenn Matteusz tatsächlich gekommen war, würde das Folgen haben. Erinnerungen aufbrechen lassen. Und Tania wusste nicht, ob sie das ertrug.
Das Brummen eines Rasenmähers holte sie aus ihren Gedanken.
Der Mann hatte doch etwas in den Briefkasten geworfen!
Tania stemmte sich am Tisch hoch, durchquerte den schmalen Flur, den sie erst im letzten Frühjahr in hellem Beige hatte streichen lassen – ihre einzige Renovierung in den letzten 20 Jahren –, nahm den Briefkastenschlüssel vom Schlüsselbrett und öffnete die dunkel verglaste Haustür. Dann schloss sie den Briefkasten auf. Mit zitternden Fingern entnahm sie einen Umschlag. Er schien alt zu sein, das Papier war gelb und roch muffig. An den Kanten war er zerknickt und schmutzig.
Zurück in der Küche legte Tania ihn auf den Tisch.
»Ich mach erst Tee«, murmelte sie und setzte Wasser auf. »Dann sehe ich nach, was drinsteht.«
Sie brauchte den Aufschub, war unsicher, was sie tun sollte. Bitte keine Probleme mehr. Nichts hochkochen lassen, so wie diese verdammte Milch!
Wir sind Freunde, für ewig, Tania!
Immer wieder hämmerte Matteusz’ kindliche Stimme, die aber manchmal brach und laut kiekste, durch ihren Kopf. Freunde wollten sie sein. Als sie Kinder waren, hatte es so leicht geklungen. Einmal Freund, immer Freund.
Das Teekochen lenkte Tania ab, verschaffte ihr etwas Zeit.
Der Kessel pfiff, sie goss das Wasser über die Teeblätter und setzte sich hin. Drei Minuten brauchte der Tee, wenn er so schmecken sollte, wie sie es mochte. In diesen drei Minuten würde sie entscheiden, ob sie den Umschlag öffnete oder sang- und klanglos entsorgte und einfach so weiterlebte wie bisher.
Und doch gelang es Tania kaum, den Blick von dem Umschlag zu wenden. Mit krakeliger Schrift war ihr Vorname darauf geschrieben. Nur der.
Noch zwei Minuten. Tanias Finger tasteten über die Rückseite des Kuverts. Ihr Herz klopfte.
Freunde für ewig, Tania.
Hatte es sich tatsächlich um Matteusz gehandelt? Warum war er dann nicht reingekommen? Hatte mit ihr gesprochen?
Als sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte, waren sie Kinder gewesen, aber nicht mehr unbeschwert. Es war die Zeit, als sie noch viele Tränen gehabt hatte. Tränen, die kurz darauf ganz versiegten.
Tania, ich bin immer für dich da, hörte sie wieder seine Stimme.
Vorsichtig griff sie nach dem Umschlag, öffnete den Falz und nahm das Papier heraus.
Das Erste, was sie las, war das Wort »Borntuchen«.
Tania schloss die Augen und ließ das Blatt Papier sinken. Die Vergangenheit hatte sie eingeholt.
Es war eben tatsächlich Matteusz gewesen. Ihr alter Freund aus Polen. Es gab also mindestens noch einen Menschen, der auch diese Schatten sah, die seit damals um sie herumtanzten und sich auch nach all den Jahren nicht verscheuchen ließen.
Sie waren auf der Flucht aus Topolno in Westpreußen gewesen und Matteusz lebte auf diesem Gutshof in Borntuchen, wo sie eine Zeit lang hatten rasten müssen. Er war ihr Freund geworden in der kurzen Zeit. Ein Mensch mit Wärme, während sich alles andere kalt angefühlt hatte. Die Temperaturen, die Menschen. Alles.
Tania hatte all die Jahre nie wieder von Matteusz gehört, trotz ihres kindlichen Versprechens.
Wie viel Zeit war seitdem vergangen? Tania rechnete nach. Sie war jetzt 78, Matteusz musste ein paar Jahre älter sein. Damals war er zwölf gewesen. Ein kleiner zerlumpter Kerl mit Zahnlücken, der stets mit Knickerbockern und barfuß herumlief. Auch bei der eisigen Kälte, die geherrscht hatte. Das tat er nicht, weil er Schuhe ablehnte. Er hatte schlichtweg keine besessen. Dennoch war er für Tania herumgeflitzt, hatte versucht, ihr das Leben leichter zu machen.
Noch eine Minute, dann musste Tania die Teeblätter aus der Kanne nehmen. »84«, flüsterte sie. »Er muss jetzt 84 Jahre alt sein.« Und wieder diese Fragen: »Was will er hier? Warum spricht er nicht mit mir?« Sie entnahm die Teeblätter. Dann goss sie sich die Tasse voll.
Ihre Hände zitterten, als sie das Stück Papier wieder in die Hand nahm. Zuerst betrachtete sie es genauer. Es war sehr vergilbt und trocken und schien irgendwo herausgerissen worden zu sein. Die Sätze waren in einer fein geschwungenen Handschrift verfasst, die sich von der auf dem Kuvert unterschied. An der Seite war der Abdruck eines Hühnerfußes zu erkennen.
Tania atmete einmal tief ein. Dann wagte sie, auch die nächsten Sätze zu lesen. Der Kloß in ihrem Hals löste sich, und nach fast 70 Jahren kam eine erste Träne. Der Brief war von ihrer toten Mutter.
*
Kenza Klausen sah sich in ihrem neuen Büro um. Letzte Woche hatte sie ihren Dienst bei der Mordkommission Wilhelmshaven/Friesland begonnen und musste in der Dienststelle in Wilhelmshaven erst heimisch werden. So einfach war das nicht, aber sie hatte zuvor in Oberhausen gearbeitet und das dringende Bedürfnis gehabt, in der Nähe des Meeres zu leben.
Sie wollte einfach nur weg aus der Großstadt, weg von Jasper und weg von alten und bösen Erinnerungen. Ihre Mutter war viel zu früh gestorben. Vermutlich, weil sie ihrem gewalttätigen Ehemann nie Paroli geboten hatte. Ihre Seele war daran zerbrochen und am Ende auch ihr Herz.
Jasper war mit Kenzas Trauer und Wut über das alles nicht zurechtgekommen, und so war es an der Zeit gewesen, sich ein neues Leben aufzubauen. Nur, so leicht ließen sich alte Verletzungen nicht abschütteln. Ihre Wohnung, die sie in einem Einfamilienhaus in der Schulstraße bezogen hatte, war noch nicht einmal halbwegs eingerichtet. Es fehlte noch an allem. Dass sie die Umzugskisten schon ausgeräumt hatte, war ein Sieg über ihre Ohnmacht, die sie nach all dem ihrem Leben gegenüber verspürte. Morgen wollte sie die Bücherregale anbohren, Gardinen aufhängen …
Es klopfte und die Sekretärin Frau Martens steckte den Kopf ins Büro. »Moin, Frau Klausen. Schon etwas heimisch geworden?«
»Ich arbeite dran. Nicht alle Kollegen sind glücklich über mein Kommen.« Kenza dachte an Bert Janßen, der ihr gleich unmissverständlich klargemacht hatte, für wie falsch er ihre Besetzung hielt. »Muss mich erst an alles gewöhnen.«
Frau Martens lächelte Kenza an. »Bleiben Sie entspannt. Kollege Janßen kann ein Ekel sein, aber er beruhigt sich auch wieder. Spätestens, wenn ein anderer oder eine andere neu ist.«
Rosige Aussichten, dachte Kenza. Wer weiß, wann das der Fall ist.
Zum Glück machte der Rest des Teams einen netteren Eindruck, allen voran Thilo Frahm, der Leiter der Spusi. Ein freundlicher Teddybär mittleren Alters mit Vollbart, hatte Kenza gleich zu Beginn gedacht.
»Aber weshalb ich hier bin«, Frau Martens reichte Kenza eine Akte. »Es gibt im LK Friesland in der letzten Zeit gehäufte Einbrüche in Einfamilienhäuser oder Einkaufsläden. Vermutlich organisierte Banden. Und da es momentan keine Morde aufzuklären gibt … Sie können sich ja mal reinlesen.«
Kenza nickte, dankbar, eine Aufgabe zu haben und sich so abzulenken. Mit Janßen würde sie schon klarkommen. Nicht jeder Kollege tat sich leicht damit, eine junge Frau vor die Nase gesetzt zu bekommen, und schon gar nicht, wenn sie blonde lange Haare hatte und kurze Röcke oder enge Jeans trug.
»Dann gutes Gelingen«, sagte Frau Martens. »Und der Janßen, der ist doch nur stinkig, weil der sich selbst Hoffnung auf Ihren Posten gemacht hat. Aber gut, dass er den nicht bekommen hat. Das denken wir übrigens alle.«
Das erklärte natürlich so einiges.
*
»Da war ein Mann auf der Straße!«, wurde Malin Meißner von ihrer Oma empfangen. Sie schaute wie immer nach der Arbeit bei ihr vorbei. Zum einen, weil sie ihre Oma sehr liebte, zum anderen, weil sie sich verantwortlich fühlte. Malin war Freelancer und hatte ein eigenes Büro mit einer Unternehmensberatung, sodass sie sich die Zeit meist frei einteilen konnte.
Ihre Oma ließ sich jetzt mit zitternden Händen auf den Küchenstuhl fallen. Sie wirkte völlig aufgelöst, etwas, was Malin von ihr nicht kannte.
»Was für ein Mann, Oma? Du bist so blass, als hättest du ein Gespenst gesehen.«
»Er war vor meinem Haus! Ich kenne ihn, aber er ist einfach so wieder verschwunden.«
Malin setzte sich ihrer Großmutter gegenüber. Normalerweise hätte sich ihre fürsorgliche Oma zuallererst darum gekümmert, dass ihre Enkelin eine Tasse Tee vor der Nase hatte. Dass sie es nicht tat, zeigte, wie aufgewühlt sie war. Trotzdem versuchte Malin, die Situation zu entschärfen. »Ein Mann. Was redest du denn, Oma? Es gibt viele alte Männer in der Stadt. Warum sollte nicht auch einer an deinem Haus vorbeilaufen?«
»Gib mir bitte ein Glas Wasser!« Es wirkte, als wären Malins Sätze an ihrer Großmutter einfach abgeprallt. Ihre Stimme bebte, die ganze Körperhaltung hatte etwas Geducktes.
»Oma!«, begann Malin behutsam, aber die winkte ab.
»Ich bin nicht verwirrt! Dieser Mann … Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.«
Malin umfasste die faltigen Hände und streichelte sie sacht. »Dann schieß mal los!«
»Matteusz«, stieß Tania schließlich hervor. »Der Mann war Matteusz!«
Malin verstand nicht. Den Namen hatte sie noch nie gehört. »Wer ist Matteusz? Dein heimlicher Verehrer, von dem Opa nichts wissen durfte und der dir nun auf deine alten Tage den Hof macht? Dann freu dich doch!«, versuchte Malin zu scherzen, doch ihre Oma winkte ab.
»Nein, um Himmels willen.« Pause. Schlucken. »Ich kenne … ich kenne Matteusz aus Polen. Aus meiner Kindheit.«
Malin lachte auf. »Oma, damals warst du ein kleines Mädchen! Wie willst du ihn nach der langen Zeit wiedererkennen? Das ist Jahrzehnte her! Wie alt warst du da? Fünf?«
»Sechs«, antwortete Tania. »Ich war sechs und ich kenne diese Augen. Die hat nur er. Das war Matteusz.«
»Oma, du weißt doch gar nichts mehr aus dieser Zeit! Oder besser, fast gar nichts mehr. Deine Worte! Du hast immer behauptet, du kannst dich nicht einmal an deine Mutter erinnern. Außer an die Farbe ihrer Schuhe. Und nun willst du einen Mann, der zu der Zeit ebenfalls ein Kind war, wiedererkannt haben?«
Ihre Oma formte lautlos ein paar Sätze, ehe sie weitersprechen konnte. »Als er vorhin gegangen ist, war es, als hätte er gleichzeitig ein Tuch vor meinen Augen weggezogen. Es ist alles wieder da. Alles. Jedes Detail. Halte mich für senil, weil ich ihn aus der Vergangenheit zu kennen glaube. Aber es sind diese Augen, die ich nie vergessen habe. Er war immer für mich da, als ich so allein war. Er war mein Freund, auch wenn er ein paar Jahre älter war als ich.« Ihre Stimme brach.
»Vielleicht wünschst du dir auch nur so sehr, dass er es war?«, fragte Malin vorsichtig. »Ich meine, du bist viel allein, da können schon mal eigenartige Gedanken kommen.«
»Ich irre ganz bestimmt nicht!«, beharrte ihre Oma. »Ich kann es beweisen. Auch wenn er einfach so wieder weggegangen ist, ohne mit mir zu sprechen.«
Malin seufzte. Was nur war mit ihrer Großmutter passiert? Warum erzählte sie so merkwürdige Dinge, die nicht stimmen konnten? »Oma, warum sollte er nach all den Jahren aus Polen kommen, dich in Deutschland ausfindig machen und einfach so wieder verschwinden?« Weil ihre Großmutter nicht mehr antwortete, sprach Malin weiter: »Ich glaube, du hast dich doch geirrt. Wenn er es wirklich gewesen und extra aus Polen gekommen wäre, hätte er doch mit dir gesprochen, oder meinst du nicht? Vor allem, wo er doch dein Freund aus Kindertagen war.«
Ihre Oma ging auf die letzte Bemerkung nicht ein, sondern erhob sich. »Ich habe recht, weil er mir etwas hiergelassen hat, Malin. Ich sag doch, ich kann das beweisen.« Sie öffnete eine Schublade und kam mit einem geöffneten Briefumschlag zurück. Vorsichtig, als wäre er sehr kostbar, legte sie ihn auf dem Tisch ab.
Malin sah sie fragend an, wagte aber nicht, das Kuvert in die Hand zu nehmen, solange ihre Großmutter sie nicht dazu aufforderte.
»Es hatte den Anschein, als wolle Matteusz nicht gesehen werden. Vielleicht hatte er vor irgendwas Angst? Er sah arm aus, ein bisschen zerlumpt. Matteusz hat den Umschlag in den Kasten geworfen und ist dann rasch verschwunden. Trotzdem muss es ihm wichtig gewesen sein, sonst hätte er die weite Reise nicht auf sich genommen und hätte ihn mit der Post geschickt.« Tania schob Malin den Brief hinüber.
Die sah ihn sich genauer an, erfasste die krakelige Schrift.
»Wenn er extra gekommen ist, wird er bestimmt später mit dir reden wollen«, überlegte Malin. »Es kann doch sein, dass du erst den Brief lesen sollst und er dann zurückkommt.« In Malin arbeitete es fieberhaft. »Wenn er wirklich von ihm stammt, war es vielleicht wichtig, dass du erst mit dem Geschriebenen allein bist. – Steht denn etwas Schlimmes drin?« Ihre Oma zitterte mittlerweile am ganzen Körper, sie kämpfte mit sich und die Augen schimmerten merkwürdig feucht. Malin hatte ihre Oma noch nie weinen sehen, nicht einmal, als ihr Mann gestorben war. Sie jetzt so zu erleben, berührte sie tief. Und machte sie hilflos.
Sie rückte ein Stück näher und nahm ihre Oma in den Arm. Seit Malin sich erinnern konnte, roch Oma Tania gleich. Ein bisschen nach Seife und ein bisschen nach Sommerwiese. Dieser Duft war untrennbar mit ihr verbunden, genau wie ihre Stimme und ihre zarten, nur leichten Gesten, mit denen sie Worte, die ihr wichtig erschienen, unterstrich.
Jetzt aber wirkte ihre Großmutter fast statisch, ihre Stimme hatte keinerlei Klang und unter den typischen Omaduft mischte sich der von Schweiß.
»Soll ich den Brief wirklich lesen?«, fragte Malin. Sie scheute sich noch immer, das zu tun.
Tania nickte. »Ja, sollst du. Und zwar jetzt!« Ihre Oma wirkte inzwischen so verletzlich wie ein Vogeljunges, das aus dem Nest gefallen war.
Malin griff zögernd nach dem Umschlag.
Die Stimme ihrer Großmutter war brüchig, als sie flüsterte: »Er konnte ihn nicht mit der Post schicken, Malin. Weil er nicht verloren gehen durfte. Er ist von meiner Mutter!«
Malin wich zurück. »Von deiner Mutter? Und das sagst du erst jetzt?« Sie überkam Gänsehaut. Wie oft hatte sie sich Gedanken über ihre leibliche Urgroßmutter gemacht. Oma Eva, über die man nicht sprach. Oma Eva, die irgendwo im Nirwana des Krieges gestorben und vergessen worden war. Oma Eva, von der sie nur ein Foto kannte, ein Bild, das die Ähnlichkeit zwischen ihr selbst und der eigenen Urgroßmutter zeigte. Oma Eva, die große Unbekannte, über die sie nur einmal die Aussage gehört hatte, sie wäre schön gewesen.
Und jetzt plötzlich gab es einen Brief von ihr? Einen letzten Gruß an ihr Kind?
»Oma Tania, der ist tatsächlich von deiner richtigen Mutter? Die den Krieg nicht überlebt hat?«
Ihre Oma schloss die Augen und schien plötzlich sehr weit weg. Ihre Stimme hatte eine weiche Färbung angenommen, als sie sprach. »Ja, von ihr. Von Eva von Kraft, meiner Mutter. Sie hatte schönes Haar. Blond, und wenn die Sonne hineinfiel, wirkte es wie mit Honig getränkt. Ich bin mit ihr immer an die Weichsel gegangen. Wir hatten so viele Störche, das kannst du dir gar nicht vorstellen! Und die Sommer waren warm. Zumindest der letzte Sommer, an den ich mich erinnere.«
»Du erinnerst dich wirklich. Komisch.«
»Ja, ich weiß plötzlich alles noch beinahe genauso, als wäre es gestern gewesen. Aber ich wünschte fast, ich würde mich nicht erinnern.« Tania wischte sich wieder über die Augen, die feucht schimmerten, aber nicht bereit schienen, wirkliche Tränen herauszulassen.
Malin schluckte und hielt den Briefumschlag noch immer fest umklammert. Niemals hatte man ihre Oma zuvor nach der Vergangenheit fragen dürfen. Fast wütend war sie stets geworden. Ausweichend. Genau wie ihre Stiefuroma, die im Heim in Wilhelmshaven lebte, und ihr Urgroßvater, ein alter Brummbär, dem Nähe zuwider war. »Lass mich in Ruhe mit den alten Geschichten, ich weiß nichts mehr«, waren die immer gleichlautenden Worte gewesen.
Und so hatte sich ein dunkles Tuch über die Zeit des Krieges und den Tod von Uroma Eva gelegt. So, als hätte es all das niemals gegeben.
Das Auftauchen von Matteusz und dieser Brief aber hatten ein Loch in dieses Tuch gerissen. Doch es war zu klein, um wirklich dahinterschauen zu können.
Tania hatte die Augen schon wieder geschlossen und sprach leise weiter. »Ich bin mit meinem Vater oft Heu machen gewesen. Auf einem großen Leiterwagen. Wir mussten aber nicht hart arbeiten, das haben die Leute gemacht.«
»Die Leute?«, hakte Malin vorsichtig nach.
»Ja, die Leute, die für uns gearbeitet haben. Meine Mutter hat für sie gekocht und Vater hat mit ihnen geschimpft, weil er sagte, sie wären faul. Stimmt aber nicht, sie haben hart gearbeitet. Vor allem Marek. Er hat mir immer Bonbons gegeben«, erzählte ihre Oma weiter. »Er war nett. Der Netteste von allen.«
»Wer ist Marek?«
»Er war auch einer von den Leuten. Genau wie Anna. Von der hab ich eine Gänsefeder bekommen. Meine Großmutter hat sie allesamt gehasst. Sie Polacken genannt. Das Wort an sich klang schon böse. Ich mochte es nicht. Heute weiß ich, wie böse es wirklich war.« Ihre Oma verlangte nach einem weiteren Glas Wasser. Sie stürzte es in einem Zug hinunter. »Mein Vater ist weggegangen, als es kalt wurde. Wir sind etwas später mit Pferd und Wagen gefahren. Ganz früh am Morgen. Da herrschte tiefster Frost. Es war sonnig, aber eiskalt. Unsere Haare waren ständig mit Raureif bedeckt. Und hinter uns haben wir den Feind schießen gehört. Wir mussten weg, einfach nur weg. Dann haben wir in einem Pferdestall gewohnt. Borntuchen hieß der Ort. Das weiß ich noch genau. Und da kommt auch der Brief her.« Malins Oma leckte sich die Lippen. Ihre Stimme schien noch immer aus der Ferne zu kommen. »Sie haben alles von ihr verbrannt.« Sie wurde plötzlich lauter, ihre Stimme wirkte voller. »Es hat so gestunken und alles war weg.« Tania deutete auf den Brief. »Da, lies! Den haben sie wohl nicht gefunden. Den nicht! Und es gibt noch mehr!«
Malin schluckte und begann zu lesen:
Borntuchen, 27.2.1945
Liebe Tania,
ich muss gehen, viel zu früh, und es gibt nichts mehr, was ich für dich tun kann. Ich muss dich allein zurücklassen in einer Welt, die unbeherrschbar geworden ist und von der niemand sagen kann, was aus ihr wird. Der Krieg ist eine hässliche Fratze, die alles Menschliche in den Hintergrund drängt. Ich würde so gern erleben, wie du zur Schule kommst oder wie du einmal heiratest und selbst Mutter wirst.
Aber das ist mir nicht vergönnt. Ich bete, dass dich das Schreiben eines Tages erreicht, denn du musst die Wahrheit kennen, wissen, was passiert ist. Lies das Tagebuch, darin findest du alles, was du wissen musst. Ich sterbe nicht, weil ich krank bin, egal, was du je hören wirst. Meine Kräfte schwinden, Liebes.
Verzeih mir, mein Kind. Alles! Nichts war mir je wichtiger als du …
An der Stelle brach der Satz ab und die Schrift verwischte. Das »Mutter«hatte sie nur noch schwer darunterschreiben können, der letzte Buchstabe zog sich nach unten, als wäre ihr beim Schreiben der Stift aus der Hand gefallen.
Mit fremder Schrift war eine Notiz auf dem Brief zu erkennen. Direkt neben einer kleinen Zeichnung, die einen See darstellte. Daneben stand das Wort »Borzytuchom«.
Malin ließ den Brief sinken und sah ihre Großmutter an.
»Was ist das?«
Oma Tania zuckte mit den Schultern. »Was weiß denn ich? Wem nützt es nun, in den alten Geschichten zu wühlen?« Sie entriss ihrer Enkelin den Brief und knüllte ihn zusammen. »Ich werfe ihn weg. Ein Tagebuch ist ja ohnehin nicht dabei.«
Malin nahm ihr das Papier aus der Hand, glättete es und steckte den Brief zurück in den Umschlag. »Nein, Oma, heb ihn auf. Es ist das Einzige, was dir geblieben ist. Sei froh, dass du das hast. Matteusz wird sicher zurückkommen und er wird dir ein paar Fragen beantworten. Vielleicht hat er auch das Tagebuch. Bestimmt wollte er dich nicht mit allem überfordern oder es gibt einen anderen triftigen Grund, warum er das Tagebuch nicht gleich mit abgegeben hat.« Malin legte den Brief zurück in die Schublade und schloss sie nachdrücklich.
»Es ist nicht das Einzige, was ich von damals habe. Es gibt die Puppe noch«, sagte ihre Oma. »Sie liegt im Schlafzimmer in der Kiste. Meine Leni.« Tania stand mühsam auf und schlurfte nach nebenan, bis sie mit einer verwaschenen Stoffpuppe zurückkam. »Die hat mir meine Mutter gemacht.«
Malin hatte sie noch nie gesehen und nahm sie in die Hand. Einfache Wollfäden simulierten blonde Zöpfe, das Kleid bestand aus grauem Leinenstoff, die Schürze aus Sackleinen.
Ihre Oma schluckte. Dabei wurden die Augen erneut feucht. Dann sog sie die Luft scharf ein. »Bitte lass mich jetzt allein!«, sagte sie plötzlich und nahm Malin die Puppe aus der Hand. »Wir sehen uns morgen.«
»Sicher, dass ich gehen soll?« Malins Stimme schwankte.
»Ja, bitte! Sei mir nicht böse, aber ich muss nachdenken. Ich kann das alles jetzt nicht. Es – ist – zu – viel.«
Malin stand auf. Auch wenn sie ihre Oma jetzt wirklich nur ungern allein ließ. »Ich rufe später noch mal an!«
»Ja, mach das. Danke.«
Malin zuckte mit den Schultern. Ihre Oma Tania saß mit leerem Blick auf dem Stuhl und starrte abwechselnd von der Puppe zum Fenster, das einen Blick in den Garten ermöglichte. Sie kannte ihre Großmutter. Kein Wort würde sie jetzt noch aus ihr herausbekommen. Zögernd schloss sie die Tür hinter sich.
Tania
Borntuchen (Borzytuchom), Februar 1945
Brandgeruch stieg in Tanias Nase. Das kleine Mädchen sah in den dunkel aufsteigenden Qualm, der sich senkrecht wie eine Säule in den klaren Winterhimmel schraubte. Ich will zu meiner Mutter, dachte sie und wischte sich über die nassen Wangen. Die Tränen kamen und ließen sich nicht zurückhalten.
Über dem Hof hing ein bestialischer Gestank, weil ihre Oma alle Dinge ins Feuer warf, die Tanias Mutter gehörten. Ihre Unterwäsche, das einzige Buch, das sie auf die Reise mitgenommen hatte. Sogar ihre Bibel und die wollenen Strümpfe wurden ein Opfer der Flammen. Warum tat ihre Oma das? Es gehörte doch alles Mutter und die würde traurig sein, wenn es vernichtet war. Und sie würde frieren, schließlich war es unglaublich kalt. So kalt, dass sich beim Atmen kleine Dampfwölkchen bildeten.
Tania durfte seit dem kargen Frühstück nicht mehr zu ihrer Mutter. Sie war die letzten Tage blass und müde gewesen, hatte krank ausgesehen. Heute Morgen war es besonders schlimm gewesen. »Ich muss schlafen, Tania. Bin so müde. Oma gibt auf dich Acht!«
Aber jetzt müsste ihre Mutter doch lange wieder wach sein.
Jemand zupfte am Ärmel des Mädchens. Sie schrak zusammen. Es war Matteusz, ihr Freund. Seine Augenbrauen zuckten, wie immer, wenn er aufgeregt war. Oder wenn er etwas ausgefressen hatte. »Komm! Du sollst Milch vom Bauern holen. Schon vergessen?«
Matteusz’ Augen waren so blau wie der Sommerhimmel. Tania mochte es, wenn er sie lange ansah. Sie kannte keinen, der so schauen konnte wie ihr Freund. Heute aber blickte er auf seine Füße, die er der Kälte wegen mit Wolllappen umwickelt hatte. Das Tuch war schwarz vor Dreck. Er schabte damit über den gefrorenen Boden. »Kommst du jetzt?«
Tania schüttelte den Kopf. Sie hatte den Auftrag ihrer Oma nicht vergessen, aber sie fürchtete sich. Wenn sie nicht tat, was die Großmutter verlangte, würde Tania Schläge bekommen. Das hielt sie immer noch besser aus als die Angst, an den Männern vorbeizulaufen, die im Stall arbeiteten und deren Augen in schwarzen Höhlen lagen. Sie lachten, wenn Tania sie anschaute, und entblößten ihre gelben Zähne. Die meisten waren alt, hinkten oder liefen krumm. Für ihre Oma zählte das nicht. »Du kriegst wenigstens etwas. Du mit deinen blonden Locken und diesen Katzenaugen. Dir geben sie nicht nur Milch, sondern auch einen Kanten Brot mehr mit. Oder einen Apfel.«
Und so quälte Tania sich Tag für Tag mit klopfendem Herzen an den Männern vorbei, die vielen Stufen hinauf zur Veranda des Gutshofes. Matteusz wusste von ihrer Angst und begleitete sie, aber er wagte sich niemals bis zur Haustür hinauf. Die Bäuerin hätte ihn geschlagen, hätte er das getan. Matteusz war ein Niemand, das hatte Tania schon begriffen. Ihn durften alle prügeln und schubsen. Nur ihre Mutter tat das nicht, sondern goss ihm von der Milch den Rest in eine der Blechschalen. Auch das Stück Brot, was sie immer für ihn bereithielt, half ihm, den Tag besser zu überstehen. Matteusz verehrte Tanias Mutter, und manchmal war sie eifersüchtig, vor allem, wenn sie ihm zu häufig über das wirre dunkle Haar strich.
»Komm, Tania«, wiederholte er. »Lass uns Milch holen, bevor deine Oma böse wird.«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Will bei Mutter bleiben, Matti«, sagte sie. Der Rauch des Feuers breitete sich nun über den Hof aus, weil ein leichter Wind aufgekommen war. Tania hustete und zog sich den Wollschal vors Gesicht. Sie hüpfte auf und nieder, weil sie kalte Zehen hatte. Ihre Schuhe waren zu klein und so konnte sie keine dicken Wollsocken darin tragen.
Matteusz zerrte heftiger am Stoff ihrer Schürze, die sie über dem zerlumpten Wollkleid trug, unter dem sie drei Schichten Pullover anhatte. »Nein, du kommst jetzt!«
Tania stampfte mit dem Fuß auf. »Ich will aber nicht!« Ihre Stimme überschlug sich.
Matteusz riss sie mit sich und schleppte Tania hinter die Wand der Stallung, wo sie der Rauch nicht mehr erreichen konnte. Dort drückte er sie mit dem Rücken gegen die Mauer. »Hör auf zu schreien! Du kannst nicht mehr zu deiner Mutter!«
In Matteusz’ Ton schwang so starke Verzweiflung, dass Tania augenblicklich innehielt. »Warum? Warum geht das nicht?«, hauchte sie. »Hat sie noch nicht ausgeschlafen?«
Matteusz’ Augen wirkten dunkel. Er schluckte, bevor er antwortete. »Sie wird nie mehr aufstehen … Deine Mutter ist … tot!«
Tania stieß Matteusz weg. Tot waren die Schweine, wenn Vater sie geschlachtet hatte und das Blut in den Trögen aufgefangen wurde, damit sie braune Wurst davon machen konnten. Tot waren auch die Hühner, die Mutter rupfte, bevor sie Suppe kochte. Tot war auch Tante Otilie. Aber die war plötzlich einfach weg, und dann hatte es Kaffee gegeben und leckeren Kuchen. Damals, als sie noch zu Hause waren. »Hau ab, du lügst. Sie kann nicht tot sein. Sie ist ja noch da. Ich will sofort zu meiner Mutter!«
»Das geht wirklich nicht, Tania!« Über Matteusz’ sommersprossige Wangen rannen Tränen. »Hat deine Oma dir denn nichts gesagt? Deine Mutter schläft jetzt für immer.« Der Junge zitterte.
Tania schüttelte den Kopf. Warum sollte ihre Mutter das tun? Sie mussten schließlich bald weiterziehen zum Vater ins Reich. Er würde dort auf sie alle warten. Tania hatte am Morgen noch mit ihrer Mutter gesprochen, ihr einen Kuss auf den Scheitel gehaucht und sie festgehalten, weil sie so traurig aussah. Bis ihre Oma sie weggezerrt hatte. »Ich muss schlafen, Tania. Bin so müde. Oma gibt auf dich Acht!« Wieder hämmerten diese Worte durch Tanias Kopf.
Sie war danach aus dem Stall gestolpert, hatte sich in der Tür noch einmal umgedreht und ihre Mutter auf ihrem Strohbett angesehen. Das Letzte, an was sich Tania erinnern konnte, war das schmale Gesicht und dass ihre Mutter kurz darauf fürchterlich gehustet hatte und es danach klang, als würde sie sich übergeben.
»Mach dich fort! Deine Mutter ist krank!« Wenn Großmutter in diesem Tonfall sprach, gehorchte Tania. Nur an den Männern hatte sie sich nicht vorbeigewagt. Sie hatte sich durch die Hintertür hineingeschlichen und im Pferdestall verkrochen. Hier war es immer angenehm warm und es roch gut. Den Kopf ans Holz gelehnt, lauschte sie dem Schnauben der Tiere und hoffte, dass der Husten ihrer Mutter aufhörte. Das war dann auch geschehen, doch kurz darauf hatte Großmutter alle Sachen verbrannt.
»Mutter war müde«, sagte Tania schließlich. »Ja, sehr müde.«
»Noch viel müder als Miez, wenn sie sich zusammenrollt«, bestätigte Matteusz. »Deine Mutter schläft jetzt ganz fest und es geht ihr gut. Richtig gut, weißt du? Da, wo sie fortan sein wird, sind die Engel und die machen Musik. Sie wird ein weißes Kleid anhaben und … auch einer von ihnen werden.«
»Dann ist sie im Himmel?«, fragte Tania nach.
Matteusz nickte erleichtert. »Noch nicht, aber bald.«
»Warum macht Oma ein Feuer mit Mutters Sachen?«
»Weil sie krank war. Da muss man alles verbrennen, sonst steckt man sich an. Hat deine Oma mir so gesagt.«
Tanias Kinn zitterte bereits wieder. Sie schlich zur Stallecke und wagte einen Blick auf den Hof, wo das Feuer noch immer loderte. Sie sah, wie ihre Großmutter auch das Kleid in die Flammen warf, das ihre Mutter stets angezogen hatte, wenn sie schön aussehen wollte. Sie hatte darin getanzt und gelacht, sich über den weichen grauen Stoff gefreut, der um ihre Beine geschwungen war.
»Aber wie kommt Mutter jetzt in den Himmel?«, überlegte Tania. »Hat sie Flügel?«
Matteusz trat von einem Fuß auf den anderen. Er biss sich auf die Unterlippe und schwieg.
Tania musterte ihn. »Lügner! Mutter ist gar kein Engel! Das hast du nur so gesagt!«
»Doch, ist sie wohl. Es dauert nur ein paar Tage. Ihr müssen erst die Flügel wachsen, das Wolkenzimmer muss eingerichtet werden und so. Da kann sie nicht gleich hinreisen.«
Tania blickte Matteusz noch immer zweifelnd an. »Wie lange dauert das?«
Ihr Freund zögerte. »Weiß nicht genau. Aber nach der Beerdigung wird sie in den Himmel fliegen. Das ist der Tag, wo wir uns von ihr verabschieden, du weißt doch, was ein Friedhof ist, oder?«
Tania nickte. »Da, wo die vielen Steine stehen und die Blumen blühen. Und bei einer Beerdigung gibt es Kaffee und Kuchen. Wie bei Tante Otilie.«
»Genau, jedenfalls wenn kein Krieg ist. Und vom Friedhof aus werden die Toten zu Engeln und fliegen los. Das ist wie ein Flughafen für die Toten.« Matteusz redete und redete. Tania verstand zwar nicht alles, was ihr Freund sagte, aber offenbar war es nicht schlimm, tot zu sein.
2
Der September zeigte sich auch heute von seiner schönsten Seite. Der Tote, der neben der Schlossgraft lag, passte ebenso wenig in das Bild wie die Plastiktüte, die sich in einem der herunterhängenden Äste verfangen hatte. Trotz der ungewöhnlichen Wärme rieb sich Polizeihauptkommissarin Kenza Klausen die Oberarme. Sie fröstelte.
Gestern noch hatte man sie mit dieser Diebstahlsache betraut und nun gab es tatsächlich einen Mord. Ein wenig unsicher war sie schon und erhoffte sich Unterstützung von den erfahrenen Kollegen, doch wenn etwas schieflief, würde sich jeder darauf berufen, dass sie die leitende Kommissarin war. Sie hatte die Verantwortung, ob es ihr gefiel oder nicht.
Ihrem Kollegen Bert Janßen war die Schadenfreude anzumerken gewesen, als er sie beim Frühstück gestört und ihr telefonisch von dem Mordfall berichtet hatte. Er glaubte an Kenzas Scheitern und machte weiterhin keinen Hehl daraus, dass er mit der neuen Ersten Hauptkommissarin nicht einverstanden war. »Wenn die uns so ein junges Gemüse vor die Nase setzen, dann muss es auch allein wachsen.« Das sollte seiner sonoren Lache nach witzig klingen, aber Kenza hatte er nichts vormachen können. Bert Janßen war ein ähnlicher Typ wie ihr Vater. Gedrungene Statur, kurzes blondes Haar und leichter Bauchansatz. Er war genauso bestimmend, herrschsüchtig und von sich überzeugt. So sehr, dass er die Grenzen der anderen nicht mehr wahrte.
Kenza streckte den Rücken durch. Sie durfte sich jetzt keinesfalls von Janßen aus dem Konzept bringen lassen.
Die Spurensicherung unter Thilos Leitung war schon vor Ort und durchkämmte den Jeverschen Schlosspark. Überall blitzten die weißen Anzüge durch die Büsche. Der Pfau schlug aufgeregt sein Rad, während der Ganter sich eben einem Kollegen zischend näherte, der die gefällte Eiche untersuchte.
Eine junge Frau mit schwarzem Bubikopf und schlanker, sportlicher Figur stand etwas abseits und schüttelte immer wieder den Kopf. Ihr Gesicht war leichenblass. Sie hatte nach Janßens Auskunft den Toten in der Graft entdeckt. Mit ihr musste Kenza gleich noch sprechen, jetzt wollte sie sich zunächst den aktuellen Stand der Spurensicherung einholen. Sie näherte sich Thilo Frahm, mit dem sie von der ersten Begegnung an per Du war.
»Hallo, Thilo, kannst du schon was sagen?«
»Moin, Kenza. Ein bisschen. Es sieht nicht so aus, als wäre der Mann in der Graft ertrunken. Die Schlagwunde am Hinterkopf lässt den Verdacht auf Fremdeinwirkung zu. Ich vermute, er war schon tot, als er hineingeworfen wurde.«
Er deutete mit dem Kopf hinter sich, wo ein weiterer Mann das Geschehen betrachtete. »Das ist Doc Stock, der Leiter der Rechtsmedizin aus Oldenburg. Wir holen ihn in solchen Fällen gern dazu, ich hoffe, du bist damit einverstanden. Er sagt, er hat einen besseren Überblick, wenn er selbst am Tatort war.«
»Doc Stock?«, fragte Kenza.
Thilo grinste. »Wir nennen ihn so, weil er wirkt, als hätte er einen Stock verschluckt. Dass sein Nachname so gut dazu passt, ist Zufall. Aber er ist ein supernetter Kollege.«
»Ist okay, dass ihr ihn geholt habt. Wichtig ist ja nur, dass der Fall schnell geklärt wird. Und wer helfen kann: immer zu. Ich stell mich ihm gleich mal vor.« Kenza konzentrierte sich wieder auf das, was Thilo zuvor gesagt hatte. »Ihr geht also von Mord aus. Schon bekannt, wie lange er dort liegt?«
Thilo wiegte den Kopf. »Ich denke«, er sah auf die Uhr, »jetzt ist es acht … so vier Stunden bestimmt. Meint Doc Stock auch. Später mehr, du weißt schon. Der Leichnam wird gleich nach Oldenburg in die Gerichtsmedizin gebracht.«
Kenza nickte. »Und wer ist der Tote? Weiß man das schon?«
Thilo schüttelte den Kopf. »Er trägt keine Papiere bei sich. Aber er wirkt der Kleidung nach verarmt. Ich schätze ihn auf mindestens 80.«
»Und es ist ganz sicher, dass er nicht einfach in die Graft gefallen ist, sich dabei oder zuvor gestoßen hat und dann ertrunken ist?« Eine letzte hoffnungsvolle Frage.
»Ganz sicher, Kenza. Die Wunde kann so nicht entstanden sein.« Thilo sah sie mit schief gelegtem Kopf an, als ahnte er etwas von ihren Zweifeln. »Das wird schon. Du schaffst das. Lass dir von Janßen nicht ans Bein pinkeln! Der kocht auch nur mit Wasser.«
»Das sagst du so leicht. Er will mich loswerden, so schnell es geht.«
»Das hat er ja nun nicht zu entscheiden, oder?« Thilo lächelte sie freundlich an und strich sich über den Bart. »Wir sind jedenfalls allesamt froh, dass du unser neuer Boss bist und nicht er. – Guck, da kommt auch schon Verstärkung.« Er wies auf einen schlanken jungen Mann, der sich, in Jeans und leichten Blouson gekleidet, näherte. Er war etwa 40 Jahre alt, hatte blondes, leicht gescheiteltes Haar und ein verschmitztes Lächeln im Gesicht, sogar wenn er wie jetzt ernst guckte.
»Moin, Thilo«, begrüßte er den Ermittler. »Und Sie sind Kenza Klausen? Hi.«
»Ja, ich bin die Neue«, erwiderte Kenza. »Ich komme aus Oberhausen, also mitten aus dem Pott, und hab mich nach Wilhelmshaven versetzen lassen. Ich dachte, hier gibt es weniger Kriminalität. Das war wohl ein Irrtum.« Kenza unterbrach sich. Herrgott, was quasselte sie hier rum? Der Kollege hatte sich ja noch nicht einmal vorgestellt! »Darf ich nach Ihrem Namen fragen?«, stieß sie rasch hervor.
»Finn Gerdes. PHK aus Jever. Ich unterstütze Sie hier vor Ort. Also Mord in Jever, deshalb auch ein Bulle aus dem ansässigen Kommissariat zur Unterstützung.«
Zumindest wirkte dieser Mann sympathisch. Kenza entspannte sich etwas und lächelte ihn freundlich an. »Willkommen im Team. Ich geh dann mal zu Doc Stock.«
Kenza stellte sich dem Rechtsmediziner vor, der zwar nicht lächelte, sie aber neugierig musterte. »Ach, die neue Kommissarin! Ich mache mich nachher gleich an die Arbeit, dann wissen wir mehr.«
Kenza bedankte sich und blickte sich um.
Die Schaulustigen scharten sich bereits hinter dem blau-weißen Band, mit dem der Tatort neben der Graft großzügig abgesperrt worden war, und versuchten einen Blick zu erhaschen. Zur Untersuchung hatten die Kollegen den alten Mann aus dem Wasser gezogen und auf einer Plane abgelegt.
»Bauen Sie bitte einen größeren Sichtschutz!«, forderte Kenza die Kollegen auf. Sie mochte es nicht, wenn ihnen Fremde bei der Arbeit zusahen und womöglich sogar Fotos schossen, die sie später bei Facebook oder sonst wo verbreiteten. »Sofort!« Ihre Stimme klang eine Spur zu herrisch und sie erkannte an Janßens Mimik, dass er sie vor den Kollegen der KTU imitierte. Sie seufzte. Nein, leicht wurde es ihr hier wirklich nicht gemacht.
»Ich muss mich dann jetzt um die Zeugin kümmern.« Kenza nickte den Kollegen freundlich zu.
Sie näherte sich der jungen Frau, die noch immer wachsbleich an einem Baum lehnte und dem Treiben mit reglosem Gesichtsausdruck zusah. Sie war etwa in Kenzas Alter, wirkte mit der sportlichen Kleidung recht burschikos. Ihre beiden kleinen Hunde, die eher an zu groß geratene Ratten erinnerten, sprangen hektisch um ihre Beine herum.
»Wollen Sie sich besser hinsetzen?« Kenza wies auf die Parkbank, die so stand, dass sie den Blick auf den Toten verhinderte.
Die Frau nahm das Angebot dankbar an und fächerte sich mit der Hand etwas Luft zu. »Danke, jetzt geht es wieder! Mich nimmt das alles etwas mit. Man findet ja nicht täglich eine Leiche.« Sie band die Leinen der Hunde an der Lehne der Parkbank fest und wirkte erleichtert, nicht mehr auf das Tatgeschehen blicken zu müssen.
»Ich bin Kriminalhauptkommissarin Kenza Klausen und leite die Ermittlungen«, stellte Kenza sich vor. »Sie haben den Verstorbenen also entdeckt?«
Die Frau nickte.
»Ihren Namen, bitte!« Kenza zückte ihren Block. »Entschuldigung. Malin Meißner. Ich lebe hier in Jever in der Großen Burgstraße. In einem winzigen Einzimmerappartement.« Sie deutete mit dem Kopf in Richtung der hohen Mauer, die die Schlossgraft von der Straße abgrenzte. »Das liegt gleich dort drüben.«
Kenza schrieb sich die genaue Adresse auf und fragte dann nach: »Sie haben vermutlich Ihre Hunde im Schlosspark ausgeführt, als Sie den Toten entdeckt haben?«
»Ja, ich war mit ihnen draußen. Meine Nachbarin ist verreist und ich passe auf die Tiere auf. Sie kommt heute zurück.« Die Frau strich einem der weiß gescheckten Hunde über den Kopf. Der leckte ihr die Hand.
»Aber Sie kannten den Toten nicht?«
»Nein. Woher? Ich kenne hier längst nicht jeden. Auch wenn Jever fast ein Dorf ist. Außerdem bin ich nicht allzu dicht an ihn herangegangen.«
Über ihnen kreiste gerade lautstark krächzend ein Schwarm Saatkrähen.
Malin Meißner folgte Kenzas Blick. »Die Vögel machen einem manchmal Angst. Ich kann irgendwie verstehen, dass viele Menschen sie hier nicht wünschen. Todesvögel.«
Kenza lächelte nur. Die Krähen waren in Jever offenbar ein Thema, das heiß diskutiert wurde. Sie hatte erst gestern wieder in der Zeitung davon gelesen. Sie schaute die junge Zeugin abwartend an, aber die Krähen waren wohl abgehakt.
»Bei dem Toten handelt es sich um einen sehr betagten Mann, mindestens 80 Jahre alt. Er war ärmlich gekleidet und trug einen Anzug. Es könnte sich um einen Obdachlosen handeln.«
Bei ihren Worten war Malin Meißner merklich erblasst.
»Kennen Sie ihn doch?«, fragte Kenza, denn die Frau wirkte, als hätte sie eine Ahnung.
»Kommt er aus Polen?«, fragte sie schließlich.
»Wir wissen es nicht. Er trug keine Papiere bei sich. Warum?«