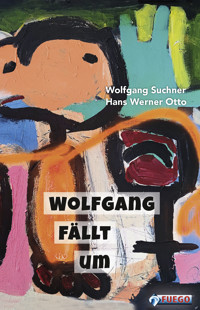
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Trompeter Wolfgang Suchner hat beschlossen, die zweite Phase seiner Ausbildung zum Musiklehrer gar nicht erst zu beginnen, sondern sein Leben als freischaffender Künstler fortzusetzen. Sechs Jahre schon macht er Straßenmusik, spielt in verschiedenen Bands und hat sich schließlich auf Musiktheater verlegt. Da trifft ihn ein epileptischer Anfall, ein Grand Mal. Ein Blutschwamm in seinem Gehirn hat ihn verursacht, geblutet und die Fehlschaltungen bewirkt. Das kann jederzeit noch einmal geschehen, aber dann vielleicht tödlich enden. Besonders in Situationen, in denen großer Druck im Kopf entsteht - zum Beispiel beim Trompetespielen. Wolfgang weiß nicht, wie es weitergehen soll. Auch als Operationen den Schwamm und das Ausblutungsrisiko minimiert haben, bleibt da noch die Epilepsie. Und die wird er nicht mehr los. Wie lebt man mit einer bedrohlichen chronischen Erkrankung? "... Das ist das Loch. Er versteht nicht, was geschieht, und er weiß nicht, was geschehen ist. Es gibt keine Erinnerung. Da ist ein Loch in der Zeit. Wenn man hindurch gucken könnte, sähe man die andere Seite. Die Rückseite der Zeit. Vielleicht hat er sie ja gerade gesehen, aber er kann sich nicht erinnern ..."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wolfgang Suchner Hans Werner Otto
Wolfgang fällt um
Das Loch in der Zeit
FUEGO
– Über dieses Buch –
Der Trompeter Wolfgang Suchner hat beschlossen, die zweite Phase seiner Ausbildung zum Musiklehrer gar nicht erst zu beginnen, sondern sein Leben als freischaffender Künstler fortzusetzen. Sechs Jahre schon macht er Straßenmusik, spielt in verschiedenen Bands und hat sich schließlich auf Musiktheater verlegt. Da trifft ihn ein epileptischer Anfall, ein Grand Mal. Ein Blutschwamm in seinem Gehirn hat ihn verursacht, geblutet und die Fehlschaltungen bewirkt. Das kann jederzeit noch einmal geschehen, aber dann vielleicht tödlich enden. Besonders in Situationen, in denen großer Druck im Kopf entsteht - zum Beispiel beim Trompetespielen. Wolfgang weiß nicht, wie es weitergehen soll. Auch als Operationen den Schwamm und das Ausblutungsrisiko minimiert haben, bleibt da noch die Epilepsie. Und die wird er nicht mehr los. Wie lebt man mit einer bedrohlichen chronischen Erkrankung?
„... Das ist das Loch. Er versteht nicht, was geschieht, und er weiß nicht, was geschehen ist. Es gibt keine Erinnerung. Da ist ein Loch in der Zeit. Wenn man hindurchgucken könnte, sähe man die andere Seite. Die Rückseite der Zeit. Vielleicht hat er sie ja gerade gesehen, aber er kann sich nicht erinnern.“
Prolog
Das grösste Gesundheitsrisiko ist das Leben
Selbst wäre ich gar nicht darauf gekommen. Aber nicht nur behandelnde Ärzte, auch einige Journalisten und Redakteure ermutigten mich nach Interviews, über Epilepsie und ketogene Ernährung sowie mein Leben als Künstler zu schreiben – ich hätte doch so viel zu erzählen, meinten sie.
In einer Ruhephase, erzwungen durch Auftrittsleere während der Coronastille, kam ich darauf zurück und fragte meinen Freund Hans Werner Otto, ob er sich vorstellen könne, das alles zu Papier zu bringen. Dann verabredeten wir uns über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren immer mal wieder zum Kaffee, ich erzählte und er notierte, fragte und hakte nach, schickte mir dann seine Ausformulierungen, und Stück für Stück kam als ganzes Buch zustande, was eigentlich eher als längerer Aufsatz gedacht war.
Für mich war dieser Rückblick auf mein Leben ein echtes Abenteuer. Ich musste nicht nur in meinen Erinnerungen kramen, sondern oft wie zu einer fremden Person recherchieren, wenn sich herausstellte, dass das, was ich zu erinnern glaubte, gar nicht mit nachprüfbaren Fakten übereinstimmte. Außer anderen zeitlichen Abfolgen offenbarten sich da auch Dinge, die verschüttgegangen waren und mit denen ich nie gerechnet hätte. Im Rückblick sehe ich nun, wie viel Ungewöhnliches ich erleben durfte, aber auch, was meine Freundinnen und Kolleginnen alles mitgetragen haben und wie sehr ich sie belastet habe – eine Einsicht, für die ich erst über 60 Jahre alt werden musste. Ihnen allen, die mich unterstützt haben, an meiner Seite waren - und blieben – und mir geholfen haben, mein Leben mit Epilepsie zu leben, danke ich hier. So viele sind es – und etliche sind leider schon verstorben –, dass ich niemanden namentlich nennen oder hervorheben möchte. Sie alle machten die wunderbare Fülle und Buntheit meines Lebens aus, das ich, auch mit all seinen Fehlern und Unzulänglichkeiten, an keiner Stelle und selbst dann nicht rückgängig machen würde, wenn ich es könnte.
Der Rückblick hat mir auch gezeigt, dass meine Entscheidung richtig war, trotz Epilepsie als Freiberufler weiterzumachen – mit allen Risiken, die ein solches Leben bietet. Das Leben selbst ist ein Risiko, auch ohne Epilepsie. Ich genieße es.
Und das noch hoffentlich eine lange Zeit.
Wolfgang Suchner
1 Das Loch
Wuppertal 1991:
Grand Mal.
Großes Malheur.
Große Scheiße.
Zuerst ist da ein weit klaffendes Loch. Er weiß nicht mehr, was war. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Er weiß auch nicht, wo er ist, obwohl ihm der Raum, in dem er da mitten auf dem Boden liegt, ganz bekannt vorkommt. Blinkendes Blaulicht flackert von außen herein, lässt das Gesicht dieses Mannes, den er kennt, aufleuchten und wieder verblassen. Ganz nah vor ihm. Aber wie heißt er. Er kennt ihn, er kennt ihn gut, aber wie heißt er. Und er selbst, wie heißt er. Er kennt sich nicht mehr.
Er ist gar nicht da. Er ist nicht da, aber auch nicht hier, auf diesem Sisalteppich, auf dem er sich offenbar das Gesicht zerkratzt hat, es schmerzt. Mal ist er gar nicht da, nimmt sich nur von außen wahr, ohne jede Regung. Und mal fühlt er sein Gesicht, es ist heiß und schmerzt. Zwei Wahrnehmungen, die einander ablösen, wie das Blaulicht, das mal da ist und mal nicht mehr da ist, nur nicht so schnell. Der Mann, den er kennt, den er gut kennt, sagt etwas zu ihm, fragt etwas. Und eigentlich möchte er ihm antworten, aber es geht nicht. Er hat keine Worte. Er hört die Frage und die gesprochenen Worte, er denkt auch eine Antwort, aber die hat keine Worte. Er ist sprachlos.
Außer dem Gesicht des Mannes, den er kennt, ist da noch das Gesicht einer Frau, die er kennt, aber wie heißt sie. Und die Gesichter von zwei Männern, die er noch nie gesehen hat. Mal fühlt er ihre Hände auf seinem Körper, mal sieht er sich selbst wie von weit oben, seinen Körper auf einer Trage ausgestreckt, mal fühlt er das Schaukeln dieser Trage, mal schaut er sich selbst hinterher und den Männern, die ihn aus der Wohnung über den Flur zur Haustür getragen haben. Mal spürt er den Luftzug auf der Straße und sieht das blaue Blinklicht auf dem Rettungswagen, die Quelle also und nicht den Widerschein, mal ist ihm, als sei er noch in der Wohnung und habe nichts mit dem zu tun, was gerade geschieht.
Das ist das Loch. Er versteht nicht, was geschieht, und er weiß nicht, was geschehen ist. Es gibt keine Erinnerung. Da ist ein Loch in der Zeit. Wenn man hindurchgucken könnte, sähe man die andere Seite. Die Rückseite der Zeit. Vielleicht hat er sie ja gerade gesehen, aber er kann sich nicht erinnern.
Da kommt etwas zurück. Das, was vor dem Loch war.
Eine Schlinge drückt um seinen Hals und eine Trompete hängt vor seinem Mund. Der Mann, den er gut kennt, ist bei ihm, und jetzt hat der Mann auch einen Namen, er heißt Winni. Und die Frau, das ist Marie. Er selbst heißt Wolfgang. Oder?
Doch, das ist sein Name. Es gibt viele Wolfgangs. Es dauert eine Weile, bis er diesen Namen als einen annimmt, der nicht mehr außerhalb seiner selbst herumschwirrt und irgendwelchen anderen Menschen anhängen mag, sondern der ganz zu ihm gehört. Er, Wolfgang.
Da ist dieser große, weiß gestrichene Raum in der ehemaligen Bandwirkerei, in der sie gerade geprobt haben - Marie, Winni und er, Wolfgang. Das neue Stück soll irgendwas mit Grenzen zu tun haben, irgendetwas, so ganz genau wissen sie es noch nicht. Vor eineinhalb Jahren ist die Berliner Mauer umgefallen. Pina Bausch zeigt hier in Wuppertal am Anfang ihres Stückes dem Publikum eine große Mauer aus Bimsstein, die zusammenbricht und aus ihren Bruchstücken die Kulisse bildet, in der die Tänzerinnen sich dann ihre Plätze und Bewegungsräume suchen müssen. Das Stück heißt Palermo, nicht Berlin, und die Mauer stand als Bühnenbild schon fest, bevor sie in Berlin wackelte, aber alle im Publikum denken an Berlin. Eine Grenze wurde geöffnet. Andere werden geschlossen. Das europäische Dublin-Abkommen hält Flüchtlinge im Ankunftsland fest, macht bewusst, dass die in Schengen gefallenen Grenzen gar nicht so wie die Mauer umgefallen, sondern nach außen gerückt sind, Grenzen sind etwas durchaus Reales und durch und durch Absurdes, man reibt sich daran, man stößt sich daran, man stürmt dagegen an: Grenzen sind ein Thema.
Sie probieren etwas aus. Marie mit ihrer tiefen, raumfüllenden Stimme, Winni mit der Klarinette und Wolfgang mit der Trompete: Wie und an welcher Stelle werden Grenzen deutlich, so spürbar, dass auch mögliche Zuschauerinnen sie später erfahren können? Er, Wolfgang, stellt einen Tisch in die Bühnenmitte, verknotet ein Seilende an einem Tischbein und legt sich das andere Ende als Schlinge um den Hals. Dann nimmt er die Trompete, spielt ein paar Töne und geht langsam über die Bühne. Das Seil strafft sich und hindert ihn weiterzugehen, immer, wenn der Rand des Kreises erreicht ist, in dem er sich um den Tisch bewegen kann - die Trompete verstummt. Wolfgang geht zurück zum Tisch, beginnt wieder von vorne. Beim dritten Anlauf dann fühlt er sich in seinen Bewegungen so sicher, dass er sich stärker auf die Trompete konzentrieren kann. Aus den Tönen wird eine kleine Melodie, er wiederholt sie, variiert sie, lässt sie mal klein und bescheiden daherkommen, dann wieder gibt er ihr mehr Volumen. Mehr Luft, noch mehr, er presst die Lungen leer und die Melodie füllt sich, steigt in brillante Höhen. Und bricht plötzlich ab. Quäkt noch einmal leise. Er hat die Schlinge völlig vergessen, erschrickt, als sie ihm jetzt kurz den Hals zuschnürt. Keine Luft mehr.
Mittagspause bei Marie, sie wohnt ganz nah und hat schon eine Suppe vorbereitet. Während sie im Topf rührt und Winni die ersten Ideen notiert, geht Wolfgang auf und ab, Winni stellt eine Frage, wirft ein Problem auf, Wolfgang bleibt stehen, nennt eine mögliche Lösung, aber Winni verwirft sie, Wolfgang geht weiter. Marie beginnt die Suppenteller auf den Tisch zu verteilen, hat jetzt auch eine Idee, hält in ihrer Bewegung inne, der Teller in ihrer Hand schwebt noch über dem Tisch. Winni schüttelt den Kopf. Der Teller sinkt, Marie deckt weiter den Tisch. Und Wolfgang geht weiter auf und ab, hin und her, auf und ab. Wird plötzlich langsamer, blickt auf, bleibt stehen.
Jetzt hab ich's! sagt er.
Und fällt um, mitten hinein in dieses Loch.
Homosexuell? Wieso?
Das fragt Winni den Mann im Krankenhaus, den Mann im weißen Kittel, der in der Aufnahme Dienst hat.
Nun, das ist doch Ihr Freund, nicht wahr, sagt der Kittel freundlich.
Er ist mein Freund, aber wir sind nicht homosexuell.
Wie dem auch sei, wir hätten nur gerne auch Ihre Personalien. Wir müssen doch irgendjemanden verständigen können, falls da was ist.
Wolfgang, den die Sanitäter von der Trage auf eine Liege gebettet haben, will sich einmischen, möchte etwas dazu sagen, und er hebt den Kopf, öffnet den Mund. Aber er weiß nicht, ob er schon Worte finden wird, traut sich selbst noch nicht über den Weg.
Und ich habe auch nichts gegen Homosexuelle. Verstehen Sie das nicht falsch.
Gut. Sind wir aber nicht.
Sie könnten das also ruhig sagen, wenn Sie homosexuell sind.
Der Kittel beugt sich über die Papiere und füllt etwas aus.
Da braucht man sich heute nicht mehr zu schämen.
Wolfgang hebt wieder den Kopf, öffnet den Mund, aber es kommt nichts heraus. Doch Winni platzt der Kragen.
Verdammt, wir sind nicht schwul! Wir sind Freunde und arbeiten zusammen, aber wir ficken nicht! Haben Sie das jetzt endlich kapiert? Und mein Freund hier hatte gerade einen epileptischen Anfall, da gibt es was ganz anderes zu besprechen, oder?!
Der Kittel macht beschwichtigende Handbewegungen und bleibt freundlich. Sind Sie sicher? Woher wollen Sie wissen, dass es ein epileptischer Anfall war?
Doch, das weiß Winni, da ist er sicher. Er hat in seiner Zivildienstzeit etliche Grand Mals gesehen, die zuckenden Spasmen, den Schaum vor dem Mund, hat alles beiseitegeräumt, woran der Tobende sich hätte verletzen können. Auch bei Wolfgang. Nur der Teppich ist übrig geblieben, der Sisalteppich, der die Wangen aufgekratzt hat.
Die Nachricht dringt allmählich in Wolfgangs wiederkehrendes Bewusstsein ein. Ein epileptischer Anfall. Er weiß gar nicht, was das ist. Er hat ihn ja gar nicht erlebt, diesen Anfall. Aber es mag schon stimmen. Wenn Winni das sagt. Winni hat ihn erlebt. Und wohl auch Marie. Aber nicht er, Wolfgang. Er hatte einen Anfall, aber hat ihn nicht erlebt. Er hat nur aufgekratzte Wangen.
Musik, hatte Herr Goldau gesagt, sein Trompetenlehrer an der Musikschule. Musik solle er studieren. Trompete. Auf der Musikhochschule.
Zu unsicher, hatten seine Eltern gesagt, brotlose Kunst. Er solle doch Lehrer werden, Landesbeamter, das sei was Sicheres.
Dann eben Musiklehrer, entschied Wolfgang. Dann wären alle zufrieden. Und er hoffentlich auch.
Aber mit dem Musiklehrer war es eigentlich schon am ersten Tag des Studiums vorbei. Da lernte er Uli und Rudi kennen, Geige und Akkordeon, die ihn mit in ihre Gruppe nahmen. Fortschrott hieß sie, man hatte bisher nur im Unigelände gespielt, wollte aber raus, auf die Straße, in die Fußgängerzonen, wo das richtige Publikum für Friedensbewegendes und linke Konsumkritik zusammenkam. Nein, Wolfgangs Instrument passe nicht so gut, befand man, schließlich müsse gesungen werden, die Texte seien wichtig und dürften nicht hinter Trompetenstößen verschwinden. Ob er nicht Bass spielen wolle? Irgendwo hatte jemand mal einen Bass gesehen, der aus einer Kiste, einem Besenstiel und einer Wäscheleine bestand, so wie ihn die Skifflebands früher benutzt hatten. Wolfgang baute ihn nach, probierte verschiedene Kistengrößen, ersetzte die Wäscheleine nach langer Suche durch Darmsaiten, solchen, wie man sie zum Bau von Uhren benutzt, und gab der Kiste den straßenmusiktauglichen Klang. Sie erregten Aufsehen, wenn sie sich vor den Einkaufszentren aufbauten und loslegten, unverstärkt, aber laut genug, bekamen häufig Probleme mit der Polizei und wurden auch dadurch immer bekannter, spielten trotz Platzverweisen in der Vorweihnachtszeit zum Ärger vieler Kaufhausbetreiber, wurden einmal sogar festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt, Verbrecherfotos von allen Seiten, und ein paar Stunden eingesperrt, laute Gegendemonstranten vor dem Polizeipräsidium. Bei ihrem nächsten Auftritt vor dem Elberfelder Marktplatz trat der prominente Free Jazzer Peter Kowald als Zeichen seiner Solidarität auf, und selbst Pina Bausch sah man im Straßenpublikum, das seine Helden feierte.
Das Studium war inzwischen völlig in den Hintergrund getreten. Wolfgang zog in seine erste Wohngemeinschaft, 1980, das Jahr, das mit der Gründung der Grünen begann und mit dem Tod John Lennons endete, künstlerische Kreise aus Musik, Aktivismus und Tanz überlappten sich, und in der Schnittmenge entstand ein Ort für Tanz und Musik, ein gemeinsam gemieteter Übungsraum, den sie Werkstatt nannten. So vieles wurde auf einmal möglich.
Schon vor Beginn des Studiums hatte Wolfgang sich für die Musik des Willem Breuker Kollektiefs begeistert, war nach Amsterdam zu dessen Auftritten gefahren, bei denen sich Jazz-Improvisationen mit sorgfältig strukturierten Kompositionen und musikalischem, auch szenischem Humor verbanden — jetzt lernte er Breuker persönlich kennen und schrieb über ihn seine Examensarbeit. Dagegen schien die frei improvisierte Musik der Wuppertaler, die Ende der Sechziger noch zusammen mit Breuker gespielt hatten, sich zu ernst zu nehmen: der Free Jazz in Gestalt von Peter Brötzmann, dessen ekstatische Saxofontöne ihm den violettroten Kopf schier platzen ließen. Peter Kowald mit dem rasierten Schädel, der keinen lustigen Kisten-, sondern seinen ernsten, großen Kontrabass spielte, über den er sich tief beugte, als verneige er sich vor dem Instrument. Der hatte ein Haus in Wuppertal, und als dort in einer Wohngemeinschaft etwas frei wurde, ist Wolfgang eingezogen, ernster Bass und Kistenbass wurden Freunde.
Vorher, als Wolfgang Marie und Winni getroffen hatte und dessen Klarinette, konnte aus dem Gedanken, Musik und Theatrales zu verbinden, etwas werden, das ihnen großen Spaß machte und das sie gerade deshalb Ernst nannten: Ernst Musiktheater. Schon die Reaktionen auf ihr erstes Stück zeigten, dass sie auf dem richtigen Weg waren.
„Alarm!“ hieß es. Die Geschichte um den Autoschrauber Max, den Finanzbeamten Ewald, beide bei der freiwilligen Feuerwehr, und die Briefträgerin Anna hatten sie komplett selbst geschrieben einschließlich sämtlicher Musiknummern. „Was heißt hier Feuer - wer löscht denn, wenn‘s brennt?“
Es ließ sich sogar davon leben. Eintrittserlöse und das Kleingeld, das bei den Fortschrott-Auftritten zusammenkam, hätten bei weitem nicht hingereicht, aber da sie mit den Musiktheaterprojekten in den richtigen Fördertöpfen rührten, kam zumindest so viel zusammen, dass Wolfgang monatlich die Miete für sein WG-Zimmer und seinen Beitrag zur Haushaltskasse zahlen konnte. Und als sie dann auch noch die Bühnenrechte erhielten für das Aids-Aufklärungsstück „Dreck am Stecken“, entwickelt vom Berliner Theater Strahl, konnte man schon fast von einem geregelten Einkommen sprechen: mehr als hundert Vorstellungen in der ganzen Bundesrepublik, öffentlich gefördert.
Es ließ sich gut an, dieses neue Leben, fern von jedem einst erstrebten Beamtendasein. Das Erste Staatsexamen reichte, zur Not konnte er es immer noch vorweisen, sollte er mal in Zeiten der Flaute als Trompetenlehrer in Musikschulen arbeiten und sich damit ein Einkommen sichern müssen. Nein, kein Referendariat in Schulen, kein Zweites Staatsexamen und dann als Musiklehrer durch Schulklassen wandern, immer wieder aufs Neue mit den angesagten Hits und Trends der Kids konkurrieren müssen und irgendwann nur noch auf die Pensionierung warten.
Es funktionierte. Ohne viel Bühnenerfahrung, ohne Schauspielübungen, aber mit der kreativen Energie ungebundener Endzwanziger, wohl auch mit einer kleinen Portion Sendungsbewusstsein, sprangen sie rein ins Theatrale und wurden vom Publikum darin bestätigt, immer weiterzumachen. Es lief gut an. Aber dann kam dieses Loch.
Nein, mehr lasse sich im Augenblick nicht machen, sagt man ihnen im Krankenhaus. Winni solle Wolfgang nach Haus bringen, sobald er wieder einigermaßen auf den Beinen sei. Und dann solle man darauf achten, ob so etwas noch einmal vorkomme, und in diesem Fall wieder reinschauen. Das wäre erst einmal alles.
Du gehst morgen direkt zu deinem Hausarzt, rät Winni. Nein, fast befiehlt er es. Hast du gehört? Morgen!
Sie gehen morgen direkt zur Magnetresonanztomographie, sagt der Hausarzt am nächsten Tag. Carnap heißt er, Dr. Carnap. Haben Sie gehört? Morgen!
Da ist etwas zu sehen in Ihrem Kopf, sagt die CT-Ärztin am Tag darauf. Eine Art Schwamm. Der wird ausgeblutet und damit den epileptischen Anfall ausgelöst haben, und das war offenbar ein richtiger Grand Mal,den Sie da hatten. Sie gehen morgen direkt damit ins Krankenhaus. Haben Sie gehört? Morgen!
Ein Schwamm?
Wolfgang stellt sich den rosa Badeschwamm vor, der bei den Eltern seinen festen Platz neben den Armaturen der Badewanne hat und regelmäßig erneuert wird, wenn er anfängt, sich an den Rändern aufzulösen.
Ein Schwamm im Kopf, etwa so groß wie ein Taubenei.
Wie groß ist ein Taubenei?
Etwa so, hat die Ärztin gesagt und mit den geöffneten Fingern einer Hand etwas Nichtexistierendes umfasst, einen Hohlraum geschaffen, in den alles projiziert werden kann.
Hauptsächlich Blut, hat sie gesagt, er besteht aus Gewebe, natürlich, aber seine Größe erhält er durch das Blut, das er speichert. So wie der Badeschwamm Wasser speichert. Und wenn man ihn ausdrückt, wird er ganz klein, bevor er sich dann wieder mit Luft aufbläht.
Im Unterschied zum Badeschwamm, der viele kleine Löcher umschließt, besteht Ihr Schwamm aber aus vielen kleinen Äderchen. Da haben sich längs einer Arterie lauter Verzweigungen gebildet. Das Blut wird also nicht nur auf direktem Weg durchgeleitet, sondern muss jetzt gleichzeitig auch noch all die kleinen Nebenflüsschen in den feinen Äderchen füllen. Und wenn es mit richtigem Druck einschießt, kann solch ein Äderchen auch mal platzen und ausbluten. Gut, dass es nur eines war und es sich gleich wieder geschlossen hat. Sonst hätten Sie das wohl nicht überlebt. Was Sie da haben, heißt arterielle venöse Malformation, linkszerebral. Das ist der Schwamm.
Und wo kommt der her?
Den hat man Ihnen mit in die Wiege gelegt, Herr Suchner. Ohne Sie zu fragen. Da waren Sie noch ganz klein und er auch. Der war schon immer da, ist mit Ihnen gewachsen und immer größer geworden. Aber erst jetzt hat er sich bemerkbar gemacht.
Ja, so etwas lässt sich durchaus operieren, sagt der Arzt im Krankenhaus. Haben wir schon ein paarmal durchgeführt. Ist recht aufwändig, aber geht. Sollen wir einen Termin machen?
Wolfgang sagt weder ja noch nein, fragt nur leise etwas nach.
Wie bitte? Ja, natürlich müssen wir dazu den Kopf öffnen. Wie soll man sonst operieren?
Jetzt spürt Wolfgang zum ersten Mal etwas, das man fast schon Angst nennen könnte. Schnell weg hier. Nach Hause und nachdenken.
Da gibt es doch diese anthroposophische Klinik in Herdecke, die den Anspruch hat, ganzheitlich zu arbeiten, was auch immer das heißen mag. In seinem Fall sei ganzheitlich gleich herkömmlich, sagt man ihm. Aber das sei gar kein Problem. Schädeldecke abklappen, und dann müsse man sich da eben durcharbeiten. Im Grunde keine große Sache, nur recht langwierig. Der Schwamm liege ja so nah am Sprachzentrum, da komme man nicht ohne Umwege hin. Und mehrere Operationsteams brauche man auch, weil die ganze Geschichte so um die zwanzig Stunden dauere, da müssten sich die Leute ja schließlich abwechseln. Raus mit dem Schwamm, dann Klappe zu und Affe lebt. Sollen wir einen Termin vereinbaren?
In der Düsseldorfer Uniklinik wird anders operiert. Man sägt den Schädel nicht auf, um die Decke abzuklappen und von oben an den Schwamm zu gelangen, sondern schiebt eine Sonde in die Leiste, lässt sie durch den gesamten Körper wandern, ja, auch durch das Herz, und schiebt sie von unten hin zum Schwamm. Und der wird dann nicht weggeschnitten, sondern verklebt, sodass weniger Blut hineingerät und er dadurch kleiner wird, so wie der große Badeschwamm zusammengedrückt und ausgepresst nachher in eine Faust passt. Und wenn er klein genug ist, kann man ihn anschließend durch Bestrahlung entfernen, da gebe es ganz neue Geräte, allerdings bisher nur sehr wenige in Europa, in den USA sei man da schon weiter. Wenn man den Schwamm in der aktuellen Größe bestrahle, zerstöre man zu viel Umliegendes. Nein, die Operation dauere nicht so lange, allerdings müsse sie mehrmals durchgeführt werden, da man in einem Durchgang nicht alle Zuflüsse verkleben könne.
Ja, man habe sie schon mehrfach, über fünfzig Mal durchgeführt. Und in neunzig Prozent der Fälle sei sie erfolgreich gewesen.
Auf der Rückfahrt von Düsseldorf sitzt Wolfgang in der S-Bahn einer alten Dame gegenüber. Sie schläft mit weit geöffnetem Mund und man würde sie für tot halten, gäbe sie nicht ab und zu leise Schnarchgeräusche von sich. Wolfgang sieht aus dem Fenster auf Felder, wo der Mais zwei Meter hoch steht, will den Blick dort halten, wo jetzt Kleingartenanlagen vorbeiziehen, in der Spiegelung aber drängt sich immer wieder die alte Dame mit dem offenen Mund ins Bild. Neunzig Prozent. Zehn Prozent also tragen Schäden davon, welcher Art auch immer. Er fokussiert die draußen vorbeirauschende Kulisse, dann wieder die alte Dame.
Auf dem Weg vom Bahnhof durch die Innenstadt taucht er ein in die Massen von Menschen, die Fortschrott mit Straßenmusik zu missionieren versucht hat, so wie die Heilsarmee oder christlich Erweckte, die ihren Zuversichtsglauben verbreiten wollen, denkt er. Da standen wir ihnen noch gegenüber, denkt er weiter, und jetzt bin ich ein Teil von ihnen. Wir sind hundert Prozent. Und wer sind die zehn Prozent?
Die Kneipe, die Peters Haus und seinem WG-Zimmer darin gegenüberliegt, bietet einen Mittagstisch. Aber er möchte nur einen Espresso, hockt sich an den Tresen. Statt aus dem S-Bahn-Fenster fliehende Landschaften, kann er jetzt ein unbewegtes Getränkeregal anschauen, daneben sich selbst im Spiegel betrachten. So also sieht einer aus, der einen Schwamm im Kopf hat. Die Kratzer auf der Wange sind kaum noch zu erkennen. Die oberste Reihe Getränke neben dem Spiegel beginnt mit dem Whisky, den Peter hier manchmal bestellt. Achtunddreißig Prozent Alkohol.
Wie viel sind zehn Prozent? Wolfgang dreht sich um und zählt die Gäste, bemüht, den Zeigefinger nicht deutlich mitwandern zu lassen. Am Tresen ist er der Einzige, aber etliche Tische sind auch an diesem Morgen schon besetzt. Man isst zu Mittag, unterhält sich, ab und zu lacht jemand laut. Achtunddreißig Personen, so viele wie der Whisky Prozente hat. Er schätzt die meisten auf Ende zwanzig, Anfang dreißig. Sie sehen gesund aus, keinem ist anzusehen, dass er oder sie eine Krankheit in sich trägt. In sich. Im Kopf. Kranke Gedanken, vielleicht, aber auch die sieht man nicht.
Zehn Prozent, das wären dann drei Komma acht Menschen. Nicht ganz vier. Es gibt nur einen Tisch, der mit vier Personen besetzt ist, drei Männer, eine Frau. Einen kennt Wolfgang flüchtig, man hat sich auch schon zugenickt. Der ist offenbar vor kurzem Vater geworden, man sieht ihn ab und zu einen Kinderwagen schieben. Sein Nebenmann trägt Brille und Schnurrbart und fährt sich ständig mit der Hand durchs Gesicht. Die Frau am Tisch, die immer wieder laut auflacht, hat die nackten Beine übereinandergeschlagen und lässt ihre Sandale mit der Fußspitze wippen. Der Letzte in der Runde, der eng anliegende Funktionskleidung trägt und vor dessen Stuhl ein großer Rucksack liegt, scheint einer von diesen Fahrradkurieren zu sein, die man in letzter Zeit immer mal wieder irgendwo sieht. Das wären dann also die zehn Prozent. Schäden, welcher Art auch immer. Der junge Vater wäre vielleicht gestorben, seinen Nebenmann stellt sich Wolfgang mit glasigen Augen und offenem Mund vor, unfähig zu kommunizieren. Die Frau halbseitig gelähmt, schiefer Mund, und statt des Schirms lehnte eine Gehhilfe am Tisch. Der Fahrradkurier säße im Rollstuhl.
Wolfgang dreht sich schnell wieder um. Im Spiegel sieht er dann den, der einen Schwamm im Kopf hat. Und dahinter taucht plötzlich der Glatzkopf Peter Kowald auf. Er hockt sich zu ihm an den Tresen und bestellt einen Kaffee.
2 Kopf und Schwamm
Sie haben Montabaur passiert, Limburg an der Lahn, fahren jetzt weiter die A3 lang auf Frankfurt zu. Peter sitzt am Steuer. Die Rücksitze des Kombi sind umgeklappt, der Kontrabass liegt diagonal auf der Ladefläche, daneben rechts eine Tasche von Peter und links eine von Wolfgang. Etwa vier Stunden brauchen sie bis Würzburg. In der Uniklinik dort wird operiert wie in Düsseldorf, also nicht Methode Dosenöffner - den Schädel ringsum einsägen und aufklappen - sondern minimalinvasiv, von unten durch die Leiste. Von hinten durch die Brust ins Auge, lachen sie. Nur haben die in Würzburg schon länger Erfahrung damit als Düsseldorf. Ruf da mal an, hat Peter gesagt, und mach einen Termin. Ich habe am Samstag einen Auftritt in Würzburg, da kommst du mit.
Das war vor drei Tagen, und jetzt ist Samstag.
In einem waren alle Ärzte, mit denen Wolfgang bisher gesprochen hat, sich offenbar einig: Mit der Trompete muss Schluss sein. Damit erzeugt man noch stärker als bei den meisten anderen Blasinstrumenten einen Druck im Kopf, der den Rückfluss des venösen Blutes behindern kann, während das arterielle weiter vom Herzen in den Schädel gepumpt wird. Und die Kleinstgefäße, die zusammen den Schwamm bilden, können platzen.
Die Halsschlinge, mit der Wolfgang sich bei der Probe fast strangulierte, hat diesen Druck natürlich noch verstärkt. Aber das Risiko besteht auch ohne Halsschlinge.
Nie mehr Trompete spielen.
Was bleibt eigentlich von mir, wenn die Trompete wegfällt? Ich kann doch sonst nichts.
Wenn ich nie mehr Kontrabass spielen dürfte, würde ich mir wieder meine alte Tuba zur Brust nehmen, sagt Peter. Damit würde ich dann weitermachen. Und genau so könntest du doch jetzt zum Bass wechseln. Die Voraussetzungen bringst du ja mit. Vom Kistenbass zum Kontrabass. Ich besorge dir einen zum Üben.
Aber so weit ist Wolfgang noch nicht, dass er jetzt schon Pläne machen könnte. Er muss erst einmal den Schlag in die Magengrube wegstecken, den dieser Satz ihm verpasst hat: Nie mehr Trompete spielen. Nie mehr.
Dann arbeite ich als Trompetenlehrer an der Musikschule, hat er gesagt, als seine Eltern ihn einmal fragten, was er denn machen wolle, der brotlose Künstler, falls er von seinen Auftritten als Musiker und vom Musiktheater wirklich nicht mehr leben könne. Trompetenlehrer geht aber jetzt auch nicht mehr. Nichts geht mehr, keine Zukunft.
Irgendwas finden wir schon, sagt Peter.
In Würzburg erklärt ihm ein freundlicher Gehirnchirurg noch einmal das Vorgehen - die Erfolgsaussichten stellen sich hier viel besser dar als in Düsseldorf. Wir können gerne einen Termin machen, aber wohnen Sie nicht in Wuppertal? Da liegt Essen doch viel näher. Die Kruppklinik, Professor Kühne. Bei dem hab ich gelernt. Alles, was ich kann, habe ich von ihm.
Professor Kühne arbeitet nicht nur in Essen, er stammt auch von dort - und wenn nicht aus Essen selbst, dann jedenfalls aus dem Ruhrgebiet, das hört man, die breite Aussprache, die kein einzelnes R nach Vokalen zulässt, wirkt auf Wolfgang als vertrauensbildende Maßnahme. Es ist Sommer, die Blätter beschatten hier im Park der Klinik den Schotterweg, der Professor ist barfuß in seinen Sandalen mit den weißen Riemen, ganz offensichtlich fühlt er sich wohl in seiner Umgebung und mit seiner Arbeit. Zum dritten Mal lässt sich Wolfgang das Prozedere erklären. Was man bei diesem Verkleben vermeiden muss: dass auf einmal gar kein Durchfluss erfolgt und plötzlich eine Hirnpartie nicht durchblutet wird. Jede Operation ist riskant, sagt der Professor, und so ein Gehirn ist natürlich ziemlich sensibel.
„Gehian“, sagt er. In Würzburg hat man „Gehirrn“ gesagt.
Wenn man nicht operiert, besteht das Risiko, dass der Schwamm noch mal ausblutet und so ein Grand Mal wiederkommt. Und wenn Sie weiter Trompete spielen, könnte sich ein solches Risiko erhöhen. Könnte, sage ich, muss aber nicht. Auch möglich, dass Sie genau so weiterleben wie bisher - und es tut sich überhaupt nichts.





























