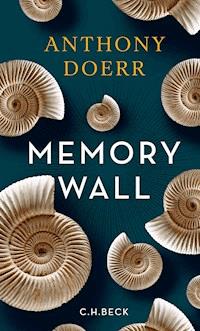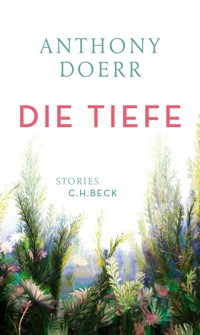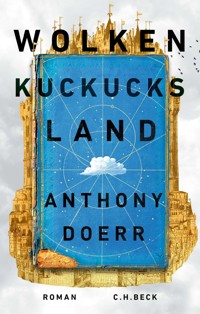
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anthony Doerrs neuer, lang erwarteter Roman "Wolkenkuckucksland" ist eine faszinierende Geschichte über das Schicksal, den unschätzbaren Wert, die Macht, die Magie und die alles überdauernde Überlebensfähigkeit von Büchern, Geschichten und Träumen. Im Mittelpunkt dieses großen Romans stehen Kinder an der Schwelle zum Erwachsenwerden, die sich in einer zerbrechenden Welt zurechtfinden müssen. Anna und Omeir während der Belagerung und Eroberung von Konstantinopel 1453, Seymour, der aus fehlgeleitetem Idealismus einen Anschlag auf eine Bibliothek im heutigen Idaho verübt, und Konstance im Raumschiff "Argos" in der Zukunft, auf dem Weg zu einem Exoplaneten. Was sie alle auf geheimnisvolle und geradezu atemberaubende Weise über Zeiten und Räume miteinander verbindet, ist eine Geschichte über ein utopisches Land in den Wolken. Anthony Doerr schreibt über menschliche Verbindungen – miteinander, mit der Natur, mit früheren und zukünftigen Generationen. Ihm gelingt es in diesem gleichzeitig wunderschön erzählten, außerordentlich spannenden und wirklich liebevollen Roman ins pulsierende Herz dieser Verwobenheit vorzudringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Anthony Doerr
WOLKENKUCKUCKSLAND
ROMAN
Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence
C.H.BECK
ZUM BUCH
Anthony Doerrs neuer, lang erwarteter Roman «Wolkenkuckucksland» ist eine faszinierende Geschichte über das Schicksal, den unschätzbaren Wert, die Macht, die Magie und die alles überdauernde Überlebensfähigkeit von Büchern, Geschichten und Träumen.
Im Mittelpunkt dieses großen Romans stehen Kinder an der Schwelle zum Erwachsenwerden, die sich in einer zerbrechenden Welt zurechtfinden müssen. Anna und Omeir während der Belagerung und Eroberung von Konstantinopel 1453, Seymour, der aus fehlgeleitetem Idealismus einen Anschlag auf eine Bibliothek im heutigen Idaho verübt, und Konstance im Raumschiff «Argos» in der Zukunft, auf dem Weg zu einem Exoplaneten. Was sie alle auf geheimnisvolle und geradezu atemberaubende Weise über Zeiten und Räume miteinander verbindet, ist eine Geschichte über ein utopisches Land in den Wolken. Anthony Doerr schreibt über menschliche Verbindungen – miteinander, mit der Natur, mit früheren und zukünftigen Generationen. Ihm gelingt es in diesem gleichzeitig wunderschön erzählten, außerordentlich spannenden und wirklich liebevollen Roman ins pulsierende Herz dieser Verwobenheit vorzudringen.
ÜBER DEN AUTOR
Anthony Doerr lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Boise, Idaho. Neben Erzählungsbänden veröffentlichte Doerr die Romane «Winklers Traum vom Wasser» (C.H.Beck 2005, 2016) und «Alles Licht, das wir nicht sehen» (C.H.Beck 2014), für den er 2015 den Pulitzer Prize erhielt. Der Roman wurde zu einem Weltbestseller und in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Für seine Erzählungen hat Doerr bislang vier Mal den renommierten O. Henry Prize erhalten, neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt er auch drei Mal den Pushcart Prize.
ÜBER DEN ÜBERSETZER
Werner Löcher-Lawrence ist als literarischer Agent und Übersetzer tätig. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören u.a. John Boyne, Patricia Duncker, Nathan Englander und Hilary Mantel. Für C.H.Beck hat er bereits Anthony Doerrs Roman «Alles Licht, das wir nicht sehen» übersetzt.
INHALT
PROLOG: Für meine allerliebste Nichte, in der Hoffnung, dass dies dir Gesundheit und Licht bringt
Die Argos – Missionsjahr 65 Tag 307 in Gewölbe Eins
Konstance
EINS: Fremder, wer immer du bist, öffne dies und siehe, was dich erstaunen wird
Die Stadtbibliothek von Lakeport – 20. Februar 2020, 16:30 Uhr
Zeno
Seymour
Zeno
Seymour
Zeno
ZWEI: Aethon hat eine Vision
Konstantinopel – 1439–1452
Anna
Ein Holzfällerdorf in den Rhodopen Bulgariens – In ebenjenen Jahren
Omeir
Anna
Omeir
Anna
Omeir
DREI: Die Warnung des alten Weibes
Lakeport, Idaho – 1941–1950
Zeno
Lakeport, Idaho – 2002–2011
Seymour
Lakeport, Idaho – 1941–1950
Zeno
Lakeport, Idaho – 2002–2011
Seymour
VIER: Thessalien, Land der Magie
Die Argos – Die Missionsjahre 55–58
Konstance
FÜNF: Der Esel
Die Stadtbibliothek von Lakeport – 20. Februar 2020, 17:08 Uhr
Seymour
Zeno
Seymour
Zeno
SECHS: Das Versteck der Banditen
Konstantinopel – Herbst 1452
Anna
Die Straße nach Edirne – Im selben Herbst
Omeir
Anna
SIEBEN: Der Müller und die Klippe
Korea – 1951
Zeno
Lakeport, Idaho – 2014
Seymour
Die Argos – Missionsjahr 61
Konstance
ACHT: Ringsherum
Die Straße nach Konstantinopel – Januar–April 1453
Omeir
Konstantinopel – In ebenjenen Monaten
Anna
Omeir
Anna
NEUN: Am gefrorenen Rand der Welt
Korea – 1952–1953
Zeno
Lakeport, Idaho – 2014
Seymour
Die Argos – Missionsjahr 64
Konstance
Korea – 1952–1953
Zeno
Lakeport, Idaho – 2014
Seymour
Die Argos – Missionsjahr 64
Konstance
ZEHN: Die Möwe
Die Stadtbibliothek von Lakeport – 20. Februar 2020, 17:27 Uhr
Seymour
Zeno
Seymour
ELF: Im Bauch des Wals
Konstantinopel – April–Mai 1453
Omeir
Anna
Omeir
ZWÖLF: Der Zauberer im Wal
Die Argos – Missionsjahr 64 Tag 1–Tag 20 in Gewölbe Eins
Konstance
Lakeport, Idaho – 1953–1970
Zeno
Lakeport, Idaho – 2016–2018
Seymour
Die Argos – Missionsjahr 64 Tag 21–45 in Gewölbe Eins
Konstance
DREIZEHN: Aus dem Wal und in den Sturm
Konstantinopel – Mai 1453
Anna
Omeir
Anna
Omeir
Anna
Omeir
Anna
VIERZEHN: Die Tore vom Wolkenkuckucksland
Die Argos – Missionsjahr 64 Tag 45–46 in Gewölbe Eins
Konstance
London – 1971
Zeno
Lakeport, Idaho – Februar–Mai 2019
Seymour
Die Argos – Missionsjahr 64 Tag 46–276 in Gewölbe Eins
Konstance
FÜNFZEHN: Die Wachen an den Toren
Die Stadtbibliothek von Lakeport – 20. Februar 2020, 17:41 Uhr
Seymour
Zeno
Seymour
SECHZEHN: Das Rätsel der Eulen
Sechseinhalb Kilometer westlich von Konstantinopel – Mai 1453
Anna
SIEBZEHN: Die Wunder von Wolkenkuckucksland
Lakeport, Idaho – 1972–1995
Zeno
Die Argos – Missionsjahr 64 Tag 276 in Gewölbe Eins
Konstance
Lakeport, Idaho – 1995–2019
Zeno
ACHTZEHN: Es war alles so großartig, nur …
Die Argos – Missionsjahr 65 Tag 325 im Gewölbe Eins
Konstance
Lakeport, Idaho – August 2019
Zeno
Die Argos – Missionsjahr 65 Tag 325–340 in Gewölbe Eins
Konstance
NEUNZEHN: Aethon heißt Lodern
Lakeport, Idaho – August 2019–Februar 2020
Seymour
Zeno
Seymour
ZWANZIG: Im Garten der Göttin
Dreizehn Kilometer westlich von Konstantinopel – Mai–Juni 1453
Omeir
EINUNDZWANZIG: Das Super magische, extra starke Buch von Allem
Die Stadtbibliothek von Lakeport – 20. Februar 2020, 18:39 Uhr
Zeno
Seymour
Zeno
Die Argos – Missionsjahr 65 Tag 341–370 in Gewölbe Eins
Konstance
ZWEIUNDZWANZIG: Was du schon hast, ist besser als das, was du so verzweifelt suchst
Justizvollzugsanstalt des Staates Idaho – 2021–2030
Seymour
DREIUNDZWANZIG: Die grüne Schönheit der zerbrochenen Welt
Fünfzehn Kilometer von einem Holzfällerdorf in den bulgarischen Rhodopen – 1453–1494
Anna
In derselben Schlucht – 1505
Omeir
VIERUNDZWANZIG: Nostos
Boise, Idaho – 2057–2064
Seymour
Die Argos – Missionsjahr 65
Konstance
EPILOG
Die Stadtbibliothek von Lakeport – 20. Februar 2020, 19:02 Uhr
Zeno
Qaanaaq – 2146
Konstance
Anmerkung des Autors
Dank
Für alle Bibliothekare, damals, heute und in den Jahren, die da kommen werden
Chorführer: Schön, welchen Namen wählen wir nun für die Stadt?
Ratefreund: Wollt ihr so was recht Großes, Lakedaimonisches, So nennen wir sie Sparta.
Hoffegut: Hilf mir Herakles! Wer möchte ‹Spart da› nennen unsre neue Stadt? Wer spart da wohl bei Gründung dieser Residenz?
Ratefreund: Wie soll denn aber nun ihr Name sein?
Hoffegut: Er sei Genommen aus den Wolken und dem Reich der Lüfte. Was Hochgestochenes.
Ratefreund: Na – Wolkenkuckucksland?
Aristophanes, Die Vögel, 414 vor Christus
PROLOG
Für meine allerliebste Nichte, in der Hoffnung, dass dies dir Gesundheit und Licht bringt
Die Argos
Missionsjahr 65 Tag 307 in Gewölbe Eins
Konstance
Ein vierzehnjähriges Mädchen sitzt im Schneidersitz auf dem Boden eines kreisrunden Gewölbes. Wilde Locken liegen ihr wie ein Heiligenschein um den Kopf, die Strümpfe sind voller Löcher. Das ist Konstance.
Hinter ihr, in einem durchsichtigen Zylinder, der fast fünf Meter hoch vom Boden bis zur Decke reicht, hängt eine Maschine, aus unzähligen Goldfäden bestehend, von denen keiner dicker als ein menschliches Haar ist. Jeder dieser Fäden windet sich in einer erstaunlich komplexen Verschlungenheit um Tausende andere. Gelegentlich pulsiert Licht in einem der Bündel: mal hier, mal da. Das ist Sybil.
Zusätzlich gibt es noch eine aufblasbare Liege, eine Recyclingtoilette, einen Essensdrucker, elf Säcke Nahrungspulver und ein multidirektionales Laufband in Form eines Autoreifens, Perambulator genannt. Aus einem Diodenring an der Decke fällt Licht. Ein Ausgang ist nicht zu erkennen.
Der Großteil des Bodens wird von fast hundert rechteckigen Zetteln bedeckt, die Konstance aus leeren Nahrungspulversäcken gerissen, zu einer Art Quadrat zusammengelegt und mit selbst gemachter Tinte beschrieben hat. Auf manchen drängen sich die Zeilen dicht an dicht, auf anderen steht nur ein einziges Wort. Eines enthält die vierundzwanzig Buchstaben des griechischen Alphabets. Auf einem anderen ist zu lesen:
In den tausend Jahren vor 1453 wurde Konstantinopel dreiundzwanzig Mal belagert, aber kein Heer vermochte je, die Mauern zu überwinden.
Konstance lehnt sich vor und nimmt drei Zettel aus dem Puzzle vor sich. Die Maschine hinter ihr flimmert.
Es ist spät, Konstance, und du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen.
«Ich habe keinen Hunger.»
Wie wäre es mit einem leckeren Risotto? Oder einem Lammbraten mit Stampfkartoffeln? Es gibt immer noch viele Kombinationen, die du nicht ausprobiert hast.
«Nein, danke, Sybil.» Sie betrachtet den ersten Zettel und liest:
Die verschollene griechische Prosaerzählung Wolkenkuckucksland des Schriftstellers Antonios Diogenes, die von der Reise eines Hirten in eine utopische Stadt am Himmel berichtet, geschrieben wahrscheinlich um das Ende des ersten Jahrhunderts v. u. Z.
Den zweiten:
Durch eine byzantinische Zusammenfassung des Buches aus dem neunten Jahrhundert wissen wir, dass es mit einem kurzen Prolog begann, in dem sich Diogenes an eine kränkelnde Nichte wandte und ihr erklärte, er habe die nachfolgende komische Geschichte nicht erfunden, sondern sei in einem Grab der alten Stadt Tyros darauf gestoßen.
Den dritten:
Auf dem Grab, schrieb Diogenes an seine Nichte, stand: Aethon – lebte 80 Jahre als Mensch, 1 Jahr als Esel, 1 Jahr als Zackenbarsch, 1 Jahr als Krähe. Im Grab, behauptete er, eine hölzerne Truhe gefunden zu haben, darauf die Aufschrift: Fremder, wer immer du bist, öffne dies und siehe, was dich erstaunen wird. In der Truhe selbst hätten vierundzwanzig Tafeln aus Zypressenholz mit Aethons Geschichte gelegen.
Konstance schließt die Augen, sieht, wie der Dichter in die Finsternis des Grabes hinabsteigt, sieht, wie er im Licht seiner Fackel diese seltsame Truhe untersucht.
Die Dioden in der Decke verblassen langsam, die weißen Wände verfärben sich bernsteingelb, und Sybil sagt: Bald ist LightOut, Konstance.
Sie geht vorsichtig zwischen den Zetteln auf dem Boden hindurch und holt die Reste eines leeren Sacks unter ihrer Liege hervor. Mit Zähnen und Fingern reißt sie ein rechteckiges Stück heraus, gibt einen kleinen Löffel Nahrungspulver in den Essensdrucker, drückt einige Knöpfe, und der Drucker spuckt ein paar Gramm einer dunklen Flüssigkeit in seine Schüssel. Konstance nimmt einen aus einem Polyäthylenrohr herausgebrochenen behelfsmäßigen Stift, dessen Spitze sie zu einer Schreibfeder geschnitzt hat, taucht ihn in die behelfsmäßige Tinte, beugt sich über den leeren Zettel und zeichnet eine Wolke darauf.
Sie taucht ihre Feder ein zweites Mal in die Tinte.
Über die Wolke zeichnet sie die Türme einer Stadt und deutet mit Punkten winzige Vögel an, die um die Türme herum aufsteigen. Der Raum wird immer dunkler. Sybil flimmert. Konstance, ich muss darauf bestehen, dass du etwas isst.
«Ich bin nicht hungrig, danke, Sybil.»
Sie nimmt einen Zettel, auf dem ein Datum steht, der 20. Februar 2020, und legt ihn neben einen anderen mit der Aufschrift Tafel A. Die Zeichnung der Wolkenstadt kommt links daneben. Einen Atemzug lang scheint es fast so, als stiegen die drei Zettel im verbleichenden Licht auf und begännen zu leuchten.
Konstance hockt sich wieder auf ihre Fersen. Sie hat diesen Raum seit fast einem Jahr nicht verlassen.
EINS
Fremder, wer immer du bist, öffne dies und siehe, was dich erstaunen wird
Wolkenkuckucksland, von Antonios Diogenes, Tafel A
Diogenes’ Kodex misst 30 x 22 cm. Von Würmern zerfressen und von Schimmel bedeckt, ließen sich nur vierundzwanzig Seiten, hier von A bis Ω gekennzeichnet, retten. Alle waren nur noch zu einem gewissen Grad zu entziffern. Die Handschrift ist ordentlich und neigt sich ein wenig nach links. Aus der Übersetzung durch Zeno Ninis aus dem Jahr 2020:
… wie lange schon hatten diese Tafeln in der Truhe vor sich hin gemodert und auf Augen gewartet, die sie lesen würden? Obwohl ich sicher bin, dass du die Wahrheit der absonderlichen Ereignisse in Zweifel ziehen wirst, von denen sie in meiner Übersetzung berichten, meine liebe Nichte, lasse ich auch nicht ein Wort aus. Vielleicht waren die Menschen, die in jenen fernen Zeiten auf der Erde lebten, tatsächlich Untiere, und eine Vogelstadt schwebte zwischen den Reichen von Menschen und Göttern. Vielleicht schuf sich der Schäfer auch, wie es alle Narren tun, seine eigene Wirklichkeit und entschied, dass sie wahr sei. Aber wenden wir uns seiner Geschichte zu und entscheiden für uns selbst, ob er bei Verstand war.
Die Stadtbibliothek von Lakeport
20. Februar 2020, 16:30 Uhr
Zeno
Er geht mit fünf Fünftklässlern durch den dicht fallenden und dahinwehenden Schnee aus der Schule hinüber in die Stadtbibliothek. Er ist über achtzig, trägt einen Drillichmantel, seine Stiefel haben Klettverschlüsse, und auf seiner Krawatte fahren Cartoon-Pinguine Schlittschuh. Den ganzen Tag schon ist er voller Freude, und jetzt, an diesem Donnerstagnachmittag im Februar um halb fünf, als er die Kinder vor sich den Gehweg hinunterlaufen sieht, Alex Hess mit seinem Eselskopf aus Papiermaschee, Rachel Wilson mit einer Plastikfackel und Natalia Hernandez, die einen tragbaren Lautsprecher mit sich führt, da drohen ihn seine Gefühle zu übermannen.
Sie kommen am Polizeirevier vorbei, am Kaufhaus Parks, den Eden’s-Gate-Immobilien. Die Stadtbibliothek von Lakeport ist ein zweistöckiges viktorianisches Knusperhaus mit hohem Giebel an der Ecke von Lake und Park Street. Sie wurde der Stadt nach dem Ersten Weltkrieg gestiftet, der Kamin neigt sich etwas zur Seite, die Regenrinnen hängen durch, und die Risse in dreien der vier Fenster nach vorne heraus werden von Paketband zusammengehalten. Auf den Wacholderbüschen entlang des Gehwegs und auf der Buchrückgabekiste an der Ecke, die so bemalt ist, dass sie wie eine Eule aussieht, liegt eine dicke Schneedecke.
Die Kinder rennen in Richtung Eingang, hinauf unter das Vordach und klatschen mit Sharif ab, dem Kinderbuch-Bibliothekar, der herausgekommen ist, um Zeno die Stufen hinaufzuhelfen. Sharif hat lindgrüne Stöpsel in den Ohren und bunten Glitter in den Haaren auf seinen Armen. Auf seinem T-Shirt steht: I LIKE BIG BOOKS AND I CANNOT LIE.
Zenos Brille ist beschlagen, und er muss sie sich drinnen erst einmal säubern. Ausgeschnittene Papierherzen kleben auf der Empfangstheke, und auf einer gerahmten Stickerei an der Wand dahinter steht: Hier beantworten wir eure Fragen.
Auf den drei Monitoren auf dem Computertisch führen Bildschirmschoner-Spiralen eine Art Synchrontanz auf. Zwischen dem Regal für Hörbücher und zwei schäbigen Ohrensesseln tropft Heizungswasser aus der Decke in einen großen 25-Liter-Eimer.
Plitsch. Platsch. Plitsch.
Die Kinder verteilen überall Schnee und stürmen gleich nach oben in den Kinderbuchbereich. Zeno und Sharif sehen sich lächelnd an, als sie hören, wie ihre Schritte am oberen Ende der Treppe innehalten.
«Boa», sagt die Stimme von Olivia Ott.
«Heiliger Bimbam», die von Christopher Dee.
Sharif fasst Zeno beim Ellbogen und hilft ihm die Stufen hinauf. Der Eingang zum ersten Stock liegt hinter einer golden besprühten Sperrholzwand versteckt, und Zeno hat über die oben mit einem Bogen versehene Tür in der Mitte folgende Worte geschrieben:
Ὦ ξένε, ὅστις εἶ, ἄνοιξον, ἵνα μάθῃς ἃ θαυμάζεις
Die Fünftklässler drängen sich vor der Sperrholzwand, Schnee schmilzt von ihren Jacken und Rucksäcken, und alle sehen Zeno an, während der erst einmal wieder zu Atem kommen muss.
«Wissen alle noch, was das bedeutet?»
«Natürlich», sagt Rachel.
«Klaro», sagt Christopher.
Natalie reckt sich auf die Zehenspitzen und fährt mit dem Finger über die einzelnen Worte. «Fremder, wer immer du bist, öffne dies und siehe, was dich erstaunen wird.»
«Oh, du meine Güte», sagt Alex mit seinem Eselskopf unter dem Arm. «Das ist, als gingen wir ins Buch hinein.»
Sharif schaltet das Treppenlicht aus, und die Kinder drängen sich im roten Schein der Ausgang-Leuchte vor der kleinen Tür zusammen. «Fertig?», ruft Zeno, und von der anderen Seite der Sperrholzwand antwortet Marian, die Bibliotheksleiterin: «Fertig.»
Nacheinander gehen die Fünftklässler durch den kleinen Durchgang mit dem hübschen Bogen in die Kinderbuchabteilung. Die Regale, Tische und Sitzsäcke, die normalerweise den Raum füllen, sind an die Seiten geschoben worden, und an ihrer Stelle stehen dreißig Klappstühle. Darüber hängen Dutzende mit Glitter überzogene Pappwolken von den Deckenbalken. Vor den Stühlen gibt es eine kleine Bühne, die Wand dahinter wird von einer großen Stoffbahn bedeckt, auf die Marian eine Stadt in den Wolken gemalt hat.
Goldene Türme mit Hunderten kleinen Fenstern und Fahnen, und auf den Spitzen wachsen Wimpel in die Höhe. Vogelschwärme kreisen um sie, kleine braune Ammern und große silberne Adler, Vögel mit langen, gebogenen Schwänzen und andere mit langen, gebogenen Schnäbeln, Vögel der Welt und Vögel der Fantasie. Marian hat die Deckenlampen ausgemacht, und im Licht eines einzelnen Karaokestrahlers auf einem Stativ glitzern die Wolken, schimmern die Vogelscharen, und die Türme scheinen von innen zu leuchten.
«Das ist …», sagt Olivia.
«… besser, als ich …», sagt Christopher.
«Wolkenkuckucksland», flüstert Raphael.
Natalie stellt ihren Lautsprecher ab, Alex springt auf die Bühne, und Marian ruft: «Vorsicht, einiges von der Farbe kann noch feucht sein.»
Zeno lässt sich auf einen Stuhl in der ersten Reihe sinken. Jedes Mal, wenn er blinzelt, flirrt ihm ein Erinnerungsbild über die Innenseite der Augenlider: sein Vater, der sich in eine Schneewehe fallen lässt, eine Bibliothekarin, die eine Schublade des Kartenkatalogs aufzieht, ein Mann, der in einem Gefangenenlager griechische Buchstaben in den Lehm kratzt.
Sharif zeigt den Kindern den Garderobenraum voller Requisiten und Kostüme, den er hinter drei Bücherregalen geschaffen hat, und Olivia zieht sich eine Latexglatze über den Kopf. Christopher schiebt einen bemalten, wie ein Marmorsarkophag aussehenden Mikrowellenkarton auf die Bühne, Alex berührt einen Turm der gemalten Stadt, und Natalie holt einen Laptop aus ihrem Rucksack.
Marians Telefon summt. «Die Pizzas sind fertig», sagt sie Zeno in sein gutes Ohr. «Ich geh rüber und hole sie. Bin ratzfatz wieder da.»
«Mr Ninis?» Rachel klopft Zeno auf die Schulter. Ihre roten Haare sind zu zwei geflochtenen Zöpfen zurückgebunden, und sie sieht ihn mit großen Augen an. «Haben Sie das alles gebaut? Für uns?»
Seymour
Eine Straße weiter döst der grauäugige siebzehnjährige Seymour Stuhlman mit einem Rucksack auf dem Schoß in einem mit zehn Zentimetern Schnee bedeckten Pontiac Grand Am. Es ist ein dunkelgrüner JanSport-Rucksack in Übergröße, in dem sich zwei Presto-Druckkochtöpfe befinden. Beide sind mit Dachnägeln, Kugellagern, einer Zündvorrichtung und einem guten Pfund hochexplosiven Sprengstoffs namens Composition B gefüllt. Kabel führen aus den Töpfen hoch zu den Deckeln, wo sie mit dem Schaltkreis je eines Handys verbunden sind.
Im Traum wandert Seymour unter Bäumen auf eine Gruppe weißer Zelte zu, aber mit jedem Schritt, den er vorwärts macht, verrutscht der Weg, und die Zelte weichen ein Stück weiter zurück. Eine fürchterliche Verwirrung ergreift Seymour, und er fährt aus seinem Schlaf hoch.
Die Uhr im Armaturenbrett sagt ihm, es ist 16:42 Uhr. Wie lange hat er geschlafen? Eine Viertelstunde. Höchstens zwanzig Minuten. Wie dumm. Wie leichtsinnig. Seit mehr als vier Stunden sitzt er jetzt hier, seine Zehen sind ganz taub, und er muss pinkeln.
Er wischt mit dem Ärmel über die beschlagene Windschutzscheibe, riskiert es, die Scheibenwischer kurz anzuschalten, und sie schieben ein Sichtfenster in den Schnee. Vor ihm parken keine Autos. Da sind keine Leute, der Gehweg ist leer. Das einzige Auto auf dem schotterbestreuten Parkplatz westlich von ihm ist der schneedeckte Subaru von Marian, der Bibliothekarin.
16:43 Uhr.
Fünfzehn Zentimeter Schnee bis zum Abend, sagt das Radio, über Nacht dann noch mal vierzig bis fünfzig Zentimeter.
Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden die Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen. Erinnere dich an die Dinge, die du weißt. Eulen haben drei Augenlider. Ihre Augäpfel sind keine Kugeln, sondern längliche Röhren. Einen Schwarm Eulen nennt man ein Parlament.
Er muss nur hineingehen, den Rucksack in der südöstlichen Ecke der Bibliothek verstecken, so nahe wie möglich am Immobilienbüro Eden’s Gate, und wieder herauskommen. Nach Norden fahren, warten, bis die Bibliothek um sechs Uhr schließt, anrufen und es fünfmal klingeln lassen.
Bäääng.
So einfach.
Um 16:51 Uhr verlässt eine Gestalt in einem kirschroten Parka die Bibliothek, zieht sich die Kapuze über den Kopf und schippt den Schnee mit einer großen Schaufel aus dem Zugang. Marian.
Seymour stellt das Radio aus und sinkt tief in seinen Sitz. In seiner Erinnerung ist er sieben, acht Jahre alt, bei den Sachbüchern für Erwachsene, irgendwo in den 598ern, und Marian holt ein Buch über Eulen hoch oben aus dem Regal. Ihre Wangen sind ein wahrer Sommersprossensturm, und sie riecht nach Zimtkaugummi. Sie setzt sich neben ihm auf einen der rollenden Trittschemel. Auf den Bildern, die sie ihm zeigt, sitzen Eulen vor Höhlen, auf Ästen und fliegen hoch über Felder.
Er schiebt die Erinnerung beiseite. Was sagt Bishop? Ein Krieger, der von seiner Sache überzeugt ist, verspürt weder Schuld noch Angst oder Reue. Ein Krieger, der von seiner Sache überzeugt ist, wird zu etwas Übermenschlichem.
Marian fährt mit dem Schneeschieber die Rollstuhlrampe herunter, streut noch etwas Salz, geht dann die Park Street hinauf und wird vom Schnee verschluckt.
16:54 Uhr.
Den ganzen Nachmittag hat Seymour darauf gewartet, dass die Bibliothek leer ist, und jetzt ist es so weit. Er zieht den Reißverschluss des Rucksacks auf und schaltet die mit Klebeband auf den Deckeln der Druckkochtöpfe haftenden Handys ein, holt seinen Gehörschutz heraus, so einen, wie man ihn auf einem Schießstand benutzt, eine Art Kopfhörer ohne Lautsprecher, und zieht den Rucksack wieder zu. In der rechten Tasche seiner Windjacke steckt eine halb automatische Beretta 92, die er im Werkzeugschuppen seines Großonkels gefunden hat. In der linken ein Handy, auf dessen Rückseite drei Nummern stehen.
Geh hinein, versteck den Rucksack, komm wieder heraus. Fahr nach Norden, warte, bis die Bibliothek schließt, und ruf die ersten beiden Nummern an. Lass es fünfmal klingeln. Bäääng.
16:55 Uhr.
Ein Schneepflug kommt mit zuckendem Warnlicht über die Kreuzung. Ein grauer Pick-up fährt vorbei, King Construction steht auf der Tür. Das Geöffnet-Zeichen leuchtet im Erdgeschossfenster der Bibliothek. Marian ist wahrscheinlich nur kurz etwas besorgen, sie wird nicht lange weg sein.
Los. Steig aus dem Wagen.
16:56 Uhr.
Der Schnee landet kaum hörbar auf der Windschutzscheibe, und doch scheint es ihm, als würde er jedes einzelne Auftreffen bis in die Zahnwurzeln spüren. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Eulen haben drei Augenlider. Ihre Augäpfel sind keine Kugeln, sondern längliche Röhren. Einen Schwarm Eulen nennt man ein Parlament.
Er klemmt sich den Hörschutz über die Ohren. Zieht die Kapuze über den Kopf. Legt die Hand auf den Türöffner.
16:57 Uhr.
Ein Krieger, der von seiner Sache überzeugt ist, wird zu etwas Übermenschlichem.
Er steigt aus dem Wagen.
Zeno
Christopher verteilt Grabsteine aus Styropor auf der Bühne und stellt den Mikrowellenkarton-Sarkophag so hin, dass das Publikum die Inschrift lesen kann: Aethon – lebte 80 Jahre als Mensch, 1 Jahr als Esel, 1 Jahr als Zackenbarsch, 1 Jahr als Krähe. Rachel nimmt ihre Plastikfackel, und Olivia kommt mit einem Lorbeerkranz auf der Latexglatze hinter den Bücherregalen hervor. Alex lacht.
Zeno klatscht einmal in die Hände. «Eine Kostümprobe ist etwas, das wir ernst nehmen, erinnert ihr euch? Morgen Abend sitzt eure Großmutter im Publikum und muss womöglich niesen, oder das Baby von jemandem fängt an zu schreien, jemand von euch vergisst einen Satz, aber was immer passiert, wir machen weiter, richtig?»
«Ja, Mr Ninis.»
«Alle auf ihren Platz, bitte. Natalie, die Musik.»
Natalie drückt eine Taste auf ihrem Laptop, und aus dem Lautsprecher erklingt eine unheimliche Orgelfuge. In die Musik hineingemischt ist das Knarzen eines Tores, Krähen krächzen, Eulen rufen. Vorne auf der Bühne entrollt Christopher ein paar Meter weißen Satin und kniet sich an das eine Ende, Natalie ans andere. Gemeinsam lassen sie den Satin auf und ab wogen.
Rachel tritt in ihren Gummistiefeln auf die Mitte der Bühne. «Es ist ein nebliger Abend im Inselkönigreich von Tyros», sie blickt auf ihren Text und hebt den Blick dann wieder, «und der Schriftsteller Antonios Diogenes kommt aus dem Archiv. Seht, das ist er, müde und besorgt, er hat Angst um seine sterbende Nichte, aber wartet nur, bis ich ihm das seltsame Ding zeige, das ich zwischen den Gräbern gefunden habe.» Der Satin bauscht sich in die Höhe, die Orgel spielt, Rachels Fackel flackert, und Olivia kommt ins Licht.
Seymour
Schneekristalle verfangen sich in seinen Wimpern, und er blinzelt sie weg. Der Rucksack auf seinen Schultern ist ein Fels, ein Kontinent. Die großen gelben Eulenaugen auf der Buchrückgabekiste scheinen ihm zu folgen, als er daran vorbeigeht.
Die Kapuze auf dem Kopf, den Hörschutz über den Ohren, geht Seymour die fünf Granitstufen unter das Vordach der Bibliothek hinauf. Ein Schild hängt innen hinter der Scheibe der Eingangstür, auf dem in Kinderhandschrift steht:
Hinter der Empfangstheke ist niemand, niemand am Schachbrett. Niemand am Computertisch, niemand stöbert in den Zeitschriften. Es muss der Schneesturm sein, der alle davon abhält herzukommen.
Auf der gerahmten Stickerei hinter der Theke steht: Hier beantworten wir eure Fragen. Die Uhr zeigt auf fünf nach fünf. Die Bildschirmschoner-Spiralen bohren sich immer tiefer in die Monitore hinein.
Seymour geht in die südöstliche Ecke und kniet sich in den Gang zwischen Sprachen und Linguistik. Von einem unteren Regalbrett zieht er Englisch leicht gemacht, 501 englische Verben und Holländisch für Anfänger, schiebt den Rucksack in den staubigen Freiraum dahinter und stellt die Bücher zurück.
Als er aufsteht, explodieren violette Feuerwerke vor seinen Augen. Das Herz wummert ihm in den Ohren, seine Knie zittern, seine Blase schmerzt, und er kann seine Füße nicht spüren. Er hat Schnee bis tief in den Gang geschleppt, aber er hat es geschafft.
Jetzt wieder hinaus.
Als er zurück durch den Sachbuchbereich geht, scheint der Boden samt Regalen steil nach oben zu führen. Seine Turnschuhe sind wie aus Blei, seine Muskeln wollen ihm nicht gehorchen. Titel taumeln an ihm vorüber. Verlorene Sprachen, Weltreiche des Wortes, 7 Schritte, ein Kind zweisprachig großzuziehen. Er schafft es an den Sozialwissenschaften, der Religion und den Wörterbüchern vorbei, will nach der Tür greifen, als er spürt, wie ihm jemand auf die Schulter fasst.
Nein. Bleib nicht stehen. Dreh dich nicht um.
Aber er tut es. Ein schlanker Mann mit grünen Ohrstöpseln steht vor der Empfangstheke. Er hat dichte schwarze Brauen, neugierige Augen, und auf dem sichtbaren Teil seines T-Shirts steht: I LIKE BIG … In seinen Armen hält er Seymours JanSport-Rucksack.
Der Mann sagt etwas, aber der Hörschutz lässt ihn klingen, als stünde er Hunderte Meter weit entfernt, und Seymours Herz ist ein Stück Papier, das zerknüllt, entfaltet und wieder zerknüllt wird. Der Rucksack darf nicht hier sein. Er muss hinten in der Ecke versteckt liegen, so nahe wie nur möglich am Immobilienbüro Eden’s Gate.
Der Mann mit den Brauen blickt hinunter auf den Rucksack, schaut hinein, der Reißverschluss ist ein Stück geöffnet, hebt den Blick und zieht die Stirn kraus.
Tausend winzige schwarze Punkte bilden sich vor Seymours Augen. In seinen Ohren fängt es an zu rauschen. Er fährt mit der rechten Hand in die rechte Tasche seiner Windjacke, und sein Finger findet den Abzug der Pistole.
Zeno
Rachel tut so, als müsste sie sich anstrengen, um den Deckel des Sarkophags anzuheben. Olivia greift in die letzte Ruhestätte aus Pappe und holt eine kleinere Schachtel daraus hervor, die mit einer Schnur zugebunden ist.
Rachel sagt: «Eine Truhe?»
«Sie hat oben eine Aufschrift.»
«Wie lautet sie?»
«Da steht: Fremder, wer immer du bist, öffne dies und siehe, was dich erstaunen wird.»
«Stell dir vor, Master Diogenes», sagt Rachel, «wie viele Jahre diese Truhe in diesem Grab überdauert hat. Die Jahrhunderte, die sie überlebt hat! Erdbeben, Überschwemmungen, Feuersbrünste, Leben und Tod von Generationen! Und jetzt hältst du sie in deinen Händen!»
Christophers und Natalies Arme werden allmählich müde, doch sie lassen den Satinnebel auch weiter auf und ab wabern, von der Orgelmusik untermalt. Schnee weht gegen die Fenster, und die Heizung unten im Keller stöhnt wie ein gestrandeter Wal. Rachel sieht zu, wie Olivia die Schnur von der Truhe löst und ein altes Wörterbuch herausholt, das Sharif im Keller gefunden und mit goldener Farbe besprüht hat.
«Es ist ein Buch.»
Sie tut so, als bliese sie Staub vom Einband, und Zeno in der ersten Reihe muss lächeln.
«Und erklärt uns dieses Buch», sagt Rachel, «wie jemand achtzig Jahre lang ein Mensch, ein Jahr lang ein Esel, ein weiteres ein Zackenbarsch und noch eines eine Krähe sein kann?»
«Dann wollen wir mal nachsehen.» Olivia öffnet das Wörterbuch und legt es auf ein Stehpult weiter hinten auf der Bühne. Natalie und Christopher lassen den Satin zu Boden sinken, Rachel räumt die Grabsteine weg, Olivia den Sarkophag, und Alex Hess, einen Meter zwanzig groß, tritt mit seiner goldenen Löwenmähne, einem Hirtenstab und einem beigefarbenen Bademantel über seiner Sportshorts in die Mitte der Bühne.
Zeno beugt sich auf seinem Stuhl vor. Seine schmerzende Hüfte, der Tinnitus im linken Ohr, die sechsundachtzig Jahre, die er auf dieser Erde gelebt hat, und die unzähligen Entscheidungen, die ihn hierher gebracht haben, alles das verblasst in diesem Moment. Alex steht im Lichtkegel des Karaokestrahlers und blickt auf die leeren Stühle, als befände er sich nicht im ersten Stock einer heruntergekommenen Bibliothek in einer kleinen Stadt mitten in Idaho, sondern als sähe er hinaus auf die grünen Hügel um das antike Königreich Tyros.
«Ich», sagt er mit seiner hohen, sanften Stimme, «bin Aethon, ein einfacher Hirte aus Arkadien, und die Geschichte, die ich zu erzählen habe, ist so lächerlich, so unglaublich, dass du nie auch nur ein Wort davon glauben wirst – und doch ist sie wahr. Denn ich, den sie ein Spatzenhirn und einen Einfaltspinsel genannt haben, ja, ich, der Schwachkopf, der Schafskopf, der einfältige Aethon, ich bin einst bis an den Rand der Erde und hoch bis zu den schimmernden Toren des Wolkenkuckuckslandes gereist, wo niemandem etwas fehlt und ein Buch mit allem Wissen …»
Von unten tönt ein Knall herauf, der sich für Zeno ganz wie ein Schuss anhört. Rachel lässt einen Grabstein fallen. Olivia zuckt zusammen, und Christopher duckt sich.
Die Musik spielt weiter, die Wolken drehen sich an ihren Schnüren, und Natalies Hand schwebt über ihrem Laptop. Ein zweiter Knall hallt nach durch den Boden, Angst reicht wie ein langer, dunkler Finger durch den Raum und berührt Zeno auf seinem Stuhl.
Alex im Lichtkegel beißt sich auf die Unterlippe und sieht Zeno an. Einen Herzschlag lang. Zwei. Deine Großmutter im Publikum könnte niesen. Ein Baby könnte schreien. Einer von euch könnte einen Satz vergessen, doch was immer passiert, wir machen weiter.
«Aber», fährt Alex fort und lässt den Blick erneut über die leeren Stühle gleiten, «ich sollte am Anfang beginnen», und Natalie ändert die Musik, Christopher wechselt von weißem zu grünem Licht, und Rachel bringt drei Pappschafe auf die Bühne.
ZWEI
Aethon hat eine Vision
Wolkenkuckucksland, von Antonios Diogenes, Tafel β
Obwohl die ursprüngliche Ordnung der Tafeln strittig ist, sind sich die Gelehrten einig, dass die Episode, in welcher der betrunkene Aethon eine Gruppe Schauspieler Aristophanes’ Komödie Die Vögel aufführen sieht und das Wolkenkuckucksland für einen wirklichen Ort hält, an den Beginn seiner Reise gehört. (übersetzt von Zeno Ninis)
… bin die Nässe leid, den Matsch und das ewige Blöken der Schafe, bin es leid, ein beschränkter, schafsköpfiger Einfaltspinsel genannt zu werden, habe meine Herde auf dem Feld zurückgelassen und bin in die Stadt gestolpert.
Auf dem Platz saßen alle auf ihren Bänken. Vor ihnen tanzten eine Krähe, eine Dohle und ein Wiedehopf, alle menschengroß, und sie machten mir Angst. Allerdings erwiesen sie sich als sanftmütige Vögel, und zwei ältere von ihnen sprachen von der Wunderbarkeit einer Stadt, die sie in den Wolken bauen wollten, zwischen Himmel und Erde, weit von den Kümmernissen der Menschen entfernt und nur für Beflügelte erreichbar, eine Stadt, in der niemand zu leiden habe und alle weise seien. In meiner Vorstellung erhob sich ein Palast mit goldenen Türmen hoch oben in den Wolken, um den Falken und Rotschenkel flogen, Wachteln, Sumpfhühner und Kuckucke, wo Fleischbrühe aus Wasserspeiern strömte und Schildkröten Honigkuchen auf ihren Rücken trugen. Wein floss in Kanälen links und rechts der Straßen.
Als ich das alles mit meinen eigenen Augen sah, stand ich auf und sagte: «Warum hier bleiben, wenn ich dort sein könnte?», ließ meinen Weinkrug fallen und machte mich gleich auf den Weg nach Thessalien, ein Land, das jeder kennt und das berüchtigt ist für seine Hexerei. Ich wollte sehen, ob ich nicht eine Hexe finden könnte, die mich verwandeln würde …
Konstantinopel
1439–1452
Anna
Auf dem Vierten Hügel der Stadt, die wir Konstantinopel nennen, die für ihre Einwohner aber einfach nur die Stadt war, gegenüber vom Kloster der heiligen Kaiserin Theophanu, in der ehedem großen Kunststickerei von Nicholas Kalaphates, lebt eine Waise namens Anna. Erst mit drei Jahren beginnt sie zu sprechen. Und dann kommt eine Frage nach der anderen.
«Warum atmen wir, Maria?»
«Warum haben Pferde keine Hände?»
«Wenn ich ein Rabenei esse, bekomme ich dann schwarze Haare?»
«Passt der Mond in die Sonne, Maria, oder umgekehrt?»
Die Nonnen aus dem St. Theophanu nennen sie Äffchen, weil sie immer auf ihre Obstbäume klettert, die Jungen vom Vierten Hügel nennen sie bloß Mücke, weil sie sie nicht in Ruhe lässt, und die oberste Stickerin, Witwe Theodora, meint, sie sollte Heillos heißen, weil sie kein anderes Kind kennt, das in einer Stunde einen neuen Stich lernen kann, um ihn in der nächsten schon wieder zu vergessen.
Anna und ihre ältere Schwester Maria schlafen zwei Türen hinter der Spülküche in einer Kammer mit einem kleinen Fenster, die kaum groß genug für eine Rosshaarpritsche ist. Gemeinsam besitzen sie vier Kupfermünzen, drei Elfenbeinknöpfe, eine geflickte Wolldecke und eine Ikone der heiligen Koralia, die womöglich einmal ihrer Mutter gehört hat. Anna hat noch nie süße Sahne geschmeckt, noch nie eine Orange gegessen und war auch noch nie außerhalb der Stadtmauern. Noch vor ihrem vierzehnten Geburtstag werden alle Menschen, die sie kennt, entweder versklavt oder tot sein.
Es dämmert. Regen fällt auf die Stadt. Zwanzig Stickerinnen steigen die Treppe zum Arbeitsraum hinauf und setzen sich auf ihre Bänke. Witwe Theodora geht von Fenster zu Fenster und öffnet die Läden. Sie sagt: «Gebenedeiter, bewahre uns vor Müßiggang», und die Stickerinnen antworten, «denn wir haben unzählige Male gesündigt», und Witwe Theodora schließt den Schrank mit den Garnen auf, wiegt Gold- und Silberfäden und die kleinen Schachteln mit den Saatperlen, schreibt die Zahlen auf eine Wachstafel, und kaum, dass es im Raum hell genug ist, um einen schwarzen von einem weißen Faden zu unterscheiden, fangen sie an.
Mit ihren siebzig Jahren ist Thekla die Älteste. Die Jüngste ist die siebenjährige Anna. Sie hockt neben ihrer Schwester und sieht zu, wie Maria eine halb fertige Priesterstola auf dem Tisch ausrollt. An den Rändern winden sich Ranken in wunderbaren Reigen um Lerchen, Pfauen und Tauben. «Jetzt, nachdem wir Johannes, den Täufer, umrissen haben», sagt Maria, «kommen seine Gesichtszüge.» Sie fädelt den passend gefärbten Faden in eine Nadel, spannt den Stoff in den Stickrahmen und führt eine Reihe Stiche aus. «Wir drehen die Nadel, stechen mit der Spitze durch die Mitte des letzten Stiches und spleißen die Fasern, siehst du?»
Anna sieht es nicht. Wer will ein solches Leben, will den ganzen Tag über Nadel und Faden gebeugt sein, um Heilige und Sterne, Greife und Ranken in die Kleidung von Hierarchen zu sticken? Eudokia singt eine Hymne über drei heilige Kinder, Agata von den Versuchungen Hiobs, und Witwe Theodora stakst wie ein nach kleinen Fischen Ausschau haltender Reiher durch den Raum. Anna müht sich, Marias Nadel zu folgen, Steppstich, Kettenstich, doch da landet ein kleines braunes Schwarzkehlchen direkt auf der Fensterbank vor ihrem Tisch, schüttelt sich ein paar Wassertropfen vom Gefieder, singt wiet-tsäk-tsäk-tsäk, und schon träumt sich Anna in den Vogel hinein. Sie flattert von der Fensterbank auf, weicht den Regentropfen aus und fliegt hoch nach Süden über die Häuser und die Ruine der Polyeuktos-Basilika. Möwen kreisen um die Kuppel der Hagia Sophia wie Gebete um Gottes Kopf, der Wind krönt die Wellen des Bosporus mit weißem Schaum, und um die Landzunge fährt eine Handelsgaleere, die Segel voll gebauscht. Aber Anna fliegt immer noch höher, bis die Stadt nur mehr eine Stickerei aus Dächern und Gärten tief unter ihr ist, bis sie oben in den Wolken ist, bis …
«Anna», zischt Maria, «welches Garn jetzt?»
Von der anderen Seite des Raumes flackert Witwe Theodoras Aufmerksamkeit zu ihnen herüber.
«Purpur? Um Silber herum?»
«Nein», seufzt Maria. «Kein Purpur. Und kein Silberfaden.»
Den ganzen Tag holt sie Fäden und Stoff, holt Wasser, holt den Stickerinnen ihr Essen, Bohnen und Öl. Am Nachmittag hören sie das Getrappel eines Esels, den Gruß des Pförtners, und dann kommt Meister Kalaphates die Treppe herauf. Die Frauen sitzen etwas gerader, sticken etwas schneller. Anna kriecht unter den Tisch, sammelt alle Fadenreste ein, die sie finden kann, und flüstert leise vor sich hin: «Ich bin klein, ich bin unsichtbar, er kann mich nicht entdecken.»
Mit seinen überlangen Armen, dem weinverfärbten Mund und dem streitlustigen Buckel ähnelt Kalaphates mehr als alle anderen Männer, die sie je gesehen hat, einem Geier. Er lässt missbilligende Schnalzlaute hören, während er zwischen den Bänken hindurchhumpelt, und sucht sich schließlich eine der Stickerinnen aus, hinter der er stehen bleibt. Heute ist es Eugenia, und er lässt sich darüber aus, wie langsam sie arbeitet, dass man eine Unfähige wie sie in den Tagen seines Vaters nie auch nur in die Nähe eines Seidenballens gelassen hätte, und versteht ihr Frauen denn nicht, dass jeden Tag mehr Provinzen an die Sarazenen verloren gehen, dass die Stadt die letzte Insel Christi im Meer der Ungläubigen ist, und dass sie alle, gäbe es die Stadtmauern nicht, längst auf einem Sklavenmarkt irgendwo im gottverlassenen Landesinneren zum Verkauf stünden?
Kalaphates redet sich immer mehr in Rage, doch dann klingelt der Pförtner und kündigt die Ankunft eines Kunden an. Kalaphates wischt sich über die Stirn, rückt das goldene Kreuz auf der Knopfleiste seines Hemds zurecht und watschelt zurück nach unten. Alle atmen erleichtert auf. Eugenia legt ihre Schere zur Seite, Agata reibt sich die Schläfen, Anna kommt unter der Bank hervorgekrochen, und Maria stickt weiter.
Fliegen drehen Kreise zwischen den Tischen. Von unten klingt Männerlachen herauf.
Eine Stunde vor dem Dunkelwerden ruft Witwe Theodora sie zu sich. «So Gott will, Kind, ist es nicht zu spät, Kapernknospen zu sammeln. Sie werden Agatas Schmerzen in den Handgelenken mildern und Thekla mit ihrem Husten helfen. Suche nach welchen, die kurz vor dem Aufblühen stehen. Und sei vor dem Abendläuten zurück, bedecke dein Haar und hüte dich vor Schurken und Schuften.»
Anna kann kaum noch die Füße auf dem Boden halten.
«Und renne nicht. Sonst fällt dir dein Schoß noch heraus.»
Sie zwingt sich dazu, langsam die Treppe hinunterzugehen, langsam den Hof zu durchqueren, langsam am Pförtner vorbei … Dann fliegt sie. Am Tor vom St. Theophanu vorbei, um die mächtigen Granitblöcke einer umgefallenen Säule herum, zwischen zwei Reihen Mönchen hindurch, die in ihren schwarzen Kutten wie flugunfähige Krähen die Straße hinauftrotten. Pfützen schimmern auf den Wegen, drei Ziegen grasen in den Trümmern einer verfallenen Kapelle und drehen ihr im genau gleichen Moment die Köpfe zu.
Wahrscheinlich wachsen zwanzigtausend Kapernbüsche näher bei Kalaphates’ Haus, aber Anna rennt die zwei Kilometer bis zur Stadtmauer. Dort, in einem mit Nesseln zugewucherten Obstgarten, am Fuß der großen inneren Mauer, gibt es einen versteckten Eingang, länger schon, als dass sich jemand an die Zeit davor erinnern könnte. Anna klettert über einen Schutthaufen, zwängt sich durch die Öffnung dahinter und läuft eine enge Wendeltreppe hinauf. Dreimal im Kreis geht es bis nach oben, zwischen drohenden Spinnweben hindurch, hinein in den kleinen Gefechtsstand eines Bogenschützen. Zwei Schießscharten in entgegengesetzten Richtungen lassen Licht herein. Überall liegt Schutt. Sie kann hören, wie Sand durch Risse unter ihren Füßen rieselt. Eine erschreckte Schwalbe fliegt davon.
Atemlos wartet sie darauf, dass sich ihre Augen an das Licht gewöhnen. Vor Jahrhunderten hat jemand, vielleicht ein einsamer Bogenschütze, den seine Wache langweilte, ein Fresko an die südliche Wand gemalt. Zeit und Wetter haben viel vom Putz herunterrieseln lassen, doch das Dargestellte ist noch immer klar zu erkennen.
Links steht ein Esel mit traurigen Augen an einer Meeresküste. Das Wasser ist blau und voller geometrisch schöner Wellen, ganz rechts auf einem Wolkenfloß so hoch, dass Anna nicht bis dort hinaufreichen kann, leuchtet eine Stadt mit silbernen und bronzenen Türmen.
Ein halbes Dutzend Mal schon hat sie dieses Bild betrachtet, und immer rührt es etwas in ihr an, ein unaussprechliches Gefühl von Fernweh, eine Ahnung davon, wie unglaublich groß die Welt ist und wie klein sie selbst darin. Der Stil des Bildes ist ganz anders als der der Stickerinnen in Kalaphates’ Werkstatt, die Perspektive, die viel elementareren Farben. Wer ist der Esel, und warum wirkt er so verloren? Und was für eine Stadt ist das? Zion, das Paradies, die Stadt Gottes? Sie reckt sich auf die Zehen. Zwischen den Rissen im Putz kann sie Säulen und Bögen erkennen, Fenster und winzige um Türme fliegende Tauben.
Im Obstgarten unten fangen die Nachtigallen an zu singen. Das Licht verblasst, der Boden knarzt, und der Turm scheint ein Stück weiter in Vergessenheit zu versinken. Anna zwängt sich durch die westliche Schießscharte auf die Mauer, wo Kapernbüsche in einer Reihe ihre Blätter der untergehenden Sonne entgegenstrecken.
Sie sammelt Knospen und füllt sie in ihre Taschen. Dennoch, die Größe der Welt hält ihre Aufmerksamkeit gefangen. Hinter der äußeren Mauer und dem Graben voller Algen wartet sie mit Olivenhainen und Ziegenpfaden, und die winzige Gestalt eines Treibers führt zwei Kamele an einem Friedhof vorbei. Die Steine strahlen die Hitze des Tages ab, die Sonne sinkt aus dem Blick. Als die Abendglocke läutet, ist ihre Tasche erst zu einem Viertel gefüllt. Sie wird zu spät kommen. Maria wird sich sorgen, Witwe Theodora böse sein.
Anna schlüpft zurück in den Turm und hält noch einmal unter dem Bild inne. Einmal noch Luft holen. Im Zwielicht scheinen die Wellen zu schäumen, die Stadt zu schimmern. Der Esel wandert am Ufer entlang und will unbedingt übers Meer.
Ein Holzfällerdorf in den Rhodopen Bulgariens
In ebenjenen Jahren
Omeir
Dreihundert Kilometer nordwestlich von Konstantinopel, in einem kleinen Holzfällerdorf neben einem schnellen, wilden Fluss, wird ein nicht ganz vollständiger Junge geboren. Er hat feuchte Augen, rosa Wangen und viel Kraft in den Beinen. Aber links an seinem Mund trennt eine Öffnung die Oberlippe vom Gaumen bis zur Nase.
Die Hebamme weicht zurück. Die Mutter des Kindes schiebt dem Kleinen einen Finger in den Mund: Die Scharte reicht bis hoch in den Gaumen. Als wäre sein Schöpfer ungeduldig geworden und hätte einen Moment zu früh mit seiner Arbeit aufgehört. Der Schweiß auf der Haut der Mutter erkaltet, Furcht verdrängt die Freude. Viermal war sie schwanger, und sie hat noch kein einziges Baby verloren, hat sich vielleicht sogar für in besonderer Weise gesegnet gehalten. Und jetzt das?
Der Junge schreit, eisiger Regen trommelt aufs Dach. Sie versucht ihn mit den Schenkeln zu halten, drückt eine ihrer Brüste mit beiden Händen vor, schafft es aber nicht, dass sich seine Lippen darum schließen. Er schluckt, sein Hals zittert, und er verliert weit mehr Milch, als er bekommt.
Amani, die älteste Tochter, ist vor Stunden schon aufgebrochen, um die Männer hoch oben aus dem Wald zu holen. Sie werden bereits nach Hause eilen. Die zwei jüngeren Töchter blicken zwischen Mutter und Neugeborenem hin und her, als versuchten sie zu ergründen, ob so ein Gesicht erlaubt ist. Die Hebamme schickt eine von ihnen zum Fluss Wasser holen, die andere soll die Nachgeburt vergraben. Es ist stockfinster draußen, und das Kind schreit noch, als sie die Hunde und die Glocken von Blatt und Nadel, ihren Ochsen, hören, die vorm Stall draußen ankommen.
Der Großvater und Amani treten durch die Tür, eisglitzernd und mit aufgewühltem Blick. «Es ist gestürzt, das Pferd …», sagt Amani, doch als sie das Gesicht des Babys sieht, hält sie inne. Der Großvater hinter ihr sagt: «Dein Mann ist vorausgeritten, das Pferd muss in der Dunkelheit weggerutscht sein, und der Fluss …»
Entsetzen erfüllt die Kate. Das Neugeborene schreit, die Hebamme schiebt sich zur Tür hin, eine finstere, elementare Angst verzieht ihr das Gesicht.
Die Frau des Hufschmieds hat sie gewarnt, Geister der Toten würden schon den ganzen Winter über in den Bergen Unheil bringen, durch verschlossene Türen schlüpfen, schwangeren Frauen Krankheiten bringen und kleine Kinder ersticken. Die Frau des Hufschmieds meinte, sie sollten eine Ziege als Opfer draußen an einen Baum binden und obendrein noch einen Topf Honig in den Fluss gießen, aber ihr Mann sagte, sie könnten keine ihrer Ziegen entbehren, und sie selbst wollte nicht so einfach auf ihren Honig verzichten.
Stolz.
Mit jeder ihrer Bewegungen blitzt ein Schmerz in ihrem Leib auf. Mit jedem Herzschlag kann die Mutter spüren, wie die Hebamme von Haus zu Haus eilt und die Geschichte verbreitet. Ein Dämon ist geboren worden. Sein Vater ist tot.
Der Großvater nimmt das schreiende Kind, legt es auf den Boden, steckt ihm einen Fingerknöchel zwischen die Lippen, und der Junge beruhigt sich. Mit der anderen Hand öffnet er die Scharte in der Oberlippe des Babys.
«Vor Jahren gab es auf der anderen Seite des Berges einen Mann mit genau so einer Öffnung in der Lippe. Ein guter Reiter, wenn man nicht mehr darauf achtete, wie hässlich er war.»
Er gibt ihr das Kind zurück und bringt Ziege und Kuh herein, um sie vorm Wetter zu schützen, geht ein weiteres Mal hinaus in die Nacht und spannt die Ochsen aus. In den Augen der Tiere spiegelt sich die Glut der Feuerstelle, und die Töchter drängen sich um ihre Mutter.
«Ist es ein Dschinn?»
«Ein böser Geist?»
«Wie kann es atmen?»
«Wie kann es essen?»
«Wird Großvater es zum Sterben in die Berge bringen?»
Das Kind blinzelt mit dunklen, lernenden Augen zu ihnen auf.
Der Graupel wird zu Schnee, und sie schickt ein Gebet zum Himmel, dass ihr Sohn verschont bleibt, sollte er eine Aufgabe in dieser Welt haben. Doch als sie kurz vorm Morgengrauen aufwacht, sieht sie den Großvater an ihrem Lager stehen. In seinem Rindslederumhang und mit all dem Schnee auf den Schultern sieht er aus wie der Geist aus einem Holzfällerlied, ein Ungeheuer, das es gewohnt ist, schreckliche Dinge zu tun, und auch wenn sie sich sagt, dass ihr Sohn schon am Morgen neben ihrem Mann auf einem Thron in einem Garten ewiger Glückseligkeit sitzen wird, in dem Milch und Honig fließen und es nie Winter wird, fühlt es sich an, als gäbe sie einen Teil ihrer Lunge weg.
Hähne krähen, Räder knirschen im Schnee, in der Kate wird es hell, und erneut ergreift sie das Entsetzen. Ihr Mann ertrunken, das Pferd mit ihm. Die Mädchen waschen und beten, melken Schönheit, die Kuh, füttern Blatt und Nadel, schneiden Kiefernzweige, damit die Ziege etwas zum Kauen hat, und der Morgen wird zum Nachmittag, ohne dass sie die Kraft hätte aufzustehen. Frost im Blut, Frost in ihren Gedanken. Ihr Sohn quert in diesem Moment den Fluss in den Tod. Oder jetzt. Oder jetzt.
Der Abend dämmert, und die Hunde knurren. Sie erhebt sich und schleppt sich zur Tür. Eine Windböe hoch aus den Bergen lässt eine glitzernde Wolke aus den Bäumen auffahren. Der Druck in ihren Brüsten ist kaum zu ertragen.
Eine lange Weile geschieht nichts. Dann kommt der Großvater auf der Stute am Fluss heruntergeritten, ein Bündel über dem Sattel. Die Hunde fahren auf. Der Großvater steigt ab, ihre Arme recken sich vor, um zu nehmen, was er mitgebracht hat, obwohl ihr Kopf ihr sagt, sie sollte es nicht.
Das Kind lebt. Seine Lippen sind grau, seine Wangen aschfahl, aber nicht einmal seine winzigen Finger sind frostgeschwärzt.
«Ich habe ihn bis weit nach oben zum Hain gebracht.» Der Großvater legt Holz aufs Feuer und bläst in die Asche, um ein Feuer zu entfachen. Seine Hände zittern. «Ich habe ihn auf die Erde gelegt.»
Sie rückt so nahe ans Feuer, wie es nur geht, hält mit der rechten Hand Kinn und Wange ihres Kindes und drückt mit der linken einen Strahl Milch in seinen Mund. Die Milch läuft aus Nase und Scharte, aber der Junge schluckt. Die Mädchen schlüpfen durch die Tür herein, gefangen vom Mysterium des Ganzen, die Flammen lodern auf, doch der Großvater zittert. «Ich bin zurück aufs Pferd gestiegen. Er blieb so ruhig. Er sah hinauf in die Bäume. Eine kleine Gestalt im Schnee.»
Das Kind ringt um Luft und schluckt wieder. Draußen vor der Tür heulen die Hunde. Der Großvater sieht auf seine zitternden Hände. Wie lange wird es dauern, bis es im Dorf alle wissen?
«Ich konnte ihn nicht zurücklassen.»
Noch vor Mitternacht werden sie mit Heugabeln und Fackeln vertrieben. Das Kind ist der Grund für den Tod des Vaters gewesen, und es hat den Großvater verhext, damit er es aus dem Wald wieder mitbringt. Es hat einen Dämon in sich, der Makel in seinem Gesicht ist der Beweis.
Sie lassen den Stall zurück, die Wiese, den Rübenkeller, sieben geflochtene Bienenstöcke und die Kate, die der Vater des Großvaters vor sechzig Jahren gebaut hat. Bis zum Morgen haben sie es einige Kilometer den Fluss hinauf geschafft. Der Großvater stapft neben den Ochsen durch den Schneematsch, die Ochsen ziehen den Wagen, auf dem die Mädchen sitzen und Hühner, Töpfe und Geschirr festhalten. Schönheit, die Kuh, trottet hinterdrein und scheut vor jedem Schatten zurück, den Schluss bildet die Mutter auf der Stute. Das Baby blinzelt aus seinem Bündel und sieht zum Himmel hinauf.
Bei Einbruch der Nacht sind sie in einer weglosen Schlucht, fünfzehn Kilometer vom Dorf entfernt. Ein Bach windet sich zwischen eisbedeckten Felsen hindurch, und eigenwillige Wolken, groß wie Götter, ziehen durch die Baumwipfel, pfeifen merkwürdig und erschrecken die Tiere. Sie kampieren unter einem Sandsteinüberhang, wo Urmenschen vor Äonen Höhlenbären, Auerochsen und flugunfähige Vögel auf den Felsen gemalt haben. Die Mädchen drängen sich an ihre Mutter, der Großvater macht Feuer, die Ziege wimmert, die Hunde zittern, und in den Augen des Babys spiegelt sich das Licht der Flammen.
«Omeir», sagt seine Mutter. «Wir nennen ihn Omeir. Den, der lange lebt.»
Anna
Sie ist acht, bringt vom Winzer drei Krüge mit Kalaphates’ dunklem Kopfschmerz-Wein zurück und bleibt draußen vor einem Wohnheim stehen, um auszuruhen. Durch die Fensterläden hört sie in einem seltsam akzentuierten Griechisch:
Aber Odysseus
Ging zum berühmten Palast des Alkinoos; vieles erwog er
Innehaltend, ehe zur ehernen Schwelle er hinkam,
Denn da war ein Glanz wie von Sonnenlicht oder von Mondschein
In des stolzen Alkinoos’ Haus, dem hochüberdachten.
Erzverkleidete Wände erstreckten sich hierhin und dorthin,
Von der Schwelle bis drinnen; ringsum ein Gesimse aus Glasfluss.
Goldene Türen verschlossen das Innere des festen Gebäudes.
Silbern waren die Pfosten und standen auf ehernem Sockel,
Silbern der Türsturz oben darüber und golden der Türring.
Goldne und silberne Hunde waren zur Rechten und Linken,
Welche Hephaistos gefertigt mit kundigem Sinne,
Um des großgesinnten Alkinoos’ Haus zu bewachen.
Anna vergisst den Handkarren, den Wein, die Zeit – alles. Der Akzent klingt ihr fremd, aber die Stimme ist tief und flüssig, und das Versmaß erinnert an einen vorbeigaloppierenden Reiter. Es folgen Jungenstimmen, welche die Verse wiederholen, dann setzt die erste Stimme wieder ein:
Außer dem Hof ist ein großer Garten nahe der Hoftür,
An vier Morgen, von allen Seiten vom Zaune umzogen.
Große Bäume stehen darin in üppigem Wachstum,
Apfelbäume mit glänzenden Früchten, Granaten und Birnen
Und auch süße Feigen und frische, grüne Oliven.
Denen verdirbt nie Frucht, noch fehlt sie winters und sommers
Während des ganzen Jahres, sondern der stetige Westhauch
Treibt die einen hervor und lässt die anderen reifen.
Birne auf Birne reift da heran und Apfel auf Apfel,
Aber auch Traube auf Traube und ebenso Feige auf Feige.
Was für ein Palast ist das, in dem die Türen golden schimmern, silberne Säulen stehen und um den herum die Bäume ständig Früchte tragen? Wie hypnotisiert geht sie auf das Wohnheim zu, klettert über das Tor und linst durch den Fensterladen. Drinnen sitzen vier Jungen im Wams um einen alten Mann herum, dem ein Kropf seitlich aus dem Hals wächst. Die Jungen wiederholen seine Verse in einem blutlosen Singsang, und der Mann hält etwas auf dem Schoß, das gebundene Pergamentblätter zu sein scheinen. Anna beugt sich so weit vor, wie sie sich traut.
Sie hat erst zweimal ein Buch gesehen: eine ledergebundene Bibel mit glitzernden Edelsteinen, die von den Älteren im Kloster St. Theophanu den Mittelgang hinausgetragen wurde, und einen medizinischen Katalog auf dem Markt, den der Kräuterhändler zuschnappen ließ, als Anna hineinzusehen versuchte. Das hier sieht älter aus und schmutziger. Die Buchstaben reihen sich dicht an dicht auf dem Pergament wie die Spuren von hundert Schnepfenvögeln.
Der Lehrer wiederholt den Vers, in dem eine Göttin einen Reisenden in Nebel hüllt, damit er sich ungesehen in den funkelnden Palast schleichen kann. Anna stößt aus Versehen an den Fensterladen, und die Jungen blicken auf. Und schon verscheucht ein breitschultriger Hausmeister Anna vom Fenster, als wäre sie ein Vogel, der sich an Obst vergreift.
Sie geht zurück zu ihrem Handkarren und schiebt ihn so nah heran, wie sie sich traut, aber Wagen rumpeln vorbei, und sie kann nichts mehr hören. Wer ist dieser Odysseus und wer die Göttin, die ihn in magischen Nebel hüllt? Ist das Königreich des tapferen Alkinoos das gleiche, das auch oben in den Turm gemalt ist? Das Tor öffnet sich, und die Jungen kommen heraus. Sie werfen ihr finstere Blicke zu, während sie den Pfützen ausweichen. Kurz drauf tritt der alte Lehrer, auf seinen Stock gestützt, ins Licht, und sie stellt sich ihm in den Weg.
«Ihr Gesang. Was steht auf den Seiten?»
Der Mann bewegt kaum den Kopf, es ist, als wüchse da ein Kürbis unter seinem Kinn.
«Können Sie es mich lehren? Ich kenne schon ein paar Zeichen, zum Beispiel das mit den zwei Säulen und dem Stab dazwischen, oder das, das wie ein Galgen aussieht, und den umgedrehten Ochsenkopf.»
Mit dem Finger malt sie ein A in den Straßenkot vor seinen Füßen. Der Mann hebt den Blick in den Regen. Da, wo seine Augen weiß sein sollten, sind sie gelb.
«Mädchen gehen nicht zu Lehrern. Und du hast kein Geld.»
Sie nimmt einen Krug vom Karren. «Ich habe Wein.»
Er wird aufmerksam. Sein Arm greift nach dem Krug.
«Erst», sagt sie, «eine Unterrichtsstunde.»
«Du wirst es nie lernen.»
Sie gibt nicht nach. Der alte Lehrer stöhnt. Mit dem Ende seines Stocks schreibt er etwas in die nasse Erde:
Ὠκεανός
«Ōkeanos, der Ozean, der älteste Sohn von Himmel und Erde.» Er zieht einen Kreis um das Wort und sticht in die Mitte. «Hier das Bekannte.» Dann sticht er daneben. «Hier das Unbekannte. Jetzt den Wein.»
Sie gibt ihn ihm, und er trinkt mit beiden Händen. Sie geht in die Hocke. Ὠκεανός. Sieben Zeichen in der Erde. Und doch enthalten sie den einsamen Reisenden und den Palast mit seinen kupfernen Wänden, goldenen Wachhunden und die Göttin mit ihrem Nebel?
Weil sie zu spät kommt, bestraft Witwe Theodora Anna mit Stockschlägen auf die linke Fußsohle, und weil einer der Krüge halb leer ist, gibt es auch noch was auf die rechte Sohle. Jeweils zehn Schläge. Anna weint kaum. Die halbe Nacht schreibt sie die neuen Buchstaben auf die Tafeln ihres Geistes, und während sie am nächsten Tag die Treppe hinauf- und hinunterhumpelt, wenn sie Wasser holt, Aale für Chryse, die Köchin, sieht sie das Königreich des Alkinoos vor sich, umgeben von Wolken und mit Westwind gesegnet, reich an Äpfeln, Birnen und Oliven, blauen Feigen und roten Granatäpfeln, und überall stehen Jungen aus Gold auf leuchtenden Sockeln und halten brennende Fackeln in der Hand.
Zwei Wochen später kommt sie vom Markt zurück und macht einen Umweg am Wohnheim vorbei, wo sie den Lehrer mit dem Kropf wie eine Topfpflanze in der Sonne sitzen sieht. Sie stellt ihren Korb mit Zwiebeln ab und schreibt mit dem Finger vor ihm in die Erde:
Ὠκεανός
Rundherum zieht sie einen Kreis.
«Der älteste Sohn von Himmel und Erde. Hier das Bekannte, dort das Unbekannte.»
Der Mann neigt mühsam den Kopf zur Seite und nimmt sie in den Blick, als sähe er sie zum ersten Mal. Die Nässe in seinen Augen reflektiert das Licht.
Sein Name ist Licinius. Vor seinem Unglück, sagt er, hat er einer wohlhabenden Familie in einer Stadt im Westen als Lehrer gedient und besaß sechs Manuskripte und eine eiserne Kassette, in der er sie aufbewahrte: zwei Bände mit den Leben der Heiligen, einen mit Reden von jemandem namens Horaz, ein Testament der Wunder der heiligen Elisabeth, einen Leitfaden der griechischen Grammatik und die Odyssee des Homer. Aber dann nahmen die Sarazenen seine Stadt ein, und er floh ohne alles in die Hauptstadt, und Dank sei den Engeln im Himmel für ihre Mauern, deren Fundamente die Gottesmutter selbst gelegt habe.
Aus seinem Mantel zieht Licinius drei braune, fleckige Pergamentbündel. Odysseus, sagt er, war einst General der größten Armee, die je aufgestellt wurde und deren Legionen aus Hyrmina, Dulichion, aus den ummauerten Städten Knossos und Gortyn, aus den fernsten Fernen des Meeres kamen, und sie überquerten den Ozean in Tausenden schwarzen Schiffen, um das sagenumwobene Troja zu zerstören. Von jedem Schiff traten tausend Krieger, so zahlreich, sagt Licinius, wie Blätter an den Bäumen oder die Fliegen, die über Eimern warmer Milch in Schafställen schwirren. Zehn Jahre belagerten sie Troja, und nachdem die Stadt endlich gefallen war, segelten die müden Krieger zurück nach Hause. Alle kamen sicher an, nur Odysseus nicht. Das Lied seiner Heimreise, erklärt Licinius, besteht aus vierundzwanzig Büchern, eines für jeden Buchstaben des Alphabets, und es dauert Tage, es zu rezitieren. Ihm, Licinius, sind jedoch nur diese drei geblieben, jedes bestehend aus einem halben Dutzend Seiten, und sie berichten von jenem Teil der Reise, da Odysseus die Höhle der Kalypso verlässt, in einen Sturm gerät und nackt ans Ufer der Insel Scheria gespült wird, der Heimat des tapferen Alkinoos, des Königs der Phäaken.
Es gab einmal eine Zeit, fährt Licinius fort, da jedes Kind im Reich jeden einzelnen Namen in der Geschichte des Odysseus kannte. Aber lange, bevor Anna geboren wurde, brannten römische Kreuzfahrer aus dem Westen die Stadt nieder, brachten Tausende um und nahmen ihr fast allen Besitz. Dann halbierten Seuchen die Einwohnerzahl um die Hälfte, halbierten sie noch einmal, und die Kaiserin musste Venedig ihre Krone verkaufen, um ihre Truppen bezahlen zu können. Der gegenwärtige Kaiser trägt eine Krone aus Glas und kann sich kaum die Teller leisten, von denen er isst, und so dämmert die Stadt in einem langen Halbdunkel dahin, wartet auf die Wiederkunft Christi und hat keine Zeit mehr für die alten Geschichten.
Anna kann den Blick nicht von den Blättern vor ihr wenden. So viele Worte! Es würde sieben Leben brauchen, sie alle zu lernen.
Jedes Mal, wenn Chryse, die Köchin, Anna zum Markt schickt, findet das Mädchen einen Grund, Licinius zu besuchen. Sie bringt ihm Brotkrusten, einen geräucherten Fisch, einen halben Korb Drosseln. Zweimal gelingt es ihr, einen Krug mit Kalaphates’ Wein zu stehlen.
Dafür unterrichtet er sie. A ist ἄλφα: Alpha, Β ist βῆτα: Beta, Ω ist ὦμέγα: Omega. Während sie den Boden des Arbeitsraums fegt, einen weiteren Ballen Stoff holt, einen Eimer Kohlen, während sie neben Maria sitzt, die Finger taub, Atemwolken über der Seide, übt sie die Buchstaben auf den tausend leeren Seiten in ihrem Kopf ein. Jeder steht für einen Klang, und die Buchstaben und ihre Klänge zu verbinden heißt, Wörter zu bilden, Wörter zu verbinden, Welten zu schaffen. Der ermattete Odysseus bricht mit seinem Floß von der Höhle Kalypsos auf, und die Gischt des Meeres bedeckt sein Gesicht. Der Schatten des Meergottes, Tang strömt aus seinem blauen Haar, blitzt im Wasser auf.
«Du füllst deinen Kopf mit nutzlosen Dingen», flüstert Maria. Aber den geknoteten Kettenstich, den Ankerkettenstich und den Girlandenstich wird Anna nie lernen. Das, was sie wirklich mit einer Nadel vermag, ist, sich aus Versehen in den Finger zu stechen und auf den Stoff zu bluten. Ihre Schwester sagt, sie solle sich die heiligen Männer vorstellen, wie sie in Gewändern, die sie zu schmücken geholfen hat, die göttlichen Mysterien vollbringen. Aber Annas Gedanken schweifen zu Inseln am Rand des Meeres, auf denen sich immer holde junge Mädchen tummeln und Göttinnen auf Lichtstrahlen vom Himmel herabkommen.
«Heilige Mutter, hilf», sagt Witwe Theodora, «wirst du es denn nie lernen?» Anna ist alt genug, um sich der Bedenklichkeit ihrer Lage bewusst zu sein. Maria und sie haben keine Familie, kein Geld. Sie gehören zu niemandem, und allein Marias Fertigkeit mit der Nadel sorgt dafür, dass sie im Haus des Kalaphates wohnen dürfen. An einem dieser Tische zu sitzen und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Kreuze, Engel und Blätter auf Pluviale, Kelchvela und Messgewänder sticken zu dürfen, bis ihre Rücken gebeugt sind und die Augen ihnen den Dienst versagen, auf mehr können sie in ihrem Leben nicht hoffen.
Äffchen. Mücke. Heillos. Aber Anna kann nicht anders.
«Ein Wort nach dem anderen.»
Wieder studiert sie das Durcheinander der Zeichen auf dem Pergament.
πολλῶν δ ̓ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω
«Ich kann es nicht.»
«Doch, du kannst es.»
Nun, ἄστεα sind Städte, νόον ist der Verstand, und ἔγνω bedeutet lernte.
Sie sagt: «Er sah die Städte vieler Männer und lernte, wie sie lebten.»
Der massige Hals von Licinius erbebt, als sich sein Mund zu einem Lächeln verzieht.
«Genau, das ist es.»
Fast über Nacht erstrahlt die Welt in neuer Bedeutung. Sie liest die Inschriften auf Münzen, auf Grund- und Grabsteinen, auf bleiernen Siegeln, Strebepfeilern und auf in die Stadtmauer eingelassenen Marmorplatten – jede verwundene Straße der Stadt ist ein eigenes zerschlissenes Manuskript.
Worte leuchten auf dem angeschlagenen Rand eines Tellers, den Chryse, die Köchin, unter dem Herd aufbewahrt: Zoë, die Frommste. Über dem Eingang einer vergessenen kleinen Kapelle: Friede sei allen, die freundlichen Herzens hereinkommen. Ihr Lieblingssatz ist in den Sturz über der Tür des Wächters neben dem Tor zum Kloster St. Theophanu eingemeißelt. Es hat sie einen halben Sonntag gekostet, ihn zu entziffern.