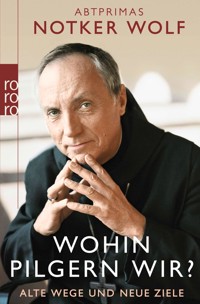9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Wenn ich gelegentlich nach Deutschland zurückkehre, kommt mir das Land wie ein großer Wartesaal vor, ein Wartesaal voller Warntafeln und Verbotsschilder, von denen das größte strengstens untersagt, bei Ankunft des Zuges den Bahnsteig zu betreten.» Schuldige für die Probleme dieses Landes finden wir schnell und prangern sie an. Doch was ist mit uns selbst? Schuldlos, aber völlig machtlos? Notker Wolfs ketzerische Analyse zeigt: Die Deutschen sind weiterhin ein Volk der Untertanen. Wir führen das unbeschwerte Leben einer Gesellschaft, die die persönliche Verantwortung an der Garderobe des Staates abgegeben hat. Denn seine Fürsorge und Bevormundung schafft Sicherheit. Aber um den Wandel der Verhältnisse mitzugestalten, müssen wir unsere individuelle Freiheit zurückgewinnen. Denn in Zukunft werden wir uns selbst überlassen sein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Abtprimas Notker Wolf
mit Leo G. Linder
Worauf warten wir?
Ketzerische Gedanken zu Deutschland
Inhaltsverzeichnis
Zitat
01 Überlegungen auf einem chinesischen Bahnhof
02 Eine Reise in die Zukunft
03 Das 29. Kapitel der Apostelgeschichte
04 Was machst du, wenn es nicht klappt?
05 Schuldlos, aber völlig machtlos?
06 Zeiten der Bevormundung
07 Die romantische Revolution
08 Kurs auf die totale Freiheit
09 Das elfte Gebot
10 Rettet die Achtundsechziger!
11 Wer sich um meinetwillen verliert
12 Vom Fremden zum Nächsten
13 Menschen mit Hintergrund
14 Die große Zwangsverbrüderung
15 Benediktiner in Afrika
16 Was in meiner Macht steht
17 Trauen wir uns!
18 Gleichheit – eine deutsche Obsession
19 Erziehung in der Konsumgesellschaft
20 Auf den Lehrer kommt es an
21 Vision Menschenwürde
Wir gingen durch Feuer und Wasser. Doch du hast uns in die Freiheit hinausgeführt.
Psalm 66, 12
01
ÜBERLEGUNGEN AUF EINEM CHINESISCHEN BAHNHOF
Ich verliere nicht leicht die Nerven. Ich habe manches erlebt und bin auf ziemlich alles gefasst. Aber damals, in der Bahnhofshalle der nordostchinesischen Stadt Shenyang, musste ich mich mühsam beherrschen. Es war meine erste Reise nach China, ich wollte mit dem Zug ins Innere der Mandschurei und bis an die nordkoreanische Grenze, und es schien mir nicht vergönnt, in den Besitz einer simplen Fahrkarte zu gelangen.
Zum Glück hatte ich meine Pfeife dabei – und Pater Sebastian, einen deutschen Benediktiner, der seit Jahren in Südkorea lebte. Pater Sebastian konnte nicht nur die chinesischen Schriftzeichen von Ortsnamen entziffern, er hatte auch ausgiebige Erfahrungen mit dem südkoreanischen Geheimdienst gesammelt. Mit anderen Worten: Er ließ sich nicht leicht ins Bockshorn jagen – und reagierte deshalb gelassen, als nach Stunden stoisch ertragenen Wartens die Reihe endlich an uns war und die Dame im Dämmerlicht des Fahrkartenschalters bloß den Kopf schüttelte und trocken erklärte, für Ausländer gebe es einen eigenen Schalter, die Treppe hoch, im ersten Stock. Er verlor nicht einmal die Fassung, als wir nach einer weiteren Stunde geduldigen Wartens im ersten Stock erfuhren, unser Devisengeld sei hier wertlos, an diesem Schalter könne man nur mit chinesischem Geld bezahlen. Er blieb auch unerschütterlich, als wir in einer dritten Schlange abermals eine gute Stunde ausharren mussten, bevor man uns die Fahrkarten tatsächlich aushändigte. Und er bewährte sich ungemein, als dann spätabends der Zug einlief und auf dem Bahnsteig ein unglaubliches Gerangel entstand, ein Stoßen und Schieben und Drängen, sodass wir uns regelrecht zu einer der Waggontüren vorkämpfen und bis in unser Abteil durchboxen mussten.
Eine harte Bewährungsprobe für unsere Geduld. Nicht die erste. Ich rief mir ins Gedächtnis, dass wir uns nicht auf einer Vergnügungsreise befanden. Ein Jahr zuvor, 1984, hatte China seine Grenzen für Individualreisende geöffnet, seither hatte ich darauf gebrannt, in die ehemalige Mandschurei zu fahren und Kontakt zu den Christen dort aufzunehmen. Würde ich überhaupt noch Christen finden? Wir Benediktiner hatten Anfang des letzten Jahrhunderts im Nordosten Chinas missioniert, hatten eine Abtei errichtet, Pfarreien gegründet, ein ganzes Schulsystem aufgebaut. Dann waren unsere Missionare von den Kommunisten des Landes verwiesen worden. Was war aus den Chinesen geworden, die sich seinerzeit zum christlichen Glauben bekehrt hatten? Niemand wusste etwas darüber. Ich fühlte mich für sie mitverantwortlich. Ich musste ihnen zeigen, dass wir sie nie vergessen hatten. Und außerdem war ich entschlossen, ein neues Kapitel unserer Missionsarbeit in China aufzuschlagen.
Ein argwöhnischer Staatssicherheitsdienst wie der chinesische konnte das, was wir vorhatten, durchaus verdächtig finden. Auf jeden Fall mussten wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Um keine schlafenden Hunde zu wecken, hatten wir nichts im Voraus gebucht, kein Hotel, keinen Flug und keine Zugfahrt. Kein übereifriger, unterbeschäftigter Geheimdienstmann irgendwo in der Provinz sollte von unseren Plänen Wind bekommen. Nur– Reisende, die unerwartet auftauchten, existierten in jenen Jahren für chinesisches Hotelpersonal eigentlich gar nicht. Oft saßen wir stundenlang auf unseren Koffern und warteten. Wieder einmal. Warteten, bis irgendwann sich irgendjemand doch noch unser erbarmte.
Nun gut, ich kann warten. Noch waren die Chinesen mit solchen Reisenden wie Pater Sebastian und mir überfordert. Bereut habe ich die langen Wartezeiten aber keineswegs. Ich habe nämlich – auf meiner ersten wie auf allen späteren Reisen – unterdessen die Menschen beobachtet und erlebt, wie ansteckend eine allgemeine Aufbruchstimmung sein kann, wie beflügelnd sich Erfolge auf ein ganzes Volk auswirken. Ich habe gesehen, mit welchem Eifer, mit welcher Energie und Zielstrebigkeit die Chinesen ihren Geschäften nachgehen. Und ich habe im Lauf der Jahre erfahren, mit welchen Hoffnungen, mit welchen großen Erwartungen sie in die Zukunft schauen, habe die Begeisterung in ihren Augen gesehen und den Stolz auf ihre Fortschritte. Eine solche Dynamik, habe ich manches Mal gedacht, muss zuletzt in den USA geherrscht haben, zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, als Einwanderer aus der Alten Welt in ihren Briefen nach Hause berichteten, wie unwiderstehlich mitreißend das Leben in Amerika sei.
1985 kündigten sich die späteren Erfolge erst zaghaft an. Seinerzeit war Peking noch eine triste Stadt, grau in grau, und alle trugen die dunkelblaue, kommunistische Einheitsmontur. Aber das, was solche Erfolge möglich macht, war damals bereits zu spüren: Zukunftsoptimismus, Selbstvertrauen und Einsatzfreude. Mit solchen Menschen kann man viel erreichen – und wir haben seither in China auch viel erreicht, haben Schulen unterstützt, Krankenhäuser finanziert und sogar Kirchen gebaut. Nicht dass Pater Sebastian und ich gleich mit offenen Armen empfangen worden wären. Niemand hatte auf uns gewartet. Wer waren wir denn? Zwei dahergelaufene deutsche Patres im Reich der Mitte, der Sprache unkundig, mit mysteriösen Absichten und der unbegreiflichen Gewohnheit, keine Reservierungen vorzunehmen. Dennoch ist man uns nach anfänglichem Misstrauen mit Aufgeschlossenheit begegnet. Sie ließen mit sich reden, unsere chinesischen Gesprächspartner. Sie waren willens, sich überzeugen zu lassen. Diese Menschen waren Realisten, auf ihren Vorteil bedacht wie jeder vernünftige Mensch und obendrein bereit, neue Wege zu beschreiten, Wege, die seit Maos Zeiten versperrt gewesen waren. China war in Bewegung geraten, und es war großartig, das mitzuerleben.
Diese Bilder von Tüchtigkeit und Zuversicht vor Augen, bin ich auf chinesischen Bahnhöfen und in chinesischen Hotelhallen oft ins Grübeln gekommen. Bei uns in Deutschland, habe ich gedacht, steht die Luft wie in einem geschlossenen Raum. Da bewegt sich nichts. Da steht auch die Diagnose längst fest. Und diese Diagnose lautet: Es ist schlecht bestellt um unsere Welt. Unheil breitet sich aus. Noch größeres Unheil zieht herauf. Aber nichts gegen das Verderben, das sich am Horizont bereits abzeichnet. Folglich ist Pessimismus die erste Bürgerpflicht und Optimismus unverantwortlich. Schönfärberei wäre es, an dieser Welt auch nur ein gutes Haar zu lassen. Und sträflicher Leichtsinn, noch einen Hoffnungsschimmer sehen zu wollen. Nur Gewissenlose nehmen in dieser Zeit, in dieser Welt noch etwas auf die leichte Schulter. Wir haben allen Grund, schwarz zu sehen. Das Glaubensbekenntnis der Kleingläubigen.
Und wie peinlich wir alles vermeiden, was nach Zuversicht aussehen könnte. «Das hat sowieso keinen Zweck», heißt es. Oder: «Das klappt nie und nimmer.» Oder: «Das kann gar nicht funktionieren.» Als wäre es unser hart erkämpftes Menschenrecht, das Schlimmste befürchten zu dürfen und ans Misslingen zu glauben. Doch ändern darf sich auch nichts, sonst müssten wir am Ende womöglich feststellen, dass wir im Irrtum waren. Und das wäre vermutlich die größte Katastrophe – nicht Recht behalten zu haben mit unserem Pessimismus. Von China aus gesehen, erinnerte mich Deutschland an einen Masochisten, der sich erst gründlich quält und dann krankschreiben lässt.
Oder leisten wir uns bloß einen unerbittlichen Realismus? Ein geschärftes Problembewusstsein, wie es so schön heißt? Ist der Eifer, mit dem wir jeden neuen Vorschlag madig machen und jeder neuen Perspektive die düsterste Seite abgewinnen, vielleicht nur ein Zeichen unseres aufgeklärten, kritischen Verstandes? Wer sind denn die wahren Realisten? Diejenigen, denen man nichts vormachen kann, die einen untrüglichen Blick für die Schwachstelle einer jeden Sache haben, die alles, was glänzt, auf gar keinen Fall für Gold halten? Oder Menschen wie die Chinesen, die sich von ihrem ehrgeizigen Aufbauprojekt anstecken lassen, die sich ihrer Kraft bewusst sind, die der Zukunft entgegenfiebern und bereit sind, alles, was glänzt, auch wirklich für Gold zu halten?
Bei dem Gedanken an Deutschland fallen mir gewisse Klöster ein. Klöster, in denen kein Leben mehr herrscht. So etwas kommt vor. Neues Leben kann dann nur von außen kommen, wie in jenem Kloster auf einer Insel vor der südfranzösischen Küste. Die Gemeinschaft dort war auf fünf alte Mönche zusammengeschrumpft. Diese Mönche befolgten brav ihre Regel, jeder für sich, und ließen es dabei bewenden. Zeitlebens zum Schweigen angehalten, hatten sie den Kontakt zueinander verloren. Dann zogen drei junge Männer aus einer modernen Gemeinschaft ein, nahmen das Heft in die Hand, und fünfzehn Jahre später war die Gemeinschaft auf neunzig Brüder angewachsen. Sie hatten das Chorgebet und die Liturgie neu gestaltet und in die alten Mauern ein solches Leben gebracht, dass junge Menschen dort ihre Ideale verwirklicht fanden. Bei meinem Besuch merkte ich ihnen die Freude an der eigenen Berufung an und die Befriedigung, die ihre Arbeit ihnen verschaffte. Vor allem aber: Man lebte nun nicht mehr aneinander vorbei. Man traf sich häufig und redete miteinander. Es war zu einem wirklichen inneren Kontakt gekommen. Ein sterbendes Kloster hatte sich in ein aufblühendes Kloster verwandelt, und mittlerweile ist von dort ein altes, romanisches Kloster wiederbesiedelt worden und sogar eine Neugründung in Norditalien ausgegangen.
In einem Fall wie diesem haben die alteingesessenen Mönche zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen mit, lassen sich anstecken und mitreißen. Oder sie bestreiten, dass es auch anders geht, ziehen sich beleidigt zurück und verschanzen sich hinter einer frommen Selbstgefälligkeit. Mir scheint, wir Deutschen haben uns bislang für die zweite Möglichkeit entschieden. Jeder weiß, dass es nicht mehr so weitergeht, doch jeder hofft, dass sich nichts ändern wird. Dramatische Staatsverschuldung? Zusammenbruch der Sozialsysteme? Kindermangel? Globalisierung? Ein Lösungsvorschlag nach dem anderen wird als unmoralisch und unzumutbar vom Tisch gefegt. Dabei hat das neue Leben in unserem eigenen Kloster, wenn ich so sagen darf, längst Einzug gehalten, und eine Katastrophe vermag ich darin nicht zu sehen. Vor Jahren beklagte sich ein Pater bei mir, sein Kloster sei auch nicht mehr das, in das er einmal eingetreten sei. «Sei froh», habe ich ihm geantwortet, «denn sonst wäre es ein Friedhof.»
Ob wir es wollen oder nicht – kaum etwas wird bleiben, wie es war. In absehbarer Zeit werden zwei Milliarden Menschen in Indien und China mit uns in derselben Liga spielen, als unsere Konkurrenten auf allen Märkten und Mitbewerber um ein schönes Leben. Zwei Milliarden Menschen – nicht ungebildeter als wir, beruflich nicht schlechter qualifiziert als wir, nicht phantasieloser als wir, aber hungrig auf Erfolg, strotzend vor Selbstbewusstsein und angestachelt von dem Ehrgeiz, es dem Rest der Welt zu zeigen. Das meiste von dem, was wir können, können inzwischen Hunderte von Millionen im ostasiatischen Raum auch. Wir sind nichts Besonderes mehr. Unser Vorsprung schmilzt dahin. Wir werden uns an den Gedanken gewöhnen müssen, ein Land unter vielen anderen zu sein. Deutsche Wertarbeit? Zeiss-Jena? Gut und schön. Aber die Chinesen produzieren mittlerweile Geräte von ähnlicher Qualität, nur viel billiger. Die technische Ausstattung für unser Krankenhaus in Nordkorea beispielsweise habe ich letztes Jahr in China gekauft, für ein Fünftel des deutschen Preises. Kein sozialistischer Schrott, wohlgemerkt, sondern beste, hochwertige Instrumente. In Container verstaut, überquerten sie zwei Wochen nach meiner Bestellung bereits den Grenzfluss zwischen China und Nordkorea. Bei einer deutschen Firma hätte allein die Lieferung schon drei Monate gedauert.
Und diese Entwicklung ist unausweichlich. Nicht aufzuhalten. Längst hat sie alle Lebensbereiche erfasst. Kein Ort auf dieser Welt, der nicht per E-Mail erreichbar wäre. Kein Bergdorf, das für den Coca-Cola-Transporter zu abgelegen wäre. Keine Wüste, die vor unserer Abenteuerlust noch sicher wäre. Globalisierung ist unser Urlaub auf den Malediven genauso wie die Erdgasleitung zwischen Sibirien und Sizilien oder spottbillige T-Shirts «made in China». Globalisierung ist aber auch das Abwandern von Industrien und Arbeitsplätzen nach Fernost, sind Arbeitslosigkeit und leere Kassen hier bei uns. Man mag das bedauerlich oder beängstigend finden. Man kann, wie die Globalisierungsgegner von Attac, das zerstörerische Walten eines entfesselten Neoliberalismus darin erkennen und unsere Errungenschaften dadurch bedroht sehen. Aber es hilft nichts. Revolutionäre Entwicklungen verlaufen unkontrolliert. Die Französische Revolution hat seinerzeit die Errungenschaften des Adels massiv gefährdet – danach war es nämlich mit dem schönen Leben auf illuminierten Schlössern für die meisten erst einmal vorbei. Heute begreifen wir die Französische Revolution als großen politischen Fortschritt, aber aus Sicht des französischen Adels war sie vermutlich eine neoliberale Barbarei.
Wer sich die Parteien und Gewerkschaften in Deutschland heute anschaut, könnte den Eindruck gewinnen, alle befänden sich in einem Abwehrkampf gegen das, was auf uns zukommt. Diesen Kampf haben wir schon verloren. Denn wenn alle alles gleich gut können, dann gewinnt am Ende der, der weniger Ansprüche stellt. Dem es nicht um sein Recht auf Seeigelkaviar geht, sondern um den Zugriff auf das Lebensnotwendige. Und wohl auch der, der wie die Chinesen eine Vision hat. Die chinesische Vision ist klar und überzeugend: Alles daransetzen, selbst zu Reichtum zu kommen, und nach anderthalb Jahrhunderten der Demütigungen und Schwäche den alten Glanz, die alte Größe Chinas als Reich der Mitte wiederherzustellen. Für die Chinesen ist das seit fünfundzwanzig Jahren Motivation genug, alljährlich ein Wirtschaftswachstum von rund neun Prozent hinzulegen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die chinesische Volkswirtschaft an der amerikanischen vorbeizieht – von zwanzig Jahren sprechen die einen, von vierzig Jahren andere. Doch lange vorher schon wird es mit unserer gemütlichen europäischen Welt vorbei sein.
Der Betreuungsstaat sozialdemokratischer Prägung ist bereits am Ende. Die Politik kann uns nicht mehr die Privilegien garantieren, die wir, verglichen mit dem Rest der Welt, bisher genossen haben. Und ich halte es nur für fair, den anderen die gleichen Chancen im weltweiten Wettbewerb einzuräumen wie uns selbst. Wenn wir vernünftig wären, sagt Lee Kuan Yu, der langjährige Regierungschef von Singapur, wenn uns unser Wohl tatsächlich am Herzen läge, dann würden wir die unumgänglichen Reformen so schnell wie möglich hinter uns bringen. Worauf warten wir also noch? Darauf, dass es wieder so schön wie früher wird? Dass wir aufwachen, und die Globalisierung war nur ein hässlicher Spuk? Dass die Welt sich doch noch unseren Wunschträumen fügt? Glauben wir immer noch, mit den alten Rezepten gegen die neue Wirklichkeit Recht behalten zu können?
In dreiundzwanzig Jahren als Erzabt von Sankt Ottilien und fünf Jahren als Abtprimas des Benediktinerordens habe ich die Erfahrung gemacht, dass man nicht auf bessere Zeiten oder günstigere Umstände warten darf. Ich habe erlebt, dass das Unvorstellbare in greifbare Nähe rückt, wenn man aus dem Bewusstsein seiner persönlichen Freiheit heraus ein Gefühl dafür entwickelt, wie weit die eigene Kraft reicht und was alles im Bereich des Möglichen liegt. Das klappt nie und nimmer? Das hat sowieso keinen Zweck? Das kann gar nicht funktionieren? Wenn ich damals auf die Schwarzseher gehört hätte, wäre ich niemals nach China gekommen…
02
EINE REISE IN DIE ZUKUNFT
«Reden willst du mit denen? Mit chinesischen Kommunisten?» – «Ich versuch’s. Ich will halt schauen, was sich machen lässt. Man kann’s doch versuchen, oder?» – «Mensch, Notker, die Chinesen lassen nicht mit sich reden.» – «Warum sollten sie das nicht?» – «Sinnlos. Zu früh. Die Zeit ist noch nicht reif. Lass die Finger davon, bis die Verhältnisse in China sich geändert haben. Irgendwann, früher oder später, werden sie sich für liberalere Ideen öffnen müssen…»
Niemand hielt es im Herbst 1984 für eine sonderlich gute Idee, nach China zu fahren. Die Diagnose stand wieder einmal fest: Aussichtslos – mit Chinesen kann man nicht verhandeln. Überall begegnete ich einem tief verwurzelten Glauben an den Fehlschlag, an die Macht der Verhältnisse und die eigene Hilflosigkeit. Der einzige Mensch von ungetrübtem Optimismus war Pater Sebastian. Der kam Ende des Jahres aus Südkorea (wo er einen Verlag leitete), sah mir in die Augen und sagte: «Du, Notker, hättest du nicht Lust, nach China zu fahren? Ich habe das Gefühl, wir sollten uns da mal umschauen.» – «Sebastian, was glaubst du, was ich seit Monaten mache?», sagte ich. «Ich rufe Reisebüros an, melde mich mit Anton Müller und erkundige mich, ob die Chinesen schon Privatreisen zulassen. Und gerade habe ich gehört, dass es jetzt möglich ist. Lass uns gleich nächstes Jahr hinfahren!»
Noch einer bestärkte mich – Franz Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident und Intimfeind der deutschen Linken, jüngst erst als guter Freund des chinesischen Volkes aus dem Reich der Mitte zurückgekehrt. In dem Empfehlungsschreiben, das er uns mit auf den Weg gab, hieß es: «Die beiden Bürger des Freistaates Bayern (es folgen unsere Namen) möchten China bereisen. Ich bitte, ihnen kompetente Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen…» Dass die chinesische Botschaft in Bonn mir kein Visum ausstellte, bekümmerte Pater Sebastian wenig. «Das besorgen wir uns in Hongkong», sagte er. «Und zwar innerhalb von vierundzwanzig Stunden. Ich weiß, wo.»
Anfang Mai 1985 saß ich also in einem Flugzeug nach Hongkong, wo wir uns treffen wollten. Was erwartete mich? Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur: Hoch oben, im Nordosten Chinas, lag unser altes Missionsgebiet, und fast an der Grenze zu Russland und Nordkorea musste es eine Stadt namens Yanji geben. Benediktinermönche aus Sankt Ottilien hatten 1920 dort zusammen mit anderen Ordensbrüdern eine Abtei gegründet. Als die Kommunisten 1946 in Yanji einmarschierten, war unser Kloster sofort geschlossen worden. Die koreanischstämmigen Mönche waren über die nahe Grenze in die Heimat ihrer Vorfahren geflohen, und von den deutschen Brüdern waren drei ermordet, alle anderen ins Gefängnis geworfen worden. Seit der Ausweisung der letzten Überlebenden 1952 hatten wir überhaupt keine Nachricht mehr aus Yanji. Diese Geschichte ließ mir seit langem keine Ruhe. Ich wollte unbedingt wissen, wie es dort heute ausschaut und ob man überhaupt noch auf Spuren unserer Tätigkeit treffen würde. Außerdem fühlte ich mich in der Pflicht – gegenüber den Gründern all dieser Schulen und Kirchen, aber auch gegenüber den Menschen, die damals Christen geworden waren. Es mochten ja etliche von ihnen noch leben. Ich hätte es verantwortungslos gefunden, sie ihrem Schicksal zu überlassen.
In Hongkong traf ich meinen Reisegefährten. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden erhielt ich ein Express-Visum. Zwei Tage später flogen wir nach Peking weiter.
Pater Sebastian war voller Tatendrang. Eine nostalgische Reise in die ruhmreiche Vergangenheit unseres Ordens war ihm zu wenig. Gleich jetzt, bei dieser Gelegenheit, sollten wir erste Beziehungen anknüpfen, sollten uns Vorschläge für eine künftige Zusammenarbeit überlegen und soziale Projekte in Aussicht stellen können, um das Eis zu brechen. Also den Faden, der vor vierzig Jahren abgerissen war, wieder aufnehmen. Und – uns so unauffällig wie möglich im Land bewegen. Keine Reservierungen! Andernfalls müssten wir damit rechnen, am nächsten Bahnhof, vor dem nächsten Hotel vom Geheimdienst in Empfang genommen zu werden.
Die Ankunft in Peking war ernüchternd. Fünf- bis sechsstöckige Wohnhäuser, Block an Block, graue Betonfassaden, so weit das Auge reichte, in den Straßen Schwärme von Fahrradfahrern und jeder im blauen Maokittel. Es war trostlos. Und noch auf dem Flughafen lernten wir, wie es Leuten ergeht, die nicht im Voraus gebucht haben. «Meiyou» war mein erstes chinesisches Wort. Meiyou – «Haben wir nicht». Im Informationsbüro auf dem Flughafen rief man zwar pflichtschuldig ein Hotel nach dem anderen an, aber die Antwort lautete in jedem Fall «meiyou». Unverrichteter Dinge zogen wir ab, nahmen uns ein Taxi und fuhren über eine Schotterstraße nach Peking hinein. Als wir uns dem ersten Hotel näherten, neigte die Fahrerin ihren Kopf gegen die zusammengelegten Hände und sah uns fragend an. Ob wir ein Bett für die Nacht suchen würden? Wir nickten. Sie winkte ab und wandte sich wieder der Straße zu. Wir ließen trotzdem vor dem Hotel halten und stiegen aus. An der Rezeption hieß es bloß kurz und trocken: «meiyou». Wo wir sonst übernachten könnten? Achselzucken. «Sie müssen sich beim Travel Service melden», sagte einer. – «Wie lange hat der auf?» – «Bis fünf.» Die große Uhr hinter seinem Rücken zeigte kurz vor sechs. Wollte er uns auf die bequeme Tour loswerden? Wir beschlossen zu bleiben.
Seit drei Stunden saßen wir auf unseren Koffern in der Hotelhalle, als jemand von der Rezeption zu uns herüberkam und uns erklärte, wir könnten jetzt in den Speisesaal. Pater Sebastian sah sich genauso außerstande wie ich, die Speisekarte zu entziffern, deshalb zeigten wir auf die Teller anderer Leute und warfen dem Kellner aufmunternde Blicke zu, bekamen aber irgendetwas anderes serviert. Wieder zu unseren Koffern zurückgekehrt, eröffnete uns der Rezeptionist, ab elf gebe es für uns zwei Betten in einem Schlafsaal. Ich erhob keine Einwände. Als Mönche hatten wir uns früh daran gewöhnt, in Sälen zu schlafen. Als Schüler in Sankt Ottilien hatte ich mir einen Schlafsaal mit neunundfünfzig anderen geteilt, und später, als Novize, waren wir im Schlafsaal zu zwanzig gewesen. Das Doppelzimmer, das uns kurz vor elf dann plötzlich angeboten wurde, war mir dennoch lieber. Ein Doppelzimmer war überhaupt die beste Lösung. So konnte keiner von uns beiden still und leise in irgendeiner Versenkung verschwinden. (Zwei Tage später trafen wir eine Dänin, die sich auskannte. Sie sagte: «Wissen Sie, wenn Sie lange genug warten, kriegen Sie in China immer ein Zimmer. Es gibt nämlich eine Anordnung, Ausländer nicht auf der Straße stehen zu lassen. Nur – wenn man nicht vorbestellt, gibt es eben so lange kein Zimmer, bis diese Regelung in Kraft tritt. Ist doch logisch.»)
Am nächsten Tag ließen wir einen Teil unseres Gepäcks in der deutschen Botschaft – was uns Vorteile beim «Nahkampf» um die Zugabteile verschaffen sollte–, vereinbarten mit dem Kulturattaché, nach uns Ausschau zu halten, sollten wir innerhalb von vierzehn Tagen nicht wieder zurücksein, und flogen nach Shenyang – wo wir, wie schon berichtet, auf dem Bahnhof einen halben Tag zwischen Hoffen und Bangen schwebten, bis wir die Fahrkarten für die Weiterfahrt nach Norden endlich in Händen hielten. Der Zug sollte erst spätabends gehen, vorher wollten wir uns den Kaiserpalast von Shenyang ansehen, und auf dem Weg dahin gesellte sich einer zu uns. Ein ungemein neugieriger Chinese. Gewiss nicht die Art von «kompetentem Gesprächspartner», an die Franz Josef Strauß gedacht hatte, dennoch jemand, an dem zumindest Pater Sebastian sein Vergnügen hatte. «Der Erzabt von Sankt Ottilien mit einem Informanten des chinesischen Geheimdienstes», murmelte er grinsend. «Das ist zu schön. Das muss ich fotografieren.» Dann sagte er laut auf Englisch: «Geht nur schon weiter. Mir ist der Schuh aufgegangen», bückte sich und machte ein Foto von uns beiden. Unser Begleiter versuchte noch eine Weile, hinter unsere Geheimnisse zu kommen, fand uns ausgesprochen fad und ließ schließlich von uns ab.
Wir hatten Erste-Klasse-Fahrkarten (wie sie für Ausländer obligatorisch waren), saßen im Erste-Klasse-Wartesaal und tranken gerade Tee, als der Zug einlief. Im nächsten Augenblick herrschte auf dem nächtlichen Bahnhof ein bedrohliches Getümmel. Offenbar gab es für diese Situation keine Regel, jedenfalls setzten die Chinesen, bis eben noch höflich und diszipliniert, jetzt alles ein, was irgendwie als Hieb- und Stichwaffe taugte. Knie und Ellbogen taten wertvolle Dienste, und wir sahen uns gezwungen, unseren Weg ins Abteil buchstäblich freizukämpfen. Mit feiner Zurückhaltung hätten wir nichts auszurichten vermocht. Anschließend genossen wir unseren Triumph auf langen, mit rotem Samt überzogenen und weißen Deckchen belegten Liegen – der Zug war ein russisches Fabrikat und die Einrichtung daher auf unsere Körpermaße zugeschnitten. So feudal war ich in deutschen Zügen noch nie gereist. Hin und wieder kam eine Dame herein und brachte uns Tee, und gegen Mitternacht kamen wir in Jilin an.
Keine halbe Stunde später wurden wir von drei jungen Polizisten in einem Mercedes-Kastenwagen aus den dreißiger Jahren zum Hotel gefahren. Die Bahnhofsvorsteherin von Jilin, eine mütterliche Person, hatte beide Ausländerherbergen des Ortes angerufen, war beide Male mit «meiyou» abgespeist worden, hatte beide Male zornig den Hörer auf die Gabel geknallt, war dann auf den düsteren Bahnhofsvorplatz gestürzt und hatte drei Polizisten hereingeschleift. In einem Tonfall, so gebieterisch wie ihre Gestik, hatte sie den dreien eingeschärft, diesen gestrandeten Ausländern ein Quartier zu beschaffen, komme, was da wolle, und so saßen wir jetzt im Fond eines Polizeiautos auf dunkelroten Samtpolstern und lachten in uns hinein – da leistete uns die örtliche Polizei Quartiermacherdienste, während uns die Geheimpolizei bereits auf ihrem Radarschirm hatte! Vor dem ersten Hotel stand ein grimmiger Wächter in einem Kirgisenpelz, der brauchte nur «meiyou» zu sagen, und wir setzten unsere Fahrt fort. Aber als sich dieses Spiel im zweiten Hotel wiederholte, wurden unsere drei Polizisten deutlich, und zehn Minuten später hatten wir ein wunderbares Doppelzimmer.
Hier in Jilin trafen wir die ersten Christen. Einen Priester, der in seiner kleinen, neugotischen Kirche gerade die Messe zelebrierte und uns hinterher die letzten Diözesanschwestern von Jilin vorstellte. Ich war erschüttert. Da kamen sieben alte Weiblein herein. Alle waren sie vermummt, trugen russische Hosen und Jacken und hatten die Köpfe umwickelt, trotzdem entdeckte ich in einigen Gesichtern Narben. Sie hatten wohl manche Folterung über sich ergehen lassen müssen und dennoch durchgehalten. Der Priester sprach leidlich gut französisch, aber ich gab mich nicht zu erkennen; ich wollte sie nicht in Gefahr bringen und verabschiedete mich, nachdem wir ein paar Höflichkeiten ausgetauscht hatten.
Noch waren wir nicht am Ziel. Am selben Abend eroberten wir uns ein Abteil im Nachtzug nach Yanji, der Hauptstadt der autonomen koreanischen Region, und für die nächsten Stunden fuhren wir durch die Dunkelheit, immer in östlicher Richtung, dem hintersten Winkel der Mandschurei entgegen. Im Speisewagen bot man uns eine Flasche vorzüglichen alten Portwein an – wohl über Macao ins Land gekommen–, unsere vergnügte Stimmung erfuhr eine weitere, unvorhergesehene Steigerung, und um fünf Uhr morgens hatten wir endlich die Stadt erreicht, in der unsere Ottilianer Benediktiner jahrzehntelang erfolgreich gewirkt hatten. Wir stiegen praktisch auf freiem Feld aus, denn der Bahnhof war unlängst abgerissen worden, fuhren mit dem Taxi zum einzigen Ausländerhotel – und wurden bereits erwartet. Der Hoteldirektor und der Polizeichef gaben sich ungeachtet der frühen Morgenstunde die Ehre. Was wir in diesem abgelegenen Teil Chinas eigentlich vorhätten? Herumzureisen, antwortete ich, nichts weiter. «Aber die Touristen fahren doch alle in den Süden!?» – «Ebendeshalb fahren wir in den Norden. Ich möchte einen Artikel über die Schönheiten des Nordens schreiben.» Wir beharrten darauf, normale Touristen zu sein. Das Palaver zog sich noch eine Weile hin, dann gab der Polizeichef auf und überließ uns einem Führer, der uns auf all unseren Wegen in Yanji begleiten sollte. Für die Dauer unseres Aufenthalts mussten wir zudem ein Taxi anmieten.
Doch nach dem Frühstück war von Taxifahren keine Rede mehr. «Heute müssen wir zu Fuß gehen», eröffnete uns unser Führer. «Die Taxis von Yanji sind alle ausgebucht.» – «Wir Deutschen marschieren gern», entgegnete Pater Sebastian, und wir liefen los. Das Katz-und-Maus-Spiel konnte beginnen.
03
DAS 29.KAPITEL DER APOSTELGESCHICHTE
Alles bisher war Vorgeplänkel gewesen. Jetzt wurde es ernst. Pater Sebastian hatte nämlich in Seoul eine rätselhafte Botschaft erhalten: Wenn ihr in Yanji seid, geht im Krankenhaus auf die neunte Station, alles Weitere wird sich ergeben. Mithin mussten wir als Nächstes versuchen, uns unbemerkt Zutritt zum Krankenhaus von Yanji zu verschaffen.
Einstweilen waren wir allerdings in der Obhut unseres Führers. Während des Vormittags konnten wir uns nicht selbständig machen, erhaschten aber bei unserer Stadtbesichtigung einen Blick auf dieses Krankenhaus. Und dann erlebten wir eine aufregende Stunde. Wir kamen zur Musik- und Tanzschule von Yanji, offenbar eine der Sehenswürdigkeiten – und standen vor unserem ehemaligen Schwesternkloster! Wenig später tauchte das Militärhauptquartier vor uns auf, und ich erkannte augenblicklich unsere alte Abtei und die Kirche! Unser Führer, von koreanischer Abstammung wie die meisten in Yanji, war so diskret, nicht nach dem Grund für unsere offenkundige Begeisterung zu fragen. Er wollte auch nicht wissen, woher Pater Sebastian fließend Koreanisch konnte. Wir luden ihn zu einem guten Mittagessen ein, verabschiedeten uns dann von ihm zu einer ausgiebigen Siesta, betraten unser Hotel durch die Vordertür, verließen es gleich wieder durch die Hintertür und machten uns auf den Weg zum Krankenhaus.
Wir tauchten im Menschengewimmel eines Marktes unter und erreichten unbehelligt unser Ziel. Beim flüchtigen Blick zurück durch die gläserne Eingangstür fielen uns zwei Gestalten am Rande des Marktes auf, die sich suchend in alle Richtungen umschauten; sie machten einen nervösen Eindruck. Wir liefen weiter, über Gänge und Treppen, fragten uns zur neunten Station durch und traten ein. Sogleich wurde eine der Ärztinnen dort auf uns aufmerksam. Sie schaute uns mit zur Seite gelegtem Kopf an, zog dann wortlos ihren weißen Kittel aus und winkte uns, ihr zu folgen. Ich habe nie herausgefunden, wer diese Frau war. Ich habe sie später nie mehr gesehen. Durch einen Seitenausgang traten wir auf die Straße und gingen so unauffällig wie möglich hinter ihr her, bis wir nach etwa zwanzig Minuten zu einem Häuserblock kamen, wo sie in einen Innenhof einbog. Im nächsten Moment standen wir vor einer Tür. Wir sahen sie an, sie nickte, und wir klopften. Schlurfende Schritte waren zu vernehmen, und eine alte, bucklige Frau öffnete. Sofort erfasste sie die Situation, trat zur Seite und ließ uns ein. Im selben Moment war unsere Führerin verschwunden.
Da standen wir, und die alte Frau begann mit brüchiger Stimme zu erzählen. Uns wurde klar, dass wir uns an dem Ort befanden, wo sich seit dreißig Jahren die Christen von Yanji versammelten. Ihr Name sei Domitilla, sagte sie, und ich musste an jene Christin im alten Rom denken, nach der eine Katakombe benannt worden war. Jetzt, so erfuhren wir, gebe es nur noch vier kleine Gemeinden in dieser Gegend, zwei davon auf dem Land. Vier Gemeinden und ein Pfarrer, zusammen nicht mehr als 200Menschen – dieses Häuflein war von den einstmals 30000Christen in Yanji also übrig geblieben. Noch während wir Domitillas Bericht lauschten, trafen immer mehr von diesen Standhaften ein – offenbar sprach sich unsere Ankunft wie ein Lauffeuer herum, und bald wurde es eng in Domitillas kleiner Wohnung. Alle waren gerührt, Pater Sebastian und ich nicht weniger als die anderen, und viele hatten Tränen in den Augen. Diese chinesischen Christen zerflossen beinahe vor Freude darüber, dass wir sie nicht vergessen hatten, und wir waren tief berührt davon, wie unerschütterlich sie zusammengehalten hatten. Unsere als sinn- und zwecklos beargwöhnte Reise hatte sich bereits gelohnt, selbst wenn es uns diesmal noch nicht vergönnt wäre, neue Projekte in Angriff zu nehmen.
Nachts gegen elf wurden wir von einem Militärbus abgeholt. Am Steuer saß Domitillas Adoptivsohn, der gerade seinen Militärdienst leistete und uns partout mit einem Omnibus der chinesischen Armee zurückbringen wollte! Nicht genug damit, drehte er vor unserem Hotel erst einmal laut hupend ein paar Runden, bevor er uns absetzte. Mir blieb fast das Herz stehen. Aber der junge Mann meinte, es sollten nur alle wissen, dass wir des Christenhäufchens wegen nach Yanji gekommen seien – er musste seiner Freude einfach Luft machen. Von unseren Aufpassern war gottlob nichts zu sehen. Vielleicht besprachen sie gerade ihren Misserfolg.
Am anderen Morgen erzählte mir Pater Sebastian, Ordensschwestern in Südkorea hätten ihm Medikamente für eine Mitschwester übergeben, die beim Einmarsch der Kommunisten seinerzeit nicht geflüchtet war und noch leben müsse, und zwar unter den Christen draußen auf dem Land. Das Problem sei nur, dass das Umland von Yanji nach wie vor für Ausländer gesperrt sei. Fünf Minuten später trat unser Führer ein und erklärte, in der Stadt selbst gebe es nicht mehr viel zu sehen, aber außerhalb der Stadt sei ein Bauernmuseum zu besichtigen, das er uns gern zeigen würde. Ich traute meinen Ohren nicht. «Ich bin ein Fachmann für Bauernmuseen», erklärte ich. «Ich kann es kaum erwarten, dieses Museum zu besuchen.»
Wir bestiegen ein Taxi – heute waren sie also nicht alle ausgebucht–, fuhren aufs Land und näherten uns bald einer kleinen Stadt. Da geschah etwas Merkwürdiges. Auf einer Brücke am Ortsrand hatten sich Männer versammelt; sie winkten aufgeregt und riefen uns etwas zu, und als wir herankamen, verstand Pater Sebastian ihre Rufe: «Herr Pater! Herr Pater!» Wir schauten uns an. Das mussten die Christen sein, die wir suchten. Aber woher konnten sie wissen, dass wir kamen? «Es gibt viele Geheimnisse in China, aber es bleibt nichts geheim», meinte Pater Sebastian schmunzelnd (und brachte damit auf den Punkt, was für mich die Quintessenz meiner chinesischen Erfahrungen ist). Im Augenblick blieb uns allerdings nichts anderes übrig, als unsere Fahrt fortzusetzen. So winkten wir nur zurück.
Ich hatte nicht übertrieben, ich bin tatsächlich Experte in Bauernmuseen. In Sankt Ottilien haben wir nämlich ein Missionsmuseum mit einer Asienabteilung, und als Schüler hatte ich sonntags oft Besucher durchgeführt. Ich kannte mich mit Epochen und Stilen aus, nahm jetzt einen Topf nach dem anderen in die Hand, begutachtete jeden fachmännisch, sagte anerkennend: «Ganz erstaunlich. Dieser hier muss mindestens zweihundert Jahre alt sein. Der dort drüben scheint etwas jüngeren Datums zu sein», und alle waren tief beeindruckt. So weit, so gut. Jetzt mussten wir nur noch unseren Führer abschütteln. Während des Mittagessens entschloss sich Pater Sebastian, in die Offensive zu gehen. «Es soll hier eine Kirche geben», sagte er beiläufig zu ihm. «Es wäre schön, wenn wir die noch besichtigen könnten. Fahren Sie nur schon mit dem Taxi zurück, wir nehmen dann später den Bus.» Und der Mann willigte ein! Möglich, dass ihn das gute Essen, die gute Stimmung, der reibungslose Verlauf in einen Zustand der Seligkeit versetzt hatten und er jetzt jeden Missklang vermeiden wollte, jedenfalls fuhr unser Führer ohne uns zurück.
Alle hatten sich in der Kirche versammelt. Es war noch die alte Kirche, heruntergekommen und baufällig, aber gut genug für ein gemeinsames Gebet nach langer Zeit. Es war ergreifend für alle. Auch die koreanische Schwester tauchte auf, eine hagere, alte Frau mit dem milden Gesichtsausdruck eines Menschen, der sein Leben lang in aller Bescheidenheit Gutes getan und manches durchlitten hat. Sie hatte seinerzeit die chinesische Staatsbürgerschaft angenommen und durfte später ganz offiziell ein Nonnenkloster gründen und Novizinnen aufnehmen.