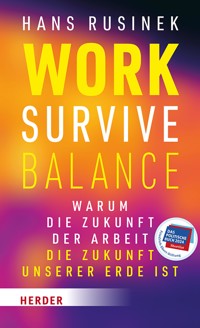
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es wird viel geredet über die Zukunft der Arbeit: Das Büro wird zur Lounge, die Firma zur Familie und die Kollegen treffe ich nun auch im Metaverse. Wenn das die Lösungen für eine bessere Zukunft sein sollen, dann möchte ich mein Problem zurück. Denn das wahre Problem ist doch, dass wir durch unsere Art zu wirtschaften den Planeten so abgearbeitet haben, dass er vor Überarbeitung unser Überleben in Frage stellt. Die Umweltkrise ist eine Krise unserer Tätigkeiten. Wie kann also sinnvolles Arbeiten im Anthropozän aussehen? Für diese Frage bringt der Arbeitsforscher Hans Rusinek die Zukunft der Arbeit und die Zukunft des Planeten radikal zusammen. Und dekliniert einmal durch, welche Denk- und Handelsbarrieren wir für eine enkeltaugliche Arbeitswelt überwinden müssen: etwa im Umgang mit Zeit, im Beachten unserer und anderer Körper oder im Entdecken künstlicher Intelligenz. Denn noch können wir unsere Zukunft selbst gestalten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Rusinek
Work-Survive-Balance
Warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © Cultura RF / Joseph Giacomin / GettyImages
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft SRL, Timișoara
ISBN Print: 978-3-451-39965-7
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-82889-8
Für Marie Yael
und ihr Jahrhundert
Inhalt
Willkommen im Anti-Anti-Arbeits-Club!
Die Veränderungsdimensionen
1 Die Zukunft des PlanetenVor allem unser Problem
2 Die Zukunft der ArbeitWenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück
3 Praxistheorie für PraxiswandelEin kleiner Theorieteil, aber eigentlich geht’s um Schokoriegel
Die Herausforderung
1 HaltungVom Kreislauf der Konsumproduktion zu enkeltauglichen Unternehmungen
2 OrganisationsverständnisVon der isolierten Profitmaximierung zum eingebetteten Wertstiften
3 AnerkennungVon der Arroganz der Wissensarbeit zum Respekt für jede Arbeit
4 Intelligenz(en) Vom Denkverbot in der Arbeit zum Zusammenspiel von KI, MI und ÖI
5 SinnVom Egotrip der Selbstverwirklichung zum wahren Sinn der Arbeit
6 ZusammenhaltVon falschen Generationenkonflikten zum intergenerativen Zusammenarbeiten
7 ZeitVom Hamsterrad des Hetzens zum zeitgemäßen Arbeiten
8 SichtbarkeitVon unsichtbarer Arbeit zur Wahrnehmung, was den Laden am Laufen hält
9 KörperVon der Entkörperlichung zum Spüren von Verantwortung
Die letzten Seiten, die ersten Schritte
Manifest der enkeltauglichen Arbeit
Danke an ...
Anmerkungen
Abbildungsnachweis
Wenn du weiterlesen möchtest
Über den Autor
Willkommen im Anti-Anti-Arbeits-Club!
„Irgendwie sind wir in der einzig möglichen Welt gelandet, in der es eine Apokalypse gibt, wir aber trotzdem zur Arbeit gehen müssen.“
Tom Cashman1
Arbeit, wir müssen reden. Du hast heute einen schlechten Ruf: Wir träumen von einer Frührente durch plötzlichen Bitcoin-Reichtum, kämpfen bedingungslos für ein bedingungsloses Grundeinkommen und üben uns im Quiet Quitting, wo wir nur noch die absoluten Minimalanforderungen erfüllen und auf keinen Fall mehr Mühe, Interesse oder Begeisterung in die Arbeit stecken als unbedingt nötig.
Diese Abkehrbewegungen haben ihre Gründe. Ein Steuersystem, das Einkommen aus Arbeit wesentlich höher besteuert als Einkommen aus Erbe oder Aktien, die Vermutung, dass uns Automatisierung die Arbeit bald abnehmen könnte, und die demografische Aussicht, dass uns ohnehin die Arbeiterinnen ausgehen könnten, all das führt zu einer Neubewertung der Arbeit. Ob sie sich lohnt. Ob man sie braucht. Ob’s noch jemanden gibt, der sie macht. Im Modus des Arbeitsbashings wurden ganze Regalwände armeverschränkender Bücher geschrieben, Überschriften à la „Arbeit nervt“ garantieren großartige Klickzahlen. Arbeitsbashing ist ein Alleabholer – so einleuchtend, aber doch auch so banal wie die meisten Wahlplakate. Und in seiner Totalablehnung doch auch so weltfremd: Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, mussten die meisten von uns, ja eben doch noch zur Arbeit gehen.
Die Abkehrbewegungen bringen uns nicht weiter. Wenn wir das Projekt Arbeit aufgeben, wenden wir uns von all dem ab, was es leisten kann – und in Zukunft noch stärker leisten sollte: all das, was uns in der Klimakrise auch gemeinsam ins Handeln bringen könnte.
Es ist Arbeit, verstanden im Sinne der Praxistheorie als jede Form von produktivem Tätigsein ( Theorie), die uns das Gefühl existenzieller Verbundenheit geben kann. Wir alle suchen eine Bestätigung dafür, dass unser Dasein nicht an der Welt vorübergeht, dass wir auf andere wirken – ein Bedürfnis, das bereits im Schreien eines Babys seinen Ausdruck findet. Für Erwachsene sind es der Arbeitsplatz (idealerweise mit weniger Geschrei), der zeigt, dass wir wirksam sind, und der Gehaltszettel, der zeigt, dass diese Wirksamkeit Anerkennung erfährt. Auf der Arbeit werden wir zu denkenden, planenden und – wichtig! – hoffenden Wesen, wie der Soziologe Hartmut Rosa schreibt.2 Der erste Beruf kann prägender als das erste Kind sein.3 Der Verlust eines Arbeitsplatzes ist deshalb nicht nur eine ökonomische Katastrophe, sondern auch eine existenzielle. Für Rosa eine Menschenrechts- und sogar Körperverletzung.
Gerade in Zeiten solch großen Wandels ist das Resonanzgefühl, das sich einstellt, wenn ich in meiner Arbeit die Zukunft mitgestalten kann, wichtiger denn je: Jeder Heizungsinstallateur, der eigenhändig eine Wärmepumpe verbaut, kann sich abends schlafen legen in der Gewissheit, die Energiewende ein kleines Stück vorangebracht zu haben.4 Und wird deshalb dranbleiben. Denen, die aber vom individuellen Glück ohne Arbeit träumen, kann man nur alles Gute wünschen. Denn keine Arbeit wird eben auch keine Lösung sein.
Auch für uns als Kollektiv ist Arbeit ein – wenn nicht der! – zentrale Wirkungsraum: Wir lernen, auch mit Menschen klarzukommen, mit denen wir nicht unsere Freizeit verbringen würden. Mit diesen unfreiwilligen Schicksalsgenossen lernen wir, Beiträge zu leisten, die um ein Vielfaches das in den Schatten stellen, was uns allein gelingen würde. Dann lernen wir dort auch – weil wir mit manchen doch gut klarkommen – mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Partner fürs Leben kennen. In der Arbeit lernt eine Gesellschaft laufen: Ein Nebenprodukt von Arbeitsbeziehungen sind arbeitende Beziehungen. Hier besorgt sich eine Gesellschaft, was sie zum gemeinsamen Überleben braucht. Damit hält dieser Lern- und Mach-Ort uns zusammen und verspricht jeder, die mitmachen möchte, soziale Integration und Aufstieg – zumindest idealerweise. Genau deswegen ist der erste Job ja so prägend – hier lade ich die gesellschaftliche Software herunter, die Dos und Don’ts, mit denen ich mich dann „professionell“ nennen kann und die mir – idealerweise! – das Eintrittsticket zum Mitgestalten geben. Durch das Einüben dieser Arbeitspraktiken halten wir sie in Betrieb und machen somit Zukunft.
Die schlechte Nachricht ist, dass dies in vielen Fällen eine Zukunft ist, mit der wir unsere Lebensgrundlage immer mehr in Gefahr bringen, weil wir planetare, aber auch psychische und physische Ressourcen über alle Grenzen hinweg abarbeiten: Unsere derzeitigen Dos und Don’ts sind nicht gerade auf Regeneration, Maßhalten oder Verantwortung programmiert. In die Zukunft geblickt sind unsere Praktiken deshalb nicht enkeltauglich, weil wir kommenden Generationen damit keine Zukunft lassen: Die Arbeit wird ihrem Ideal also nicht gerecht. Wir müssen sie deshalb jetzt nicht nur als Raum zum Lernen, sondern vor allem zum Umlernen begreifen. Dass sich die Arbeitswelt bald ändern wird, geben die planetaren Grenzen vor, wie dies geschieht, ist noch offen: by Design or by Desaster?
Work-Life-Balance, dieser Begriff hat mich schon immer irritiert. Er hindert uns daran, uns Arbeit als einen lohnenden und sinnvollen Teil des Lebens vorstellen zu können und Arbeit in vielerlei Hinsicht auch persönlich zu nehmen. Etwa wenn uns politische, ökologische oder moralische Zweifel aufkommen.
Ich glaube aber auch, dass an der Sehnsucht nach Balance etwas dran ist und wir diesen Begriff neu besetzen müssen. Mir geht es um die Frage: Wie lässt sich denn eine Balance in der Arbeit selbst finden? Eine Balance zwischen einem Abarbeiten von all dem, was dort für normal gehalten wird, und einem Entwickeln von Arbeitsweisen, die wir für normativ besser halten. Eine Balance aus Ökonomie und Ökologie im Sinne der regenerativen Arbeit. Eine Balance aus Work und Survive eben. Denn es wird schwer, nach Feierabend ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören.5
In diesem Buch werden Klimakrise und Arbeitswelt deshalb konsequent zusammengeführt. Unsere Verhaltensweisen im Angesicht der Klimakrise umzuschreiben – gemeinschaftlich, erfahrbar und nicht traumatisierend –, das geht nur in der Arbeit. Eine Abkehr von der Arbeit wäre eine Abkehr von der Hoffnung, dass gemeinsame Anstrengungen die Menschen vereinen und ihre Lage verbessern können – uns bliebe nur totalitäre Macht durch Zwang. Kein Zufall vermutlich, dass zeitgleich zur Abkehr von der Arbeit auch die Sehnsucht nach einem alles regelnden Staat immer größer wird.
Wir brauchen die Arbeit eben noch. Eine besser funktionierende Arbeitswelt, mit all ihren integrativen, sinngebenden und praktikanleitenden Eigenschaften, ist die zentrale Voraussetzung für ein demokratisches Bewältigen der Klimakrise – und das zentrale Thema dieses Buches. Dass sich die Arbeitwelt dafür ändern muss, ist klar – dass wir sie brauchen, aber eben auch. Willkommen also im Anti-Anti-Arbeits-Club!
Was dich in diesem Buch erwartet
Vor einem kurzen inhaltlichen Überblick an dieser Stelle ein ausnahmsweise sehr lifehackiger Tipp, von dem ich wünschte, ich hätte ihn früher gekannt: Sachbücher muss man nicht von Deckel zu Deckel lesen – vor allem nicht in einem Durchgang. Macht auch keiner. Das Buch lässt sich an jedem Kapitel, an jeder Veränderungsdimension öffnen – deshalb die Querverweise. Es ist ein Büffet und kein Zwölf-Gänge-Menü. Und nun guten Appetit!
Die Zukunft des Planeten – schwierig. Vor allem für uns. Als das Containerschiff „Ever Given“ im März 2021 im Suezkanal stecken blieb, verursachte es nicht nur einen geschätzten Transportausfall von über 50 Milliarden Dollar. Ein Schiff, das sich mit zu viel Ladung und zu viel Geschwindigkeit in der engen Umwelt verkeilte – und auch noch „Ever Given“ heißt! –, lieferte obendrein eine perfekte Illustration für unser entgrenztes Arbeiten im Anthropozän.6 Das Anthropozän ist die Epoche, in der unser Handeln einen unumkehrbaren Einfluss auf unsere Erdsysteme gewonnen hat, in der wir von mittelgroßen, allesfressenden Primaten zu einer prägenden Kraft auf diesem Planeten wurden.7 Von Primaten unterscheidet uns auch das Büro. Von den meisten jedenfalls. Im ersten Kapitel ( Planet) geht es darum, dass die Krise des Planeten und die Krise der Arbeit entscheidend zusammenhängen. Sie sind das „Was“ und das „Wie“ zu einer besseren Zukunft.
Im zweiten Kapitel ( Arbeit) schauen wir uns an, wie heute über die Zukunft der Arbeit gedacht wird. Wir unterscheiden vier Typen. Die verlassen sich in ihrem oberflächlichen Zukunftsbrimborium wahlweise auf beschleunigte Innovationsproduktion im Sinne des Design Thinking, auf die Kommunikation grandioser Ziele im Sinne eines Davos-Kapitalismus, auf die sektenhafte Entgrenzung von Arbeit als einziges Sinnzentrum und auf eine digitale Weltflucht, fern von den planetaren Folgen unseres Tuns. Das ist in seiner Konsequenz alles ziemlich Old Work. Diese Arten, Zukunft zu gestalten, bleiben innerhalb der zerstörerischen Logiken der Klimakrise und verkürzen damit unsere Zukunft. Immer wieder das Gleiche zu tun und davon ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist eine landläufige Definition von Wahnsinn. Was diese Typen vereint und was wir durch eine smarte Theory of Change überwinden müssen, sind drei Missverständnisse, wie (und von wem!) Zukunft gemacht wird.
Deshalb wird es, bevor wir zu den Veränderungsmaßnahmen kommen, im dritten Kapitel ( Theorie) – Alarm! Alarm! – ein wenig theoretisch. Was braucht echter Wandel in der Arbeitswelt? Und vor allem: Was mache ich gegen meine Sucht nach KnoppersRiegeln? Eine Theory of Change muss her! Wir lernen von der Praxistheorie, dass wir in weiten Teilen unsichtbaren Programmen folgen und unser normales Verhalten nicht bewusst reflektieren – solange es zu keinen Irritationen im Ablauf kommt. Unsere Fähigkeiten (Skillset), der Raum und die Dinge um uns (Toolset) und die sozialen Einstellungen (Mindset) sorgen dafür, dass wir auf Autopilot durch unsere (Arbeits-)Welt wandeln. Das ist praktisch, weil wir schnell ins Arbeiten kommen und nicht jeden Ablauf von Neuem ausdiskutieren müssen wie in einer richtig anstrengenden Wohngemeinschaft. Gefährlich wird es, wenn uns diese Programme zombiehaft in den Abgrund ziehen. So drohen wir uns selbst und den Planeten komplett abzuarbeiten, ohne es rechtzeitig zu merken. Die Praxistheorie zeigt aber auch, was es braucht, um vom unreflektierten Verhalten zum bewussten Handeln zu kommen, wie uns ein Umlernen gelingt. Wir erfahren von den ersten Menschen, die im Mittelalter nicht mehr in ihr Haus urinierten, von einer weltverändernden Fotografie aus den 1960ern und wie man Kollegen dazu bringen kann, mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Nichts ist eben so praktisch wie eine gute Theorie! Die Praxistheorie führt uns zum Working-Planet-Modell und zu den Veränderungsdimensionen, Dimensionen unseres Handelns und Denkens, die sich verändern können und müssen, an denen sich der Praxiswandel orientieren muss.
Haltung: In der ersten Veränderungsdimension trinken wir einen Kaffee mit einer arbeitsamen Hannah Arendt. Wir reden über das Grundprinzip unseres Wirtschaftens, darüber, was wir eigentlich als unsere Um-Welt begreifen, ob wir diese nicht besser Mit-Welt nennen sollten, und mit welcher Haltung wir diese Welt bearbeiten: produzierend, konsumierend oder wirklich handelnd?
Organisationsverständnis: In der zweiten Veränderungsdimension stellen wir uns in Manier der Feuerzangenbowle die Frage: „Wat is ’ne Firma eijentlich?“ Es geht um naive Organisationen, die von der Gegenwart des Anthropozäns überrollt wurden, und darum, wie heute eine postnaive Firma aussehen kann. Es geht um Studien zur fatalen Wirkung der heutigen Managementausbildung. Beweise, die jedem Ökonomen – auch mir – die Schamesröte ins Gesicht treiben. Es geht darum, wie wir uns einen besseren Begriff von Wirtschaft in komplexen Systemen machen.
Zeit: In der dritten Veränderungsdimension geht es um den Rhythmus unserer Arbeitswelt. Einer Welt, in der es wahrscheinlicher ist, am Wochenende eine E-Mail zu schreiben, als wochentags ins Kino zu gehen. Einer Welt, wo die Burnout-Raten durch die Decke gehen. Es ist diese unerbittliche Gehetztheit, die den Abbau unserer eigenen Ressourcen mit dem Abbau unserer ökologischen Ressourcen verbindet. Alles, was lebt, ob Managerin oder Mangoplantage, braucht auch Regeneration, ein Auf und Ab statt eines Always-on. Wir lernen, warum Verantwortung für uns und andere eine zeitintensive Praktik ist und warum wir nach dem Mittagessen keinen Kaffee trinken sollten.
Anerkennung: In der vierten Veränderungsdimension geht es um den Begriff der Wissensarbeit, der eigentlich eine Frechheit ist. Ist der Pfleger, der die Bedürfnisse seiner Patientinnen oft weiß, bevor diese von ihnen überhaupt artikuliert werden, denn kein Wissensarbeiter? Eine arrogante Arbeitsgesellschaft, die nur abstrakte Intelligenz belohnt und nicht etwa Empathie oder Fleiß, bringt unsere Gesellschaft aus dem Gleichgewicht und entfremdet Millionen. Wir müssen verstehen, dass Solidarität zwischen Arbeitswelten die Voraussetzung für gemeinsame Verbesserungen ist. Es stellt sich am Ende heraus, dass es in vielen Bereichen die „Wissensarbeiter“ sind, die sich aufschlauen müssen.
Sichtbarkeit: In der fünften Dimension fragen wir uns, warum E-Mail-Tippen und PowerPoint-Präsentationen-Basteln Arbeit genannt wird, aber ein Baby zu wickeln, Angehörige zu pflegen oder Umweltaktivistin zu sein, nicht als Arbeit gelten darf. Wir lauschen der berühmten Anthropologin Margaret Mead und stellen fest, dass die gemeinsame Fürsorge, die Care-Arbeit, das Fundament unseres Wirtschaftens ist. Eine Fürsorge, die sich im Anthropozän auf den Planeten ausweiten muss. Solange unser Arbeitsbegriff diese Tätigkeiten ausgrenzt, grenzt er auch die Möglichkeit eines enkeltauglichen Wirtschaftens aus.
Sinn: In der sechsten Dimension geht es um eine Frage, die parallel zur Klimakrise aufgekommen ist – „Warum mache ich das hier eigentlich?“ Motiviert uns diese Frage, oder ist sie zu einem Sinndruck geworden? Wir begegnen drei Sinnsuchenden aus der Geschichte, die heutige Fragen nach Purpose und Selbstverwirklichung geprägt haben: den Hippies, den Romantikern des Sturm und Drangs und den protestantischen Kaufleuten. Dank ihnen verehren wir heute rücksichtslose Genies, gehen für die „Selbstverwirklichung“ (schon mal jemanden gesehen, der sein „Selbst“ „verwirklicht“ hat?) über unsere Grenzen und gönnen uns keine anderen Sinnquellen jenseits des Jobs. Alles gar nicht mal so sinnvoll. Wir schauen uns an, warum diese Selbstsuche auch umweltschädlich ist und wie wir zu einer Resonanz kommen, die kein Egotrip ist, sondern das schützenswerte Verbindende spürbar macht. Macht Sinn, oder?
Zusammenhalt: In der siebten Dimension geht es um das älteste Vorurteil der Welt. Darum, dass die „junge Generation nicht richtig arbeiten will“, was schon vor 2500 Jahren gesagt wurde und Hesiod sozusagen zum Säulenheiligen aller Boomer macht. Es geht um die lähmende Spaltung, in die Unternehmen aufgrund von Generationenkonflikten geraten sind. Wir erfahren, wie wir stattdessen intergenerative Allianzen schmieden. In dem Maße, wie wir über Generationen hinweg zusammenarbeiten können, werden wir im Sinne zukünftiger Generationen arbeiten.
Intelligenz(en): In der achten Dimension geht es um die Revolution der künstlichen Intelligenz (KI) und ihre Auswirkungen auf die Arbeit. Wir besuchen drei Innovationslabore aus drei Jahrhunderten und lernen, dass Automatisierung schon immer Gestaltungsaufgabe war. Nie nur Schicksal, oft sogar Befreiung. Wir verstehen, dass wir mit KI eine andere, uns heute vielleicht ebenso fremd gewordene Intelligenz wiederentdecken: die MI, die menschliche Intelligenz mit ihren einzigartigen Fähigkeiten zur Reflexion, Emotionalität und Verantwortungsübernahme. Wie revolutionär wäre das eigentlich, wenn diese MI eines Tages auf unsere Arbeitswelt losgelassen würde? Und wären wir dann bereit für das Wahrnehmen einer ÖI, die Intelligenzform des ökologischen Lebens?
Körper: Am Schluss, in der neunten Dimension, steht das, was am Ende immer bleibt, wenn alle Lichter aus und die Show vorbei ist. Wir besinnen uns darauf, dass wir Körper sind und dass Spüren-Können die Voraussetzung für Verantwortung ist. Wir schauen einer Londonerin bei ihrer harten, lauten, besonderen Arbeit zu – wir lassen uns davon etwas neidisch machen. Wir blicken in die Forschung zu Embodied Cognition und stellen fest, dass bessere Arbeit nicht Kopfsache ist, sondern eben Körpersache.
Work-Survive-Balance: Die Arbeitswelt als gesellschaftliches Reallabor
Work-Survive-Balance heißt: Wer von der Zukunft der Arbeit spricht, darf von der des Planeten nicht mehr schweigen. Konsequent Arbeitswelt und Klimakrise zusammenzuführen, heißt aber nicht, in eine banale, hyperindividualistische „Mindset is Everything“-Litanei zu verfallen – dafür bitte zu irgendwelchen dubiosen Mindsetcoaches umschalten! Es heißt, dass es sich lohnt, sich selbst an die Arbeit zu machen und neue Praktiken einzuüben, die die Basis von großen Strukturen und damit auch die Basis von ihrer Veränderung sind. Das wiederum soll nicht von der Verantwortung von Staaten und Konzernen ablenken, im Gegenteil: Das kritische Hinterfragen dieser Institutionen ( Sinn), das Ziehen von Grenzen gegenüber ihnen ( Sichtbarkeit) und das Einfordern von einer erneuerten Legitimität ( Organisationsverständnis) sind auch neu einzuübende Praktiken.
Wir sollten uns selbst an die Arbeit machen, weil dies dann auch etwas mit uns macht: Ins Handeln zu kommen, sich als Akteurin im Hinblick auf globale Herausforderungen zu begreifen, ist der Anfang einer teilhabenden Weltbeziehung, eines Ausbruchs aus dem „Ich mach hier nur meinen Job“ und des „Was kann ich denn ausrichten?“, der anstiftend ist und der Arbeit neue Würde gibt. Every Job is a Climate Job.
Veränderung ist die einzige Konstante in der Geschichte der Arbeit.8 In der Antike galt sie als minderwertige Tätigkeit, die den Charakter verdirbt – man konnte sie nur negativ definieren, als Neg-Otium (Nicht-Muße). Zu der Zeit hatte die Elite eben Sklaven dafür – abscheulich, aber für den Umgang mit der KI tatsächlich lehrreich. Durch das Christentum wurde Arbeit zur göttlichen Strafe als Teil der Vertreibung aus dem Paradies (dieser verdammte Apfel!). Das Leiden an möglichst harter Tätigkeit wurde zum Gottes-Dienst und bei den Benediktinern gar auf eine Ebene mit dem Gebet gestellt: Ora et labora. Die Renaissance gab uns das Gefühl, bei mancher Tätigkeit einen göttlichen Funken zu entfachen. Die Industrialisierung bescherte uns die Gefühlsinnovation „Entfremdung“. Zuletzt wurde Arbeit zum Synonym für Leistung, zur alleinigen Quelle von Anerkennung. Auf einmal war es die Muße, die wir negativ definieren: als Frei-Zeit oder Urlaub (aus dem Mittelhochdeutschen von „Erlaubnis“). Und nun, da wir der planetaren Folgen dieser Arbeit gewahr werden, entsteht die Chance für einen neuen Bedeutungswandel: Vielleicht ist die Zukunft der Arbeit ja Arbeit an der Zukunft?
Meine Motivation zu dieser Arbeit
Es ist der Blick auf die Zukunft, der mich motiviert, diesen Bedeutungswandel mit einem Buch zu unterstützen. Zu Beginn des Schreibprozesses kam mein erstes Kind zur Welt, der Zukunftsblick hat eine existenzielle Note bekommen. Vielleicht lebt, vielleicht arbeitet meine Tochter gar bis ins 22. Jahrhundert?
Es ist der Blick auf Herausforderungen planetaren Ausmaßes, für die es frische Perspektiven und Mut braucht – und gerade deshalb auch Kinder von Menschen, die diesen Blick vermitteln wollen –, und letztendlich auch der Blick auf eine Arbeitswelt, der das Zukunftsgaga der New-Work-Diskurse nicht helfen wird. Auch hier wird sich das Klima ändern müssen.
Ich blicke aber auch zurück. Auf Arbeit, die mich geprägt hat. Der Zivildienst im jüdischen Altenheim in Tel Aviv, wo Arbeit hart, aber über jede Sinnfrage erhaben war. Die Beratung von Konzernen, die durch Arbeit reicher wurden als manche Länder. Die sich immer mehr spalten in jene, die die Zeichen der Zeit verstanden haben, und jene, die sich an der Vergangenheit festkrallen. Die zahlreichen Transformationsprojekte, in denen ich unzählige Menschen und ihre Beziehung zur Arbeit kennenlernte: von der Arbeit Entfremdete, von der Arbeit Begeisterte. Menschen, für die in der Arbeit immer „mehr gehen muss“, und Menschen, die vor allem darauf warten, dass sie gehen dürfen. Menschen, die an der Spitze langer Befehlsketten stehen, und Menschen, die all diese Anforderungen und manchmal auch sich selbst abarbeiten müssen. Und dann gibt es die Arbeit in der Forschung, wo ich so unterschiedliche Arbeits-Denker wie David Graeber und Lawrence Summers kennenlernen durfte. Wo wertvolle Erkenntnisse für bessere Arbeit gewonnen werden, die nie die Welt der Praxis erreichen – vielleicht schafft dieses Buch ja eine kleine Brücke.
Die Geschichte der Arbeit ist faszinierend, weil es unsere Geschichte ist. Wir sollten sie deshalb bewusst und gemeinsam in die Zukunft weiterschreiben. Das kann dieses Buch allein niemals leisten. Es ist deshalb kein paternalistischer Ratgeber geworden und auch keine verschriftlichte Glaskugel, die die Zukunft vorwegnimmt. Weder bin ich jemand, der für jede Arbeitssituation besser Bescheid weiß als die Person, die die Arbeit macht, noch verfüge ich über die Möglichkeit, Zeitreisen zu unternehmen – für so was bitte selbsterklärten Gurus auf LinkedIn folgen.
Was dieses Buch aber kann, ist, in jeder Veränderungsdimension bestehende Praktiken zu hinterfragen, so dass jeder und jede selbst weiterdenken und sich an eine bessere Zukunft machen kann. Zwischen dem Pessimismus, dass wir uns von Arbeit abwenden müssen, und dem Optimismus, dass Arbeit einfach nur so weitergehen kann wie bisher (nur noch etwas schneller und schriller), möchte ich das etablieren, was wir praktischen Pragmatismus nennen können: 9Wo Pessimisten und Optimistinnen eigentlich schon zu wissen meinen, wie die Zukunft wird – nämlich jeweils furchtbar oder vom Feinsten –, sind praktische Pragmatisten gestaltend und teilnehmend. Sie gehen davon aus, dass Zukunft kein Selbstläufer ist, sondern etwas, das sich durch unser Eingreifen verändern lässt, aber auf dieses Eingreifen auch angewiesen ist.
In diesem Sinne, an die Arbeit!
Die Herausforderung
1 Die Zukunft des Planeten
Vor allem unser Problem
„Die eigentliche Misere der Menschheit ist folgende:
Wir haben paläolithische Emotionen, mittelalterliche Institutionen und gottähnliche Technologie.“
E. O. Wilson1
Francisco de Goya, Kämpfe mit Knüppeln, ca. 1820/1823
Im Raum 67 des Prado-Museums in Madrid hängt ein eher unscheinbares Bild. Knüppelkampf heißt es. Gemalt wurde es von Francisco de Goya um das Jahr 1820. Dieses Werk ist eines seiner Schwarzen Gemälde – befremdliche Bilder, die der im Alter ziemlich in sich gekehrte und ertaubte Star der spanischen Malerei direkt an die Innenwand seiner Villa, der Quinta del Sordo (das Haus des Tauben), pinselte. Was all diese Schwarzen Gemälde gemeinsam haben, ist, dass in ihnen Goyas düstere Sicht auf die Menschheit zum Ausdruck kommt.
Warum hat diese obskure Zeichnung so viele Denker fasziniert, die sich mit der Zukunft unserer Gattung auf diesem Planeten beschäftigen, vom Philosophen Michel Serres über den Molekularbiologen und Historiker Hans-Jörg Rheinberger bis zur Anthropozänforscherin Eva Horn?
Auf dem Bild im Raum 67 geht es um eine ganz spezielle Angst. Wir sehen zunächst zwei Männer, die sich mit schwingenden Knüppeln bekämpfen – erst auf den zweiten Blick merken wir, dass ihre Beine dabei unsichtbar sind. Goya lenkt unsere Aufmerksamkeit zunächst auf den Kampf zwischen den beiden, darauf, dass die eine Person gerade ordentlich von links ausholt, während die andere eine saftige Rechte auf den Gegner steuert. Doch „das eigentliche Drama“, wie Eva Horn schreibt, spielt sich gar nicht zwischen den beiden ab.2 Das eigentliche Drama ist zu erkennen, wenn man einen Schritt vom Bild zurücktritt: Es spielt sich nämlich unter ihnen ab, und bald schon um sie herum. Die beiden verbissenen Kämpfer stehen knietief im Treibsand: „Bei jeder Bewegung saugt ein zähflüssiger Strudel sie weiter ein, so dass sie einander nach und nach selbst begraben“, so Michel Serres dazu.3 Genau wie die beiden Kämpfer bemerken auch wir, wenn wir das Bild nur oberflächlich betrachten, das eigentliche Drama viel zu spät.
Wenn wir uns nun unserer Welt und der Arbeit in ihr zuwenden, stellen wir fest: Ähnlich wie die beiden Knüppelschwinger interessieren wir uns oft allein für die Konflikte zwischen Organisationen und Individuen. Die Knüppel heißen etwa Aktienrendite, Drittmitteleinwerbung, Bonuszahlung oder Marktanteile. Wie die beiden Kämpfer übersehen auch wir die eigentlichen Grundbedingungen all dieser Schwingerei. Den gemeinsamen Boden, auf dem die ganzen Händel veranstaltet werden. Dieser kommt durch unsere Scharmützel in Bewegung und gerät ins Strudeln. Was uns als bloße Bühne erschien, wird zum dritten Akteur.4 Die Natur wird gerade im Anthropozän durch unsere Handlungen zur gefährlichen Mit- oder Gegenspielerin – und ihr Knüppel ist gewaltig.
Wer länger vor de Goyas Gemälde steht und in der Darstellung ein Symbol unserer Zeit erkennt, begreift: Die Frage nach einem zukunftsfähigen Wirtschaften, die viel beschworene Zukunft der Arbeit, muss sich auf die Frage nach den Bedingungen des Arbeitens auf dieser Erde beziehen. Auf die Frage nach der Zukunft des Planeten. Wer aber mit der „Zukunft der Arbeit“ nur den Knüppelkampf selbst meint, der verpasst es, die Frage nach unserer Zukunft auf diesem Planeten zu stellen, und beantwortet sie trotzdem. Und zwar verneinend.5 Ein im Sande versinkender Narr, wer die Arbeit und den Planeten nicht zusammendenkt. Ein Genie ist de Goya, dass er dieses Werk geschaffen hat, die treffende Darstellung für die Tragik unseres Arbeitens im Anthropozän, für unser Knüppelschwingen im Treibsand. Übrigens war Goya mit seinen Schwarzen Gemälden der erste westliche Künstler, der seine eigenen Ideen, Visionen, Träume und Albträume und nicht nur die äußere Realität malte – wir begegnen anderen im Kapitel über künstliche Intelligenz. Goya war so „der erste Modernist“, wie der Kunstkritiker Robert Hughes ihn nannte.6 Und was macht diese erste moderne Kunst? Sie lässt unseren Blick auf die Krise des Anthropozäns wenden.
2022 klebten sich Klima-Aktivisten an die Rahmen der De-Goya-Bilder ein paar Gänge weiter im Raum 38. Eines davon, das Aktbild der Nackten Maja, ist aus der Zeit, wo de Goyas Blick anscheinend noch andere Suchbewegungen unternahm. Eine verpasste Klebechance, wie ich finde.
Die Metakrise des Anthropozäns – Arbeit, die sich sehen lässt
Die Erde ist sehr groß. Würde man sie auf ihre acht Milliarden Bewohner aufteilen, bekäme jeder fast eine Billion Tonnen.7 Jeder Mensch acht Chinesische Mauern. Kaum vorstellbar, dass ein so schweres Ding von einer Säugetierspezies so grundlegend verändert wurde. Kaum vorstellbar, dass deren Handeln das gesamte Erdsystem prägt und viele nun von einer neuen erdgeschichtlichen Epoche sprechen. Dem Anthropozän. Kaum vorstellbar, wenn man bedenkt, dass diese Primatengruppe erst seit einem winzigen Bruchteil der gesamten Erdexistenz auf ihrer Oberfläche herumarbeitet.8 Das ist doch mal Arbeit, die sich sehen lassen kann.
Wenn wir vom Anthropozän sprechen, dem Neuen (altgriechisch kainos), das der Mensch (anthropos) hervorgebracht hat, dann meinen wir, dass der Mensch einen nicht umkehrbaren Einfluss auf das Erdsystem hat, welches sich deshalb neu justieren muss. Wir sprechen also von einer Metakrise, deren Folgen wir seit Jahrzehnten durchleben, auf die wir aber in der Unzahl an verschiedenen Krisendiagnosen nie einen klaren Blick gewinnen konnten. Einer Metakrise, die in der Geologie und im Erdsystem klar und zusammenhängend hervortritt.
Wie bei dem Bild von de Goya müssen wir erst einen Schritt zurücktreten, um dies zu erkennen. Dann stellen wir fest, dass es unserer Gattung gelungen ist, ebendiese rasante „Entwicklung von mittelgroßen, allesfressenden Primaten zu einer prägenden Kraft für die physikalischen und biogeochemischen Prozesse auf diesem Planeten“ zu durchlaufen, die Eva Horn meint.9 Dann stellen wir fest, dass all diese Knüppelei eben auch unsere Lebensgrundlagen verändert hat. Dafür gibt es unzählige Tatorte, wie Horn ausführt, „vom globalen Klimawandel und seinen Folgen über die Veränderung der ozeanischen und atmosphärischen Strömungssysteme, die Versiegelung von Böden und die Störung der Wasserzyklen, das rasante Schwinden der Artenvielfalt, die Anreicherung von Luft, Böden und Gewässern mit toxischen und nicht-abbaubaren Substanzen, die Störung wichtiger Stoffkreisläufe (wie Phosphor und Stickstoffkreislauf) bis zu einer rasant wachsenden Zahl von Menschen und Schlachtvieh“.10 All dies betrifft den unsichtbaren dritten Akteur im Gemälde von de Goya, die Grundlage, die unter unserem Handeln nachgibt.
Als Erdsystem bezeichnet man das Zusammenspiel verschiedener Sphären auf dem Planeten: Gase der Atmosphäre, Gesteine und Sedimente der Lithosphäre, Gewässer, Eisschichten und Meere der Hydrosphäre und die lebendigen Organismen der Biosphäre. Hinzu kommt nun noch die vom Menschen, also aus der Biosphäre, geschaffene Technosphäre, bestehend aus all seinen hergestellten Dingen. Diese Sphären befinden sich in Wechselwirkungs- und Rückkopplungsprozessen, was dazu führt, dass die Erde in ein dynamisches Gleichgewicht gebracht wurde – und sich dort ein bisschen wie ein planetarisches Thermostat ausgleichend hält.11 Diese fließende Dynamik führt zu Artenvielfalt, biologischer Evolution und veränderten Klimabedingungen, die in einem selbstregulierenden Zusammenhang stehen: Die Gase in der Atmosphäre bestimmen die Oberflächentemperatur, diese verändert zum Beispiel die Form auf der Erde lebender Organismen, und diese wirken durch Abgabe von Gasen über Atmung und Verwesung wieder auf die Atmosphäre zurück. Entscheidend ist hier, dass soziale Prozesse des Menschen nun einen Maßstab erreicht haben, dass diese ebenfalls Einfluss auf geophysikalische, geochemische und biologische Prozesse nehmen, dass also unser Handeln auf Erdsystemebene einen für uns gefährlichen Unterschied macht. Das zeigt sich beispielsweise folgendermaßen:
Biosphäre: Die Populationen wild lebender Fische, Vögel, Reptilien und Säugetiere sind in den letzten fünfzig Jahren im Durchschnitt um 69 Prozent geschrumpft.
12
Wild lebende Tiere machen nur noch drei Prozent der Biomasse von terrestrischen Wirbeltieren aus, der Rest sind Menschen (30 Prozent) und ihre Arbeits- und Nutztiere (67 Prozent).
13
Biosphäre und Technosphäre: Seit 1910 hat sich die Masse aller von uns produzierten Dinge (Technosphäre) alle zwanzig Jahre verdoppelt. 1910 entsprach sie drei Prozent aller lebenden Organismen (Biosphäre). Seit 2020 gibt es mehr Technosphäre als Biosphäre.
14
Lithosphäre: Weltweit wird durch menschliche Arbeit mehr Erde, Sand und Stein bewegt als durch natürliche Prozesse.
15
Hydrosphäre und Atmosphäre: Seit der industriellen Revolution hat sich der CO
2
-Gehalt der Atmosphäre um 44 Prozent erhöht, was das Klima erwärmt, das Meerwasser saurer macht und die Lebensbedingungen aller Organismen massiv verändert.
16
Die Erdsystemforschung weist darauf hin, dass wir also in einer fatalen Ganzheit stehen, die uns selbst nicht bewusst ist. Dass wir Teil eines Erdsystems sind, mag nicht überraschen, und dennoch findet es sich in unserem Arbeits- und Wirtschaftsverständnis nicht wieder, weil Natur und Kultur, Planet und Arbeit stets vollkommen getrennt betrachtet werden ( Organisationsverständnis).
Wenn wir vom Anthropozän sprechen, meinen wir aber nicht nur diese fatalen Dynamiken auf der Erdsystemebene, sondern auch den wissenschaftlichen Versuch während des Anthropozäns nachzuweisen, dass wir uns damit bereits in die Signatur der Erde eingeschrieben haben – wir eben prägender und unwiderruflicher Namensgeber einer neuen Erdepoche sind.
Die Mittagspause des Reginald Claude Sprigg
Die Epochen der Erde werden durch ihren Beginn definiert: Um eine Erdepoche einwandfrei bestimmen zu können, braucht die Geowissenschaft einen GSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point). Das ist die nachweisbare Datierung, etwa in einem Gestein, die den Eintritt in ein neues Erdzeitalter markiert. Es geht hier stets um die Untergrenze eines bestimmten Vorkommens, etwa den Fund des entwicklungsgeschichtlich ältesten Plaktons, oder den Nachweis des ersten Auftretens einer Sauerstoff-Isotopenstufe. Bis sich die Forschungs-Community auf einen GSSP geeinigt hat, vergehen in der Regel Jahrzehnte – Geologen denken eben von Beruf aus in anderen Zeitspannen. Ist diese Einigung erzielt, wird an dem Fundort, wo der Nachweis erbracht wurde, eine goldene Plakette angebracht. Diese Plakette heißt „Golden Spike“, weshalb auch GSSPs oft so genannt werden. Und es gibt tatsächlich Fans, die zu Golden Spikes in abgelegenen Kraterlandschaften pilgern, wie andere zu Hard Rock Cafes, den höchsten Bergen der Alpen oder zu Wallfahrtsorten. Jeder Nerd ist anders.
Für unser gegenwärtiges Anthropozän ist es nicht ganz einfach, einen klaren „Golden Spike“ auszumachen, denn bisher wurden Erdzeitalter ja erst im Nachhinein definiert, nicht in ihrer eigenen Gegenwart. Und im Nachhinein heißt hier meist: Hunderte Millionen Jahre später. Der einzigartige Versuch im Anthropozän ist eine Definition aus der Epoche selbst heraus.
Wie sich solch ein Golden Spike finden lässt, kann der Geologe Reginald Claude Sprigg zeigen, ein abenteuerlicher Australier in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Er war etwa der Erste, der es wagte, Gesteinsformationen auch unter Wasser zu erkunden. Dafür stieg er in einen umgebauten Boiler, der bis heute am Hafen von Adelaide steht und bei mir beim Ansehen bereits tiefste Beklemmungen ausgelöst hat. Unsere Sprigg-Geschichte beginnt aber damit, dass der heroische Reginald in den 1940er Jahren vom südaustralischen Bergbauamt beauftragt wurde, stillgelegte Minen zu untersuchen. Er sollte schauen, ob diese wieder profitabel gemacht werden können. Profitabel zum Beispiel als Abbaustätten von Uran, das für das Manhattan-Projekt, den Bau der ersten Atombombe, benötigt wurde – eine Ironie der Geschichte, die Sprigg in eine überraschende Verbindung mit dem Anthropozän bringt, wie wir gleich sehen werden. Für diesen Auftrag machte sich Sprigg auf den Weg zu den Ediacara-Hügeln im staubtrockenen Südaustralien, um dort in stillgelegte Kupfer- und Silberminen aus dem 19. Jahrhundert zu steigen. Diesmal nicht unter Wasser, sondern unter die knochentrockene Wüste. Was für ein Job!
Sein Fund allerdings, der Geschichte schreiben sollte und Sprigg einen Golden Spike eintrug, begegnete ihm direkt auf der Oberfläche. In seiner Lunchpause. Dort saß er, am Fuße der mächtigen Hügelkette, und ließ ganz gedankenverloren und Sandwich kauend seinen Blick schweifen, bis dieser plötzlich ins Stocken kam. Er blickte auf einen merkwürdigen Stein, oder besser: einen Stein mit merkwürdigen Abdrücken. Quallenartige Fossilien, wie er blitzschnell begriff. Ein gelangweilter Blick, der sein Leben veränderte – und ein weiterer Beleg dafür, wie wertvoll Momente der Regeneration bei der Arbeit sind ( Zeit). Denn auf dem Stein, den er später auf ein Alter von 560 Millionen Jahre datieren konnte, hätte es nach der damals herrschenden Lehrmeinung gar keine Fossilien von dieser Komplexität geben dürfen. Seine Entdeckung bildete die Untergrenze einer neuen Epoche. Seine Lunchpause führte zum Jahrhundertfund.
In einer beinahe klassischen „Dynamik“ wissenschaftlicher Communities wurde Spriggs Fund zunächst nicht beachtet, seine Papers wurden abgelehnt, bei seiner Präsentation auf dem Internationalen Geologenkongress 1948 im fernen London wurde ihm einfach nicht geglaubt.
Denn Spriggs Mittagspausenfund passte nicht zu der damals gängigen Überzeugung, dass Leben von einer solchen Komplexität erst im Kambrium, also erst 15 Millionen Jahre später, möglich war: Alle hingen der These der Kambrischen Explosion an, dem Big Bang der Biologie, der eben erst in der späteren Epoche des Kambriums geschehen sei. Die Geologen in Spriggs Zeiten gingen also den bequemen Weg: Sie sagten, Sprigg habe sich vermessen oder sei ein Schwindler.
Erst 2004, zehn Jahre nach Spriggs Tod, kam der Paradigmenwechsel. Seine Erkenntnisse wurden angenommen, ein neues Erdzeitalter wurde eingetragen, und an dem Ort von Spriggs’ Mittagspause hängt nun eine Golden-Spike-Plakette: Sie zeigt den ersten Fundort für eine Epoche, die nun Ediacarium heißt, benannt eben nach den Ediacara-Bergen, durch die Reginald Claude Sprigg stapfte. Die beiden in der Mittagspause entdeckten Fossiliengattungen tragen zu Ehren ihres Entdeckers die würdevoll-knuffigen Namen Spriggia und Spriggina. Reginald Claude Sprigg starb aber trotz dieser Ehre, die er ja nicht mehr erleben durfte, als anerkannter und sehr reicher Mann. Nichts hatte das mit dem Golden Spike zu tun (selbst die Plakette ist eigentlich aus Bronze), sondern mit seinen zahlreichen anderen Abenteuern, in denen er neben der eigentlichen Auftragserfüllung stets auch Ölvorkommen entdeckte – man würde das heute einen „Side Hustle“ nennen ( Sichtbarkeit).
Diese verdammten 50er Jahre: Von nun an ging’s bergab
Was wäre nun unser eindeutig und für immer auf dem Planeten nachweisbarer „Golden Spike“ für das Anthropozän? Was wären unsere Spriggia- und Spriggina-Fossilien, mit denen wir uns als geologische Kraft in die Erde einschreiben? Die Mitglieder der einflussreichen Anthropocene Working Group (AWG) schlagen für den Moment, an dem der Mensch erdzeitalterprägende Kräfte entwickelte, eine ganze Reihe Golden Spikes vor.17 Ein Kandidat befindet sich sogar in der deutschen Hauptstadt.
All die vorgeschlagenen Orte haben gemeinsam, dass sich im Gestein angelagerte Sedimente mit menschengemachten Feststoffen wie Metalllegierungen oder Glas finden, ferner Flugasche, die durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe entsteht und sich ebenfalls in Sedimenten einlagert – die Schmauchspuren verbrannter Fossilien schaffen die Fossilien von morgen! Die ersten dieser Ablagerungen werden auf die 1950er Jahre datiert.
Das aus naturwissenschaftlicher Sicht vielleicht stärkste Argument für einen Startpunkt unserer Epoche des Anthropozäns ist eine Isotopenanomalie, die sich ebenfalls seit den 1950ern messen lässt. Es handelt sich um radioaktive Isotope, die durch Atombombentests, für die ja auch Reginald Sprigg auf Forschungsreise gegangen ist, in die Erdkruste eingelagert worden sind. Diese Art von Einlagerung findet bis heute kein Ende. Ein Tatort sind Korallenriffe vor den Philippinen: Dort sind nicht nur die ersten Spuren der großen Atombombentests nachweisbar, sondern auch von Tschernobyl sowie merkwürdigerweise seit 1996 auch radioaktive Ablagerungen aus dem Südchinesischen Meer.18
Neben solchen Spuren finden wir auch Plastik in allen Formen und Farben. Es ist in Fluss- und Meeresströmungen außerordentlich mobil und langlebig.19 Den ersten Fund von Mikroplastik haben Forscher in Kanalsedimenten in Tokio ausgemacht. Auf welches Datum datiert das Team diesen Fund? Richtig, auf die 1950er Jahre! Heute finden wir Mikroplastik weltweit, sogar in Plankton, Fischen sowie im Blut von lebenden Menschen. 2023 haben Forscher entdeckt, dass sich auf dem „großen pazifischen Müllteppich“, der doppelt so groß ist wie New York City und zwischen Kalifornien und Hawaii schwimmt, mittlerweile Küstenorganismen fortpflanzen und überleben können – fernab von jeglicher Küste.20
Vielleicht hast du an einem geologischen Kandidatenort für eine Golden-Spike-Plakette schon einmal einen sonnigen Tag verbracht? Es ist der Berliner Teufelsberg.21 Der während des Zweiten Weltkriegs innerhalb des Stadtgebiets angefallene Schutt wurde dort zu Hügeln aufgeschüttet. Der Teufelsberg besteht aus einer Schicht aus Beton, Ziegeln, Klinker, Flugasche, Schlacke und festen chemischen Abfällen, die bis zu 80 Meter dick ist und eine Fläche von 1,1 Millionen Quadratmeter hat – von der aus heute viele Menschen die Aussicht auf die Stadt genießen. Auch der Teufelsberg bildet eine deutliche zeitliche Untergrenze für menschliche Spuren im Gestein, befand die Anthropocene Working Group nach einer Exkursion.22 Und seit wann sollen diese Spuren zu sehen sein? Wieder seit den 1950er Jahren! Weil diese Materialeinschlüsse mit anderen Ablagerungen weltweit in Zusammenhang gebracht werden, so dass dieser Berg eben kein Einzelfall, sondern exemplarisch ist, ist er ein Spike-Kandidat. Dass sich das Zumüllen der Erde durch den Menschen gerade in Berlin besonders einwandfrei nachweisen lässt, überrascht mich übrigens kein bisschen …
Am 11. Juli 2023 hat sich die Anthropocene Working Group dann auf einen Ort geeinigt. Es ist der Crawford-See in der Nähe der Metropole Toronto, an dessen vom nuklearen Fallout veränderten Sedimenten sich die Signatur des Menschen am klarsten nachweisen lässt. Und natürlich zeigt der Crawford-See diese Spuren seit 1950. Auch wenn die Vorgeschichte des Anthropozäns eine lange ist, mit den 1950ern hat diese Epoche ihren geologischen Startpunkt. „Von nun an ging’s bergab“, singt Hildegard Knef wenig später auf den Bühnen der jungen Bundesrepublik – war die Hilde eigentlich Erdsystemforscherin? Bemerkenswerterweise sind die 1950er Jahre auch das Geburtsjahrzehnt all der Menschen, die derzeit ihren Machtzenit in der Arbeitswelt erreicht haben. Dieses für unsere Zukunft immer noch so folgenreiche Jahrzehnt wird uns deshalb noch mal begegnen: zum Beispiel in den Kapiteln zu Haltung und Generationenkonflikten.
Jenseits der geologischen Fachdebatten offenbart dieser Nachweis des Anthropozäns nämlich eine tiefe Wahrheit: Unsere Arbeit hat planetare Folgen, die für Zeiträume spürbar sind, die unser Denken in historischen Epochen um ein Vielfaches überschattet. Wir sind mit unserer Arbeit verantwortlich für biologische, chemische und physikalische Veränderungen, die bis dato nur die Kräfte der Natur ins Spiel bringen konnten – wir haben die Macht von Göttern, aber nicht unbedingt das entsprechende Verhalten.
Der dümmstmögliche aller Dinos
An dieser Stelle ein kurzes Wort zu einem typischen Argument: Natürlich haben sich Erdepochen schon immer abgelöst. Natürlich hat sich in dem zugrunde liegenden Ausgleichsspiel der Erdsysteme auch das Klima immer schon verändert. Doch es ist falsch, wenn nicht gar dumm oder interessengeleitet, dies als Ausrede fürs Nichthandeln zu benutzen à la „Klimawandel war schon immer da“. Zwar stimmt es, dass Natur der Wandel selbst ist und dass mancher Ökokitsch einer unberührten, stabilen Natur diese Einsicht stets verfehlt hat. Doch wenn für die Natur dieser Wandel okay ist, sie gewissermaßen der Wandel ist, ist er es für uns als einzelne Spezies noch lange nicht. Wir drohen also zum Dino zu werden und obendrein noch zum dümmstmöglichen Dino, weil wir unsere Gefährdung aktiv verhindern könnten. Ja, Klimawandel hat es immer gegeben, aber Triceratops, Stegosaurus (mein Lieblingsdino) und Ichthyosaurus gibt es eben nicht mehr. Genauso drohen sich Erdgeschichte und Menschheitsgeschichte voneinander zu trennen. „Wir kippen das Klima in die Zeit vor rund drei Millionen Jahren“, so Frank Böttcher, Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, „den Homo sapiens gibt es aber erst seit rund 250.000 Jahren. Wir überspringen also die Menschheitsgeschichte.“23 Auch wenn ich als Kind ein Riesenfan war: Wir sollten keine Dinos werden!
Die Große Beschleunigung – Arbeit im Mittelpunkt des Anthropozäns
Um diese Spaltung von Erd- und Menschheitsgeschichte zu vermeiden, muss unsere Geschichte anders weitergeschrieben werden: Welches Handeln sollten wir genau ändern, und woher kommt es? Was genau an unserem Handeln ist denn das Problem? Dafür tauchen wir einmal kurz und mutig in ein paar Datensets ein und schauen uns die Auswirkungen dieser ominösen 1950er Jahre mal auf quantitativer Basis an. Und bemerken eine rasante Beschleunigung zahlreicher scheinbar zusammenhangsloser Variablen! Diese Datensets lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Die erste Gruppe bildet soziale Prozesse ab – Menschheitsgeschichte also – wie den internationalen Tourismus, Papierproduktion oder die Anzahl von Staudämmen. Eine zweite Gruppe betrifft natürliche Prozesse des Erdsystems (oder besser: des restlichen Erdsystems, wir sind ja ein Teil von ihm), wie Methanvorkommen, Übersäuerung der Ozeane oder Verlust des Tropenwalds – die Erdgeschichte.
All diese Trends weisen in eine Richtung. Viele dieser Trends haben gewiss ihre Vorläufer, aber bei den meisten sind es die 1950er, an denen sich die Entwicklung radikal verschärft hat – und es oft sogar bis heute tut. Was wir hier sehen, dieser Knick nach oben auf so vielen Ebenen, wird von Umwelthistorikerinnen die Große Beschleunigung genannt.24 Wenn das Anthropozän die Epoche benennt, dann ist die auf diesen Kurven zu erkennende Große Beschleunigung ihre Initialzündung, manche nennen es auch die erste Ära des Anthropozäns. Ganz entscheidend ist hier, dass diese Kurven nicht einzelne politische Reformen oder technologische Erfindungen wiedergeben, also gezieltes Handeln. Sie zeigen eher die Summe unserer willkürlichen, oft zusammenhangslosen Praktiken, also das Verhalten, das wir in der Großen Beschleunigung so an den Tag legen: wie oft wir in den Urlaub fliegen oder zu sinnlosen Meetings, wie sehr wir in Arbeitsmetropolen ziehen, weil uns nur dort der Erfolg zu locken scheint, wie viel Energie wir bei all dieser Busyness verbrauchen, wofür es neue Staudämme braucht. Legen wir diese beiden Sets an Kurven nebeneinander, so sehen wir den Aufstieg unserer Ökonomien in direkter Verbindung mit der Missachtung der Ökologien: Ja, wir zerstören den Planeten, aber die Sektkorken, die knallen!
Die Große Beschleunigung seit den 1950er Jahren
Das bisschen Ökonomenehre in mir gebietet es darauf hinzuweisen, dass es noch eine andere Gruppe an Kurven gibt, die man dazulegen könnte und die ebenfalls massiv anstiegen: Sie zeigen die Entwicklung der Menschenrechte seit den 1950er Jahren.25 Sie zeigen, wie sehr dieser Sektrausch Menschen aus extremer Armut befreit hat: 1950 waren es 70 Prozent der Menschen weltweit, heute weniger als zehn Prozent. Sie zeigen, wie sehr dieser Rausch Demokratien nach vorne brachte: 1950 wurden bereits 30 Prozent der Menschen demokratisch regiert (1940 waren es nur zehn Prozent), und heute sind es mehr als 50 Prozent, Tendenz aber rückläufig. Oder sie zeigen, wie viele Menschen heute lesen können: 1950 waren dies etwa 35 Prozent der Weltbevölkerung, und jetzt sind es 85 Prozent. All das darf nicht verschwiegen werden. Aber dass dieser Siegeszug der menschlichen Entwicklung eben auch seit den 1950ern einen gigantischen Aufschwung nahm, entschärft nicht das bedrohliche Szenario des Anthropozäns. Ganz im Gegenteil: Es zeigt auf tragische Weise, wie „das Haus der modernen Freiheiten auf einem immer größeren tönernen Sockel aus fossilen Brennstoffen gebaut ist“. So bringt es der indische Historiker Dipesh Chakrabarty auf den Punkt.26 Oder anders gesagt: Wir haben uns sozioökonomisch in eine gigantische Beschleunigung hineingearbeitet, damit haben wir uns einiges an Menschenrechten erarbeitet, nur leider auch den Planeten ökologisch abgearbeitet.
Einlenken gern, aber bitte ohne Einlenken!
Es ist eine Jahrhundertaufgabe, uns aus dieser Verzwickung zu befreien, ohne dass Produktivitätseinbußen unser Wirtschafts- und Sozialsystem zusammenbrechen lassen. Das Runterkommen von diesem Rausch kann schnell in eine Katerstimmung kippen. Denn natürlich werden wir nicht mehr alles rausholen können, wenn wir nicht mehr alles (aus der Erde) herausholen – eine banale Tautologie. Nicht banal genug jedoch, um ein Umdenken anzustoßen: Wie kommen wir von quantitativem Wachstum zu qualitativem Wachstum? Von einem Mehr zu einem wirklich Besseren? Besser für uns, für den Planeten, für unsere Enkel. Dass viele über ein Einlenken im Hinblick auf die Klimakrise nur unter der Prämisse sprechen, dass eigentlich alles so bleiben soll, wie es ist, sehen wir gleich bei der Auseinandersetzung mit der Zukunft der Arbeit ( Arbeit). Einlenken gern, aber bitte ohne Einlenken! Einlenken heißt dann leider sein Gegenteil: auf der Überholspur des explosiven Wachstums geradeaus weiterheizen.
Die Unfähigkeit, überhaupt nur ein Einlenken zu diskutieren, zeigt, dass unsere Gesellschaften sich derzeit nur durch Steigerung halten können. Der Soziologe Hartmut Rosa nennt dies eine „dynamische Stabilisierung“.27 Wir können uns das vorstellen wie eine E-Scooterfahrt. Gehen wir vom Gas, kippen wir um und sehen noch lächerlicher aus, als wir es auf dem Gefährt ohnehin schon tun. Dass wir als Kollektiv ein permanentes Wachstum brauchen, um uns zu stabilisieren, das macht auch was mit uns persönlich. Es zwingt uns nach Rosa in ein mehrfaches Aggressionsverhältnis:28 gegen die Natur, aus der man immer mehr „herausholen“ muss ( Haltung); gegen andere, die immer mehr zu Konkurrenten werden ( Anerkennung); aber auch gegenüber uns, weil wir im wahrsten Sinne des Wortes an uns selbst Raubbau betreiben ( Körper). Diese Dreieraggression ist die Formel zum „Erfolg“ in dieser Arbeitswelt. „Wer reich werden will, sollte sehr aggressiv sein“, konstatiert der Vermögensforscher Wolfgang Lauterbach.29 Die Große Beschleunigung sitzt so tief in unseren Köpfen, dass wir nicht darauf hoffen können, die Klimadiplomatie, die Innovationskraft oder gar der Gesetzgeber werde es schon richten – so tief also, dass wir uns schon selbst an die Arbeit machen müssen.
Die Veränderungsdimensionen für unsere Arbeitswelt
Der Wandel, den wir brauchen, muss Wandel auf der Ebene unseres Verhaltens sein. Die abgebildeten Kurven haben das deutliche Bild eines industriellen Menschen gezeichnet, dem es zwar gelungen ist, eine neue Erdepoche zu erschaffen. Dem es aber nicht gelungen ist, sein Handeln von dieser neuen Ära updaten zu lassen: Das Klima verändert sich, warum können wir es nicht? Um diese Frage zu beantworten, tauchen wir von den Makroebenen der Erde und der Ökonomie zu unserer eigenen Handlungsebene ab – und zum ersten Teil des Working-Planet-Modells.
Das Working-Planet-Modell I: Arbeitspraktiken als Fundament der Klimakrise
Wir finden die Große Beschleunigung in unserem ökonomischen Grundprinzip des Extrahierens aller Ressourcen, der Schätze der Natur, aber auch der Human Ressources – ein so wunderbar selbstverräterischer Begriff wie aus einem schlechten Schurkenfilm! Das Grundprinzip des Abschürfens und Verbrauchens findet sich im Sprechen und Denken über Arbeitsprozesse wieder: Wir brennen für etwas, haben etwas in der Pipeline, geben Gas – Sprachbilder einer Ära der fossilen Brennstoffe. Unsere Umwelt – die ja eigentlich eine Mitwelt ist – wird zur Cheap Nature degradiert und damit zur passiven Hintergrundfolie unseres Tuns – genau wie im Gemälde de Goyas. Eine Fehlhaltung, die uns wortwörtlich den Boden unter den Füßen wegzieht.
So ist auch unser Verständnis von den Handelnden in der Arbeitswelt, den Organisationen, gefährlich verengt: Wir koppeln das Wirtschaften vom Sozialen radikal ab – sowohl in der Wirtschaftswissenschaft als auch in der Wirtschaftspraxis. Hätte ich am Anfang des letzten Jahrhunderts Wirtschaftswissenschaften studiert, hätte man dieses Fach noch Nationalökonomie genannt, denn dem Selbstbild dieser damals jungen Wissenschaft entsprach eine klare Verankerung in den Staatswissenschaften und der Soziologie – obendrein wäre ich dann heute mindestens 120 Jahre alt. Da ich das Studium aber Anfang dieses Jahrhunderts antrat, erntete ich irritierte Blicke, wenn ich sagte, dass die Wirtschaftswissenschaften zu den Sozialwissenschaften gehören – oder gehören sollten. Weniger irritierend scheint es, im Wirtschaftlichen eine von allen politischen und sozialen Problemen befreite Pseudophysik zu sehen und Unternehmen als isolierte Profitmaximierungsmaschinen managen zu wollen.





























