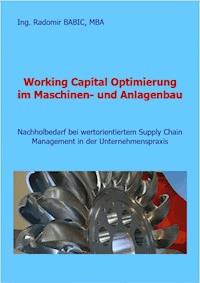
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bei den Unternehmen der Maschinen- und Anlagenbaubranche sind hohe Kapitalsummen im Umlaufvermögen gebunden. In den letzten Jahren konnten viele Unternehmen dieser Branche ihr Working Capital reduzieren. Jedoch zeigen die Branchenvergleiche noch viel Handlungsbedarf, besonders bei der Kapitalbindungsdauer und der Working Capital Ratio. Die vorliegende Arbeit hat das Hauptziel, Optimierungsmöglichkeiten des Working Capital im Rahmen einer wertorientierten Supply Chain aufzuzeigen. Dabei wird der Fokus auf die Maschinen- und Anlagenbaubranche gelegt. Die Literatur- und Studienanalysen bestätigen die branchen-übergreifende Anwendbarkeit der analysierten Optimierungsansätze. Jedoch ist der konkrete Erfolg von der Anpassung an ein konkretes Unternehmen bzw. eine konkrete Supply Chain abhängig. Zu den schon öfter erprobten Lösungsansätzen wurden alternative Lösungswege vorgeschlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wird gegebenenfalls auf eine geschlechterneutrale Differenzierung (Bsp: MigrantInnen) verzichtet. Die Begriffe gelten daher im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich immer für beide Geschlechter. Unabhängig von der inhaltlichen Gestaltung sei vorausgesetzt, dass beide Geschlechter selbstverständlich als gleichwertig erachtet werden.[1]
Abstract
Bei den Unternehmen der Maschinen- und Anlagenbaubranche sind hohe Kapitalsummen im Umlaufvermögen gebunden. In den letzten Jahren konnten viele Unternehmen dieser Branche ihr Working Capital reduzieren. Jedoch zeigen die Branchenvergleiche noch viel Handlungsbedarf, besonders bei der Kapitalbindungsdauer und der Working Capital Ratio. Die vorliegende Arbeit hat das Hauptziel, Optimierungsmöglichkeiten des Working Capital im Rahmen einer wertorientierten Supply Chain aufzuzeigen. Dabei wird der Fokus auf die Maschinen- und Anlagenbaubranche gelegt. Die Literatur- und Studienanalysen bestätigen die branchenübergreifende Anwendbarkeit der analysierten Optimierungsansätze. Jedoch ist der konkrete Erfolg von der Anpassung an ein konkretes Unternehmen bzw. eine konkrete Supply Chain abhängig. Zu den schon öfter erprobten Lösungsansätzen wurden alternative Lösungswege vorgeschlagen. Es konnte nicht bestätigt werden, inwieweit diese Ansätze schon in der Praxis erfolgreich und zielgerichtet auf die Optimierung des Working Capital angewendet wurden. Deswegen scheint hier eine künftige Forschung empfehlenswert.
Stichworte:
Wertorientierte Unternehmensführung, wertorientiertes Supply Chain Management, Working Capital Management, Forecast-to-Fulfill-Prozess, Order-to-Cash-Prozess, Purchase-to-Pay-Prozess,Days Inventory Outstanding, Days Payables Outstanding, Days Sales Outstanding, Cash-to-Cash-Cycle, Cash Velocity & Value Chain Velocity, Value Management, Target Costing, Free Cash Flow, Return on Capital Employed, Weighted Average Cost of Capital, Economic Value Added, Shareholder Value
Abstract (English)
Regarding machinery and plant industry high amounts of capital are tied up in current assets. In the last few years many companies were able to reduce their working capital. There is still a lot to be done regarding cash conversion cycle and working capital ratio. The main objective of this thesis is to show the possibilities for optimization of working capital, concerning value-based supply chain management. The focus has been put on the machinery and plant industry. The optimization approaches can also be applied across all industry sectors. The success depends on the adaptation of these methods in practice. Alternative solutions have also been proposed. It could not be verified whether these approaches have been successfully applied in practice. Literature says that this approach has a positive impact on the reduction of working capital. Further research could be recommended.
Keywords:
Value oriented Corporate Management, Value oriented Supply Chain Management, Working Capital Management, Forecast-to-Fulfill-Process, Order-to-Cash-Process, Purchase-to-Pay-Process,Days Inventory Outstanding, Days Payables Outstanding, Days Sales Outstanding, Cash-to-Cash-Cycle, Cash Velocity & Value Chain Velocity, Value Management, Target Costing, Free Cash Flow, Return on Capital Employed, Weighted Average Cost of Capital, Economic Value Added, Shareholder Value
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Abstract (English)
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen
Vorwort
Executive Summary
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Forschungsthema
1.3 Ziele und Methoden
2. Hauptteil
2.1 Theoretische Grundlagen
2.1.1 Wertorientierte Unternehmenssteuerung
2.1.2 Wertorientierte Kennzahlen
2.1.3 Working Capital Management
2.2 Literaturanalyse
2.2.1 Traditionelle Optimierungsansätze
2.2.2 Alternative Optimierungsmethoden des WCM
2.3 Forschungsarbeit
2.3.1 Empirische Daten aus der Literaturanalyse
2.3.2 Analyse und Diskussion
3. Schlussteil
3.1 Überprüfung von Hypothesen
3.2 Beantwortung der Forschungsfragen
3.3 Ausblick
3.4 Handlungsempfehlungen
3.5 Umsetzungsmöglichkeiten
3.6 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Anhang
1. Tabellenanhang zum Working Capital Management
2. Vorratsmanagement - Forecast-to-Fulfill-Prozess
3. Forderungsmanagement - Order-to-Cash-Prozess
4. Verbindlichkeiten-Management - Purchase-to-Pay-Prozess
Abkürzungsverzeichnis
Abb. … Abbildung
ABS … Asset Backed Securities
AG … Aktiengesellschaft
AV … Anlagenvermögen
Bsp. … Beispiel
bspw. … beispielsweise
CAPM …Capital Asset Pricing Model
CCC … Cash Conversion Cycle
CE … Capital Employed
CF … Cash Flow
C2C-Cycle … Cash to Cash Cycle
DCF … Discounted Cash Flow
d. h. … das heißt
Diagr. …Diagramm
DIH … Days Inventory Held
DII … Days in Inventory
DIO … Days Inventory Outstanding
DM … Direktes Material
DPO … Days Payables Outstanding
DSO … Days Sales Outstanding
DTC … Design to Cost
DTO … Design to Objectives
€ … Euro
EBIT … Earnings Before Interest and Taxes
EBITDA … Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EK … Eigenkapital
et al. … und andere
etc. … et cetera
EVA … Economic Value Added
evtl. … eventuell
f. … folgende Seite
FCF …Free Cash Flow
ff. … fortfolgende Seiten
FK … Fremdkapital
F&E … Forschung und Entwicklung
ggf. … gegebenenfalls
ggü. … gegenüber
GuV … Gewinn- und Verlustrechnung
Hrsg. … Herausgeber
ICV … Internationaler Controller Verein
i.d.R. … in der Regel
IM … Indirektes Material
inkl. … Inclusive
IV … Immaterielles Vermögen
JIS … Just-in-Sequence
JIT …Just-in-Time
KPI … Key Performance Indicator
LuL … Lieferung und Leistung
Mio. … Millionen
MtO … Make-to-Order
MtS … Make-to-Stock
NOPAT … Net Operating Profit after Taxes
Nr. … Nummer
NWC … Net Working Capital
OFCF … Operating Free Cash Flow
RHB … Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
ROCE … Return on Capital Employed
QFD … Quality Function Deployment
s. … siehe
S. … Seite
SAV …Sachanlagenvermögen
SCM … Supply Chain Management
SG&A…Selling, General and Administrative Expenses
SHV … Shareholder Value
sog. … so genannt
u.a. … unter anderem
VDI …Verein deutscher Ingenieure
VE … Value Engineering
vgl. … vergleiche
VM … Value Management
vs. … versus
WA … Wertanalyse
WACC … Weighted Average Cost of Capital
WCM … Working Capital Management
WIP … Work in Progress
z. B. … zum Beispiel
Verzeichnis der Abbildungen
Abb. 1: Thema-Eingrenzung.18
Abb. 2: Zuordnung Hypothesen - Forschungsfragen.21
Abb. 3: Untersuchungsdesign.22
Abb. 4: Aufbau der Arbeit25
Abb. 5: Wertorientierte Kennzahlen.29
Abb. 6: ROCE-Baum (alle Werte x 1.000)30
Abb. 7: Grundkonzept der durchschnittlich gewichteten Kapitalkosten.31
Abb. 8: Berechnung von G+V, WACC, EVA..33
Abb. 9: Finanzielle Werttreiber bei Economic Value Added (EVA)34
Abb. 10: Shareholder Value.36
Abb. 11: Zusammenhänge zwischen Free Cash Flow und WACC.36
Abb. 12: Berechnung von Shareholder Value mit Terminal Value.37
Abb. 13:Working Capital 2001–2010 in der Schweiz, in Deutschland und in den USA..39
Abb. 14:Zusammenhang von Return on Capital Employed (ROCE) und Working Capital39
Abb. 15:Working Capital-Zyklus.40
Abb. 16: Stellhebel im Working Capital Management41
Abb. 17:Bandbreite des Working Capital-Umfangs.42
Abb. 18:Kennzahlen/Indikatoren für Working Capital-relevante Prozesse.43
Abb. 19: Net Working Capital44
Abb. 21: Eigene Abbildung in Anlehnung an Losbichler 201l, Berechnung des C2C-Cycles.46
Abb. 20: Einfluss der Änderung des C2C-Cycle auf den Cash Flow..47
Abb. 22: Reichweitenanalyse / Benchmarks.49
Abb. 23:Auswahl empfohlener KPIs zur Working Capital-Steuerung.50
Abb. 24: Wirkungen des Working Capital Managements (Quelle Losbichler, 2010)51
Abb. 25:Wertsteigerungshebel und Geschäftswertbeitrag.52
Abb. 26:Zusammenhang G+V, Bilanz und Cash Flow-Statement54
Abb. 27: Cash Flow-Statement (Kapitalflussrechnung)55
Abb. 28: Veränderung der liquiden Mittel, Cash Flow-Statement56
Abb. 29:Index der Marktkapitalisierung 2005-2008.57
Abb. 30: Reduzierung der Materialkosten - Einfluss auf EBIT.58
Abb. 31:Wirkung von Einkauf und Supply Chain auf das operative Ergebnis (EBIT)58
Abb. 32: Eigene Abbildung in Anlehnung an Heesen/Moser 2013: 218.61
Abb. 33: Kostenbeeinflussbarkeit während Projektphasen.61
Abb. 34:Working Capital reduzieren: Ansätze.62
Abb. 35:Kernprozesse des Working Capital Managements.63
Abb. 36:Typische Aufgaben und Schwachstellen im Working Capital Management64
Abb. 37:Forecast-to-Fulfill-Teilprozessschritte (Quelle: Ernst & Young, 2013)65
Abb. 38:Treiber und Zielsetzungen im Forecast-to-Fulfill-Cycle.66
Abb. 39:Order-to-Cash-Teilprozessschritte.69
Abb. 40:Treiber und Zielsetzungen im Order-to-Cash-Cycle.70
Abb. 41:Purchase-to-Pay-Teilprozessschritte.74
Abb. 42:Treiber und Zielsetzungen im Purchase-to-Pay-Cycle.75
Abb. 43:Fehlsteuerung durch Ertragsoptimierung in den Abteilungssilos.79
Abb. 44:Typische Zielkonflikte entlang der Wertschöpfungskette.79
Abb. 45: Formen der organisatorischen Verankerung des WCM..81
Abb. 46: Verantwortung für die Bestandteile des Working Capital82
Abb. 47:Prozessverantwortliche und Bilanz.82
Abb. 48: Praxisbeispiel Projektablauf mit dezidiertem Experteneinsatz.85
Abb. 49: 6-Phasen Vorgehensfahrplan zum Working Capital Management86
Abb. 50: Verbesserungspotenziale vs. Schwierigkeitsgrad der Umsetzung.87
Abb. 51: Treiber des Working Capital im Überblick und deren Wirkungsweise.89
Abb. 52: Wirkungsweisen der Maßnahmen zur Optimierung des Cash Cycle im Überblick.90
Abb. 53:Erweiterung der „Porter’schen Wertschöpfungskette“.91
Abb. 54: Ableitung Superiority Index.92
Abb. 55: Zielsetzung vonValue Cash Velocity.93
Abb. 56: Zielsetzung vonValue Chain Velocity.93
Abb. 57:Ableitung Stellhebel für Verbesserungen aus Treiberbaum und Fokusbereichen.94
Abb. 58:Ansatz zur Erhöhung der „Cash & Value Chain Velocity“.95
Abb. 59: Generelle Vorgehensweise zur Implementierung „überlegener Geschäftsmodelle“.96
Abb. 60:Anwendung des Value Managements bei Entwicklungen.98
Abb. 61:Die drei Werthebel des Value Managements.99
Abb. 62:Wertanalytische Aufgaben im Maschinenbau mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.101
Abb. 63:Konzept des Target Costing.102
Abb. 64: Beispiel Materialkosten-Einsparung.107
Abb. 65: Überprüfung von Hypothesen.134
Autor
Ing. Radomir BABIC, MBA
Berufliche Entwicklung vom Facharbeiter bis zur Führungskraft im technischen Umfeld des Maschinen- und Anlagenbaus, bei vier weltbekannten Unternehmen.
Sein beruflicher Werdegang begann in Kroatien und folgte in Deutschland und Österreich weiter. Dabei arbeitete er in Produktentwicklung, Standardisierung, Konstruktion, Produktion, Qualitätsmanagement und Vertrieb/After Market Business.
Mitarbeit in den interdisziplinären Teams bei den Innovations- und Prozessoptimierungsprojekten.
Vorwort
Der theoretische Rahmen dieser Arbeit ergibt sich aus dem Konzept der wertorientierten Unternehmensführung. Wertorientierte Unternehmens-steuerung basiert auf dem SHV-Ansatz, in dem die gesamte Unternehmenssteuerung auf die Ziele der Eigentümer (Shareholder) ausgerichtet ist. Shareholder sind vordergründig an einer langfristigen Steigerung des Eigenkapitalwertes interessiert, der auf unterschiedlichen Wegen ermittelt werden kann. In dieser Arbeit wurde an den Discounted Cashflow-Ansatz angeknüpft, bei dem der Wert des EK auf Basis der den Eigentümern zukünftig zufließenden Zahlungen bestimmt wird. So wurde der Fokus auf dieVerfahren DCF und EVA® gerichtet.
Das Praktiker Cash Flow – Modell hat ausgedient, da es wesentliche Liquiditätsveränderungen, wie die Veränderung des Working Capital, nicht berücksichtigt. Möglicherweise kann das Modell einen positiven Cash Flow vermitteln, obwohl er in der Realität gar nicht geflossen ist. Das Cash Flow-Statement hat sich in den vergangenen Jahren zur Analyse der Finanzkraft und Steuerung der Liquidität durchgesetzt, weil es die Geldströme sichtbar macht. Die Kapitalrentabilität hat eine zentrale Bedeutung für die Messung und Steuerung des Unternehmenserfolges. Diese Kennzahl ermöglicht die Aussage über den „operativen Unternehmenserfolg“. Als Basis für die Ermittlung der wertorientiertenKennzahlen zeigtdie Kapitalrentabilität die Verzinsung des im Unternehmen gebundenen Kapitals. Der ROCE-Baummacht ersichtlich, obdie Veränderung der Kapitalrentabilität auf eine Änderung der Umsatzrentabilität, des Vermögensumschlags oder auf die Änderung beider Faktoren zurückzuführen ist.
Die Kapitalkosten haben neben der Sicherstellung der Liquidität und der unternehmerischen Unabhängigkeit eine entscheidende Rolle, sowohl bei der Auswahl von Finanzierungsformen als auch bei der strategischen Ressourcenallokation im Rahmen der Investitionsrechnung und des Wertsteigerungsmanagements. Das bilanzielle Ergebnis eines Unternehmens wird aus der GuV bekannt. Dabei wird ersichtlich,ob ein Unternehmen das Eigenkapital erhöht oder reduziert hat. Wie hoch die Eigenkapitalkosten sind und ob in einer Periode Wert geschaffen oder vernichtet wurde, wird dabei nicht ersichtlich. Ob ein Unternehmen Werte schafft oder vernichtet, kann erst nach dem Abzug der Eigenkapitalkosten vom Bilanzergebnis beurteilt werden. Das ermöglicht das Konzept des EVA. Um einen positiven EVA zu erwirtschaften, muss der ROCE größer als die Kapitalkosten sein. Das EVA-Konzept erinnert nachdrücklich an die alte Erkenntnis, dass ein Gewinn erst dann entsteht, wenn alle Kosten einschließlich der Kapitalkosten gedeckt sind.
Als ÜberleitungzurForschungsarbeitwird das WCM ausführlich behandelt. Dabei werden klassische Definitionen, Kennzahlen sowie die Ziele des WCM angeführt. Der Schwerpunkt dieses überleitenden Teils ist die Darlegung des WCM als Grundstein der wertorientierten Unternehmensführung. Dabei soll Liquidität freigesetzt, Cash Flow generiert und durch die Einsparung von Kapitalkosten, die Gesamtkapitalrentabilität erhöht werden.
Ein erfolgreiches WCM zeigt die Wirkung auf der Liquiditäts- und Profitabilitätsebene.
Die zentralen Punkte dieser Arbeit bestehenaus der Analyse der Optimierungsansätze und der Analyse sowie Diskussion der Ergebnisse der Studien und Forschungsberichte.
Darauf folgend werden die Hypothesen überprüft und Forschungsfragen beantwortet.
Die Arbeit wird im Anschluss mit einem Ausblick, Handlungsempfehlungen und Umsetzungsmöglichkeiten abgerundet.
Executive Summary
Der Kern dieser Arbeit ist einerseits die Analyse der traditionellen[2]sowie alternativen Optimierungsansätze wie „Cash & Value Chain Velocity“[3]- bzw. Value Management und andererseits die Analyse der ausgewählten Studien. Der Fokus ist dabei auf die Maschinen- und Anlagenbaubranche gerichtet.
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden an Hand der Beantwortung folgender Fragenstellungen dargestellt:
1.Wo hat der Maschinen- und Anlagenbau die größten Nachholbedarfe bei der Optimierung des Working Capital im Vergleich zu anderen Branchen?
·In der Maschinen- und Anlagenbaubranche wird eine sehr hohe Kapitalbindungsdauer identifiziert;[4][5]
·Europäische Maschinen- und Anlagenbauer habenpunkto Working Capital -Performanceeinen eklatanten Nachholbedarfgegenüber US-Unternehmen;[6]
·Esist häufig keine geeignete Supply Chain -Strategie definiert;[7][8]
·Die Prozesse und die zugehörigen Verantwortlichkeiten werden oft unzureichend definiert und gelebt;[9][10]
·Der ganzheitliche Optimierungsansatz wirdunzureichend angewendet;[11][12]
·Unzureichende Positive Anreizsysteme entlang der Supply Chain.[13]
2.Was sind die Schlüsselaussagen der behandelten Studien?
·Im Maschinen- und Anlagenbau existieren weiterhin hoheVerbesserungspotenziale;[14][15][16][17][18]
·Die größten Potenziale werden in den Funktionalen Bereichen: Beschaffung, Lagerhaltung, Working Capital sowie Produktion geortet.[19]Die größten Potenziale funktionsübergreifend liegen in Strategie, Prozessen, Organisation und Controlling;[20]
·Wichtigste Unternehmensziele sind Zahlungsfähigkeit und Werterhöhung;[21]
·Ganzheitliche Optimierung ist erfolgreicher als die isolierte Optimierung;[22]
·Gravierende Defizite sind auf der Netzwerkebene erkennbar;[23]
·Fast 70% der Unternehmen steuern ihr Working Capital nicht konsequent genug;[24]
·Eine umfassende Richtlinie konnte nur bei 26% der Unternehmen festgestellt werden;[25]
·Die Verantwortlichkeit für das WCM ist nicht im Top-Management angesiedelt;[26]
·Keinumfassendes und übergreifendes Reporting beim Working Capital implementiert.[27]
3.Was zeigt die Analyse der Optimierungsätze?
·Sowohl die traditionellen Optimierungsansätze als auch das „Cash & Value Chain Velocity“-Ansatz, können in der Maschinen- und Anlagenbaubranche erfolgreich angewendet werden;
·Der „Cash & Value Chain Velocity“-Ansatz kann zusätzliche Nutzeffekte generieren;
·Das Value Management hat eine positive Wirkung auf das Working Capital, soll aber einer weiterführenden Forschung unterzogen werden;
·Ein erfolgreiches Zielkostenmanagement lässt Erfolgsquote der Entwicklungsprojekte über 80% steigen;[28]
·In der F&E werden 70–80 % der Funktionalitäten sowie der Materialkosten festgelegt;[29]
·Kosteneinsparung von 1 % bei den Material- und Supply-Chain-Kostenkann im Maschinen- und Anlagenbau eine positiveAuswirkung von18 %auf das EBIT haben;[30]
·Durchschnittlich werden 40–60 % des Umsatzes wieder im Einkauf ausgegeben.[31]
4.Welche Top-Prioritäten zur Beseitigung der Nachholbedarfe wurden vorgeschlagen?
·Die wertorientierte Supply Chain Steuerung als strategisches Ziel implementieren;
·Bei der Konzipierung einer übergreifenden Supply-Chain-Strategie müssen Lieferanten ebenso wie Finanzen, Kunden und Potenziale betrachtet werden;
·Sensibilitätfür die Bedeutung des Working Capital Managements schaffen;
·Komplexitätdes Themas der Working Capital-Optimierung nicht unterschätzen;
·Zielkonflikteentlang der ganzen Wertschöpfungskette ausbalancieren;
·EffizienteProzessverankerungund klare Verantwortung für das Working Capital Management schaffen;
·UmfassendeWorking Capital Richtlinien erstellen und konsequent umsetzen;
·Working Capital Optimierungs-Projektplan erstellen und Umsetzung verfolgen;
·Working Capital Controlling betreiben;
·Neben der allgemeinen, auch branchenspezifischen Risikofaktoren berücksichtigen;
·Geeignete Kennzahlensystemefür die ganze Wertschöpfungskette entwickeln;
·Positive Anreizsysteme zwischen Supply-Chain-Akteuren etablieren;
·Produktkomplexität reduzieren;
·Simultanes Engineering einführen.
5.Was sind die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit?
Das Working Capital Management kann gezielt und erfolgreich zur Werterhöhung des Unternehmens beitragen. Dazu muss es eine strategische Funktion haben, im Topmanagement angesiedelt sein und klare Verantwortlichkeit erhalten. Darüber hinaus gilt es dies prozessorientiert und -integriert zu gestalten, Zielkonflikte hintanzuhalten und Interessen verstärkt auszubalancieren.
Dabei können die in dieser Arbeit behandelten Lösungsansätze an das konkrete Unternehmen angepasst, in der Maschinen- und Anlagenbaubranche zielführend eingesetzt werden.
1.Einleitung
Es wurde das Forschungsthema mit dem Titel: „Nachholbedarf bei wertorientiertem Supply Chain Management in der Unternehmenspraxis – Beispiel, Optimierung des Working Capital im Maschinen- und Anlagenbau“gewählt.
Motivation
Sowohl wissenschaftliche Arbeiten als auch praxisorientierte Beiträge zeigen, dass ein optimiertes WCM dem Unternehmen erhebliche finanzielle Vorteile verschaffen kann. Das Optimierungsziel ist die möglichst weitreichende Freisetzung des im Umlaufvermögen gebundenen Kapitals bei gleichzeitiger Optimierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten, um freie Liquidität zu schaffen und die Zinsposition des Unternehmens zu verbessern.
Die Optimierung des Working Capital wurde auch in der Maschinen- und Anlagenbaubranche als wichtig erkannt. Dennoch wird dieses Thema häufig vernachlässigt und daher gibt es noch viel ungenutztes Potenzial. Bislang verliefen viele Optimierungen des Working Capital zu Lasten der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen einer Supply Chain. Dadurch waren die Nutzeffekte niedrig und die Zielkonflikte verschärften sich weiter. Zudem schmälerte sich die Motivation für zukünftige Optimierungsprojekte. Die integrierten Optimierungsansätze sind noch eine Seltenheit. In den letzten Jahren konnten viele Unternehmen der Maschinen- und Anlagenbaubranche ihr Working Capital optimieren. Jedoch zeigen die Branchenvergleiche noch viel Handlungsbedarf für diese Branche, besonders bei der Kapitalbindungsdauer und bei der Working Capital Ratio. Hierzu gäbe es eine Vielzahl möglicher Maßnahmen, jedoch sind nicht alle für jedes Unternehmen sinnvoll. So bestehen allein durch die Branchenzugehörigkeit deutliche Unterschiede.





























