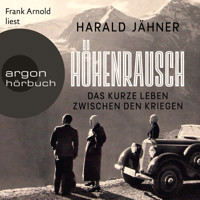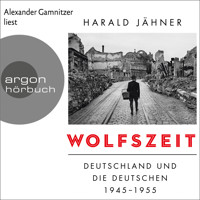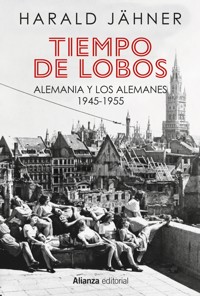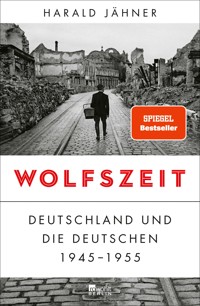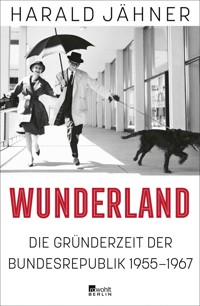
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum sind die Trümmer weggeräumt, setzt in Deutschland ein Wirtschaftsaufschwung ohnegleichen ein, auch ein nimmersatter Kaufrausch: Möbel, Autos, Reisen, Elektrogeräte. Mit dem Rock 'n' Roll erfasst die Jugend ein neues Lebensgefühl. 1957 eröffnet der erste Supermarkt, der Siegeszug der Discounter beginnt. Der Fernseher gruppiert die Wohnzimmer um. – Und plötzlich stellen sich neue Fragen: Wie soll man leben? Verlieren wir unsere kulturelle Identität an Amerika? Wie viel Freiheit braucht ein Kind, eine Ehe, ein Arbeitnehmer? Elvis Presley und Freddy Quinn geben unterschiedliche Antworten. 1967 ist die Bundesrepublik im Rohbau fertig. Erstmals kommt ein deutscher Staat ohne höhere Idee aus als das Glück des Einzelnen. Eine Reise in die Lust und Mühen des Wirtschaftswunders – in die Welt der Käseigel, Neckermann-Kataloge und Stalingrad-Erinnerungen, der Gastarbeiter und eines neuen Politikertyps wie Kennedy oder Brandt, der Happenings und des Klammerblues. Als die Beatles 1967 «All You Need Is Love» singen, ist die Studentenrevolte bereits im Gange. Harald Jähners fulminantes Porträt der jungen Bundesrepublik, einer Zeit, in der sich alles neu formierte – und die es neu zu entdecken gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Harald Jähner
Wunderland
Die Gründerzeit der Bundesrepublik 1955–1967
Über dieses Buch
Kaum sind die Trümmer weggeräumt, setzt in Deutschland ein Wirtschaftsaufschwung ohnegleichen ein, auch ein nimmersatter Kaufrausch: Möbel, Autos, Reisen, Elektrogeräte. Mit dem Rock 'n' Roll erfasst die Jugend ein neues Lebensgefühl. 1957 eröffnet der erste Supermarkt, der Siegeszug der Discounter beginnt. Der Fernseher gruppiert die Wohnzimmer um.
Und plötzlich stellen sich neue Fragen: Wie soll man leben? Verlieren wir unsere kulturelle Identität an Amerika? Wie viel Freiheit braucht ein Kind, eine Ehe, ein Arbeitnehmer? Elvis Presley und Freddy Quinn geben unterschiedliche Antworten. 1967 ist die Bundesrepublik, wie wir sie kannten, im Rohbau fertig. Erstmals kommt ein deutscher Staat ohne höhere Idee aus als das Glück des Einzelnen.
Eine Reise in die Lust und Mühen des Wirtschaftswunders – in die Welt der Käseigel, Neckermann-Kataloge und Stalingrad-Erinnerungen, der Gastarbeiter und eines neuen Politikertyps wie Kennedy oder Brandt, der Happenings und des Klammerblues. Als die Beatles 1967 «All you Need is Love» singen, ist, mitten im Kalten Krieg, die Studentenrevolte bereits im Gange. Harald Jähners fulminantes Porträt der jungen Bundesrepublik, einer Zeit, in der sich alles neu formierte – und die es neu zu entdecken gilt.
Vita
Harald Jähner, geboren 1953 in Duisburg, war bis 2015 Feuilletonchef der «Berliner Zeitung», zugleich Honorarprofessor für Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. 2019 erschien das Buch «Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945–1955», das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde; es wurde in zahlreichen Ländern veröffentlicht, darunter die USA und England, wo es für den renommierten Baillie-Gifford-Preis nominiert war. 2022 erschien «Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen», ebenfalls ein «Spiegel»-Bestseller und in viele Sprachen übersetzt. Die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb: «Ein grandioser Erzähler. Das Buch liest sich spannend wie ein guter Roman.»
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Rico Puhlmann
ISBN 978-3-644-01789-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort: Die große Beschleunigung
Willy Reichel aus München erblickte im Dezember 1957 den Bundespräsidenten Theodor Heuss auf der Titelseite der Illustrierten «Quick». Was er da sah, gefiel ihm nicht. Er setzte sich an seine Schreibmaschine und schrieb Heuss einen Brief: «Eine sehr wichtige Einzelheit Ihres Titelbildes missfällt mir sehr. Die Ärmel Ihres Fracks sind zu lang und die Manschetten des Hemdes zu kurz. Bei einem Frack besonders darf der Ärmel nie so lang sein, dass er auf den Handrücken aufstößt. Es müssen ca. 1½ cm von der weißen Hemdmanschette zu sehen sein. Ich will meinen Bundespräsidenten, den ich sehr verehre, sehr korrekt angezogen sehen. Mit freundlichen Grüßen, der Ihre Willy Robert Reichel». Er fügte noch die Empfehlung hinzu, künftig «in der Außenbrusttasche des Fracks ein weißes Taschentuch oder aber eine weiße Nelke im Knopfloch zu tragen».[1] Eine weiße Nelke wirke immer frisch und elegant.
Fünf Tage später traf die Antwort aus dem Bundespräsidialamt ein, unterzeichnet vom persönlichen Referenten Hans Bott, nach Absprache und Diktat von Heuss: «Sehr geehrter Herr Reichel! Der Herr Bundespräsident hat Ihren Brief mit Vergnügen gelesen und war leicht gerührt über die Sorge, die Sie sich mit seinem Anzug gemacht haben. Es ist die gleiche Sorge, die sich auch manche Menschen seiner näheren Umgebung machen, nur er selber (leider?!?) gar nicht. Er hat ja schon einmal in einer veröffentlichten Rede gesagt, dass es nicht sein Ehrgeiz sei, der ‹Mannequin der Bundesrepublik› zu sein. Und nun gar das weiße Taschentuch in dem, was Sie ‹Außenbrusttasche› nennen, werden Sie ihm nicht beibringen können. Das haben schon zahllose Leute versucht. Dr. Heuss aber pflegt in solchen Fällen zu behaupten, dass er nicht schwitze, und den Wunsch, ‹sehr elegant› zu wirken, hat er noch nicht in seine Weltanschauung aufgenommen. Ich fürchte, Sie müssen resignieren!»[2]
Dieser Briefwechsel passt zu dem geläufigen Bild, das wir uns von den fünfziger Jahren machen, insofern hier jemand ganz genau weiß, was korrekt ist und was nicht, und das Korrekte ihm offensichtlich das Allerwichtigste ist. Andererseits verblüfft, wie frank und frei er «seinem» Bundespräsidenten Ratschläge zur angemessenen Kleidung erteilt. Auch dass er diese gewisse Unverfrorenheit mit der Bedeutung rechtfertigt, die der Bundespräsident nun einmal für ihn habe, passt nicht unbedingt zur politischen Lethargie, die man den Aufschwungsjahren nachsagt. Sieht so Untertanengeist aus?
Die Antwort aus dem Bundespräsidialamt wiederum verblüfft durch ihre heitere Gelassenheit, ihre vornehme Ironie und ihren warmen, lebensnahen Ton. Von steifem Amtsdeutsch keine Spur.
Die Jahre zwischen 1955 und 1967 bilden das sogenannte Wirtschaftswunder. Nie zuvor wurden so viele Menschen in so kurzer Zeit so wohlhabend. Nie wieder wurden so viele Kinder geboren. Aber es wurden auch nie wieder so viele Überstunden gemacht, so viele Doppelschichten gefahren, so viel Alkohol getrunken, um herunterzukommen. «Wer wird denn gleich in die Luft gehen?» war einer der bekanntesten Werbeslogans dieser Zeit allumfassender Beschleunigung. Nervosität war ihr Preis, Gemütlichkeit ihr selten erreichtes Ideal.
Zu Beginn dieses hier erzählten langen Jahrzehnts trugen fast alle Männer Hüte, am Ende kaum noch einer. Begegneten sich Männer auf der Straße, lupften sie den Hut zur Begrüßung. Wie hoch, hing von der Herzlichkeit und Bedeutung ab, die man der Begegnung zubilligte. Unwürdigen Personen gegenüber blieb der Hut auf dem Kopf; bei entfernten Bekannten reichte eine angedeutete Berührung der Krempe, Vorgesetzten und Würdenträgern gegenüber wurden die Hüte deutlicher gen Himmel gehoben. Eine ganze Palette von Gefühlen war mit dem Hut-Signal auszudrücken, ähnlich dem, was der Hund mit seinem Schwanz macht. Im Hutziehen schwang noch die ritterliche Etikette mit, den Helm abzunehmen, um Friedfertigkeit zu bekunden und seinen Mitmenschen ein ungeschütztes Haupt zu präsentieren.
Gegen Ende der sechziger Jahre blieben die Häupter unbedeckt, der Hut wurde eher peinlich. Zwar trugen nur modebewusste junge Männer die Haare wirklich lang, aber auch die Älteren wollten zumindest nicht mehr verstecken, was sie an Stoppeln und Strähnen zu bieten hatten. Das Männerhaar wurde zu einem herausragenden Medium der Selbstdarstellung, signalisierte unterschiedliche Lebenseinstellungen und war entsprechend umkämpft. Ungezählte Prügel und Beschimpfungen setzte es wegen der langen Jungenmähnen.
Man mag solche Details für nebensächlich halten, aber sie markieren, dass sich Fundamentales änderte in einer Zeit, die doch nur geradlinig voranzuschreiten schien.
Das Jahr 1955 beendete in vieler Hinsicht die unmittelbare Nachkriegszeit. Das Besatzungsstatut wurde aufgehoben, die Bundesrepublik Deutschland erlangte Souveränität. Nur für Notstandszeiten behielten sich die Alliierten vertraglich vor, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Die Bundeswehr wurde gegründet, die Bundesrepublik trat der Nato bei und nahm diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion auf; mit der Heimkehr der letzten zehntausend Kriegsgefangenen aus Sibirien und dem Ural beginnt dieses Buch. Die Lufthansa nahm ihren Verkehr wieder auf. Erstmals wurde wieder mehr Butter als Margarine gegessen, mehr Bohnenkaffee als Surrogat getrunken, für viele Westdeutsche eine entscheidende Wendemarke.
«Wir freuen uns, die Nachricht bringen zu können, die Welt wird heiter!», schrieb das Zeitgeistmagazin «magnum» 1955 und verkündete einen «Wechsel in der Signatur der Zeit». Dieses Jahr war das wachstumsstärkste der deutschen Geschichte. Um heute sagenhaft wirkende zwölf Prozent stieg die Wirtschaftskraft, um fast zwanzig Prozent der Kraftfahrzeugbestand. Der Ausdruck «Wirtschaftswunder» verrät die beträchtliche Dosis Ungläubigkeit, die damit einherging. Aber unbeirrt ging es weiter, mit durchschnittlichen Jahreswachstumsraten von 6,4 Prozent. Das Wunder wurde selbstverständlich. Erst 1967 machte ein vorübergehender Konjunktureinbruch den Menschen deutlich, dass ihre inzwischen erworbene Sorglosigkeit auf Illusionen beruhen könnte.
Die Aufschwungsjahre prägen das Selbstverständnis der Bundesrepublik bis heute. Sie bleiben, so außerordentlich sie auch waren, Wegmarken des Möglichen. Sie leben, wenn nicht in unseren Erfolgen, so doch in unseren Ansprüchen weiter. Die berauschenden Einnahmen sind weg, die Erwartungen an den Wohlfahrtsstaat aber geblieben. Allein die Sorge über die damit einhergehende chronische Staatsverschuldung macht die Erinnerung an das vermeintliche Wirtschaftswunder zu einer erhellenden Erfahrung. Dieses Buch erzählt, wie der Wohlstand erarbeitet wurde; es führt in die Welt der Bergleute und der Stahlindustrie, in die Schwefelschwaden des Ruhrgebiets und die Mythologie der fossilen Energieträger Kohle und Erdöl. Kosten und Nutzen hielten unerbittlich die Balance und fallen uns noch heute zur Last. Dass die Emissionen des einzigartigen Booms wortwörtlich den Atem raubten, nahm man als unabwendbar in Kauf. Zu erleben ist die Entstehungsgeschichte eines fatalen Achselzuckens.
Die Gründerzeit der Bundesrepublik war geprägt durch den Genuss, aber auch von der Verdammung der Konsumgesellschaft. Zu den eigenartigen Phänomenen des Aufschwungs gehörte, wie rasch man des Wohlstands überdrüssig wurde, den eigenen ausgenommen. Der «satte Wohlstandsbürger» wurde zur Zielscheibe des Grolls von links und rechts, so als wäre Hunger eine moralische Kategorie. Ein Gefühl der inneren Leere lastete auf der jungen Republik, zu der die Wonnen des Verzehrens nicht recht passen mochten. Die Teilung des Landes, die im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen, der verlorene Nationalstolz – wie brachte man das zusammen mit der heiteren Wohlstandswelt und einer Wirtschaftsdynamik, die ständig neue Wünsche, neues Begehren entfachte?
Sogar Ludwig Erhards Redenschreiber Rüdiger Altmann empfand die Bundesrepublik zunächst als einen «Staat ohne geistigen Schatten»[3], als ein «Land, das vom Nichts angeweht ist» und dringend «geistige Deutung» brauche. Es gebe «wenige moderne Länder, deren Menschen ähnlich ratlos vor der Gesellschaft stehen, zu der sie selbst gehören», schrieb Ralf Dahrendorf noch 1965.[4] Die Jahre des Aufschwungs lassen sich auch als solche eines Landes auf der Suche nach sich selbst beschreiben. Was war das für ein seltsames Volk, das nicht mehr an den Kaiser und den Führer glaubte, sich selbst aber auch nicht recht trauen konnte?
Der Soziologe Helmut Schelsky sprach in den fünfziger Jahren von der «nivellierten Mittelstandsgesellschaft» – ein Begriff, in dem sich weite Teile derselben wiederfanden. Hatte die «soziale Marktwirtschaft» auf friedlichem Weg die klassenlose Gesellschaft geschaffen, wie ihr erfolgreichster Einkleider, der Versandhaushändler Josef Neckermann, behauptete? Die alten Bildungseliten machten da zunächst nicht mit. Gut angezogen seien die einfachen Leute zwar jetzt, aber dafür vorlaut und anmaßend, hieß es unter Journalisten, Pfarrern und Professoren. Besorgt beobachteten sie eine «wachsende Herrschaft der Halbbildung» und eine «Zerbröckelung der Kulturpyramide»[5], auf der sie bislang ganz oben gestanden hatten. Doch binnen weniger Jahre wurde Standesdünkel unfein. Kulturell passten sich das Oben und Unten der Republik aneinander an; der Ton der Eliten verlor seine Geschraubtheit, der von unten seine Primitivität. Die Nivellierung schritt voran. Wie viel wurde dadurch gewonnen, wie viel aber auch verloren?
Das Abenteuer des Fernsehens begann und hielt die Menschen in ihren Wohnungen. Radio und Fernsehen standardisierten die Umgangsformen und ebneten die Unterschiede zwischen den Regionen ein, verfeinerten aber auch die Kunst des Gesprächs und des Streitens. Der Jugend gab der deutsche Rundfunk allerdings nichts. Weil die Redakteure sich als Erzieher begriffen und sich weigerten, die Musik zu spielen, die die Leute hören wollten, flüchteten die Jungen zu den alliierten Soldatensendern. AFN und BFBS schlossen Deutschland an den Popkosmos an, der von Elvis Presley, Chuck Berry und Dionne Warwick belebt wurde. Was bedeutete es, wenn ausgerechnet Besatzungssender eine Musik lieferten, die als Rebellion und Befreiung empfunden wurde?
Westdeutschland, und in gewisser Weise auch die DDR, wurden eingebettet in einen internationalen Strom popkultureller Erregungen, die immer neue Ansprüche an die Lebensintensität, an die Selbsterfahrung, ans eigene Ich und an die Moral stellten. Das Konsumangebot differenzierte die Palette möglicher Lebensstile immer mehr aus. Die Welt der grauen Mäuse wurde bunt, schrill, vielfältig und widersprüchlich.
Eine konformistisch geprägte Gesellschaft des Mangels wandelte sich in nur wenigen Jahren in eine des Überflusses, bestimmt von Individualismus und Hedonismus. Demokratie wurde zu einem Begriff, der zunehmend auch in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie und in der Universität eingefordert wurde. Gegen- und Subkulturen entstanden, die auf ihre Jugend pochten und sich schließlich auf Basis der allgemeinen Sorglosigkeit die längste Pubertät der Geschichte genehmigten. Als Willy Brandt 1969 mit dem Slogan «Mehr Demokratie wagen» Kanzler wurde, läutete er weniger eine neue Ära ein, sondern fasste die Energien und Bedürfnisse der vergangenen Jahre zusammen: «Wir stehen nicht am Ende der Demokratie, wir fangen erst richtig an.»[6]
Und heute? Die Gründerzeit der Bundesrepublik hat in rasanter Dynamik die Phänomene geschaffen, die uns noch immer beschäftigen und bedrängen. Wie in einem Brennglas zeigen sich im großen Boom die Stressfaktoren und Glücksmomente von Wachstum und Wohlstand. Damals stank und qualmte es zwar mehr als heute, die Folgen der Emissionen sind uns aber auf viel beklemmendere Weise bewusst. Arbeiten im Akkord und «Überstundenkloppen ohne Ende» bildeten eine weitverbreitete Haltung, die uns zu unserem Glück inzwischen fremd geworden ist. Aber wie realitätstüchtig ist das? Für die Debatten über die Work-Life-Balance ist das «Wirtschaftswunder» mitsamt seiner Ausfallerscheinungen ein erhellendes Anschauungsobjekt. Der Staat gewöhnte sich in der langen Periode des exorbitanten Aufschwungs an finanzielle Handlungsspielräume zur Sicherung des sozialen Ausgleichs, der Renten und der Kultur, die zu reduzieren enorm schwerfällt.
Auch die Feindbilder zwischen Ost- und Westdeutschen, die während der Teilung entstanden, liegen noch immer auf der Seele. Und der Kalte Krieg zwang den nach zwei Weltkriegen endlich restlos friedfertig gewordenen Deutschen Fragen der Selbstverteidigung auf, die heute wieder ganz ähnlich – und ähnlich erbittert – diskutiert werden. Selbst die Drohung der USA, sich aus Europa zurückzuziehen, falls man sich dort nicht stärker an den Rüstungskosten beteilige, schwebte schon damals über der Bundesrepublik. Und die im Guten wie im Beklemmenden zentrale Rolle der Familie in der frühen Nachkriegszeit wirft ein helles Licht auf die sozialen Bindekräfte heute und die Kraft, die es abverlangt, allein zu leben. Was taten unsere Eltern und Großeltern, damit wir so wurden, wie wir sind?
Die verbreiteten Sorgen über die Zukunftsfähigkeit der Republik lassen mit neuem, geschärftem Blick auf die Kinderjahre schauen, die ihren Charakter formten. Sie waren so, wie Kinderjahre sein sollen: sorglos und schon deshalb voller Konflikte.
Erstes KapitelDie Heimkehr der letzten Zehntausend: Ankunft in einem fremden Land
«Das Gemeinsame kann zwar nicht aus dem Boden gestampft werden, aber an seinem Entstehen ist der Wille nicht unbeteiligt.»
Friedrich Sieburg, 1954
Herleshausen
Ein eigenartiger Güterzug fuhr am 12. Oktober 1955 quer durch die DDR, Waggons verschiedener Bauart, beladen mit vierhundertzwölf unruhigen Männern, aufgeregt vor Sorge, Vorfreude, Ungewissheit und Angst. Ganz vorn, hinter der Lok, ein komfortabler Schnellzugwagen mit bewaffneten russischen Transportoffizieren. Seit sie am frühen Morgen die polnische Grenze bei Frankfurt an der Oder überquert und Deutschland erreicht hatten, waren die Gedanken in den Güterwaggons finsterer, die Stimmung gedrückter. In Russland und Polen waren die Gefangenen bei den kurzen Aufenthalten noch gut versorgt und freundlich behandelt worden, im sozialistischen Ostdeutschland aber empfingen sie Kälte und Schikanen. Essen und Trinken gab es nicht mehr, die primitiven Schiebetüren mussten auch bei den Pausen auf Abstellgleisen geschlossen bleiben, es wurde geschnauzt und gehöhnt. «Die kommen sowieso wieder in ein Arbeitslager», rief einer so laut, dass man es in den Waggons deutlich hörte. Dumpfe Verzweiflung brach unter den Leichtgläubigeren aus. Hatten die Russen sie etwa doch belogen, und es sollte nach zehn, zwölf Jahren sowjetischer Lagerhaft in erneute Gefangenschaft gehen, diesmal in der DDR?
Nach quälend langen Zwischenstopps rollte der Zug endlich am frühen Morgen in den Bahnhof Herleshausen ein. Es war für Oktober ziemlich kalt, minus fünf Grad. Herleshausen, ein typisches Fachwerkdorf im armen Nordhessen, hatte eine gewisse Bedeutung erlangt, weil es den einzigen Grenzübergang von Hessen nach Thüringen bot, einen tristen Posten mit wenigen Baracken, schlecht asphaltiert, auf offener, zugiger Flur. Zwei primitive Schlagbäume und ein weißer Strich trennten den Westen vom Ostblock, trennte die Truppen der Nato von denen des feindlichen Warschauer Pakts. Dramatisch ging es am Grenzübergang allerdings selten zu, deprimierend fast immer: Lustlos, misstrauisch, patzig und auf angespannte Weise überkorrekt versahen die Grenzbeamten ihren Dienst. An diesem Tag allerdings war der Bahnhofsvorsteher von Herleshausen außer sich vor Freude. Nach zehn Jahren Langeweile ohne regulären Zugverkehr hatte er endlich mal wieder eine richtige «Zugbehandlung» durchzuführen.
Ein Legationsrat des Auswärtigen Amtes aus Bonn stand bereit, um die erste Begrüßung der Heimkehrer vorzunehmen. Das Rote Kreuz hatte belegte Brote und Tee auf Campingtischen drapiert, ein rasch zusammengezimmertes Holztor, blumengeschmückt, sollte das Tor zur Freiheit symbolisieren. Der Schustermeister Wenk, in Herleshausen nebenbei für das Glockenläuten zuständig, war in den Kirchturm gestiegen und ließ es unablässig tönen.[1] Die sowjetischen Offiziere kontrollierten ein letztes Mal die Entlassungsscheine, dann konnten die Männer die elenden Wagen endlich verlassen und kamen zögernd heran; sie schüttelten die Hände des Herleshausener Pfarrers, des Bonner Legationsrats, der vielen Sanitätsschwestern. Manche fielen ihnen sogar um den Hals. Die meisten fühlten sich dazu allerdings zu schmutzig in ihren wattierten Lagerjacken; sie waren in der Lagerhaft ängstlich und weltscheu geworden. Unsicher bestiegen sie die bereitgestellten Busse, die in langer Reihe auf den Weitertransport ins Aufnahmelager Friedland warteten, wo der Hauptakt der Empfangszeremonie stattfinden sollte.
Empfang der letzten Kriegsheimkehrer an der Grenze in Herleshausen, 1955. Krankenschwestern stehen mit heißem Tee und belegten Broten bereit. Sogar der Schlagbaum ist festlich geschmückt.
Bis gestern waren sie «Plennis» gewesen, wie sie sich selber nannten – nach dem Begriff Wojna Plenni für Kriegsgefangene. Noch ein paar Stunden, dann sollten aus den Plennis Bürger der Bundesrepublik werden. Zehn Jahre und mehr waren sie zu einer rechtlosen grauen Masse zusammengeschmolzen, gewohnt, hin und her geschubst zu werden, beim Gehen kräftesparend zu schlurfen und nicht aufzufallen. Sie kamen aus Lagern wie Workuta, Stalinogorsk oder der Stadt Asbest, aus Kohlegruben, Aluminiumhütten, Papiermühlen und Steinbrüchen. Überlebende von Ausbeutung und von Hungersnöten, aus denen sich die Sowjetunion Jahr um Jahr herausgearbeitet hatte, auch dank der Lagerhäftlinge. Tags im Moor oder Kohleflöz, nachts eng nebeneinanderliegend in langen Reihen, Körper an Körper, dazu noch übereinander in drei Pritschenetagen, ausgesaugt von Wanzen und Läusen. Was nach so vielen abstumpfenden Jahren vom Individuum übrig geblieben war, hatte sich in den ausgezehrten Körpern versteckt, in den Erinnerungen zumeist, weniger in den Hoffnungen.
Die Bundesrepublik hatte den Einzug dieser 412 «Spätestheimkehrer», wie sie offiziell genannt wurden, gut vorbereitet. 412 von 9624, die in den nächsten Wochen Zug um Zug noch kommen sollten. «Die letzten Zehntausend», wie sie überall genannt wurden – die letzten von rund zwei Millionen Menschen, die die Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion überstanden hatten.[2] Einem Drittel der Gefangenen hatte die Lagerhaft das Leben gekostet.[3] Die Heimkehrer kamen aus einem Krieg, der weltweit ungefähr sechzig Millionen Opfer gefordert hatte, eine schier unfassbare Menge, allein achtundzwanzig Millionen in der Sowjetunion. Das überschaubare, sauber durchgezählte Häuflein von Herleshausen hatte also eine Zeit überlebt, in der man die Zahl ihrer toten Schicksalsgenossen nur sehr grob überschlagen konnte, tausend Tote mehr oder weniger galten 1945 nicht viel. Inzwischen hatte man das einzelne Leben wieder schätzen gelernt. Und anders als die Millionen Heimkehrer vor ihnen, die kurz nach Kriegsende repatriiert worden waren, kamen «die letzten Zehntausend» nicht in ein zerbombtes Land, das kaum wusste, wie es sie ernähren sollte, sondern in eine perfekt organisierte Willkommensmaschinerie. In allen Dörfern an der vierundsechzig Kilometer langen Strecke zwischen Herleshausen und Friedland säumten Hunderte von Menschen die Straße. Jeder Ort, den die Busse durchfuhren, ließ seine Kirchenglocken läuten, seine Kinder jubeln, die Einwohner winken. Die Heimkehrer, noch eingeschüchtert von der abweisenden Behandlung in der DDR, trauten ihren Augen nicht. Mit allem hatten sie nach Jahren der schikanösen Zwangsarbeit gerechnet, aber nicht mit diesem triumphalen Empfang.
Radio und Zeitungen hatten die Westdeutschen schon Wochen vorher instruiert und die Begrüßung der Heimkehrenden zu einer nationalen Ehrensache gemacht. «All unser Hoffen und unsere Freude auf diese Heimkehrer trägt einen berechtigten nationalen Charakter», hatte «Die Zeit» gemahnt: «Eine Tatsache, deren Erkenntnis uns gerade in dieser an echter Gemeinsamkeit so armen Zeit nicht deutlich und wichtig genug sein kann.»[4] Vielen Heimkehrern war es in den ersten Nachkriegsjahren nicht gelungen, in der Heimat Fuß zu fassen. Verbittert und traumatisiert waren sie Sonderlinge am Rande der Gesellschaft geblieben. Nun, zehn Jahre nach Kriegsende, sollte es besser gelingen: Aus vielen Städten waren die Menschen angereist, um ihren Beitrag zum würdigen Empfang zu leisten. In einem Dankesbrief erinnerte sich einer der Heimkehrer später an seine Rückkehr wie an einen Triumphzug: «Der Jubel aller ist unser Begleiter. (…) Es ist, als ob uns eine Woge deutscher Treue empfängt, in der wir sicher ruhen. (…) Wie sie zu uns sprechen! Ja – hier sind wir frei. Das Schandmal des Verbrechers ist von uns abgefallen.»[5] Sarkastisch kommentierte eine britische Wochenschau: «Eine Grenze wird überquert, und aus 9000 Kriegsverbrechern werden 9000 Helden.»[6]
Moskau
Diesem glücklichen Tag waren dramatische Verhandlungen zwischen Bonn und Moskau vorangegangen. Stalin war seit zwei Jahren tot, die Sowjets strebten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen und den Abschluss eines Handelsvertrags mit der Bundesrepublik an. Die Bundesrepublik traute den russischen Friedensofferten aber nicht. Sie sah in der Sowjetunion einen unberechenbaren Aggressor, einen «Bären», wie es immer wieder hieß, der sich WestBerlin jederzeit einverleiben und nicht zögern würde, weiter nach Westen vorzudringen, sobald die USA nachließen, die Bestie einzuschüchtern. Als Adenauer im Frühherbst 1955 zu Verhandlungen in die russische Hauptstadt reiste, um die letzten Kriegsgefangenen freizubekommen, fürchtete er angeblich sogar um sein Leben.[1] Die Sorge um den Kanzler machte die Heldenverehrung, die aus dieser Reise erwachsen sollte, nur umso größer. Mit hundertvierzig Begleitpersonen traf Adenauer am 8. September 1955 in Moskau ein, er selbst mit den engsten Vertrauten im Flugzeug, der Rest der riesigen Delegation in einem deutschen Sonderzug, der mit einem abhörsicheren Salon, zwei Mercedes-Dienstwagen sowie einer Küche ausgerüstet war, in der vertrauenswürdige deutsche Köche die Speisen zubereiteten. Der Kanzler hatte Angst, während seines Aufenthalts in Russland vergiftet zu werden.
Der Erwartungsdruck, der auf dieser Reise lastete, war groß. In Deutschland glaubte man, dass in den sibirischen Lagern noch hundert- bis zweihunderttausend Kriegsgefangene ausharrten. Weit gefehlt: Die Sowjets hatten eine präzise Liste verbliebener Gefangener vorgelegt, eben jene 9624, die Adenauer nun freizubekommen hoffte. Mehr waren nicht mehr am Leben. Für die riesige Menge an Menschen, die auf eine Rückkehr ihrer Angehörigen warteten, würde es nach dem Tag der letzten Freilassung keine Hoffnung mehr geben. Wer dann nicht dabei war, blieb voraussichtlich für immer vermisst. Irgendwo in einem Massengrab verscharrt oder von Detonationen so zerfetzt, dass es nichts zu begraben gab. Nach 1957 erreichten noch vierhundertfünfzigtausend Suchmeldungen des Roten Kreuzes die Sowjetunion.
Sechs zermürbende Verhandlungstage standen bevor, um die Entlassung der Gefangenen zu erzielen. Auf russischer Seite führten Ministerpräsident Nikolai Bulganin und Parteichef Nikita Chruschtschow die Verhandlungen. Ihnen gegenüber Konrad Adenauer: nicht mehr der zerknirschte Nachlassverwalter des besiegten Nazireichs, über dessen Schicksal die Sowjets mit den übrigen drei Alliierten einmütig zu befinden hatten, sondern das selbstbewusste Oberhaupt eines Landes, das aus den Trümmern des geteilten NS-Deutschlands auf verblüffende Weise erstarkt war. Nur zehn Jahre nach Kriegsende hatte die Bundesrepublik ihre fast vollständige Souveränität wiedererlangt, war seit vier Monaten Mitglied der Nato, war Teil der europäischen Montanunion und der sich in Gründung befindlichen europäischen Wirtschaftsallianz, fest eingebunden in die westliche Gemeinschaft, die der Sowjetunion im Kalten Krieg bedrohlich gegenüberstand. Aus den einstigen Verbündeten des Weltkriegs – Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich – waren Gegner im Kalten Krieg geworden und aus dem zwischen ihnen aufgeteilten Deutschland ein Konfliktherd mit großem Explosionspotenzial. Daran, dass er sich wirklich entzündete, war niemandem ernstlich gelegen, auch der sowjetischen Führung nicht. Chruschtschow brauchte Zeit und Ruhe für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. In Moskau standen die Zeichen bereits auf Tauwetter.
Deshalb hatte auch die Sowjetunion Anfang des Jahres den Kriegszustand mit Deutschland für beendet erklärt, drei Jahre nach den Westalliierten. Eigentlich war damit die Sachlage klar: Ohne Krieg dürfe es auch keine Kriegsgefangenen geben; sie einzubehalten, würde schon seit Jahren gegen Völker- und Kriegsrecht verstoßen – so die deutsche Position. Die angeblichen Kriegsgefangenen seien aber gar keine, erklärte Chruschtschow, die letzten seien 1950 entlassen worden. In russischem Gewahrsam befänden sich lediglich noch verurteilte Kriegsverbrecher, die ihre Strafe zu Recht absäßen. Als Gegenleistung für ihre Freilassung verlangte die sowjetische Regierung zumindest die Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen mit Bonn. Keine allzu forsche Forderung, sollte man meinen, aber sie erschien in westdeutschen Augen unmöglich zu erfüllen: Mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion würde fast zwangsläufig eine gewisse Normalisierung im Verhältnis zur DDR einhergehen; die Nichtanerkennung der DDR gehörte aber zu den höchsten Prinzipien der westdeutschen Außenpolitik. Aus Sicht der Sowjetunion erschien dagegen die staatsrechtliche Ignorierung «ihres» Deutschlandanteils als eine kleinliche, groteske Realitätsverleugnung, unerhört angesichts des unfassbaren Blutzolls, den die Russen im Weltkrieg hatten entrichten müssen, bis sie die deutschen Soldaten endlich wieder nach Westen zurückgedrängt und besiegt hatten.
Zehn Jahre waren für die Russen eine viel zu kurze Zeit, um über die unvorstellbaren Verluste der sowjetischen Bevölkerung nicht immer wieder die Fassung zu verlieren. Stundenlang referierte die russische Delegation Details der Tötung von insgesamt zwölf Millionen Zivilisten. Als Adenauer in einer Replik davon sprach, es habe schließlich auch russische Gräueltaten gegeben, kam es zum Eklat. Das Wort «Gräueltaten» war durch einen Übersetzungsfehler in die Runde gekommen, wörtlich hatte Adenauer von «entsetzlichen Dingen» gesprochen.[2] Aber zu spät: Adenauer erlebte einen der berüchtigten Wutanfälle Chruschtschows, der den Abbruch der Gespräche einzuleiten schien. Vier Tage zähen Verhandelns schienen umsonst gewesen zu sein.
Aber man verhandelte weiter, erschöpft und erbittert, durchlitt weitere Tage voller emotionaler Höhen und Tiefen, Bluffs und Tricks, bis beide Seiten hatten, was sie wollten: Chruschtschow die Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen zwischen Moskau und Bonn, Adenauer die – allerdings nur mündliche – Zusicherung, alle verbliebenen Gefangenen würden freigelassen. Gegen den Rat seiner gesamten Delegation ließ sich der Kanzler darauf ein. Mit fast leeren Händen, mit nichts als Chruschtschows Wort, kehrte er nach Bonn zurück. Und behielt recht: Die bald darauf eingeleitete «Heimkehr der Zehntausend» führte Adenauers Anerkennung in Deutschland auf ihren Höhepunkt. Inzwischen spricht viel dafür, dass Chruschtschow ohnehin vorhatte, die letzten Internierten freizulassen,[3] und sie nur als Faustpfand für seine weiteren Ziele benutzte, aber der neunundsiebzigjährige Adenauer war mit der Heimführung der verlorenen Söhne zum Helden einer nationalen Heilsgeschichte geworden. Als eine von Dankbarkeit hingerissene alte Dame, vermutlich die Mutter eines Heimgekehrten, dem Kanzler während einer Rede beharrlich die Hand zu küssen versuchte, sodass er sie immer wieder wegziehen musste, war es selbst ihm, der tiefe Verehrung genoss und wohl auch beanspruchte, dann doch ein bisschen peinlich.
Das «Wunder von Friedland» rückte im Kalender der bundesdeutschen Mythen neben das «Wunder von Bern», den Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft, mit dem sich das soeben noch verfemte Land ein Jahr zuvor, 1954, wieder an die Weltspitze gekämpft hatte. Beide Ereignisse markieren das Ende der unmittelbaren Nachkriegszeit, eine vielleicht etwas voreilige Zäsur, aber ein Markstein der Geschichte gewiss. Die Rückkehr der Zehntausend zementierte den Ruf des Kanzlers derart, dass er noch weitere acht Jahre im Amt bleiben konnte, bis er 1963 im Alter von siebenundachtzig Jahren widerstrebend zurücktrat.
Friedland
Zurück in den Oktober 1955, als die ersten der von Adenauer Heimgeholten in ihren Bussen auf Friedland zurollten. Ausgerechnet jetzt, da das ausgehandelte Wunder sich planmäßig vollziehen sollte, lag der Kanzler mit einer schweren Erkältung im Bett. Statt seiner musste Bundespräsident Theodor Heuss die Heimkehrer empfangen, zusammen mit rund zehntausend Menschen, die sich zwischen den Baracken und Nissenhütten drängelten: Angehörige, Schaulustige, unzählige Journalisten und Pressefotografen waren herbeigereist. Ihren Hunger konnten sie an Würstchenbuden stillen, ambulante Händler verkauften «Friedlandplaketten» zur bleibenden Erinnerung. Verzweifelte Menschen hielten Plakate mit den Namen und Fotos ihrer noch immer vermissten Angehörigen in die Höhe. Als sich der erste Aufruhr gelegt hatte, begann Heuss zu sprechen. Wer seinen eigentümlich tiefen, sehr langsamen und dabei so melodischen Tonfall je gehört hat, und sei es als Youtube-Dokument, wird ihn so schnell nicht wieder vergessen. Der liberale Heuss, Bundespräsident seit 1949, verkörperte ein in höchsten Kreisen ungewöhnliches Maß an Umgänglichkeit, Besonnenheit und Wärme. «Liebe Landsleute», sagte er, «das Grußwort, das ich für das deutsche Volk zu sprechen habe, kann ganz einfach sein: Ein herzliches Willkommen!»[1]
Den Heimkehrern muss Heuss vorgekommen sein wie ein Staatsoberhaupt von einem anderen Stern, der nichts gemein hatte mit dem Deutschland, für das sie in den Krieg gezogen waren. Von Hitler zu Heuss, das war schon klanglich ein weiter Weg. Das Deutschland, das diese Landser zuletzt gekannt und in Erinnerung behalten hatten, war das Land der gebrüllten Hasstiraden, des irrlichternden Führerpathos und der verächtlichen Kommandos der SS, die die Soldaten zum längst verlorenen Kampf getrieben hatte. Und nun dieser freundliche Herr, der die Würde des höchsten Amtes mit der ganzen Behaglichkeit auskleidete, zu der der deutsche Sprachklang fähig ist. Die Plennis waren in ein gründlich verändertes Land gekommen; der Präsident, der da zu ihnen sprach, war ein Ausbund an bürgerlicher Zivilität. Kein Wort von Opfer, Vaterland, Pflichtgefühl, Heldentod und Volkes Dank.
Nach Heuss trat der Sprecher der Heimgekehrten an die Mikrofone und bat mit seltsam bellender, gehetzter Stimme um Verständnis, dass man sich noch ganz fremd fühle: «Wundern Sie sich nicht, dass Sie hier nur ernste Gesichter sehen. Es muss sich etwas lösen, bevor wir froh sein können, dass wir diesen Moment erleben, auf den wir zehn, elf, zwölf, ja dreizehn Jahre warteten, etliche sogar länger.»
Tatsächlich war manches Wiedersehen schwer durchzustehen. Ungläubig starrten sich einige Paare an, die einander vorgestellt worden waren. Sie hatten Mühe, sich wiederzuerkennen, Mühe auch, ihre Enttäuschung zu verbergen. Sie waren jung auseinandergerissen worden und hatten sich so jung in Erinnerung behalten. Nun waren sie alt, viel älter noch, als sie es der Zahl der Jahre nach waren. Steif standen sie voreinander, stumm, verlegen, unschlüssig.
Ankunft im Lager Friedland. Das Paar hält sich nach mehr als zehn Jahren Trennung wieder in den Armen.
Andere fielen sich stürmisch in die Arme, alle Fremdheitsgefühle erst einmal niederreißend, der Rest würde sich schon irgendwie ergeben. Bei einigen war die Mutter gekommen oder die Schwester; der Rest der Familie war über die Jahre auseinandergebrochen, die Frauen längst anders verheiratet. Viele hatten niemanden mehr, sie drückten sich möglichst weit hinten herum und schauten sich das Spektakel der familiären Wiedervereinigungen aus der Distanz an. Eine alte Frau streifte durch die Reihen der Einsamen und musterte die Männer mit peinlicher Intensität. Zweifelnd, bohrend blickte sie allen ins Gesicht, die auch nur entfernt an ihren seit Jahren vermissten Sohn erinnerten.
Als die letzte Rede gehalten war, die Freiheitsglocke von Friedland erklang und die Heimgekehrten, Angehörigen und Zuschauer den Choral «Nun lobet alle Gott» anstimmten, gab es kein Halten mehr. Noch den Hartgesottensten standen Tränen in den Augen, die Pressefotografen ließen die Kameras sinken und weinten hemmungslos.
Wieder und wieder wurden diese Szenen in den Kinowochenschauen und im Radio gebracht. Da sich die weiteren Transporte in der Folge über viele Wochen hinzogen, wiederholten sich die Willkommensfeiern. Stets aufs Neue bekamen die Kinder schulfrei, stand der Bonner Legationsrat, der inzwischen ein Zimmer im nahe gelegenen Hotel «St. Georg» bezogen hatte, an der Zonengrenze zur Begrüßung bereit, säumten die jubelnden Menschen die Bundesstraße nach Friedland, ertönte die Freiheitsglocke mächtig über dem tristen Platz. Und stets aufs Neue machten die Reporter ihre Heimkehrer-Interviews, die sich inzwischen zu einem eigenen Genre gemausert hatten. «Wie ein massenmedialer Kirchturm verbreitete das Radio die Erlösung der Kriegsgefangenen», schrieb der Rundfunkhistoriker Michael Stolle, der die zahllosen Reportagen aus Friedland untersucht hat: «Die Glocke von Friedland kann als mediales Erlösungs- oder Auferstehungsmuster (…) gedeutet werden, als ein Moment, in dem der Tod überwunden war und sich die überlebende Gemeinschaft zur Auferstehungsfeier trifft.»[2]
Gerade unter den Bessergestellten gehörte es in diesen Monaten zum guten Ton, sich um Heimkehrer zu kümmern. Kamen diese aus dem Lager Friedland in ihre Heimatorte, ging deshalb der Begrüßungstaumel noch einmal los, wurden auf dem Marktplatz Reden gehalten, Blumengebinde überreicht, Warengutscheine der örtlichen Einzelhändler übergeben. Es war, als ob die Bundesrepublik zugleich feierte, was sie in den zehn Jahren seit Kriegsende erreicht hatte und welche Großzügigkeit sie sich nun leisten konnte. Nach den Veranstaltungen wurden die Umarmten allerdings umso rascher vergessen und fielen der üblichen Gleichgültigkeit anheim. Deshalb mahnte der hessische Innenminister, das Mitgefühl für die Heimkehrer «dürfe nicht in großen und kleinen Empfängen verlodern»[3].
Bundespräsident Heuss dagegen fand schon bei dem Ereignis an sich, der Zeremonie in Friedland, nicht die rechte Lust; er hatte sich regelrecht zwingen müssen, ins Lager zu fahren, um die Entlassenen zu begrüßen. «Da ich glaube, dass mancherlei unerfreuliches Volk unter den Entlassenen sein mag, wollte ich lieber die Heimkehr verschleppter Frauen abwarten», schrieb er an seine langjährige enge Freundin Toni Stolper.[4] Er wusste, dass eine Menge Ungesühntes und Unausgestandenes mit den Transporten nach Deutschland rollte und der Rausch, mit dem die Begrüßung zelebriert wurde, nicht nur hehren Motiven diente. Unbequeme Fragen, die sich fast von selbst hätten ergeben müssen, half der Freudentaumel im Keim zu ersticken. «Wir haben eine ungerechte Strafe mannhaft ertragen», reklamierte der Sprecher der Heimkehrer pauschal für alle. Und der «Münchner Merkur» assistierte: «Lasst uns heute nicht rechten, ob dieser oder jener falsch gehandelt hat.»[5] Mit keinem Wort berührten die Journalisten in ihren Friedland-Reportagen die Frage, mit welchen Begründungen genau die Spätheimkehrer so lange in Gefangenschaft gehalten worden waren und ob an den Haftstrafen nicht in Einzelfällen doch etwas Gerechtes war. Keine Schulddiskussion sollte die mitreißend formulierten Heimkehrgeschichten stören.
Die führenden Politiker allerdings wussten, dass eine Menge unangenehmer Fragen die Freude bald trüben könnte. Die Plennis selbst hatten während der Haft wenig Neigung verspürt, sich nach Tätern, Haupttätern und Schuldlosen auseinanderzudividieren. Sie waren zu einer schikanierten Gefangenenmasse zusammengewachsen, deren Hass sich vor allem gegen die kommunistischen deutschen Helfershelfer der sowjetischen Lagerleiter richtete, weniger gegen die führenden Nazis unter ihnen, die ihnen den Schlamassel erst eingebrockt hatten. Aber das Prinzip «Schwamm drüber», unter Lagerbedingungen verständlich, würde einer genaueren Beobachtung nicht lange standhalten. Was da in abgewetztem Feldgrau als armselige, kaum unterscheidbare Menge daherkam, war in Wirklichkeit so verschieden, wie eine Gruppe nur sein kann. Massenmörder waren darunter, aber auch ehemalige Studenten, die nur wegen des Verteilens von ein paar Flugblättern in der Nachkriegszeit verhaftet worden waren. Nur etwa zwei Drittel unter ihnen waren ehemalige Soldaten, die anderen waren unmittelbar nach Kriegsende verschleppt worden. Darunter willkürlich wegen Spionage Verurteilte, wegen Diebstahls an Volkseigentum (oftmals nur Jacke und Hose) oder wegen antisozialistischer Stimmungsmache (ein Brief in die Westzone reichte).
Die Sowjets hatten schon vorsortiert: Da waren die sogenannten vierhundertzweiundfünfzig «Nichtamnestierten», schwere Fälle, für die Moskau ausdrücklich eine weitere juristische Prüfung verlangt hatte. Diese kamen gar nicht erst in Friedland an, sondern in der Bundesgrenzschutzkaserne Hannoversch-Münden, wo sie durchs Auswärtige Amt und alliierte Geheimdienste verhört wurden, bevor man sie vorläufig in die Freiheit entließ. Unter den Zurückgekehrten befanden sich auch Kriegsverbrecher und Massenmörder, für die kaum ein Urteil zu hart war. Zum Beispiel Carl Clauberg, Gynäkologe im Dienst der SS, verantwortlich für grausame Sterilisationsexperimente in Auschwitz und Ravensbrück. Er hatte dort mit äußerst schmerzhaften Massensterilisierungen durch das Einspritzen ätzender Chemikalien experimentiert. Himmler gegenüber prahlte er damit, auf diese Weise ganz allein eintausend Frauen am Tag sterilisieren zu können, um den Nachwuchs «missliebiger Völker» effektiv zu unterdrücken. Oder die KZ-Blockführer Wilhelm Schubert und Gustav Sorge aus Sachsenhausen, verantwortlich für unsägliche Quälereien und Dutzende Morde von eigener Hand; auch an der Tötung von mindestens zehntausend russischen Kriegsgefangenen in der Genickschussbaracke von Sachsenhausen waren sie beteiligt.
Sie alle ließ man, um den allgemeinen Freudentaumel über die Massenrückkehr nicht zu stören, zunächst einmal unerwähnt und unbeschadet in ihre Familien zurückkehren. Clauberg fand wieder eine Anstellung an seiner alten Universität Kiel und wurde dort als eine Art Märtyrer empfangen. Drei Monate später, im Januar 1956, drängte Adenauer in einer Kabinettssitzung auf die Strafverfolgung von besonders schweren NS-Tätern unter den Spätheimkehrern, sei es aus Rücksicht aufs «Ausland», wie es in der Sitzung hieß, sei es aufgrund der traumatischen Erfahrung seiner eigenen KZ-Haft. Wer ein KZ erlebt habe, wisse, dass diese Leute zu allen Verbrechen bereit gewesen seien, sagte Adenauer im Kabinett.[6] Seine Minister reagierten darauf hinhaltend und ausweichend, typisch für die schleppende Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der frühen Bundesrepublik. Carl Clauberg jedoch wurde im Februar 1956 in der Psychiatrischen Klinik Neustadt in Holstein verhaftet. Dorthin war er eingeliefert worden, weil er seine Frau mit Morddrohungen tyrannisiert hatte. 1957 starb er in der Untersuchungshaft. Die KZ-Schergen Schubert und Sorge wurden vom Landgericht Bonn 1959 zu lebenslanger Haft verurteilt.
Selbstverständlich konnten die bisweilen haarsträubend willkürlichen Urteile der sowjetischen Gerichte nicht einfach ungeprüft übernommen werden. Hatte in manchen Fällen die bloße Zugehörigkeit zur SS für das Pauschalurteil von fünfundzwanzig Jahren Besserungslager gereicht, ohne dass man konkrete Verbrechen mit individueller Tatbeteiligung nachgewiesen hatte, waren andere Verurteilte bloß ihrer Prominenz zum Opfer gefallen: Erich Hartmann, mit dreihundertzweiundfünfzig anerkannten Abschüssen der erfolgreichste Jagdflieger des Zweiten Weltkriegs, war zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden, obwohl er nur an Luftkämpfen teilgenommen und nie gegen das internationale Kriegsrecht verstoßen hatte. Der Dreiunddreißigjährige gehörte zu den in Friedland Angekommenen, denen man das Grauen der Lagerhaft schon von weitem ansah. Andere hatten Mühe, ihre einigermaßen stabile Verfassung zu erklären, denn die letzten Lagerjahre waren trotz aller grausamen Härten nicht mehr von dem Hunger bestimmt, der die ersten Nachkriegsjahre geprägt hatte. Erich Hartmann aber sah erschreckend aus: die Wangen eingefallen, das Gebiss zeichnete sich unter der Haut ab, die Augen lagen in tiefen Knochenhöhlen. Er hatte bis zum Schluss gegen das Unrechtsurteil aufbegehrt und war dafür mit Nahrungsentzug, Folter und Karzer bestraft worden. Immer wieder hatte er protestiert, war mehrfach in den Hungerstreik getreten, hatte die Arbeit verweigert und inständig verlangt, erschossen zu werden – eine Qual, die sich tief in seine Erscheinung eingegraben hatte.
Bei seiner Ankunft in Friedland wurde Hartmann von seinem einstigen Vorgesetzten, dem ehemaligen Luftwaffenkommandeur Hans Hahn, in die Arme genommen. Hahn war inzwischen ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein Selfmademan wie aus dem Bilderbuch der jungen Bundesrepublik. Er sah ganz nach Borgward Coupé aus, nach Villa mit Garten, Italienurlaub, nach dem ganzen Chic der fünfziger Jahre. Wie die beiden so unterschiedlichen Menschen sich gegenüberstanden, arriviert und wohlgemut der eine, geschunden und existenziell überfordert der andere, beide unendlich glücklich über das Wiedersehen, ergab sich ein seltsames Bild, eine Art Zeitriss. Das Gesicht des Krieges war wieder erschienen, mitten in der komfortabel gewordenen Gegenwart, ein Gesicht, in das sich das Entsetzen dauerhaft eingezeichnet hatte, als wolle es niemals weichen. Wie viele Menschen hatten vor zehn, zwölf Jahren noch genau so ausgesehen, in ganz Europa. Und jetzt standen einige Hundert von ihnen wieder da, mitten im Wohlstand, wie ausgespien aus der Vergangenheit.
«Heimkehren ist schwerer als Weggehen»
Dass die junge Bundesrepublik ein seltsames Land war, lernten die Entlassenen schnell. Sechstausend Mark Eingliederungsgeld erhielten die soldatischen Heimkehrer, die als echte Kriegsgefangene eingestuft wurden, eine Menge Geld für den Anfang. Die sogenannten «Politischen» aber, auch «Zivilinternierte» genannt, die wegen ihres Ungehorsams und ihrer Auflehnung eingekerkert worden waren, erhielten nichts.[1] Unschuldig in der Ostzone in die Mühlen der Verfolgung geraten zu sein, galt als Privatschicksal, für die der westdeutsche Staat keine Verantwortung übernahm. Diese Unterscheidung zwischen Soldatischen und Politischen gehörte zu den vielen neuen Distinktionen, an die sich die Heimkehrer erst gewöhnen mussten. Andere waren konfessioneller Natur: In Friedland bekamen die Protestanten ein einfaches Hemd, Hose und Pullover; die Katholiken aber einen richtigen Sonntagsanzug. Die Kirchen hatten bei der Spendenauswahl verschiedene Prioritäten gesetzt.
Als sie Friedland verließen, entlaust, gewaschen, neu eingekleidet, gingen die Heimgekehrten auseinander in ein Land, das wiederzuerkennen ihnen große Mühe machte. In rosafarbenen Milchbars tranken junge Leute kreischend bunte Mixgetränke. Eine filigrane Architektur aus Beton und Glas ragte kühn in die Höhe. In den großen Städten kurvten junge Frauen auf Vespas herum. Die feindlichen Soldaten von einst – Franzosen, Amerikaner und Briten – spazierten durch Deutschland, um es zu beschützen. Die Jugend hörte begeistert deren Soldatensender, klinkte aus zur Musik von Bill Haley und den Chordettes, trauerte um James Dean und Charlie Parker. Caterina Valente sang: «Komm ein bisschen mit nach Italien». Aus den Musikboxen klang ihr Lied «Nur ein Zigeuner hat soviel Sehnsucht nach den Sternen», und die Menschen summten mit, so beseelt, als hätte es die Ermordung der Roma und Sinti nie gegeben. Ein gewisser Jerry Lewis beherrschte die Kinoleinwände. Und ein junges Mädchen namens Romy Schneider, die die österreichische Kaiserin als einen süßen Fratz spielte: «Sissi» brach alle Zuschauerrekorde. Das europäische Kernforschungslabor Cern war soeben gegründet worden, der millionste Käfer vom Band gerollt. Auch frische deutsche Soldaten gab es wieder. In dem Jahr, als «die letzten Zehntausend» aus Russland zurückkehrten, wurden die ersten Bundeswehrsoldaten vereidigt. Seit Juli des Jahres hatte die junge Republik ein eigenes Verteidigungsministerium, zuvor fünf Jahre lang kleinlaut «Dienststelle Blank» genannt und in vollem Wortlaut: «Dienststelle des Bevollmächtigten des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen». So klang der Kalte Krieg auf Bonner Beamtendeutsch.
An zwölf Prozent Wirtschaftswachstum erfreute sich die Bundesrepublik 1955, ein nie wieder erreichter Wert, und verspürte doch ein Vakuum. Ein Land ohne Idee, sagten seine Kritiker. Ein Land der Ohnemichels – ohne Gemeinschaftsgefühl, ohne Zusammenhalt, eine Erfindung der Alliierten. Ein Land, in dem man zehn Jahre nach Kriegsende und den schlimmsten Hungerwintern schon wieder mit dem Wohlstand haderte: «diesem schlaraffenland, wo es aufwärts geht, aber nicht vorwärts», schrieb Hans Magnus Enzensberger in seinem berühmten Gedicht «Landessprache», «wo in den delikatessgeschäften die armut (…) aus dem schlagrahm röchelt».[2] Dass man das Wort «satt» schon wieder als Schimpfwort gebrauchte wie in der beliebten Wendung vom «satten Wohlstandsbürger», muss den notdürftig ernährten Spätheimkehrern mehr als bizarr vorgekommen sein.
Einkaufsbummel in einem gründlich geänderten Land. Am MünchnerStachus, zehn Jahre nach Kriegsende.
«Heimkehren ist schwerer als Weggehen», stand am Schwarzen Brett im Lager Friedland. Die Bundesrepublik war ein seltsames Land, die DDR nicht minder. Unfassbar, wie sehr sich die Heimat in nur zehn Jahren verändert hatte. War sie überhaupt noch wiederzuerkennen? «Wir sind wieder wer», hörte man 1955 oft. Aber wer? Das war die entscheidende Frage, die man vor sich herschob. Die Fähigkeit der Deutschen zu grübeln sei augenblicklich fast erschöpft, gestand der konservative Schöngeist Friedrich Sieburg seinen Landsleuten zu.[3] Eines jedoch machte den Heimkehrern das Eingewöhnen leichter: Es gab viel zu tun. In Nachkriegsdeutschland wurde gearbeitet bis zum Umfallen. Diesmal allerdings freiwillig.
Zweites KapitelUnter vollem Dampf – Kohle, Öl und Gastarbeiter: die Zutaten des Wirtschaftswunders
«Das Öl ist über den Zaun gestiegen, es will im Garten der Kohle ernten.»
Walter Köpping, IG Bergbau und Energie
Wie der Wohlstand klingt
Wer in den fünfziger Jahren auf das Ruhrgebiet zufuhr, sah es schon eine Stunde, bevor er dort ankam. In der Ferne verdüsterte sich ein Teil des Himmels. Schlechtes Wetter war das nicht, was sich hier zusammenbraute; es war unheimlicher, statischer, nicht so leicht aufzulösen wie ein Tiefdruckgebiet. Näher herangekommen, sah man, dass die Verfinsterung des Firmaments menschengemacht war. Aus Hunderten von Schloten stiegen Schwaden von Rauch und Dreck auf. Weißer, gelber, orangeroter Qualm bis hin zu fast schwarzem. Eine giftige Farbpalette, nuancenreich wie ein Bild von Monet, wenn auch fahler. Die Sonne drang nur schwach durch den Dunst, der alle paar Kilometer anders roch: nach feuchter Kohle, nach beißendem Schwefel, nach Öl, nach geheimnisvollen Gasen, die unzähligen Leitungen entwichen, welche die Städte durchzogen – Zutaten für eine alchimistische Hexenküche, deren wichtigste «Schwarzes Gold» hieß. Kein Zufall, dass Kohle heute noch ein Synonym für Geld darstellt: Zaster, Asche, Kohle.
Unter dem düsteren Himmel war man im Herzen des deutschen Wirtschaftswunders angekommen, einem unaufhörlich arbeitenden Organismus aus Zechen, Hochöfen, Kokereien und Teerdestillen. Viele Tausend emsige Betriebe, die ein magisches, ökonomisches Dreieck bildeten: Kohle, Stahl, Chemie. Sich über einhundert Kilometer von Ost nach West ausdehnend, sechzig Kilometer breit, war das Ruhrgebiet die größte Industrieregion Europas. «Die Vorstellung, dass hier Menschen leben (…), mag dem Fremden phantastisch vorkommen», schrieb Heinrich Böll 1958 aus der Sicht eines Mannes, der mit dem Zug hindurchfuhr. Schier unglaublich, «obwohl er die Menschen sieht: auf Bahnsteigen, Straßen, auf Schulhöfen, am Küchenherd; er glaubt nicht an diese Menschen, hält sie für Phantome, Verlorene, Verdammte; Pathos, Mitleid, ein wenig Verachtung mischen sich zu einem Gefühl, das sich in einem Seufzer ausdrückt.»[1] Fünf Millionen Menschen, in Städten lebend, die formlos ineinander übergingen. Ihren einstigen Charakter als kompakte, fest umrissene Ortschaften hatten Dortmund, Duisburg, Essen und Bochum längst eingebüßt. Man siedelte, wo die Industrie Platz ließ, zwischen Hütten, Fabriken und Fördertürmen, zwischen Abraumhalden und Industriebahnlinien, umgeben von kümmerlichem Grün, das mit der Lichtknappheit kämpfte. Das Wichtigste spielte sich unter der Erde ab. Allein eine halbe Million Menschen arbeiteten daran, dem durchlöcherten Boden die Kohle zu entreißen, eine weitere halbe Million, um mit ihrer Hilfe Stahl herzustellen.
Wirklich schön war das Ganze des Nachts, wenn die Feuer der Hochöfen den Horizont illuminierten, es aus den Schloten loderte und der Himmel erfüllt war von unzähligen flackernden Flammen. Weithin kündeten sie davon, welch unvorstellbare Energien ringsum entfacht und gebändigt wurden. Der Lärm hunderttausendfacher Industriearbeit erfüllte die Nacht und verdichtete sich zu einem unaufhörlich pulsierenden Klangteppich, der sanft durch die geschlossenen Fenster drang. Man hörte das Fauchen der Stahlöfen, das Verpuffen der Gase, das beständige Auskippen der Loren, das Prasseln von ausgeschütteter Kohle, das Tuckern der Schiffsmotoren.
Viele Kinder schliefen wunderbar, wenn sie spürten, dass rundherum alles am Wohlstand werkelte. Im Heimatkundeunterricht lernten sie, wie die Kohle gefördert und wie daraus Koks und Gas gemacht, wie Stahl hergestellt wird und wie die Bleche für die Autos gewalzt werden. Dem Krach vertrauten sie, er hatte, da waren sie sich sicher, seinen guten Sinn und Zweck. Eine Sinfonie der Geschäftigkeit, in der man irgendwann einmal selbst seinen Platz finden würde.
Ein Wunder, das keines war
Vom Wirtschaftswunder sprach man im Ruhrgebiet nicht, man wusste ja, wo der Wohlstand herkam. Wunderlich war daran wenig. Man sah es am Schwarz der Häuser, erkannte es an den Bergleuten, die mit fünfzig kaum noch Luft bekamen wegen des Staubs in ihren Lungen, spürte es bei jedem Schichtwechsel, der dreimal täglich die Straßen mit Heerscharen erschöpfter Leute füllte.
Aber die Innenstädte begannen wieder zu strahlen. Bei der Essener Lichtwoche im Dezember 1956 zeigte eine stolze Stadt, dass sie wieder Energie im Überfluss hatte und glitzerte mit vielen Tausend Glühbirnen und Leuchtstoffröhren ins eisige All. Man hatte die erste Dekade des Wiederaufbaus hinter sich, trotzdem bot das Land zehn Jahre nach Kriegsende noch immer ein befremdliches Bild. Zwar waren die meisten Trümmer weggeräumt, aber Neues war oft noch nicht entstanden. Zerbombte Wohnviertel waren verschwunden und hatten gespenstisch leeren Flächen Platz gemacht, die auf ihre Bebauung warteten – weite Mondlandschaften mitten in den belebten Städten. Ein Nebeneinander von oft kühnen, aber seltsam steril wirkenden Neubauten und diesen kahlen Wüsteneien prägte vielfach das Bild. Grau war es; Deutschlands Städte sahen aus wie nach einem rätselhaften Baumsterben, war doch der letzte Baum, der zu verfeuern war, spätestens im Hungerwinter 1947 gefällt worden. Nur ein paar neu gepflanzte Kümmerlinge brachten etwas Grün zwischen den grauen Beton. Noch immer hausten Menschen in provisorischen Nissenhütten und ehemaligen Zwangsarbeiterlagern, bewohnten rasch zusammengezimmerte Kleinhäuser und Behelfshütten. Gleich daneben wuchsen die standardisierten, immergleichen Bauten des Aufbauprogramms aus dem Boden.
Nach zehn Jahren ungeheurer Anstrengungen für den ersten Wiederaufbau war 1955 Gelegenheit, Luft zu holen und Forderungen zu stellen. Noch immer herrschte im Arbeitsleben die 48-Stunden-Woche, gearbeitet wurde an sechs Tagen. Die Gewerkschaften kämpften für eine Begrenzung auf vierzig Stunden und mithin für die Einführung des freien Samstags. «Samstags gehört Vati mir» – diese Gewerkschaftsparole war 1956 in aller Munde, aber es war kein Zufall, dass man die Forderung nach weniger Arbeitszeit einem Kind in den Mund legte. Für die meisten Deutschen gehörte es sich damals nicht, für weniger Arbeitszeit zu kämpfen. Nach 1945 schien ihr Arbeitsethos geradezu pathologisch geworden zu sein, gab es doch nach dem verlorenen Krieg und dem Holocaust nichts mehr, auf das man sonst hätte stolz sein können außer auf das Tempo des Wiederaufbaus.
Als die Philosophin Hannah Arendt 1949 für einen Besuch erstmals wieder aus ihrem amerikanischen Exil nach Deutschland zurückkehrte, beobachtete sie befremdet den Arbeitseifer der Deutschen, den sie als Verdrängungsmethode empfand: «Die alte Tugend, unabhängig von den Arbeitsbedingungen ein möglichst vortreffliches Endprodukt zu erzielen, hat einem blinden Zwang Platz gemacht, dauernd beschäftigt zu sein, einem gierigen Verlangen, den ganzen Tag pausenlos an etwas zu hantieren.»[1] Arbeiten, um zu verdrängen – aus dieser Perspektive schienen Wirtschaftswunder und deutsche Schuld miteinander verknüpft. Die rund fünfundzwanzig Millionen deutschen Beschäftigten hielten 1955 mit einer Wochenarbeitszeit von fünfzig Stunden (einschließlich der Überstunden) den Fleißrekord aller Industrieländer der Welt.[2] Viele Unternehmen warben um Facharbeiter mit der Versicherung, man dürfe bei ihnen arbeiten, bis man nicht mehr könne: Wer wolle, könne zwölf Stunden pro Tag schuften, mindestens.[3]
Der Wirtschaftsaufschwung war allerdings kein exklusiv deutsches Phänomen. Ab 1949 wurde fast ganz Europa von einer Hochkonjunktur erfasst, die beinah ungetrübt bis 1969 anhielt. In Frankreich kennt man das Wirtschaftswunder als «Trente Glorieuses»; es reichte dort von 1945 bis 1975, in Spanien spricht man vom «Milagro español», in Italien vom «Miracolo economico italiano». Nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs sorgten überall sogenannte «Nachholeffekte» für einen anhaltenden Aufschwung. Der Boom war jedoch nirgends so turbulent wie in Deutschland. Zwar begann der Anstieg verzögert, dafür jedoch ging es ab 1950 unerwartet steil bergauf.[4] Die Arbeitslosenquote, 1950 noch bei über elf Prozent, sank innerhalb von elf Jahren unter ein Prozent. Das durchschnittliche Realeinkommen hatte sich unterdessen verdoppelt. Fuhren 1950 nur eine halbe Million Autos über die Landstraßen, waren es 1965 schon mehr als zwölf Millionen. Nie zuvor war eine Gesellschaft derart schnell um so vieles reicher geworden wie die der jungen Bundesrepublik.
Ein Grund für den rasanten Aufschwung war ein neuer Krieg. Am 25. Juni 1950 drangen zweihunderttausend nordkoreanische Soldaten in Südkorea ein mit dem Ziel, das geteilte Land gewaltsam wieder zu vereinen. In die Auseinandersetzungen waren auch China und die USA verwickelt, und aus dem Waffengang wurde schließlich ein erbittert geführter, dreieinhalb Jahre dauernder Krieg mit vier Millionen Toten. Der gestiegene Bedarf an Waffen führte zu einem Aufschwung, der als Koreaboom in die Wirtschaftsgeschichte einging. Von ihm profitierte vor allem die Bundesrepublik. Die Schwerindustrie der großen Nato-Staaten war durch die Rüstungsaufträge ausgelastet, für zivile Zwecke waren keine Kapazitäten mehr vorhanden. In diese Lücke sprang die Bundesrepublik. Die Westalliierten hoben viele der Deutschland nach Kriegsende auferlegten Produktions- und Exportbeschränkungen auf, weil sie die westdeutschen Industriewaren brauchten.
Vor allem die Amerikaner drängten darauf, die westdeutsche Montanindustrie wieder von den Fesseln zu befreien, die sie ihr nach dem Zweiten Weltkrieg angelegt hatten. Gezähmt werden sollte das teutonische Stahlmonster nun durch eine wirksame Kontrolle von innen, durch die Arbeiter. Sie sollten die Krupps und Thyssens, die Schlotbarone, die man zu Recht als Hitlers Kriegsvasallen begriffen hatte, in Zukunft in die Schranken weisen. So waren es ausgerechnet die kapitalistischen USA, die der deutschen Stahlindustrie ein modernes Mitbestimmungsgesetz bescherten, das einen Teil der Unternehmungsführung in die Hände der Gewerkschaften legte. Diese sorgten dafür, dass sich die steigenden Gewinne auch als steigende Löhne niederschlugen und wachsende Konsumlaune die Wirtschaft weiter ankurbelte. So stabilisierte der Koreaboom, entfacht durch einen fürchterlichen Stellvertreterkrieg im Fernen Osten, den ökonomischen Höhenflug in Deutschland, der sogar «die wildesten Träume und Hoffnungen der 1940er Jahre übertraf»[5] und dem besiegten Land eine ungeahnt schnelle Rückkehr auf den Weltmarkt ermöglichte.
Auch die DDR profitierte vom Kalten Krieg. Die Sowjetunion brauchte die Ostdeutschen ebenfalls als Bündnispartner und erklärte den verhassten Feind von gestern zum Brudervolk. Auch sie behandelte die DDR weit pfleglicher, als es ihre Demontagegelüste der ersten Nachkriegsjahre hatten erwarten lassen. Bald wurde die DDR zur führenden Industrienation unter den Comecon-Staaten; ihr Lebensstandard übertraf den der osteuropäischen Länder bei weitem. Dennoch verließen Millionen DDR-Bürger ihren Staat, was wiederum den Aufschwung im Westen steigerte, Ostdeutschland aber mehr als hundert Milliarden Mark an Produktionsausfällen kostete.[6] Fast drei Millionen Menschen kehrten von 1949 bis zum Mauerbau 1961 dem Sozialismus den Rücken, fünfundzwanzig Prozent von ihnen waren «unbegleitete Jugendliche», deren Kreativität und Unternehmungsgeist fortan der DDR-Wirtschaft fehlten. Viele DDR-Bürger waren enttäuscht von der Planwirtschaft und durch unsinnige bürokratische Maßnahmen in ihrem Arbeitseifer frustriert. Der Westen versprach Arbeitsmöglichkeiten, die sich unmittelbar in Erfolgen auszahlen würden, während man im Osten auf morgen vertröstet wurde: «Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben», hieß die Losung, die die gerechte Entlohnung in die Zukunft verschob. Ein bisschen schneller wollte man das bessere Leben schon genießen.
Unter Tage: Josef Stefaniak geht ins Gebirge
Zu den Millionen von Menschen, denen Deutschland nach dem Krieg seinen verblüffenden Aufschwung verdankte, gehörte der Bergmann Josef Stefaniak, geboren 1915 in Duisburg, genannt Jupp. Er stammte, wenn auch in zweiter Generation, aus dem Osten. Seine polnischen Eltern waren noch vor dem Ersten Weltkrieg aus den preußischen Ostprovinzen ins Ruhrgebiet gekommen. Etwa eine halbe Million Polen waren zwischen 1870 und 1918 ins Ruhrgebiet eingewandert. Als Untertanen des deutschen Kaisers konnten sie sich frei im Reich bewegen und Wohnsitz nehmen, wo immer es Arbeit gab. So wurde das Ruhrgebiet zur Heimat der Kaczmareks, Dombrowskis, Podolskis und Schimanskis. Die Familie Stefaniak hatte eigentlich vor, bald zurückzukehren und am Aufbau der 1918 gegründeten polnischen Republik mitzuwirken, aber die Inflation von 1923 hatte ihre Ersparnisse zunichtegemacht, sodass an eine Rückkehr nicht mehr zu denken war.
1929, mit vierzehn Jahren, wurde Josef Stefaniak genau wie sein Vater «Hauer vor Kohle», wie man damals sagte. In einem Alter, in dem man heute gerade mal reif genug ist für «Age of Empires III», fuhr er täglich fünfhundert Meter herunter in einen düsteren Schacht, tief hinein in das angsteinflößend knackende und knisternde Gestein, dem er, bäuchlings liegend, hineingezwängt in einen engen Streb, mit einem schweren Presslufthammer Kohle entriss. Heiß war es dort unten, stickig, voller Energie in den verschiedensten Erscheinungsformen.
Bergmann «vor Ort» und «unter Tage».
Um Jupps Umgebung zu verstehen, müssen wir dreihundert Millionen Jahre zurückgehen in die feuchte Hitze der Karbonzeit. Damals lag das, was einmal das Ruhrgebiet wurde, wegen der Kontinentalverschiebung noch am Äquator. Bewaldete Sümpfe prägten die Tiefebene, das Treibhausklima ließ bizarre Pflanzen wuchern. Schuppen- und Siegelbäume wurden vierzig Meter hoch. Farne und schwankende Schachtelhalme, zwischen denen riesige Insekten lebten, ragten zehn Meter in die Höhe. Sümpfe verschlangen, was sie hervorbrachten, im steten Wechsel von Gedeih und Verderben; die Pflanzen starben ab, versanken im Wasser, wo sie aber nicht einfach verfaulten, sondern, abgeschlossen von Sauerstoff, Torf bildeten. Auch die Torfschicht sank ab, wurde von Ozeanen überflutet, von Geröll und Sand bedeckt, bis wieder neue Sümpfe und neue Torfschichten entstanden. Der Druck der Gesteinsmassen presste das Wasser aus dem Torf, und über die Zeit wurde daraus Braunkohle. Vergingen noch weitere viele Millionen Jahre und lastete noch mehr Druck von oben auf den unteren Schichten, so wurde aus der Braunkohle die wertvollere, energiereichere Steinkohle.
Wohlstand basiert auf Prozessen unterschiedlichster Dauer. Was Millionen Jahre brauchte, um zu entstehen, wurde und wird in Minuten verfeuert. Dazwischen lagen die zähen Stunden, die Josef Stefaniak ein Arbeitsleben lang unter Tage verbrachte.
Wenn er einfuhr, erst im Förderkorb, dann in der engen Förderbahn kauernd, durch den Stollen auf der fünften Sohle laufend und schließlich den Rest des Weges kriechend, schleppte er jede Menge Gezähe mit sich. So nennen die Bergleute ihr Werkzeug. Hinzu kam die Grubenlampe, die allein sechs Pfund wog, die Thermoskanne Kaffee und der Henkelmann mit den zwei Butterbroten, die ihm seine Frau Wanda gemacht hatte. Den Henkelmann mit den «Dubbeln» musste er gut sichern, denn die Ratten waren unter Tage immer hungrig. Es war unsäglich heiß unten, viele Hauer arbeiteten fast nackt, woran man sich gewöhnen musste. An der Abbaufront des Strebs angekommen, arbeitete er sich mit dem Abbruchhammer in die Kohle vor. Ständig drohte die Gefahr, dass sich Gesteinsbrocken über ihm lösten und herabstürzten. Die herausgebrochene Kohle wurde auf eine mobile Rutsche zum Abtransport geworfen. Pro Schicht förderte jeder Bergmann unglaubliche eintausendfünfhundert Kilo Kohle.[1]
Um das sogenannte «Hangende» notdürftig gegen Einsturz zu sichern, wurden Holzstempel gesetzt, die die Decke des frischen Strebs von unten abstützten. Die Geräusche, die das «Gebirge» von sich gab, waren Quell ständiger Unruhe und wurden instinktiv überwacht. Der Hauer Herbert Berger erinnerte sich an einen besonders verwegenen Kumpel namens Neunauge, so gerufen, weil er ein leidenschaftlicher Angler war: «Manchmal stand nur noch ein Stempel, während alle anderen im Umkreis schon geraubt worden waren. Geraubt heißt, sie waren schon wieder nach vorn an die Kohlenwand gesetzt, also wieder verwendet worden. (…) Mit der linken Hand hielt sich Neunauge an einem Stempel fest, in der rechten schwang er den dicken Hammer, mit der er genau auf den Keil des alleinstehenden Stempels zielte. Manchmal kam der Bruch sofort. Dann lösten sich Steinbrocken, so groß wie Kleiderschränke, und krachten herunter. Der Luftdruck warf mich fast um. Eine gewaltige Staubwolke hüllte uns ein. Blitzschnell sprang Neunauge zurück. Eine Sekunde zu spät oder zu weit heraus konnte den Tod bedeuten. Und das mehrere Male in jeder Schicht, an jedem Tag, in jeder Woche.»[2] Die leergeräumten Abschnitte eines Strebs nannten die Bergleute «alten Mann». Um einen «alten Mann» gegen Einsturz zu sichern, wurde er mit «taubem Gestein» gefüllt.
Josef Stefaniak stieg 1955, als er vierzig wurde, zum Rutschenmeister auf, auch Rutschenbär genannt. Als Vorarbeiter ganz vorn für die Schüttelrutsche verantwortlich, die die abgebaute Kohle zu den Förderbändern brachte, bewahrte ihn der Aufstieg vor der lebenslangen Arbeit mit dem Presslufthammer, die das Hirn so schädigt, als würde man acht Stunden täglich boxen. Josef Stefaniak war stolz auf seine Arbeit, trotz, vielleicht auch wegen des Drecks, den er nach Schicht abwusch, bis die Haut wieder weiß war und seine Augen und seine Zähne nicht mehr so strahlend aus dem schwarzen Gesicht leuchteten, was er liebte an sich und seinen Kumpels. In der dampfenden Waschkaue herrschte nach Schicht ein dichtes Gedränge nackter Männer. Wenn der Vordermann wortlos vor einem buckelte, nahm man ebenso wortlos die Seife und wusch ihm den Rücken.
Die Arbeit unter Tage und die ständige Gefahr schweißten die Bergleute zusammen wie ihre Kollegen im Märchen, die sieben Zwerge, die sich allesamt in ein und dasselbe Mädchen verguckten, das, wen wundert’s, blütenweiße Schneewittchen.[3]
Sich tief unten zurechtfinden in den Stollen und Streben im ächzenden, knackenden und hallenden Gestein, das kann nicht jeder. Es gab den Bergmännern einen Hauch von Exklusivität, den Navigationskünsten der Seeleute verwandt in deren so ganz anderem Element, aber ähnlich weit weg vom Leben der normalen Leute. An den Flözwänden war ja nicht alles schwarz. Wer sehen konnte, dem erzählte das Gestein seine eigene Geschichte und offenbarte eine faszinierende Vielfalt. Werner Bräunig, Bergmann und Schriftsteller aus Chemnitz, beschrieb in den fünfziger Jahren in seinem erst posthum erschienenen Roman «Rummelplatz», woran man tief unter den Feldern Thüringens vorbeikam, wenn man durch den Stollen ging: «Im Berg war es still geworden. Berg, der in Gängen Erz führt: Kobalt, Nickelblüte, Wismut, Silber, Uran. Bleiglanz und Zinkblende weiter östlich, Wolfram und Molybdänit, natürlich Zinn. Entgasungsprodukt granitischen Magmas aus der Tiefe, reichend von Oberkarbon bis ins Unterrotliegende, Granit, der aus Glimmerschiefer aufsteigt, Schwerspat und Flußspat, der farblose, milchweiße, der graue Quarz. Wer aber Glück hat, kann vielleicht einen Topas finden. Er kann den messinggelben Pyrit finden und den bleigrauen Antimonglanz, gediegen Wismut und vielleicht noch Silber. Wenn einer Glück hat.»[4]
Josef Stefaniak liebte das Singen im Knappenchor. «Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf!», schmetterten die Bergleute a cappella, gekleidet im traditionellen schwarzen Kittel, auf dem Kopf der Schachthut mit dem roten Federbusch. Die Stimmen, mit Milch oder Schnaps gespült, klangen so rein, wie man es diesen harten Kerlen niemals zugetraut hätte. Und Stefaniak war, wie fast alle Bergleute, tiefreligiös. Als katholischer Pole war er es besonders. Über dem Bett seiner Tochter hing ein kleines Gefäß mit Weihwasser, in das ihre Mutter den Finger tauchte, um jeden Abend vor dem Einschlafen ein unsichtbares Kreuz auf ihre Stirn zu zeichnen. Der Kittel der feierlichen Bergmannstracht, den Stefaniak beim Singen trug, hatte sechs Knöpfe an jedem Ärmel, zwölf auf der Brust und fünf zum Zuknöpfen. Diese insgesamt neunundzwanzig Knöpfe symbolisierten das Alter der heiligen Barbara, die von ihrem Vater enthauptet wurde. Seit dem Spätmittelalter ist sie die Schutzpatronin aller Bergleute.
Zweiundvierzig Jahre arbeitete Josef Stefaniak unter Tage, erst in der Zeche Haniel in Duisburg-Neumühl, dann in der Rheinpreußen in Moers. Je nach Schichtbeginn stellte er sich morgens, mittags oder abends an die Neumühler Straße, Ecke Eugenstraße, und wartete auf den Werksbus, der ihn zur Zeche fuhr. Neun Stunden später spuckte der Bus ihn todmüde an derselben Stelle wieder aus. Von dort aus ging es erst mal kurz in die Kneipe «Bei Otto». Seine Frau Wanda führte den Haushalt, entschied über alle Einkäufe, kümmerte sich um die Kinder, sorgte dafür, dass die Tochter aufs