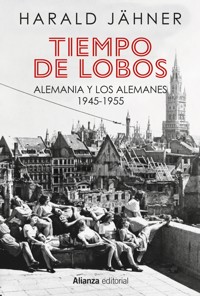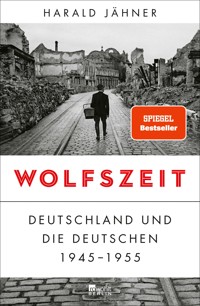
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2019. Harald Jähners große Mentalitätsgeschichte der Nachkriegszeit zeigt die Deutschen in ihrer ganzen Vielfalt: etwa den "Umerzieher" Alfred Döblin, der das Vertrauen seiner Landsleute zu gewinnen suchte, oder Beate Uhse, die mit ihrem "Versandgeschäft für Ehehygiene" alle Vorstellungen von Sittlichkeit infrage stellte; aber auch die namenlosen Schwarzmarkthändler, in den Taschen die mythisch aufgeladenen Lucky Strikes, oder die stilsicheren Hausfrauen am nicht weniger symbolhaften Nierentisch der anbrechenden Fünfziger. Das gesellschaftliche Panorama eines Jahrzehnts, das entscheidend war für die Deutschen und in vielem ganz anders, als wir oft glauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Harald Jähner
Wolfszeit
Deutschland und die Deutschen 1945–1955
Über dieses Buch
Harald Jähners große Mentalitätsgeschichte der Nachkriegszeit zeigt die Deutschen in ihrer ganzen Vielfalt: etwa den «Umerzieher» Alfred Döblin, der das Vertrauen seiner Landsleute zu gewinnen suchte, oder Beate Uhse, die mit ihrem «Versandgeschäft für Ehehygiene» alle Vorstellungen von Sittlichkeit in Frage stellte; aber auch die namenlosen Schwarzmarkthändler, in den Taschen die mythisch aufgeladenen Lucky Strikes, oder die stilsicheren Hausfrauen am nicht weniger symbolhaften Nierentisch der anbrechenden Fünfziger, Baustein einer freieren Welt, die man sich bald würde leisten können. Das gesellschaftliche Panorama eines Jahrzehnts, das entscheidend war für die Deutschen und in vielem ganz anders, als wir oft glauben.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt • Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung Werner Bischof / Magnum Photos / Agentur Focus
ISBN 978-3-644-10032-9
Hinweis: Die Seitenverweise der Text- und Bildnachweise beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Am 18. März 1952 erschien in der «Neuen Zeitung» ein Text des Schriftstellers und Lektors Kurt Kusenberg. Der Text trug den Titel «Nichts ist selbstverständlich. Lob einer Elendszeit». Nur sieben Jahre nach Kriegsende sehnte sich der Autor darin nach den Wochen der Ratlosigkeit zurück, die dem Kriegsende gefolgt waren. Obwohl nichts mehr funktionierte, keine Post, keine Bahn, kein Verkehr, trotz der Obdachlosigkeit, des Hungers und mancher Leiche, die immer noch unter den Trümmern lag, erschienen ihm diese Wochen im Rückblick als eine gute Zeit. «Kindern gleich» hätten die Menschen nach dem Krieg begonnen, «das zerrissene Netz der menschlichen Beziehungen neu zu knüpfen». Kindern gleich?
Kusenberg empfahl seinen Lesern eindringlich, sich in die «darbende, abgerissene, frierende, verelendete, gefährliche Zeit» zurückzuversetzen, als in der Abwesenheit staatlicher Ordnung unter den versprengten Menschen Moral und sozialer Zusammenhalt neu definiert wurden: «Anstand schloss Findigkeit und List nicht aus – nicht einmal den Mundraub. Aber in diesem Halbräuberleben gab es eine Räuberehre, die vielleicht moralischer war als das gusseiserne Gewissen von heute.»
Sonderbar. So viel Abenteuer soll es gegeben haben unmittelbar nach dem Krieg, so viel «Räuberehre»? So viel Unschuld? Was die Deutschen bis Kriegsende zusammengehalten hatte, war – zum Glück – komplett zerrissen. Die alte Ordnung war hin, eine neue stand in den Sternen, fürs Nötigste sorgten erst mal die Alliierten. Eine Gesellschaft konnte man die etwa 75 Millionen Menschen, die im Sommer 1945 auf dem Deutschland verbliebenen Boden versammelt waren, kaum nennen. Von der «Niemandszeit» sprach man, von der «Wolfszeit», in der «der Mensch dem Menschen zum Wolf» geworden war. Dass sich jeder nur um sich selbst oder sein Rudel kümmerte, prägte das Selbstbild des Landes bis tief in die Fünfziger hinein, als es längst schon wieder besser ging, aber man sich noch immer verbissen in die Familie zurückzog als selbstbezüglichen Schutzraum. Noch im berühmten «Herrn Ohnemichel», jenem von der Aktion Gemeinsinn in den späten fünfziger Jahren beklagten Typus des unpolitischen Mehrheitsdeutschen, lebte – im biederen Gewand – der Wolf fort, zu dem man 1945 den einstigen Volksgenossen herabsinken gesehen hatte.
Über die Hälfte der Menschen in Deutschland waren nach dem Krieg nicht dort, wo sie hingehörten oder hinwollten, darunter neun Millionen Ausgebombte und Evakuierte, vierzehn Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, zehn Millionen entlassene Zwangsarbeiter und Häftlinge, Abermillionen nach und nach zurückkehrende Kriegsgefangene. Wie sich dieses Gemenge von Versprengten, Verschleppten, Entkommenen und Übriggebliebenen entflocht und neu zusammenfand und wie aus Volksgenossen allmählich wieder Bürger wurden, davon handelt dieses Buch.
Es ist eine Geschichte, die unter der Wucht der historischen Großereignisse zu verschwinden droht. Die wichtigsten Veränderungen spielten sich im Alltag ab, im Organisieren des Essens zum Beispiel, im Plündern, Tauschen, Einkaufen. Auch in der Liebe. Eine Welle der sexuellen Abenteuerlust folgte auf den Krieg, aber auch manch herbe Enttäuschung auf die ersehnte Heimkehr der Männer. Man sah nun vieles mit anderen Augen, wollte mit allem neu anfangen, die Scheidungszahlen stiegen sprunghaft in die Höhe.
Die kollektive Erinnerung an die Nachkriegszeit ist von wenigen Ikonen geprägt, die sich tief ins Gedächtnis eingebrannt haben: der russische Soldat, der einer Frau das Fahrrad entreißt; dunkle Schwarzmarktgestalten, die sich um ein paar Eier drängen; die provisorischen Nissenhütten, in denen Flüchtlinge und Ausgebombte hausen; die Frauen, die heimkehrenden Kriegsgefangenen fragend das Foto ihrer vermissten Männer entgegenhalten. Diese wenigen Bilder sind visuell so stark, dass sie wie ein immergleicher Stummfilm die öffentliche Erinnerung an die ersten Nachkriegsjahre strukturieren. Dabei fällt das halbe Leben unter den Tisch.
Während die Erinnerung die Vergangenheit für gewöhnlich in umso milderes Licht taucht, je mehr Jahre uns von ihr trennen, gilt für die Nachkriegszeit das Umgekehrte. Sie wurde im Rückblick immer düsterer. Ein Grund dafür liegt in dem verbreiteten Bedürfnis der Deutschen, sich als Opfer zu sehen. Je schwärzer die in der Tat schrecklichen Hungerwinter von 1946 und 1947 geschildert würden, umso weniger wöge, so glaubten offenbar viele, am Ende ihre Schuld.
Hört man genauer hin, vernimmt man das Lachen. Durch das gruselig entvölkerte Köln führt 1946 schon wieder ein spontaner Rosenmontagszug. Die Journalistin Margret Boveri erinnerte sich an eine «ungeheure Erhöhung des Lebensgefühls durch die dauernde Nähe des Todes». Sie sei in den Jahren, in denen es nichts zu kaufen gab, so glücklich gewesen, dass sie später beschloss, keine größeren Anschaffungen mehr zu tätigen.
Das Elend ist nicht zu verstehen ohne die Lust, die es hervorbringt. Dem Tod entronnen zu sein stieß die einen in Apathie, die anderen in eine nie gekannte, eruptive Daseinsfreude. Die Lebensordnung war aus den Fugen geraten, Familien waren auseinandergerissen, alte Bindungen verloren gegangen, aber die Menschen mischten sich neu, und wer jung und mutig war, empfand das Chaos als einen Tummelplatz, auf dem er täglich sein Glück suchen musste. Wie konnte dieses Glück der Freiheit, das gerade viele Frauen empfanden, in den Jahren des Aufschwungs so schnell wieder verschwinden? Oder verschwand es gar nicht in dem Maße, in dem die geläufigen Karikaturen der fünfziger Jahre es glauben machen?
Der Holocaust spielte im Bewusstsein der meisten Deutschen der Nachkriegszeit eine schockierend geringe Rolle. Etliche waren sich zwar der Verbrechen an der Ostfront bewusst, und eine gewisse Grundschuld, den Krieg überhaupt begonnen zu haben, wurde eingeräumt, aber für die millionenfache Ermordung der deutschen und europäischen Juden war im Denken und Fühlen kein Platz. Nur ganz wenige, der Philosoph Karl Jaspers etwa, sprachen sie öffentlich an. Nicht einmal in den lang diskutierten Schuldbekenntnissen der evangelischen und katholischen Kirche wurden die Juden explizit erwähnt.
Die Unvorstellbarkeit des Holocaust erstreckte sich auf perfide Weise auch auf das Volk der Täter. Die Verbrechen besaßen eine Dimension, die sie, noch während sie geschahen, aus dem kollektiven Bewusstsein verbannte. Dass auch Gutwillige sich weigerten, darüber nachzudenken, was mit ihren deportierten Nachbarn geschehen würde, hat das Vertrauen in die menschliche Spezies bis heute erschüttert. Am wenigsten freilich die Mehrheit der damaligen Zeitgenossen.
Das Verdrängen und Beschweigen der Vernichtungslager setzte sich nach Kriegsende fort, auch wenn die Alliierten versuchten, durch Filme wie «Die Todesmühlen» die Besiegten zwangsweise mit den NS-Verbrechen zu konfrontieren.
Helmut Kohl sprach von der «Gnade der späten Geburt», um auszudrücken, dass die nachrückende Generation gut reden hatte. Es gab jedoch auch die Gnade der erlebten Schrecken. Die durchlittenen Bombennächte, die harten Hungerwinter der ersten Nachkriegsjahre und der Überlebenskampf unter anarchischen Alltagszuständen ließen viele Deutsche keinen Gedanken an die Vergangenheit fassen. Sie empfanden sich selbst als Opfer – und ersparten sich damit die Gedanken an die wirklichen. Zu ihrem zweifelhaften Glück. Denn wer unter den halbwegs anständig Gebliebenen in vollem Umfang an sich herangelassen hätte, welch systematischer Massenmord in seinem Namen, mit seiner Duldung und dank seinem Wegschauen begangen worden war, hätte wohl kaum den Lebensmut und die Energie aufbringen können, die nötig waren, um die Nachkriegsjahre durchzustehen.
Der Überlebenstrieb schaltet Schuldgefühle ab – ein kollektives Phänomen, das in den Jahren nach 1945 zu studieren ist und das Vertrauen in den Menschen, auch in die Grundlagen des eigenen Ichs, tief irritieren muss. Wie auf der Basis von Verdrängung und Verdrehung dennoch zwei auf ihre Weise antifaschistische, vertrauenerweckende Gesellschaften entstehen konnten, stellt ein Rätsel dar, dem dieses Buch näherkommen möchte, indem es sich in die extremen Herausforderungen und eigentümlichen Lebensstile der Nachkriegsjahre versenkt.
Obwohl Bücher wie das Tagebuch von Anne Frank oder Eugen Kogons «SS-Staat» die Verdrängung störten, begannen viele Deutsche erst mit den Auschwitz-Prozessen ab 1963 sich den begangenen Verbrechen zu stellen. In den Augen der nachfolgenden Generation hatten sie sich nicht zuletzt durch diesen Aufschub aufs äußerste diskreditiert, wenn auch die Kinder von der Verdrängungsleistung ihrer Eltern rein materiell erheblich profitierten. Selten in der Geschichte wurde ein Generationenkonflikt erbitterter, zorniger und zugleich selbstgerechter geführt als von den Heranwachsenden von 1968 und ihren akademischen Wegbegleitern.
Unser Eindruck von den Nachkriegsjahren ist geprägt von der Sicht der damals Jungen. Die Empörung der antiautoritären Kinder über die nur unter größten Schwierigkeiten zu liebende Elterngeneration war so groß, ihre Kritik derart eloquent, dass der Mythos vom alles erstickenden Muff, den sie erst einmal zu vertreiben hatten, das Bild der fünfziger Jahre noch immer dominiert, trotz differenzierterer Forschungsergebnisse. Die Generation der um 1950 Geborenen gefällt sich in der Rolle derer, die die Bundesrepublik bewohnbar gemacht und die Demokratie mit Herz erfüllt haben, und sie belebt dieses Bild immer wieder aufs Neue. Tatsächlich konnte einen die starke Präsenz der alten NS-Elite in den Ämtern der Bundesrepublik mit Abscheu erfüllen, desgleichen die Hartnäckigkeit, mit der die Amnestierung von NS-Tätern durchgesetzt wurde. Dass die Nachkriegszeit dennoch kontroverser, ihr Lebensgefühl offener, ihre Intellektuellen kritischer, ihr Meinungsspektrum breiter, ihre Kunst innovativer, der Alltag widersprüchlicher war, als die Vorstellung von der Zeitenwende 1968 es bis heute glauben macht – das war während der Recherche für dieses Buch immer wieder zu entdecken.
Es gibt einen weiteren Grund dafür, dass insbesondere die ersten vier Nachkriegsjahre einen relativ blinden Fleck in der historischen Erinnerung darstellen. Sie bilden zwischen den großen Kapiteln und Forschungsabschnitten der Geschichte eine Art Niemandszeit, für die, lax gesagt, niemand so recht zuständig ist. Das eine Großkapitel der Schulgeschichte handelt vom NS-Regime, das mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht endet, das andere erzählt die Geschichte der Bundesrepublik und der DDR, die 1949 beginnt, und konzentriert sich allenfalls auf die Währungsreform und die Berliner Blockade als Vorgeschichte jener Staatsgründungen. Die Jahre zwischen Kriegsende und der Währungsreform, dem ökonomischen «Urknall» der Bundesrepublik, sind für die Geschichtsschreibung gewissermaßen eine verlorene Zeit, weil ihnen das institutionelle Subjekt fehlt. Unsere Geschichtsschreibung ist im Wesentlichen immer noch als Nationalgeschichte strukturiert, die den Staat als politisches Subjekt in den Mittelpunkt stellt. Verantwortlich für die deutschen Geschicke ab 1945 waren aber gleich vier politische Zentren: Washington, Moskau, London, Paris – keine artgerechten Bedingungen für eine Nationalgeschichte.
Auch der Blick auf die an den Juden und Zwangsarbeitern begangenen Verbrechen endet meist mit der glücklichen Befreiung der Überlebenden durch die alliierten Soldaten. Was aber geschah dann mit ihnen? Wie verhielten sich die etwa zehn Millionen ausgehungerten, aus ihrer Heimat verschleppten Häftlinge ohne Aufsicht im Land ihrer Peiniger und Mörder ihrer Angehörigen? Wie die alliierten Soldaten, die besiegten Deutschen und die befreiten Zwangsarbeiter miteinander agierten, gehört zu den tristesten, aber auch faszinierendsten Aspekten der Nachkriegsjahre.
Im Verlauf des Buches verschieben sich die Schwerpunkte von den zivilisatorischen Seiten des Alltags, vom Aufräumen, Lieben, Klauen und Einkaufen, zu den kulturellen, zum Geistesleben und zum Design. Schärfer stellen sich nun Fragen des Gewissens, der Schuld und Verdrängung. Entsprechend bedeutsam werden die Instanzen der Entnazifizierung, die auch eine ästhetische Seite hatte. Dass gerade das Design der fünfziger Jahre von so anhaltender Berühmtheit ist, hat einen Grund in seiner verblüffenden Wirkmacht: Indem die Deutschen ihre Umwelt umgestalteten, veränderten sie sich selbst. Aber waren es wirklich die Deutschen, die die Gestalt ihrer Welt so radikal wandelten? Parallel zum Design entbrannte ein Kampf um die abstrakte Kunst, in dem auch die Besatzungsmächte die Fäden zogen. Es ging um die ästhetische Ausstaffierung der beiden deutschen Republiken, um nichts weniger als den Schönheitssinn im Kalten Krieg. Entsprechend engagiert war sogar die CIA.
Viel mehr als heute gab man sich nach dem Krieg schöngeistig, feinsinnig und unermüdlich ins ernste Gespräch vertieft, als könne man bruchlos an die Umgangsformen anknüpfen, mit denen das zur guten alten Zeit verklärte 19. Jahrhundert geendet hatte. Heute wissen wir viel über den Holocaust. Was wir weniger genau wissen, ist, wie sich in dessen Schatten weiterleben ließ. Wie spricht ein Volk über Moral und Kultur, in dessen Namen zuvor Abermillionen Menschen ermordet worden waren? Soll es anstandshalber auf das Reden über den Anstand ganz verzichten? Seine Kinder selbst herausfinden lassen, was gut und was böse ist? Das Deutungsgewerbe in den Medien lief auf Hochtouren, genau wie die anderen Gewerke des Wiederaufbaus. Alles sprach vom «Hunger nach Sinn». Das Philosophieren «auf den Trümmern der Existenz» schickte das Bewusstsein auf geistige Plündertour. Man klaute Sinn, wie man Kartoffeln klaute.
Erstes KapitelStunde Null?
So viel Anfang war nie. So viel Ende auch nicht
Der Theaterkritiker Friedrich Luft erlebte das Kriegsende im Keller. Dort unten in einer Stadtvilla in der Nähe des Berliner Nollendorfplatzes, im «Geruch von Rauch, Blut, Schweiß und Fusel», hatte er während der letzten Tage des Endkampfes mit ein paar anderen Leuten aus der Gegend ausgeharrt. Im Keller war es sicherer als in den Wohnungen, die dem kreuzweisen Beschuss durch die Rote Armee und die Wehrmacht ausgesetzt waren. «Draußen war das Inferno. Lugte man hinaus, sah man einen hilflosen deutschen Tank sich durch die Glut der Häuserzeilen schieben, halten, schießen, beidrehen. Hin und wieder stolperte ein Zivilist, von Deckung zu Deckung stürzend, über den aufgeborstenen Fahrdamm. Eine Mutter jagte mit ihrem Kinderwagen aus einem ausgeschossenen, brennenden Haus in die Richtung des nächsten Bunkers.»[1]
Ein alter Mann, der die ganze Zeit in der Nähe des Kellerfensters gehockt hatte, wurde von einer Granate zerfetzt. Einmal spülte es ein paar Soldaten aus einem Büro des Obersten Wehrmachtskommandos hinein, «gereizte, willenlose, kranke Kerle». Jeder hatte einen Karton mit Zivilkleidung dabei, um sich «im Ernstfall», wie sie sagten, dünnezumachen. Wie viel Ernstfall sollte denn noch kommen? Haut bloß ab, zischten die Kellerbewohner. Niemand wollte in ihrer Nähe sein, «wenn es aufs Letzte ging». Die Leiche des gefürchteten Blockwarts wurde auf einem Karren vorbeigeschleppt; er hatte sich aus dem Fenster geworfen.
Plötzlich fiel jemandem ein, dass im Haus gegenüber noch Haufen von Hakenkreuzfahnen und Hitlerbildern lagerten. Ein paar Mutige gingen hinüber, um alles zu verbrennen. Bloß weg damit, bevor die Russen kamen. Als das Gewehrfeuer plötzlich wieder lauter wurde und der Theaterkritiker vorsichtig aus der Kellerluke sah, erblickte er eine SS-Streife, die ihrerseits über einen Mauerrest lugte. Die Männer «kämmten noch mal durch», auf der Suche nach Drückebergern, die sie mit in den Tod nehmen konnten. «Dann wurde es stiller. Als wir vorsichtig die schmale Treppe heraufstiegen nach einer Ewigkeit des lauschenden Wartens, regnete es sacht. Auf den Häusern jenseits des Nollendorfplatzes sahen wir weiße Fahnen glänzen. Wir banden uns weiße Fetzen um den Arm. Da stiegen schon zwei Russen über die gleiche niedrige Mauer, über die so bedrohlich vor kurzem erst die SS-Männer gekommen waren. Wir hoben die Arme. Wir zeigten auf unsere Binden. Sie winkten ab. Sie lächelten. Der Krieg war aus.»
Für Friedrich Luft hatte das, was man später die Stunde Null nennen sollte, am 30. April geschlagen. 640 Kilometer weiter westlich, in Aachen, war der Krieg zur selben Zeit schon seit einem halben Jahr zu Ende; die Stadt war im Oktober 1944 als erste deutsche Stadt von den Amerikanern eingenommen worden. In Duisburg war der Krieg in den Stadtteilen links des Rheins am 28. März vorbei, rechts des Rheins erst 16 Tage später. Selbst für die offizielle Kapitulation Deutschlands gibt es drei Daten. Generaloberst Alfred Jodl unterzeichnete die bedingungslose Kapitulation am 7. Mai in Reims im Hauptquartier von US-General Dwight D. Eisenhower. Obwohl das Dokument ausdrücklich die Westalliierten wie die Rote Armee als Sieger anerkannte, bestand Stalin auf der Wiederholung der Zeremonie in seiner Anwesenheit. Am 9. Mai kapitulierte Deutschland deshalb noch einmal; nun unterzeichnete Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel die Urkunde im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. Für die Geschichtsbücher einigten sich die Siegermächte auf den Tag dazwischen, auf den 8. Mai, an dem in dieser Hinsicht eigentlich gar nichts geschehen war.[2]
Für Walter Eiling hingegen war die Stunde Null auch vier Jahre später noch nicht gekommen. Da saß er noch immer wegen «Vergehen gegen die Volksschädlingsverordnung» in der Strafanstalt Ziegenhain. Der Kellner aus Hessen war 1942 verhaftet worden, weil er an Weihnachten eine Gans, drei Hühner und zehn Pfund gesalzenes Fleisch gekauft hatte. Ein NS-Schnellgericht hatte ihn wegen «Missachtung der Kriegswirtschaftsbestimmungen» zu acht Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Nach Kriegsende glaubten Walter Eiling und seine Familie an eine schnelle Entlassung. Doch die Justizbehörden dachten nicht daran, den Fall wieder aufzunehmen. Als der Justizminister des unter amerikanischer Militäraufsicht stehenden Landes Groß-Hessen die absurd hohe Strafe endlich zurücknahm, stellte sich seine Behörde auf den Standpunkt, damit sei zwar die Haft, nicht aber die Sicherheitsverwahrung aufgehoben. Walter Eiling blieb in Gefangenschaft. Spätere Anträge auf Entlassung wurden mit dem Argument abgelehnt, der Häftling sei labil, neige zur Überheblichkeit und sei noch nicht wieder arbeitsfähig.
In Eilings Zelle dauerte die Herrschaft des NS-Regimes noch über die Gründung der Bundesrepublik hinaus an.[3] Schicksale wie das seine waren der Grund dafür, dass der Begriff «Stunde Null» später heftig umstritten war. In den Konzernzentralen, Hörsälen und Amtsstuben der Bundesrepublik arbeitete das Gros der NS-Elite ja munter weiter. Solche Kontinuitäten wurden durch das Reden von der Stunde Null verschleiert. Andererseits diente es dazu, den Willen zum Neuanfang zu unterstreichen und eine klare normative Zäsur zwischen dem alten und dem neuen Staat zu betonen, auch wenn das Leben natürlich weiterging und jede Menge Ererbtes aus dem Dritten Reich mitschleppte. Zudem war der Begriff der Stunde Null für viele Menschen von solch unmittelbarer Evidenz für den elementaren Einschnitt, den sie erlebt hatten, dass der Begriff bis heute nicht nur gebräuchlich blieb, sondern in der Geschichtswissenschaft sogar eine Renaissance erfährt.[4]
Während in Walter Eilings Zelle die Unrechtsherrschaft in aller Brutalität bestehen blieb, brach andernorts jede Form öffentlicher Ordnung zusammen. Polizisten schauten sich ratlos an und wussten nicht, ob sie noch welche waren. Wer eine Uniform hatte, zog sie lieber aus, verbrannte sie oder färbte sie um. Hohe Funktionäre vergifteten sich, niedrige warfen sich aus dem Fenster oder schnitten sich die Pulsadern auf. Die «Niemandszeit» brach an; die Gesetze waren außer Kraft gesetzt, niemand für irgendetwas zuständig. Niemandem gehörte mehr etwas, es sei denn, er saß mit dem Hintern darauf. Niemand war verantwortlich, niemand sorgte für Schutz. Die alte Macht war weggelaufen, die neue noch nicht da; nur der Lärm der Artillerie wies darauf hin, dass sie irgendwann kommen würde. Auch die Vornehmsten machten sich nun ans Plündern. In kleinen Horden brach man Lebensmittellager auf, durchstreifte verlassene Wohnungen auf der Suche nach Essbarem und einem Schlafplatz.
Überlebenstechniken in der Großstadt: Ein Berliner besorgt Brennholz. Viel ist vom Tiergarten allerdings nicht mehr übrig.
Zusammen mit der Journalistin Ruth Andreas-Friedrich, dem Arzt Walter Seitz und dem Schauspieler Fred Denger entdeckte der Berliner Dirigent Leo Borchard am 30. April mitten in der umkämpften Hauptstadt einen weißen Ochsen. Gerade hatte die Gruppe noch vor einem Tieffliegerangriff Deckung gesucht, da stand dieses Tier vor ihnen, unversehrt und sanftäugig, ein surrealer Anblick in der rauchenden Schreckensszenerie. Sie umstellten ihn, bugsierten ihn sacht an den Hörnern. Tatsächlich gelang es ihnen, den Ochsen vorsichtig in den Hinterhof des Hauses zu locken, in dem sie ein Versteck gefunden hatten. Doch wie nun weiter? Wie schlachten vier urbane Bildungsbürger ein Rind? Der Dirigent, des Russischen mächtig, traute sich, vor dem Haus einen Sowjetsoldaten anzusprechen. Der half ihnen damit aus, das Tier mit zwei Pistolenschüssen niederzustrecken. Zögernd machten sich die Freunde nun mit Küchenmessern an dem toten Tier zu schaffen. Lange blieben sie mit ihrer Beute aber nicht allein. «Plötzlich, als hätte die Unterwelt sie ausgespien, sammelt sich um den toten Ochsen eine lärmende Menge», notierte Ruth Andreas-Friedrich später in ihr Tagebuch. «Aus hundert Kellerlöchern kriechen sie hervor. Weiber, Männer, Kinder. Hat sie der Blutgeruch hergelockt?» Und schon balgt sich alles um die Fleischfetzen. Fünf blutbeschmierte Fäuste zerren dem Ochsen die Zunge aus dem Schlund. «So also sieht die Stunde der Befreiung aus. Der Augenblick, auf den wir zwölf Jahre gewartet haben?»[5]
Elf Tage dauerte es, bis sich die Rote Armee nach dem ersten Überqueren der Stadtgrenze in Malchow bis in die letzten Innenstadtquartiere vorgekämpft hatte. Auch hier, in der Hauptstadt, trat also das Kriegsende nicht überall zur gleichen Zeit ein. Marta Hillers, ebenfalls Journalistin in Berlin, später Anonyma genannt, traute sich am 7. Mai erstmals wieder, mit dem Fahrrad durch die zertrümmerten Straßen zu fahren. Neugierig radelte sie von Berlin-Tempelhof aus ein paar Kilometer in Richtung Süden und notierte am Abend in ihr Tagebuch: «Hier liegt der Krieg einen Tag länger zurück als bei uns. Man sieht bereits Zivilisten, die den Bürgersteig fegen. Zwei Frauen ziehen und schieben einen völlig ausgeglühten Operationswagen, wohl aus Trümmern geholt. Oben darauf liegt eine Greisin unter einer Wolldecke, mit blutleerem Gesicht; doch sie lebt noch. Je weiter ich fahre, desto mehr weicht der Krieg zurück. Hier sieht man bereits Deutsche in Gruppen zusammenstehen und schwatzen. An unserer Ecke wagen das die Menschen noch nicht.»[6]
Nachdem der weiße Ochse zerlegt und zerrissen war, stiegen der Dirigent Borchard und seine Freunde in eine zerbombte Wohnung ein und durchwühlten die Schränke. Statt Essbarem fanden sie nur Unmengen von Brausepulver, das sie ausgelassen und lachend in ihre Münder stopften. Als sie unter vielen Scherzen ein paar Kleider der unbekannten Bewohner anprobierten, erschraken sie plötzlich vor der eigenen Dreistigkeit. Der Übermut war verbraucht, beklommen legten sich die vier zur Nacht in das Ehebett der fremden Bewohner, die laut Klingelschild Machulke hießen. «Eigener Herd ist Goldes wert», stand in bunter Seidenstickerei über dem Bett.
Am nächsten Tag machte sich Ruth Andreas-Friedrich auf den Weg durch die Stadt, suchte ersten Kontakt zu Kollegen, Freunden, Verwandten. Wie alle war sie gierig nach Neuigkeiten, Lageberichten, Einschätzungen. Noch ein paar Tage später hatte sich das Leben in Berlin schon so weit beruhigt, dass sie wieder ihre schwer ramponierte Wohnung beziehen konnte. Auf dem Balkon errichtete sie einen provisorischen Herd aus herumliegenden Steinen, um etwas aufwärmen zu können. Eine Robinsonade mitten in der Großstadt. An Gas und Strom war nicht zu denken.
In ihr Tagebuch notierte sie jähe Stimmungsumschwünge. Hitler war tot, es wurde Sommer, und sie wollte endlich etwas machen aus ihrem Leben. Sie konnte es nicht mehr abwarten, wieder ihre Arbeitskraft einzusetzen, ihre Beobachtungsgabe, ihr Schreibtalent. Es waren erst zwei Monate seit Kriegsende vergangen, da schrieb sie in einem Moment der Euphorie: «Die ganze Stadt lebt in einem Rausch der Erwartung. Man möchte sich zerreißen vor Arbeitseifer, möchte tausend Hände haben und tausend Gehirne. Die Amerikaner sind da. Die Engländer, die Russen. Die Franzosen sollen im Anzug sein. (…) Nur darauf kommt es an, dass wir im Zentrum der Tätigkeit stehen. Dass sich die Weltmächte in unseren Trümmern begegnen und wir den Vertretern dieser Weltmächte beweisen, wie ernst es uns ist mit unserem Eifer, wie grenzenlos ernst mit den Bemühungen um Wiedergutmachung und Aufstieg. Berlin läuft auf Hochtouren. Wenn man uns jetzt versteht und verzeiht, wird man alles von uns erreichen. Alles! Dass wir dem Nationalsozialismus abschwören, dass wir das Neue besser finden, dass wir arbeiten und grundsätzlich guten Willens sind. Noch nie waren wir so erlösungsreif.»[7]
Man sollte vermuten, die Berliner hätten sich gefühlt, wie ihre Stadt aussah: zerschlagen, besiegt, abbruchreif. Stattdessen verspürte die 44-jährige Tagebuchschreiberin einen «Rausch der Erwartung», und das beileibe nicht nur in ihrem Inneren. Die ganze Stadt sah sie willens, sich mit Volldampf ans Werk zu machen. Ruth Andreas-Friedrich hatte der kleinen Widerstandsgruppe «Onkel Emil» angehört; in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem wird sie als «Gerechte unter den Völkern» geehrt. Es waren also nicht nur die Gefühllosen unter den Deutschen, die sich in die Arbeit stürzen wollten, die zu trauern Unfähigen. Zwei Monate erst liegt Hitlers Selbstmord zurück, da will Berlin – in den Worten dieser NS-Gegnerin – schon wieder im «Zentrum der Tätigkeit» stehen, will Aufstieg und Verzeihung.
Nicht umdrehen, nach vorne blicken. Eine kleine Familie schaut der Zukunft entgegen. Hinter ihr die Reste von München.
Hinter diesem wilden Schrei nach Neuanfang liegt das Ende eines Infernos, von dem man überall nur einen winzigen Ausschnitt mitbekommen hatte. An dessen Beschreibung arbeitet inzwischen die dritte Generation von Historikern, um die Dimensionen der Schrecken annähernd begreifbar zu machen. Sie bleiben unvorstellbar. Niemand kann nachvollziehen, was 60 Millionen Kriegstote bedeuten. Es gibt Eselsbrücken, um wenigstens das statistische Ausmaß fassbarer zu machen. 40000 Menschen starben bei dem Hamburger Feuersturm während der Bombardierungen im Sommer 1943 – eine Hölle, die sich wegen ihrer grausamen Bildlichkeit tief ins Gedächtnis eingegraben hat. Sie raubte etwa drei Prozent der Hamburger Bevölkerung das Leben. So schrecklich diese Ereignisse auch waren, die gesamteuropäische Opferrate war mehr als doppelt so hoch. Der Krieg kostete sechs Prozent aller Europäer das Leben. Die Dichte der Katastrophe, die Hamburg ereilte, galt für Europa, aufs Ganze gesehen, in doppeltem Maße. In Polen war sogar ein Sechstel der Einwohner getötet worden, sechs Millionen Menschen. Am schlimmsten erging es den Juden. In ihren Familien zählte man nicht die Toten, sondern die Überlebenden.
Der Historiker Keith Lowe schreibt: «Selbst jene, die den Krieg erlebten, Zeugen von Massakern wurden, mit Leichen übersäte Felder oder mit Körpern gefüllte Massengräber sahen, können das wahre Ausmaß der Massentötung, die in Europa stattfand, nicht begreifen.»[8] Das galt erst recht unmittelbar nach Kriegsende. Mit dem Chaos, das jeder Einzelne vorfand, als er mit erhobenen Armen aus dem Luftschutzkeller stieg, war er überfordert genug. Wie sollte je wieder etwas aus diesem Unheil werden, zumal in Deutschland, das die Schuld an allem trug? Es gab nicht wenige, die das schlichte Weiterleben als Unrecht begriffen und, rhetorisch zumindest, ihr Herz hassten, weil es weiterschlug.
Doch ausgerechnet der 26-jährige Wolfgang Borchert, den die Nachwelt als einen düsteren Fachmann der Klage in Erinnerung behalten sollte, versuchte, die Last des Weiterlebens in ein emphatisches Manifest seiner Generation zu verwandeln. Borchert war 1941 in die Wehrmacht eingezogen und an die Ostfront geschickt worden. Mehrfach wurde er dort wegen «wehrkraftzersetzender Äußerungen» bestraft. Schwer gezeichnet von den Front- und Hafterlebnissen und von einer unbehandelt gebliebenen Lebererkrankung, kehrte er 1945 nach einem 600 Kilometer langen Fußmarsch nach Hamburg zurück. Dort schrieb er den anderthalbseitigen Text «Generation ohne Abschied». Er besang darin mit wilder Entschlossenheit den Aufbruch einer Generation, deren Vergangenheit buchstäblich weggeschossen war. Sie stand, das meint der Titel «Generation ohne Abschied», der Psyche nicht mehr zur Verfügung, sei es durch Unvorstellbarkeit, Traumatisierung oder schnöde Verdrängung. «Generation ohne Abschied» ist ein Manifest der Stunde Null: «Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist Abgrund. Wir sind die Generation ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied. Unsere Sonne ist schmal, unsere Liebe grausam, unsere Jugend ist ohne Jugend.»[9]
Borcherts rhapsodischer, monoton dahinhämmernder Text ist geprägt von einer mit Elan aufgeladenen Orientierungslosigkeit. Nicht ohne Stolz stilisiert er einen Habitus verwegener Kälte. Zu oft habe diese Jugend Abschied von den Toten genommen, um Abschied noch empfinden zu können; in Wahrheit seien die Abschiede «Legion». Die letzten Zeilen des Textes berichten von der Kraft, die selbst dieser todkranke junge Mann für die Zukunft aufzubringen gedachte: «Wir sind eine Generation ohne Heimkehr, denn wir haben nichts, zu dem wir heimkehren könnten. Aber wir sind eine Generation der Ankunft. Vielleicht sind wir eine Generation voller Ankunft auf einem neuen Stern, in einem neuen Leben. Voller Ankunft unter einer neuen Sonne, zu neuen Herzen. Vielleicht sind wir voller Ankunft zu einem neuen Lieben, zu einem neuen Lachen, zu einem neuen Gott. Wir sind eine Generation ohne Abschied, aber wir wissen, dass alle Ankunft uns gehört.»
«Generation ohne Abschied» ist die poetische Grundsatzerklärung einer Kohorte von Übriggebliebenen, die keinen Nerv für den Rückblick hat. Die schockierende Weigerung vieler Deutscher, sich zu fragen, wie das alles hatte geschehen können, wird hier geradezu zum Programm erhoben. Die Tafel des Erlebten wird ausgewischt, frei gemacht für eine neue Schrift, «einen neuen Gott». Ankunft auf einem neuen Stern.
Das Wort «Verdrängung» wäre hier untertrieben. Sie ist bewusstes Programm. Hier wird emphatisch angefangen und bitter Schluss gemacht. Dass die Tabula rasa eine Illusion ist, eine bloße Wunschvorstellung, wusste Wolfgang Borchert natürlich genau. Was quälende Erinnerungen sind, musste ihm niemand erklären. Das Vergessen war die Utopie der Stunde.
Ein Gedicht der Stunde Null hat es sogar zu einem manifestartigen Status gebracht. Es ist die berühmte «Inventur» von Günter Eich, verfasst Ende 1945. Ein Mann zählt darin seine Habe auf, seine Ausstattung für den Neubeginn.
«Dies ist meine Mütze,
dies ist mein Mantel,
hier mein Rasierzeug
im Beutel aus Leinen.
(…)
Im Brotbeutel sind
ein paar wollene Socken
und einiges, was ich
niemandem verrate.
(…)
Dies ist mein Notizbuch,
dies meine Zeltbahn,
dies mein Handtuch,
dies ist mein Zwirn.»
Zum Inbegriff der Nachkriegsliteratur wurde «Inventur» wegen seiner aufreizenden Lakonie. Die «Kahlschlagliteraten», wie sie sich selber nannten, opponierten gegen große Töne, weil sie sich von ebensolchen, einst selbst im Mund geführt, betrogen fühlten. Auch die Begeisterungsfähigkeit lag in Trümmern. Nur noch ans Einfachste wollte man sich nun halten und ans Eigene, an das, was man auf dem Tisch ausbreiten konnte – eine lyrische Proklamation der «skeptischen Generation», die der Soziologe Helmut Schelsky 1957 mit großer Resonanz in all ihrer mentalen Ambivalenz aus der Taufe holen sollte.[10] Auch Günter Eichs lyrische Bestandsaufnahme vermeidet Erinnerung: Mit nichts als Misstrauen sowie Mantel, Bleistift und Zwirn (und mit etwas, «das ich niemandem verrate» – eine Wendung, die der eigentliche Clou des Textes ist) geht es ins neue Leben.
Auch Marta Hillers machte in ihrem Tagebuch Inventur. Es ist berühmt geworden wegen der Nüchternheit und Offenheit, mit der sie die Welle der Vergewaltigungen beschrieb, die mit dem Einmarsch der Roten Armee einherging. Die Stunde Null erlebte sie als tagelanges sexuelles Gewaltregime. Als es endlich überstanden war, zog sie am 13. Mai Bilanz:
«Auf der einen Seite stehen die Dinge gut für mich. Ich bin frisch und gesund. Es hat mir physisch nichts geschadet. Hab das Gefühl, als sei ich bestens für das Leben ausgerüstet, als hätte ich Schwimmhäute für den Modder. Ich passe in die Welt, bin nicht fein. (…) Auf der anderen Seite stehen lauter Minuszeichen. Ich weiß nicht mehr, was ich noch auf der Welt soll. Ich bin keinem Menschen unentbehrlich, stehe bloß so herum, warte, sehe derzeit weder Ziel noch Aufgabe vor mir.» Sie spielt einiges an Möglichkeiten durch: Nach Moskau gehen, Kommunistin werden oder Künstlerin? Alles verwirft sie. «Die Liebe? Die liegt zertreten am Boden. (…) Die Kunst? Ja für die Berufenen, zu denen ich nicht zähle. Bin nur ein kleiner Handlanger, muss mich bescheiden. Einzig im engen Kreis kann ich wirken und gut Freund sein. Der Rest ist Warten auf das Ende. Trotzdem reizt das dunkle und wunderliche Abenteuer des Lebens. Ich bleibe schon aus Neugier dabei; und weil es mich freut zu atmen und meine gesunden Glieder zu spüren.»[11]
Und Friedrich Luft? Der Theaterkritiker, der Ende April mit weißer Armbinde aus dem Keller gestiegen und den russischen Soldaten entgegengegangen war, blieb auch dabei, mit unstillbarer Neugier. Für das Feuilleton des im September 1945 gegründeten Berliner «Tagesspiegel» schrieb er regelmäßig Glossen unter dem Pseudonym Urbanus. Da ging es um das erotische Fluidum der Großstadt, um die schönen Kleider im Frühjahr, um die gespannte Erwartung, wenn morgens der Briefträger kommt.
Friedrich Luft war die «Stimme der Kritik» beim Westberliner RIAS. Von Februar 1946 bis zum Oktober 1990, kurz vor seinem Tod, beendete er jede seiner wöchentlichen Sendungen mit einem Satz, der den Hörern wie Honig in die Seelen träufelte, weil er Verlässlichkeit versprach: «Wir sprechen uns wieder in einer Woche. Wie immer. Gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle.»
Friedrich lebte mit seiner Frau, einer Zeichnerin, noch viele Jahrzehnte in dem Haus, aus dessen Keller er 1945 gestiegen war. In den frühen siebziger Jahren zog es Heide Luft des Öfteren in eine Kneipe am Winterfeldtplatz, nicht weit von ihrem Wohnhaus entfernt. Das Lokal hieß Ruine. Es hieß nicht nur so, es war auch eine: Das Vorderhaus war noch immer weggebombt, seine Grundmauern standen aber in Teilen und bildeten mit ihren schartigen Wänden einen bizarren kleinen Biergarten. Im Hinterhaus befand sich die Gaststube, stets rappelvoll. Ein Baum wuchs aus dem zugeschütteten Keller des Vorderhauses, und es hatte sich angeboten, ein paar Glühlampen aufzuhängen. Die Kneipe war Anfang der Siebziger ein Treffpunkt von Leuten, die mal Dichter werden wollten. Meist waren es Studenten. Es sah aus, als hätte der Krieg gerade eben erst aufgehört. Während ihr Mann daheim an seinen Kritiken fürs Radio feilte, saß Frau Luft in ihrem eleganten Pelzmantel unter den langhaarigen Leuten, parlierte ein bisschen, stets gescheit und unverbindlich, und gab manchmal einen aus. Sie war eine von vielen, die gern zur Stunde Null zurückkehrten, jeder auf seine Weise.
Zweites KapitelIn Trümmern
Wer soll das je wieder aufräumen? Strategien der Enttrümmerung
Der Krieg hatte in Deutschland etwa 500 Millionen Kubikmeter Trümmer hinterlassen. Um sich die Menge zu veranschaulichen, machten die Menschen alle möglichen Rechnungen auf. Die «Nürnberger Nachrichten» nahmen das Zeppelinfeld auf dem Reichsparteitagsgelände als Bezugsgröße. Auf diesem je 300 Meter breiten und langen Platz aufgeschichtet, würden die Schuttmengen einen 4000 Meter hohen Berg ergeben, auf dem ewiger Schnee läge. Andere legten die Berliner Trümmer, die auf 55 Millionen Kubikmeter berechnet waren, in Gedanken als einen dreißig Meter breiten und fünf Meter hohen Wall nach Westen aus und gelangten damit in der Phantasie bis nach Köln. Mit solchen Gedankenspielen versuchte man, die gewaltigen Massen, die wegzuräumen waren, fasslich zu machen. Wer damals in den stadtteilweise vollständig zerstörten Städten wie Dresden, Berlin, Hamburg, Kiel, Duisburg oder Frankfurt stand, konnte sich nicht vorstellen, wie deren Überreste jemals beseitigt, geschweige denn wiederaufgebaut werden sollten. Auf jeden der überlebenden Einwohner Dresdens entfielen 40 Kubikmeter Schutt.
So kompakt in Kubikmetern waren sie freilich nicht zu haben; die Trümmer lagen in stadtweiter Ausdehnung als fragile Ruinen vor, zwischen denen sich zu bewegen lebensgefährlich war. Wer mittendrin wohnte, oft in nur drei von vier Wänden und ohne Dach, musste erst einmal über hohe Schuttberge krabbeln und sich zwischen freistehenden Mauerresten hindurchwagen, um nach Hause zu kommen. Einzelne Mauern waren oft fassadenhoch, ohne stützende Seitenwände, und drohten jeden Moment einzustürzen. Über den Köpfen schwebte Gemäuer an verbogenen Eisenträgern, ganze Betonböden ragten frei aus nur einer Wand heraus. Darunter spielten Kinder.
Zur Hoffnungslosigkeit bestand eigentlich jeder Anlass. Doch die meisten Deutschen leisteten sich nicht mal einen kurzen Moment der Verzagtheit. Am 23. April 1945, der Krieg war offiziell noch gar nicht zu Ende, veröffentlichte das amtliche Mitteilungsblatt für Mannheim bereits den Aufruf «Wir bauen auf»:
«Ganz bescheiden können wir das vorläufig nur, denn erst gilt es, Berge von Trümmern zu beseitigen, bevor wieder ein Boden gefunden wird, auf dem gebaut werden kann. Am besten fängt man damit an, den Schutt zu beseitigen, und nach einem alten Sprichwort zuerst einmal den vor seiner eigenen Tür. Damit werden wir schon fertig werden. Schwieriger wird es, wenn ein glücklich Heimgekehrter vor seiner zerbrochenen Hütte steht, in der er gerne wieder hausen möchte. Da muss mit seit Jahren geprobter Kunstfertigkeit gehämmert und gezimmert werden, bis man wieder drin wohnen kann. (…) Selbsthilfe ist nur dann möglich, wenn man über Dachpappe und Dachziegel verfügt. Damit möglichst vielen und schnell geholfen werden kann, ist es nötig, dass jeder, der von früheren Arbeiten noch Restbestände an Dachdeckungsmaterial hat, diese unverzüglich an das zuständige Bezirksbaubüro abgibt. (…) So wollen wir wieder aufbauen, zuerst ganz bescheiden, Schritt für Schritt, damit erst einmal wieder Fenster und Dach zu sind, dann werden wir weiter sehen.»[12]
Auf Mannheim waren zwar Unmengen britischer Bomben gefallen und hatten die Hälfte der Häuser zerstört, aber durch ein fast perfektes System von Luftschutzkellern hatte nur ein halbes Prozent der Bevölkerung dabei sein Leben lassen müssen. Vielleicht erklärt sich daraus der sonderbare Frohsinn, mit dem hier im Hämmern und Zimmern fast ein Heimwerkeridyll gemalt wird. Aber auch andernorts machte man sich mit einem auf Außenstehende makaber wirkenden Elan gleich nach Ende der Kampfhandlungen ans Aufräumen.
«Erst mal wieder Grund reinbringen», hieß die Devise, und das bedeutete wortwörtlich, «einen Boden zu finden». Es gelang überraschend schnell, im Chaos der Trümmer eine erste Ordnung zu schaffen. Schmale Gänge wurden freigeräumt, auf denen man bequem durchs Geröll eilen konnte. In den zusammengefallenen Städten ergab sich eine neue Topographie von Trampelpfaden. In den Schuttwüsten entstanden Oasen des Aufgeräumten. Zum Teil hatten die Menschen die Straßen so gewissenhaft gereinigt, dass das Kopfsteinpflaster glänzte wie zu besten Tagen, während auf den Bürgersteigen die Trümmerstücke, penibel nach Größen sortiert, aufeinandergeschichtet waren. Im badischen Freiburg, das schon immer als besonders kehrwütig galt – «Z’Friburg in de Stadt, sufer isch’s un glatt» lautet ihr von Johann Peter Hebel entliehenes Motto – stapelte man die losen Trümmer so liebevoll zu Füßen der Ruinen auf, dass die apokalyptische Szenerie fast schon wieder wohnliche Züge bekam.
Auf einer 1945 aufgenommenen Fotografie von Werner Bischof sieht man einen Mann allein durch diese gekehrte Hölle laufen. Er trägt seinen Sonntagsstaat, wir sehen ihn von hinten, ein schwarzer Hut ist in den Nacken geschoben, die Reiterhosen hat er in die kniehohen Stiefel gestopft, was ihm in Kombination mit dem eleganten Sakko einen rittmeisterlichen Eindruck verschafft. Er trägt einen geflochtenen Korb in der Hand, als schlendere er zum Einkaufen, was dem Bild den offiziellen Titel «Mann auf der Suche nach etwas Essbarem» eingebracht hat. Er wandert geradezu kecken Schrittes; seine Körperhaltung drückt Optimismus und Entschlossenheit aus, und zusammen mit der aufmerksam nach oben gerichteten Kopfhaltung, in der er neugierig die Gegend mustert, ergibt sich der anrührende Eindruck, hier sei jemand in einen falschen Film geraten.
So war es, und so war es nicht. Die Deutschen hatten viel Zeit gehabt, sich an die Verwüstungen zu gewöhnen, und sie hatten Übung im Enttrümmern. Sie fingen ja nicht erst zum Kriegsende damit an. Seit Beginn der ersten Bombardierungen 1940 hatten sie nach immer verheerenderen Angriffen die Städte aufräumen und notdürftig sichern müssen. Allerdings standen ihnen dazu Massen von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern zur Verfügung, die sie unter unmenschlichen Bedingungen für die harte Arbeit einsetzten. Wie viele dabei umgekommen waren, hat in den letzten Kriegsmonaten niemand mehr genau gezählt. Nach Kriegsende aber mussten die Deutschen diese Arbeit erstmals selbst erledigen.
Was lag da näher, als diejenigen heranzuziehen, die das Desaster angezettelt hatten? Fast überall wurden in den ersten Nachkriegswochen durch die Alliierten und ihre deutschen Statthalter sogenannte PG-Einsätze organisiert. Parteigenossen der NSDAP mussten die Trümmer beseitigen helfen. In Duisburg wurde Anfang Mai via Aushang verkündet, dass NSDAP-Mitglieder zur «Wegräumung von Straßenhindernissen» zwangsverpflichtet seien. «Sie müssen von den Parteigenossen, Freunden und Gönnern der Naziclique sofort beseitigt werden. Die zu diesem Zwecke Aufgeforderten haben dazu geeignetes Werkzeug selbst zu stellen.»[13] Entsprechende Anweisungen erhielten die Nazis namentlich zugestellt. Begleitet wurde die Aufforderung von der Drohung: «Falls Sie nicht erscheinen, werden entlassene politische Häftlinge für Ihr Erscheinen Sorge tragen.»
Allerdings waren diese Stellungsbefehle weder von der britischen Militärregierung noch vom Duisburger Bürgermeister ausgesprochen worden. Unterzeichner war ein «Aktionsausschuss Wiederaufbau», hinter dem sich ein sogenannter Antifa-Ausschuss verbarg, ein Zusammenschluss von NS-Gegnern, die Entnazifizierung und Wiederaufbau unbürokratisch in die eigenen Hände nehmen wollten. Anders als in vielen Städten, wo die Antifa-Ausschüsse mit den Stadtverwaltungen zunächst eng zusammenarbeiteten, sah der Duisburger Bürgermeister in der Strafaktion des Bürgerkomitees allerdings eine Amtsanmaßung. Er versuchte die Arbeitseinsätze durch eigene Aushänge abzusagen. Aber er konnte sich in den Wirren der Ereignisse nicht durchsetzen; dem selbsternannten «Aktionsausschuss Wiederaufbau» gelang es tatsächlich, eine beträchtliche Menge murrender NSDAP-Mitglieder wiederholt zur sonntäglichen Zwangsarbeit heranzuziehen.
Auch wenn solche durch Bürgerkomitees verhängte Bestrafungsaktionen von Nationalsozialisten nicht die Regel waren, zeigt das Duisburger Beispiel, dass die Deutschen nicht die verstockte homogene Masse waren, als die sie sich später präsentierten. Der Vorgang ist aber vor allem typisch für das Amtschaos der ersten Nachkriegsmonate. Die Alliierten setzten, sobald sie eine Region erobert hatten, die amtierenden Bürgermeister automatisch ab und ernannten auf die Schnelle neue, um ein Mindestmaß an Ordnung aufrechtzuerhalten. Im Idealfall erkundigten sie sich nach denen, die das Amt vor 1933 ausgeübt hatten, oder ließen ehemalige Sozialdemokraten herbeiholen. Bisweilen stellten sich deutsche Bürger selbst zur Verfügung, was aus unterschiedlichsten Motiven, gelegentlich auch idealistischen, geschah. Oft blieben sie nur wenige Tage im Amt, weil die mit der Entnazifizierung betrauten nachrückenden Dienststellen Einspruch erhoben.
In Frankfurt am Main hielt sich der Journalist Wilhelm Hollbach vergleichsweise lange im Amt, nämlich 99 Tage. Er war durch puren Zufall an die Spitze der Stadtverwaltung gelangt: Unmittelbar nach der Kapitulation wollte er beim amerikanischen Hauptquartier vorsprechen, um die Erlaubnis für die Gründung einer Zeitung zu erhalten. Besser zu früh kommen als zu spät, hatte er sich gedacht. Die Druckerlaubnis bekam Hollbach zwar nicht, stattdessen boten ihm die Militärs das höchste Amt der Stadt an. Über dessen Besetzung hatte man sich just in dem Moment den Kopf zerbrochen, als Hollbach in die Amtsstube platzte. Zu Frankfurts Segen übrigens. Kaum im Amt leitete er die sorgfältige Gründung einer Trümmerverwertungsgesellschaft in die Wege, die zwar erst relativ spät, dafür aber umso effektiver mit dem Aufräumen beginnen sollte.
Weniger Glück hatte der Schriftsteller Hans Fallada, der im mecklenburgischen Feldberg auf die Schnelle Bürgermeister geworden war. Eigentlich hatten ihn die Russen einlochen oder gar erschießen wollen, weil irgendwer in seinem Garten eine SS-Uniform abgelegt hatte, aber beim Verhör erschien er ihnen plötzlich genau der Richtige zu sein, um fortan im Dorf die Geschäfte zu führen. Ab sofort war der notorische Trinker und Morphinist Fallada also dafür zuständig, zwischen Bauern, Bürgern und Besatzern die Dinge zu regeln. Das lief zumeist auf das Beschlagnahmen von Vorräten und auf die Organisation von Arbeitseinsätzen hinaus. Nach vier Monaten brach er unter der Last der undankbaren Aufgaben zusammen, kam ins Krankenhaus nach Neustrelitz und kehrte, zumal seine Untertanen inzwischen sein Haus geplündert hatten, nie mehr nach Feldberg zurück.[14]
Während die Bürgermeister und andere Verwaltungsspitzen zunächst einmal entlassen wurden, blieben die Angestellten und Beamten der mittleren und unteren Ränge in der Regel erst einmal auf ihren Positionen. So konnten sich die alliierten Militäradministrationen auf eingespielte Verwaltungsvorgänge verlassen. Chaos und Routine hielten sich dabei die Waage. So unklar es sein mochte, wohin Deutschland sich entwickeln würde, so geläufig waren den Beamten die Abläufe, nach denen dabei vorzugehen war.
Die Tiefe der Erschütterung stand in eigentümlichem Kontrast zur Gewandtheit ihrer administrativen Bewältigung. Die mit den Aufräumarbeiten betrauten Dienststellen mit Namen wie «Amt für Großberäumung», «Trümmeramt», «Räumungsamt» oder «Neuaufbauamt»[15] waren dieselben wie vor Kriegsende. Dort sagte man sich: Gab es gestern Zwangsarbeiter, wird es heute wieder welche geben, man muss sie nur anfordern. Irgendwer muss den Dreck ja wegmachen. Diesmal waren es keine Russen oder Juden, sondern Deutsche – für das Resultat bedeutete das keinen Unterschied. Also orderten die Ämter den jeweiligen Bedarf an Arbeitskräften nun nicht mehr bei der SS, wie sie es gewohnt waren, sondern bei amerikanischen oder britischen Militärdienststellen, die ihre deutschen Prisoners of War bereitwillig lieferten.[16] Wie werden diese Beamten sich dabei gefühlt haben? War es ihnen egal? Oder hatten sie gar Gewissensbisse? Gründe dafür gab es nicht, denn so beschwerlich das Leben in den alliierten Internierungslagern auch sein mochte, so geschunden wie von der SS wurden die Kriegsgefangenen dort nicht. Schon gar nicht wurde ihr Tod einkalkuliert oder war gar Zweck der Sache wie in den Konzentrationslagern.
Auch in den gigantischen Trümmerhalden Berlins wurde das Aufräumen zur Strafarbeit. In den allerersten Tagen nach dem Einmarsch wurden durch Ausrufe Freiwillige rekrutiert. Sie kamen, weil es nach der Arbeit einen Teller Suppe gab. Dann aber waren die NSDAP-Mitglieder an der Reihe. Sie konnten leicht ausfindig gemacht werden, da die Berliner Bezirksämter nur für wenige Endkampftage den Betrieb unterbrochen hatten. Angeleitet wurden die Beamten und Angestellten von der «Gruppe Ulbricht» und anderen kommunistischen Remigranten, die mit der Roten Armee eingetroffen waren, um das städtische Leben zu reorganisieren und das Vertrauen in die russische Verwaltung zu stärken. Beim Aufspüren von Parteimitgliedern half ihnen ein System von Haus- und Straßenobleuten, das gleich in den ersten Besatzungstagen installiert wurde.
Unter den ersten Abkommandierten war auch die achtzehnjährige Sekretärin Brigitte Eicke. Das BDM-Mädchen war kurz vor dem Zusammenbruch des Regimes noch in die Partei eingetreten und musste nun dafür zum «Nazi-Sondereinsatz». Am 10. Juni 1945 notierte sie in ihr Tagebuch:
«Früh um ½ 7 mussten wir in der Esmarchstraße antreten. Mich wundert immer, dass unsere Führerinnen und die Mädchen aus unserer Gegend, die auch in der Partei waren, wie auch Helga Debeaux, nie hier sind, sie scheinen es zu verstehen, sich zu drücken. Diese Ungerechtigkeit ist entsetzlich. Wir mussten zum Bahnhof Weißensee, aber da war schon alles überfüllt, und so sind sie mit uns wieder zurückmarschiert zur Promenade. Die liegt ja übermannshoch voll Schutt und Dreck. Sogar Menschenknochen wurden gefunden. Wir haben hier geschippt bis 12 Uhr, die Tischzeit ging bis zwei, dann wieder weiter. Und heute ist solch herrliches Wetter, alle gehen spazieren und kommen bei uns vorbei. (…) Wir sollten bis abends 10 Uhr arbeiten. Es ist eine entsetzlich lange Zeit, überhaupt, wenn man so zur Schau steht. Wir haben uns immer mit dem Rücken zur Straße gestellt, damit man nicht die feixenden Gesichter sieht. Es ist manchmal zum Heulen, wenn nicht immer welche wären, die Humor behalten und die anderen mitreißen.»[17]
Natürlich war der Berliner Bauverwaltung wie der Militäradministration klar, dass 55 Millionen Kubikmeter Schutt nicht allein mit Strafeinsätzen zu beseitigen waren. Um die Enttrümmerung zu professionalisieren, wurden Bauunternehmer herangezogen. Je nach politischer Situation wurden sie dazu entweder zwangsverpflichtet oder gegen Entgelt beauftragt. In allen vier Besatzungszonen wurden Bauhilfsarbeiter angestellt, die für einen geringen Lohn, vor allem aber für die begehrte Schwerstarbeiter-Lebensmittelkarte, in den Steinwüsten schufteten.
Zu einer Art Nachkriegsfee entwickelte sich dabei die Trümmerfrau. Sie war außerhalb Berlins wesentlich seltener anzutreffen, als man heute glaubt. In Berlin aber war Schwerstarbeit tatsächlich Frauensache.[18] Hier ackerten auf dem Höhepunkt der Räumarbeiten 26000 Frauen und nur 9000 Männer. Nachdem Hunderttausende von Soldaten gefallen oder in Gefangenschaft waren, machte sich der Männermangel in Berlin gravierender bemerkbar als anderswo, weil Berlin schon vor dem Krieg die Hauptstadt weiblicher Singles war. Sie waren aus der Enge der Provinz in die Großstadt geflohen, um den Duft von Benzin und Freiheit zu atmen und in den neuen Frauenberufen selbständig leben zu können. Nun war die Beschäftigung als Bauhilfsarbeiterin der einzige Weg, etwas Besseres zu erhalten als die niedrigste Lebensmittelkarte, die mit ihren sieben Gramm Fett pro Tag gerade mal vorm Verhungern bewahrte.
Im Westen hingegen wurden Frauen sehr selten zur Enttrümmerung eingesetzt. Hier waren es vor allem Strafaktionen im Zuge der Entnazifizierung und Disziplinierungsmaßnahmen gegen «verwahrloste Mädchen und HwG-Frauen» (für «häufig wechselnde Geschlechtspartner»), bei denen Frauen in die Trümmer mussten. Dass sich die Trümmerfrau dennoch zur mythischen Heroine des Wiederaufbaus entwickeln konnte, liegt an dem unvergesslichen Anblick, den ihr Einsatz in den Ruinenfeldern bot. Waren die Ruinen schon fotogen, so waren es die Trümmerfrauen erst recht. In den häufig abgedruckten Fotos sieht man sie in langen Reihen hügelan stehen. Teils tragen sie Schürzen, teils Kleider, unter denen die klobigen Arbeitsstiefel hervorlugen. Oft haben sie Kopftücher umgebunden, nach Traktoristinnenart vorn geknotet. So bilden sie Eimerketten, reichen sich in Blecheimern den Schutt von Hand zu Hand, schaffen ihn aus den Ruinen auf die Straße, wo er von halbwüchsigen Kindern sortiert und gesäubert wird.
Diese Bilder brannten sich ein, weil die Eimerketten eine großartige visuelle Metapher für den Gemeinsinn boten, den die Zusammenbruchsgesellschaft bitter nötig hatte. Was für ein Kontrast: Hier die zerfallenen Ruinen, dort der Zusammenhalt der Eimerkette! Der Wiederaufbau erhielt darin ein heroisch-erotisches Gesicht, mit dem man sich dankbar identifizieren und auf das man trotz der Niederlage stolz sein konnte. So konkurriert die Trümmerfrau ikonographisch mit dem «Frowlein», dem nuttigen Amiliebchen, das vergleichbar wirkmächtig durch den Bildervorrat der Erinnerung geistert.
Manche Trümmerfrauen streckten den Fotografen trotzig die Zunge raus oder drehten den Kameraleuten eine Nase. Dass einige auffallend elegante Kleider trugen, die mit ihren weißen Kragen und den leichten geblümten Stoffen vollkommen unpassend für die Drecksarbeit waren, lag meist daran, dass es ihre letzten waren. Wer in den Luftschutzkeller gegangen oder evakuiert worden war, hatte ja immer das Beste mitgenommen. Die schönsten Kleider hatten die Frauen sich bis zum Schluss aufgespart, und nun war es so weit.
In anderen Fällen hing die deplatzierte Anmut der Kleider damit zusammen, dass die Aufnahmen inszeniert waren. In einigen Wochenschauszenen werfen sich die Frauen die Trümmer so elegant und treffsicher zu, als wären sie im Sportunterricht. Das sieht toll aus, wirkt aber unglaubwürdig und uneffektiv. Vollständig verlogen sind die Aufnahmen aus dem zertrümmerten Hamburg, die noch in Goebbels Auftrag gemacht worden waren. Hier lachen vermeintliche Trümmerfrauen derart ausgelassen beim Ziegelwerfen in die Kamera, dass nur Blindgläubige das für echt halten konnten. In Wahrheit waren es Schauspielerinnen.[19]
Trümmerfrauen wurden zu mythischen Figuren der Nachkriegszeit, nicht zuletzt weil sie so fotogen waren. Hier schuften sie vor der Dresdener Zigarettenfabrik Yenidze.
Unsentimental und mitleidlos blickte die amerikanische Fotojournalistin Margaret Bourke-White auf ihre im Staub schuftenden Geschlechtsgenossinnen. In Berlin notierte sie 1945 für einen Reisebericht: «Diese Frauen bildeten eines der vielen menschlichen Förderbänder, die für die Aufräumungsarbeiten der Stadt organisiert worden waren und gaben ihre Eimer mit kaputten Ziegelsteinen in so geübtem Zeitlupentempo weiter, dass ich den Eindruck hatte, sie hätten die Mindestgeschwindigkeit berechnet, die gerade noch als Arbeit gelten konnte und ihnen ihre 72 Pfennig Stundenlohn brachte.»[20]
Es stimmt, die ersten, unkoordiniert organisierten Enttrümmerungsaktionen waren nicht sonderlich effektiv. Teilweise hatten die Trümmerfrauen den Schutt einfach in den nächsten U-Bahn-Schacht geworfen, wo er später unter großen Mühen wieder herausbefördert werden musste. Im August 1945 wandte sich der Berliner Magistrat an die Bezirksämter und wies sie an, die «unkontrollierten Eimerketten» zu unterbinden. «Primitive Aufräumaktionen» seien zu beenden, sie müssten ab sofort fachgerecht und unter Aufsicht der Bauämter ausgeführt werden.
Zur «fachgerechten Großenttrümmerung» gehörte der Aufbau eines effektiven Transportsystems, mit dem der Schutt aus den Innenstädten hinaus auf Kipphalden gebracht werden konnte. Hierzu benutzte man Feldbahnen aus der Landwirtschaft: kleine Lokomotiven, die winzige Wägelchen über provisorisch ausgelegte Gleise zogen. Die Dresdener richteten gleich sieben solcher Schmalspurlinien ein. Die T1 beispielsweise führte vom «Beräumungsgebiet Stadtmitte» zur Kippe Ostragehege. Vierzig Loks fuhren herum, die alle weibliche Vornamen trugen. Entgleisungen gab es wegen der fliegend verlegten Gleise, aber im Großen und Ganzen verlief der Betrieb perfekt, mit Haupt- und Nebenstrecken, Betriebswechselbahnhöfen, Gewinnungs- und Abkippstellen. Für diese seltsame Bahn, die durch die brandgeschwärzten Reste Dresdens fuhr wie durch ein gespenstisches Lummerland, waren fast 5000 Mitarbeiter zuständig. Die letzte Bahn fuhr 1958, das offizielle Ende der Dresdener Enttrümmerung. Da waren aber noch längst nicht alle Areale beräumt. Wenngleich schon 1946 weite Teile der Innenstadt so leergefegt waren, dass Erich Kästner eine dreiviertel Stunde hindurchlaufen konnte, ohne an einem einzigen Haus vorbeizukommen,[21] konnte erst 1977, 32 Jahre nach Kriegsende, die letzte Enttrümmerungsbrigade Dresdens ihren Dienst beenden.[22]
Die Schuttmengen veränderten die Topographie der Städte. In Berlin entstanden Kriegsendmoränen, die ihre natürlichen Schwestern im Norden der Stadt nach Süden hin fortsetzten. Auf dem Gelände der ehemaligen Wehrtechnischen Fakultät luden 22 Jahre lang täglich bis zu 800 Lastkraftwagen so viel Schutt ab, dass der auf diese Weise entstandene Berg, später sinnigerweise Teufelsberg genannt, zur höchsten Erhebung Westberlins heranwuchs.
Der Umgang mit den Trümmern beeinflusste die zukünftige Wirtschaftsentwicklung der Städte. Dass Frankfurt 1949 zwar nicht wie erhofft die Hauptstadt der Bundesrepublik, dafür aber die «Hauptstadt des Wirtschaftswunders» wurde, kündigte sich bereits beim Enttrümmern an. Die Frankfurter zeigten, dass man mit Schutt Geld verdienen konnte. Erst sah es allerdings so aus, als würde es dort überhaupt nicht vorangehen. Während andere Städte ihre Einwohner dazu anhielten, mit der Schaufel in der Hand sofort zu beginnen, ging die Frankfurter Verwaltung die Sache wissenschaftlich an. Sie analysierte, grübelte, experimentierte. Die Bürger begannen zu murren, weil ihre Stadt untätig im Chaos lag. Andernorts würden ganze Heerscharen aufräumen, in Frankfurt hingegen geschehe nichts, «um dem Aussehen der Stadt ein freundlicheres Gepräge zu geben», klagte eine Eingabe der Gewerkschaften. Doch bald zeitigte das Abwarten Erfolg. Frankfurter Chemiker fanden heraus, dass beim Durchglühen des Schutts Gips zu gewinnen war, den man in Schwefeldioxid und Calciumoxid zersetzen konnte. Am Ende des Prozesses bekomme man Sinterbims, der als Zuschlagstoff für Zement bestens zu verkaufen sei.
Zusammen mit der Philipp Holzmann AG gründete die Stadt die TVG, die Trümmerverwertungsgesellschaft, die das Aufräumen mit Verspätung, aber dafür umso effektiver in Angriff nahm. Nach dem Bau einer Großanlage zur Trümmeraufbereitung konnte sogar der Feinschutt, der in anderen Städten zu Bergen aufgetürmt wurde, für den Wiederaufbau verwendbar gemacht werden. In der wirtschaftlichen Konstruktion einer Public-private-Partnership, wie man das heute nennen würde, gelang es Frankfurt, die Aufbaukosten niedriger als in allen übrigen Städten zu halten und dazu noch ordentlich Gewinn zu machen. Ab 1952 schrieb die TVG schwarze Zahlen.[23] Die bis heute an ihrer Skyline deutlich sichtbare Prosperität der Stadt begann mit den Trümmern des alten Frankfurt.
Zur «fachgerechten Großenttrümmerung» gehörte der Aufbau eines Transportsystems. Die Trümmerbahn von Dresden fuhr auf sieben Schmalspurlinien mit 40 Kleinlokomotiven, die alle weibliche Vornamen trugen.
Der Wiederaufbau berauschte die Phantasien vieler Deutscher aber vor allem dann, wenn er wuselnde Dimensionen annahm. Vom Ameisenhaufen war auffallend gerne die Rede. Zu Pfingstmontag 1945 rief der Bürgermeister von Magdeburg die Einwohner zu einer unbezahlten Aufräumaktion auf – das Gegenmodell zur Frankfurter Praxis. Er erinnerte zunächst an die vollständige Zerstörung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg, bevor er zu den aktuellen Aufgaben kam: «Die Magdeburger müssen ihren Stadtsinn, der auch Gemeinsinn sein muss, beweisen durch das praktische Werk. (…) Keine Stadt in Deutschland, die vom Schicksal so getroffen ist wie Magdeburg, wäre in der Lage, gegen Lohn sich freizumachen von den Trümmern, die der Krieg hinterlassen hat. Welche Werte durch gemeinsame Arbeit schon dadurch gewonnen werden können, wenn die Ziegelsteine aus den Schutthaufen herausgeholt und geordnet werden, ergibt eine kleine Rechnung: 8000 Steine werden für eine normale Wohnung gebraucht; wenn viel tausend fleißige Hände an einem Sonntag eine Million Ziegelsteine neu gewinnen, dann wäre das Baumaterial für 120 Wohnungen. (…) Die Stadtverwaltung ruft, jeder Bürger, jeder Jüngling, jeder Mann soll folgen! Stunden der Bewährung in großer Not sind für die Magdeburger gekommen. Sie dürfen sich ihrer Stadt nicht versagen.»[24]
Aufstellen sollte man sich um sieben Uhr morgens «ohne vorherige Gruppenbildung, in Viererreihen, nicht gestaffelt». Zu erscheinen war Pflicht, jeder hatte 100 Steine so von Mörtel zu befreien, dass sie wiederverwendet werden konnten. Zum ersten Termin erschienen 4500 Männer, an den folgenden Sonntagen kamen doppelt so viele. Ob solche Einsätze eine freudlose Schinderei blieben oder mit einer gewissen Gaudi erledigt wurden, war von Stadt zu Stadt verschieden. Auch die Resonanz auf solche Arbeitsaufrufe war nicht überall gleich. In Nürnberg traten gerade mal 610 von 50000 Männern an.
Die geputzten Steine wurden zu je 200 Stück am Rand eines Trümmerfelds säuberlich zu Vierkantsäulen aufgeschichtet. Zum Zeichen, dass sie exakt abgezählt waren, wurde einer der oberen Ziegel hochkant gestellt. Am Ende waren auf diese Weise allein in Hamburg 182 Millionen Ziegelsteine gesammelt, geputzt, gezählt und gestapelt worden.
Hans Albers spaziert in dem Film «… und über uns der Himmel» aus dem Jahr 1947 im Trenchcoat durch die Berliner Ruinen. Aus dem Off singt er: «Es weht der Wind von Norden, er weht uns hin und her. Was ist aus uns geworden? Ein Häufchen Sand am Meer.» Die Kamera schwenkt über die sandige Trümmerwüste. Ein Häufchen Menschen macht sich im Schutt zu schaffen. Immer mehr Leute strömen dazu. Überall wird gehämmert, sortiert, Steine geklopft, die Trümmerbahn beladen. «Der Sturm fegt das Sandkorn weiter, dem unser Leben gleicht. Er fegt uns von der Leiter, wir sind wie Staub so leicht.» Mit brausender Orchesterunterstützung fällt der Chor ein: «Es muss doch weitergehen, wir fangen von vorne an.» – «Ach», ruft Hans Albers mehr, als dass er singt: «Ach, lass den Wind doch wehen!» Wieder der Schwenk über das Trümmerfeld, man sieht in rascher Schnittfolge lächelnde Menschen beim Grundreinemachen ihrer zerborstenen Welt. Der Film endet mit dem Vaterunser: «Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.»[25]
«Noch nie waren wir so erlösungsreif», hatte auch Ruth Andreas-Friedrich in ihrem Tagebuch gejubelt. «… und über uns der Himmel» zählt zu den sogenannten Trümmerfilmen. Im Hauptteil bietet er realistische Milieuschilderungen aus Berlin, zeigt bittere Armut und neuen Reichtum der Schwarzmarktgewinnler. Sein Schluss aber ist eine Apotheose des Wiederaufbaus. Mitreißend, tränentreibend, gemeinschaftsstiftend. Gigantischer Arbeitskampf, mythische Heldengemeinschaft, übermenschliche Aufgabe. Der ganze filmrhetorische Heroismus der Ufa lebt hier wieder auf, um im Enttrümmern ein unschädliches Betätigungsfeld zu finden.
Manche, nicht viele, gruselte es bei dieser Rhetorik. Während der Film beim Publikum gut ankam und von den meisten Kritikern im Großen und Ganzen gelobt wurde, fühlte sich der Kritiker der «Filmpost» an eine Propaganda erinnert, die er nie mehr sehen wollte: «Der unwahrscheinliche Aufbau-Chor, der über die Szene bleiert – eine fragwürdige Reminiszenz an Harlan-Filme –, nimmt es an Unglaubwürdigkeit mit der unwahren Schlussszene des Films ‹Irgendwo in Berlin› auf, in der ein Rudel Jugendlicher Reichsarbeitsdienst-Exerzitien vorführt. Nein, das wollen wir nicht mehr sehen, niemals wieder!»[26]
Ruinenschönheit und Trümmertourismus
Die Beliebtheit der Trümmerfilme hatte einen einfachen Grund: Die zerstörten Stadtpanoramen boten einen umwerfenden Anblick. Es wäre falsch zu behaupten, dass es ausschließlich ein entsetzlicher war. Manche Menschen konnten sich an den Trümmern nicht sattsehen. Sie empfanden sie wie einen Spiegel ihres inneren Zustands; manche hatten sogar das Gefühl, jetzt endlich sei kenntlich geworden, was die Welt auch schon vor dem Krieg ausgemacht hatte. Sie gingen in die Ruinen, grübelten in den Bruchstücken der Städte wie Dürers Melencolia über ihren herumliegenden Gerätschaften und sannen den verborgenen inneren Zusammenhängen nach, die zu diesem universellen Einsturz geführt haben könnten.
So erblickte der Architekt Otto Bartning in der Trümmerlandschaft «das durch den Krieg jählings bloßgelegte Bild einer schleichenden Krankheit», die nun erst offen zu Tage lag: «Schweigend umstarren uns die Trümmer, nicht als seien sie im Getöse der Explosionen eingestürzt, sondern als seien sie aus innerer Ursache in sich zusammengesunken. Können wir, wollen wir die ganze, grausam entlarvte Maschinerie unseres technisierten Daseins wieder zusammenbauen samt aller Last und Hast, Gedankenlosigkeit und Dämonie? Nein, sagt die innere Stimme.»[27]
Die Empfindung, dass die Trümmer das wahre Gesicht der Welt zeigten, hegten viele Menschen. Sie zogen mit Kameras in die Trümmerfelder und schossen «Bilder der Mahnung» – unter diesem Titel wurde alles gedruckt, was in Schutt und Asche lag. Natürlich wollten sie alle das Grauen darstellen, das sie bei dem Anblick befiel. Aber selbst ein so fürchterliches Schreckensszenario wie das zerhauene, brandgeschwärzte Dresden verhagelte den Fotografen nicht den Ehrgeiz, immer noch mehr aus dem Desaster herauszuholen, als es schon von sich aus bot. In der geborstenen Kunstakademie Dresden fand sich zufällig ein Skelett, das als Zeichen- und Studienobjekt gedient hatte und sich in den Trümmern gut machte. Das Skelett wirkte besonders spooky, weil es beweglich war, zum Beispiel gebückt am Stock laufen oder ein Bein so energisch ausstrecken konnte, als werde es vom Teufel gejagt.
Der Fotograf Edmund Kesting stellte das Knochengerüst so ein, dass es zwischen den barocken Trümmern zu tanzen schien. Sein Kollege Richard Peter spreizte die Arme und Beine dramatisch vom Skelett weg, bis es aussah, als haste der Tod zum Leichensammeln durch Dresden. Natürlich wussten beide Fotografen, dass die beklemmende Szenerie solche Verstärkung nun wirklich nicht nötig hatte. Aber der bestürzende Anblick Dresdens bewahrte die Profis nicht davor, es durch Hokuspokus noch toppen zu wollen.
Zu dem deutschen Trümmerbild schlechthin wurde Richard Peters «Blick auf Dresden vom Rathausturm». Oft wird das Foto auch «Eine Skulptur klagt an» genannt. Es zeigt aus der Vogelperspektive die zerstörte Stadt. Im rechten Vordergrund steht eine Art steinerner Engel, der mit verzweifelter Gebärde über die verwüstete Stadt zeigt. Dabei handelt es sich um eine drei Meter große Figur in Rückenansicht, die in schwindelnder Höhe auf der