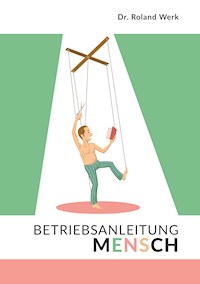Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Furcht vor Bakterien ist in dem Menschen verwurzelt. Dennoch machen wir uns Bakterien unwissentlich seit Jahrtausenden nutzbar. Das Buch "www.bakterien.com" beschreibt für den Laien die enorme Verzahnung mit der Natur und dem Menschen. Die Doppelköpfigkeit ihrer Natur zeigt sich sowohl in ihrer Bedeutung für Gesundheit als auch Krankheit. Sie verweisen uns auf unsere Verantwortung für die eigene Gesundheit und die Zukunft des Menschen über das Bindeglied Ernährung. Die moderne Forschung zu bakteriellen Floren, die Mikrobiomwissenschaft, bringt neuen Wind in die Medizin mit dem Versprechen alte Vorstellungen über den Haufen zu werfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt!
Goethe Faust
INHALT
VORWORT
EINLEITUNG
WAS WÄRE WENN
1-1 Was wäre, wenn es keine Bakterien gäbe
1-2 Was wäre, wenn wir jetzt alle Bakterien abtöten würden
1-3 Was wäre, wenn es keine Bakterienfloren gäbe
BIOLOGISCHE GRUNDREGELN
2-1 Welche Regeln gelten in der Biologie
2-2 Wie hat sich Leben entwickelt
2-3 Wie haben sich Bakterien entwickelt
2-4 Endosymbionten – Bakterien, die in Zellen leben
2-5 Exkurs: Entwicklung der Organsysteme
BAKTERIELLE GESELLSCHAFTEN
3-1 Was sind Mikrobiota
3-2 Wo gibt es Mikrobiota
3-3 Was leisten Mikrobiota
3-4 Wie funktionieren Mikrobiota
3-5 Was ist eine Dysbiose
3-6 Besondere Formen des Zusammenlebens von Bakterien mit höheren Lebewesen
MENSCH UND BAKTERIELLE GESELLSCHAFTEN
4-1 Bakterielle Gesellschaften und das zweite genetische System
4-2 Exkurs: Epigenetik
4-3 Programmierung von Krankheit und Gesundheit (DPHD)
4-4 Exkurs: DPHD
4-5 Schleimhäute: Vermittler zwischen mikrobiellen Floren und dem Körper
4-6 Leben mit Bakterien: Immunsystem
4-7 Exkurs: Bildung von sIgA
4-8 Entzündungs- und Stresssystem
4-9 Sprachrohr Hormone für die Darmflora und den Körper
4-10 Die Darmflora-/Darm-Hirn-Achse
BAKTERIELLE GESELLSCHAFTEN UND KRANKHEIT
5-1 Bakterielle Gesellschaften verändern das Krankheitsverständnis
5-2 Darmschleimhaut: Vermittler von Krankheiten
5-3 Exkurs: Fallbeispiel Neurodermitis
5-4 Dysbiose bei Krankheiten immer dabei
5-5 Exkurs: Schwangerschaftsvergiftung
5-6 Endotoxine: Wichtige Bindeglieder zwischen Ge-sundheit und Welt der Bakterien
ERNÄHRUNG – TRIEBFEDER DER EVOLUTION UND GESUNDHEIT
6-1 Ernährung und Evolution
6-2 Nahrung und der 2
te
genetische Code
6-3 Bakterielle Gesellschaften als Mittler zwischen Nahrung und Gesundheit
6-4 Ein TOR zur Gesundheit
6-5 Ernährung, Immunsystem und Darmflora
6-6 Exkurs: Muttermilch
ERNÄHRUNGSLÖSUNGEN VON GESTERN GESUNDHEITSPROBLEME VON HEUTE
7-1 Nahrungsmittelmassenproduktion: Quelle von Krankheit
7-2 Exkurs: Die Rolle der Darmflora des Menschen beim Austausch von Antibiotikaresistenzen
7-3 Ausblick: Experimente an den menschlichen Mikrofloren Experimente am Menschen
STICHWORTVERZEICHNIS
VORWORT
Als ich mein Studium aufnahm, gab es weder Internet noch Informationen vom Arbeitsamt. Ja manche Studienfächer wie Molekularbiologie oder Mikrobiologie waren wenig bekannt und wurden nicht an vielen Universitäten gelehrt. So stand ich wie viele andere in der Schlange, um mich, wie geplant, für das Chemiestudium einzuschreiben. Um mir die Zeit zu verkürzen, blätterte ich das Vorlesungsverzeichnis durch. Dabei entdeckte ich das Fach Mikrobiologie. Ich beschloss nach erfolgter Einschreibung, mir die Mikrobiologie näher anzuschauen. Diese Inspektion endete in einem Beratungsgespräch durch den Leiter des Institutes. Damals schon ein Glücksfall, heute undenkbar. Die Beratung überzeugte mich und so schrieb ich mich als erster von damals insgesamt 6 Studenten des Semesters in das Fach Mikrobiologie ein.
Seitdem hat mich die Faszination von Leben und natürlich von Bakterien nicht losgelassen. Damals wurde meine Sichtweise von Bakterien als Leistungsträger und von der enormen Vielfalt ihrer Fähigkeiten geprägt. Das nachfolgende Medizinstudium brachte mir den Aspekt der Schädlichkeit mancher Bakterien für den Menschen. Bakterien wurden und werden immer noch fast ausschließlich aus dem Blickwinkel der Infektionen betrachtet. Die positiven Beziehungen zwischen Bakterien und Menschen wurden bis vor wenigen Jahren ausgeblendet wie z.B. der Einfluss des bakteriellen Stoffwechsels auf uns.
Dabei hatten Mikrobiologen schon 1910 den Zusammenhang zwischen Immunsystem und Darmflora erkannt. Untersuchungen der normalen Darmflora zu therapeutischen Zwecken wurden lange als Hirngespinst abgetan. Erst als vor 10 bis 15 Jahren die modernen Gentechniken wie „next generation sequencing“ auf den Markt kamen, war das universitäre Interesse geweckt. Die Ergebnisse überschlugen und überschlagen sich noch immer. Eine immense Menge an Geld wurde/wird in diesen Forschungszweig gepumpt. Viele Wissenschaftler wittern hier ihre Karrierechancen. Heute werden Überlegungen bestätigt, die schon vorher mit biologischem Verständnis erkennbar waren und erkannt worden sind. Lediglich in der Medizinwelt haben sie die Anerkennung nicht bekommen. Das ändert sich erst langsam.
Vor ca. 20 Jahren bauten wir in unserem Institut eine funktionelle Diagnostik der Darmflora und des Darmes auf. Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen Mikrobiologie und der Zellbiologie sowie systembiologische Modelle bildeten die Basis. Sehr schnell wurde deutlich, dass die meisten Patienten eine Funktionsstörung der Darmflora hatten. Gelang es die Funktion der Darmflora wieder herzustellen, trat rasch eine Besserung der Beschwerden ein. Auch waren die positiven Auswirkungen bei schweren Erkrankungen wie Depression oder Krebs beeindruckend. Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik hat meine bereits erwähnte Faszination von Leben und Bakterien nur bestärkt. Gleichzeitig wurde mir die Bedenklichkeit des modernen Lebensstils für unsere Gesundheit und die unserer Nachkommen deutlich.
Dabei braucht der Mensch in seiner Entwicklung neue Ideen. Eine Reihe bekannter Wissenschaftler glaubt, dass wir am Scheideweg unserer biologischen und menschlichen Evolution stehen. Die Art, wie wir mit unseren Bakterienfloren in und auf uns umgehen, wird ein entscheidender Faktor sein. Um die Bedeutung dieses Themas zu unterstreichen, habe ich die Idee für den Titel des Buches von dem berühmten Mikrobiologen und Nobelpreisträger Joshua Lederberg „gestohlen“ (Lederberg 2000). Er sprach von einem weltweiten Netz der Bakterien und von dem Menschen als Superorganismus aus Bakterien und menschlichen Zellen.
Literatur
Lederberg J.. Infectious History. Science 288 (2000), S. 287-293.
EINLEITUNG
SEIT ÜBER 800 MILLIONEN Jahren gibt es höheres Leben auf der Erde. Seitdem haben Tiere, Pflanzen und letztendlich auch der Mensch Ärger mit einigen kriminellen Elementen aus der Viren- und Bakterienbranche. Zwar machen diese unter den Viren und Bakterien nur einen verschwindend kleinen Teil aus, dennoch ist der Ärger mit ihnen gigantisch. Bis vor 150 Jahren waren Infektionskrankheiten die Todesursache Nummer 1. Allein die Pest soll im Mittelalter 21 Millionen Menschen in Europa das Leben gekostet haben. Noch immer kann sie in bestimmten Gegenden der Welt zuschlagen. Und das, obwohl weltweit intensive Anstrengungen unternommen wurden, die Pest auszulöschen.
Infektionen haben über die Jahrtausende menschlicher Geschichte ihren kulturellen Niederschlag in der Sprache, Baudenkmäler und der Geschichte gefunden. Auch heute noch titulieren wir unseren Lieblingsfeind mit der Bezeichnung „Du Pestbeule“. In der Literatur finden sich genügend Geschichten zum „schwarzen Tod“. Hauptsächlich in Süddeutschland und Österreich errichteten Menschen „Pestsäulen“ in ihren Städten und Gemeinden. Es war ein Dank der Pestüberlebenden an Gott.
Die Katastrophen waren immens, wenn Infektionserreger in Teile der Welt eingebracht wurden, wo sie bis dahin nicht bekannt waren. So führte die Globalisierung im Mittelalter dazu, dass die Spanier bei der Eroberung Amerikas Masern eingeschleppt und damit Epidemien ausgelöst haben. Die Folge war, dass ganze indianische Völker in Amerika ausgelöscht wurden. Als „Dank“ dafür überließen diese den Spaniern die Syphilis. Diese war bis dahin in Europa nicht aufgetreten. Der „Erfolg“ ist bis heute grandios.
Sehr innovativ war die biologische Kriegsführung durch die goldenen Horden. Im frühen Mittelalter hatten die Mongolen auf ihrem Weg, Russland und Mitteleuropa zu erobern, die Pest mitgenommen. Die Stadt Kaffa widersetzte sich der Eroberung. Um ihren Widerstand zu brechen, schleuderten die Mongolen ihre Pesttoten in die Stadt.
Die Bedeutung von Virus- und Bakterienseuchen in der Vergangenheit ließe sich beliebig fortführen. Unsere Urangst vor Seuchen ist nach wie vor nicht ganz unbegründet. Eine dichte Bevölkerung und ein starker globaler Reiseverkehr würden heute Seuchen dieser Art noch katastrophaler werden lassen. Mit der Ebolavirusepidemie sind wir nur knapp an einem solchen Szenarium vorbeigeschrammt. In der Zwischenzeit ist die Botschaft wohl auch in der Politik angekommen. Immerhin stand die weltweite Gefährdung durch Seuchen als Thema auf dem G-20 Gipfel in Hamburg von 2017 (Beerheide et al. 2017).
Aus dieser zugegeben kritischen Gefährdungssituation hat sich nach Entdeckung von Viren und Bakterien als Erreger von Seuchen ein allgemeines Vorurteil entwickelt. Das ist das Vorurteil von den bösen Bakterien. Sie sind hinterhältig, da sie winzig, mikroskopisch klein, sind. Sie sind gefährlich, weil sie Infektionen verursachen können. Zudem sind sie Killer, da Medikamente zunehmend bei einigen Infektionen nicht mehr wirken. Darum brauchen wir immer mehr Desinfektionsmittel und noch mehr Antibiotika. Das ist der allgemeine Glaube und die Medizin- und Pharmaindustrie hat auch nichts dagegen.
Gerne, wenn überhaupt richtig bekannt, werden einige wesentliche Eckdaten der Mikrowelt und des Lebens übersehen oder nicht wahrgenommen. Bakterien gibt es seit über drei Milliarden Jahren auf der Welt. Viren sogar etwas länger. Das sind 3 Milliarden Jahre Überleben und 3 Milliarden Jahre Entwickeln. Der abgewandelte Songtitel von Harry Belafonte bringt es auf Punkt:
„Man smart – bacteria smarter“ (Der Mensch ist smart – die Bakterien sind smarter)
(Originaltitel: Man smart – woman smarter; Männer sind smart – Frauen sind smarter)
Dagegen sind 3 bis 6 Millionen Jahre, je nachdem inwieweit man menschenähnliche Vorläufer einbezieht, ein Klacks.
Zudem wird durch die Forschung über bakterielle Floren des Menschen und auch der Tiere deutlich, wie sehr wir mit den Bakterien in einem Boot sitzen. Denn eines ist definitiv klar, Bakterien brauchen keine Menschen, aber Menschen brauchen Bakterien. Das ist auch der Grund, warum manche Biologen spotten, dass es längst noch Bakterien geben wird, nachdem der letzte Mensch bereits gestorben ist.
Wir profitieren von biologischer Correctness. Der biologisch richtige Umgang mit Bakterien bringt uns weiter. In der Vergangenheit wurden biologische Fakten in der Regel nicht beachtet. Es ist wenig hilfreich, kleine Probleme so zu lösen, dass wir größere schaffen. Dann kann es sein, dass die menschliche Zukunft düster aussehen wird. Für alle, die es etwas boshafter haben wollen, gibt es das Zitat des bekannten Entwicklungsbiologen Wuketits: „Zum Aussterben ist es nie zu spät“ (Wuketits 2012).
In den letzten Jahren ist allerdings Bewegung in die Denkmuster der Wissenschaft gekommen. Zunehmend werden Bakterien positiver bewertet und ihre immense Bedeutung für die Menschen anerkannt. Vor kurzem erschien ein Artikel in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Science mit dem Titel „Anthropology of microbes“ (Benezra et al. 2012). Übertragen bedeutet dies in etwa: Die Wissenschaft vom Einfluss der Mikroorganismen auf den Menschen und seine Entwicklung.
Dementsprechend ist die Idee des Buches, Einblicke in die Welt der Beziehungen zwischen Bakterien und Mensch und deren Bedeutung für unsere Gesundheit zu geben. Dabei möchte ich keine Lanze für die Bakterien sondern für die Menschen brechen.
Literatur
Beerheide R., Maibach-Nagel E., Richter-Kuhlmann E.. Die Welt ist noch nicht ausreichend auf Gesundheitsgefahren vorbereitet. Interview mit Bundesgesundheitsminister Herman Gröhe. Deutsches Ärzteblatt 114 (2017), S. A979-A980.
Benezra A., DeStefano J., Gordon J. I.. Anthropology of microbes. Proceedings of the National Academy of Science 109 (2012), S. 6378-6381.
Wuketits F. M.. Zivilisation in der Sackgasse. Mankau Verlag GmbH, Murnau. 2012.
1 WAS WÄRE WENN
1-1 Was wäre, wenn es keine Bakterien gäbe
1-2 Was wäre, wenn wir jetzt alle Bakterien abtöten würden
1-3 Was wäre, wenn es keine Bakterienfloren gäbe
1 WAS WÄRE WENN
1-1 Was wäre, wenn es keine Bakterien gäbe
DIE FRAGE WAS PASSIERT WÄRE, wenn es keine Bakterien gegeben hätte, ist rein hypothetisch und unwirklich. Die Antwort ist: Dann hätte es nie jemand gegeben, der diese Frage hätte stellen können. Im allgemeinen und weniger allgemeinen Gedankengut geht man davon aus, dass Bakterien ein Schattendasein in sogenannten ökologischen Nischen führen. Das ist vollkommen falsch.
Vor 4 Milliarden Jahren glich die Welt einem Weltuntergangsszenario. Die Umwelt zu der Zeit entsprach den mittelalterlichen Höllendarstellungen niederländischer Maler. Auch in Urzeiten gab es das Höllenfeuer mit Saunatemperaturen von über 100°C. Die riesigen Kochtöpfe für die Sünder entsprechen den Geysiren mit Schwefelgestank gratis. Keiner von uns hätte in solch einer Welt leben mögen, geschweige denn, dass er sehr lange ohne Sauerstoff hätte überleben können. Und hier kommen die Bakterien ins Spiel. Sie waren nicht nur neben den Viren die ersten Lebewesen, sondern sie formten die Urwelt in das um, was heute der blaue Planet, unsere Erde, ist. Sie schufen nicht nur eine sauerstoffhaltige Atmosphäre, die uns heute noch ermöglicht zu leben, sondern sie sind auch gleichzeitig das Fundament, auf dem sich höhere Lebewesen einschließlich des Menschen entwickeln konnten. Und nach wie vor schützt uns das damals aufgenommene Projekt Ozonschicht.
Um den Sauerstoffgehalt von 0 % auf 22 % zu bekommen, mussten die Bakterien fast über 1 Milliarde Jahre heftig schuften. Ähnliche Gedanken dürften die Wissenschaftler vielleicht beflügelt haben, als sie eine wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel „animals in a bacterial world“ – „Tiere (und einschließlich Menschen) in einer Bakterienwelt“ in einer sehr angesehenen Wissenschaftszeitschrift veröffentlichten (McFall-Ngai et al. 2013).
Somit müsste der Satz „Was wäre, wenn es keine Bakterien gegeben hätte?“ mit – dann hätte es, wenn überhaupt, kein Leben in der uns bekannten Form gegeben – ergänzt werden. Ganz sicherlich hätte es dann auch nicht den heutigen Menschen gegeben. Über die Erde würden vielleicht irgendwann in ferner Zukunft extraterrestrische Wissenschaftler feststellen, dass sich Leben auf der Erde hätte entwickeln können. Ähnlich wie heute Wissenschaftler auf der Erde davon ausgehen, dass sich Leben auf dem Mars hätte entwickeln können. Somit dürfte auch klar geworden sein, dass Bakterien die wahren Herrscher auf unserer Welt sind und alle anderen Lebewesen, auch wir Menschen, eine ökologische Nische besiedeln. Dies belegt nicht zuletzt ihre Vielfalt mit weit über einer Million Bakterienarten. Ein Teil von ihnen wird in einem fünfbändigen Standardwerk der Mikrobiologie dem Bergey Manual of Systematic Bacteriology auf über 5.000 Seiten beschrieben.
1 WAS WÄRE WENN
1-2 Was wäre, wenn wir jetzt alle Bakterien abtöten würden
STELLEN WIR UNS FOLGENDES SZENARIO VOR. An einem geheimen Ort forscht ein genialer Wissenschaftler mit seinem Team. Sein Ziel ist das Superantibiotikum. Das soll alles, was mit Bakterien zu tun hat, vernichten. Da Geld keine Rolle spielt, kann er die kostspieligsten Methoden einsetzen.
Zu diesem Zeitpunkt finden viele diese Idee überwiegend gut. Keine Infektionskrankheiten mehr! Nur wenige halten diese Vorstellung alles andere als supertoll. Nun, die Geschichte geht weiter. Tatsächlich gelingt es dem Wissenschaftler nach mühseliger, langwieriger Arbeit das Superantibiotikum zu entwickeln. Die Testergebnisse zeigen, dass es jede Bakterienspezies ruckzuck abtötet und das schon in homöopathischen Dosen, d.h. super verdünnt. Die Labordaten ergeben auch Bakterien, bei denen kein übliches Antibiotikum mehr wirkt, sterben rasch ab. Sogar Resistenzentwicklungen, also ein unwirksam werden, lässt sich nicht nachweisen. Unglücklicherweise gerät zu diesem Zeitpunkt das Superantibiotikum durch einen Fehler in die Umwelt.
Was erwarten Sie, was dann alles passiert? Meinen Sie, dass die Menschen das überhaupt bemerken würden? Und gibt es überhaupt Nachteile?
Aus mikrobiologischer Sicht müssen wir mit einer enormen Menge an Problemen rechnen, ähnlich einem Supergau. Manche kann man wohlwollend als unangenehm bezeichnen. Die Mehrzahl dürfte eher unter dem Begriff „katastrophal“ fallen. Nur wenige Auswirkungen können wir dann noch positiv bewerten.
Eine wesentliche Aufgabe der Bakterien ist es, den Kreislauf der organischen Materialien in Schwung zu halten (Schlegel 1972). Bakterien bauen in Gemeinschaft abgestorbene Blätter oder tote Tiere ab. Sie kompostieren organisches Material. Bananenschalen ebenso wie Müslireste oder kalte Pommes frites werden zu Humus, zu Muttererde. Ihr Ausfall hätte riesige biologische Abfälle zufolge, in denen die Welt ersticken würde. Auch Schimmelpilze ebenso wie Würmer könnten nicht ausreichend helfen. Falls es tröstlich ist, der Biomüll würde nicht so sehr stinken, da er ja nicht bakteriell zersetzt wird. Gleichzeitig wären auch der Kohlendioxid-, der Stickstoffkreislauf usw. gestört. Pflanzen brauchen neben Kohlendioxid auch Stickstoff und viele andere Elemente zum Wachsen. Einige Pflanzen bedienen sich sogenannter Knöllchenbakterien an den Haarwurzeln, die Stickstoff aus der Luft binden. Viele andere aber leben von anorganischen Stickstoffverbindungen, die fleißige Bakterien bereitgestellt haben. Ohne Kompost ist also für Pflanzenwachstum nichts los.
Eine ganze Riege von Bakterien hilft Tieren und auch Menschen zu verdauen. Tierische Lebewesen, die andere Tiere auf ihren Speiseplan gesetzt haben, würden nach dem Superantibiotikumgau noch eine Weile Nahrung finden. Schlecht steht es allerdings um die Vegetarier unter den Tieren. Kühe z. B. können Gras nur verwerten, weil eine immense Zahl an Bakterien bei der Verdauung mithilft. Diese Tiere wären also bald verhungert. Die Fleischfresser, denen die Vegetarier als Mittagessen dienen, würden dann auch sehr bald mit knurrendem Magen nach nicht vorhandenem Nachschub Ausschau halten.
Wie später noch ausführlicher (Kap. 2-3) beschrieben wird, leben in allen höheren Zellen so eine Art Rumpfbakterien. Sie sind als Kraftwerke der Zelle, Mitochondrien, für die Energiebereitstellung zuständig. In Pflanzen ist eine weitere Rumpfbakterienart, die Chloroplasten, für die Bildung von Zucker aus Kohlendioxid, Wasser und Lichtenergie verantwortlich. Das Superantibiotikum würde auch diese Rumpfbakterien zerstören. Weder tierische noch pflanzliche Zellen könnten Energie produzieren. Wir stünden dann vor dem energetischen „black out“.
Nach den vorgestellten katastrophalen Auswirkungen wäre der Ausfall von bakteriell produzierten Lebensmitteln zwar traurig aber nicht gravierend. Dummerweise würden allerdings Lieblingsspeisen wie Joghurt und Kefir auch betroffen sein. Bei ihrer Entstehung ist eine Reihe von Bakterien beteiligt. Auch auf die vielgeliebte luftgetrocknete Wurst müssten wir aus den gleichen Gründen verzichten. Dagegen würde es wohl für manchen nicht so sehr ins Gewicht fallen, wenn es kein Sauerkraut oder scharfes Kim-chi mehr gäbe. Wir hätten mit dem Superantibiotikum, um es bildlich auszudrücken, den Ast für jegliches höhere Leben auf der Welt abgesägt.
1 WAS WÄRE WENN
1-3 Was wäre, wenn es keine Bakterienfloren gäbe
DIESE FRAGE VON DER BEDEUTUNG der Bakterienfloren, wissenschaftlich Mikrobiota, für den Menschen ist das Thema dieses Buches. Aus der Anzahl der folgenden Seiten lässt sich abschätzen, wie erheblich ihre Bedeutung ist. Bakterien sind in der Regel ausgesprochene Sozialwesen. Sie schließen sich auch mit anderen gerne zusammen, um große Aufgaben zu bewältigen, die ein einzelnes kleines Bakterium nicht schafft. Oft bilden sie auch aus arbeitsökonomischen Gründen große Konsortien, d.h. Gesellschaften. Die Devise: „Gemeinsam sind wir stark!“, ist von einem unbekannten Bakterium erfunden worden.
Solche Konsortien finden wir fast überall in und auf uns. Das Aha-Erlebnis gewannen Wissenschaftler als sie Tiere keimfrei aufzogen (Tannock 2001). Das geht natürlich nicht so einfach und mit jedem Tier. Wie immer mussten die Mäuse daran glauben. Als man dann die keimfreien Mäuse mit den normal aufgezogenen verglich, waren die Ergebnisse verblüffend. Tatsächlich können Mäuse keimfrei leben und alt werden. Sie bekommen auch keinen Schnupfen oder Blasenentzündung. Der Preis für ein schnupfenfreies Leben wird z. B. mit kleinerem Körpergewicht bezahlt. Zusätzlich müssen viele weitere positive Errungenschaften in die Waagschale geworfen werden. Darunter gehört auch ein handlungsfähiges Immunsystem. Dieses hält sich nämlich durch tägliches Sparring mit Bakterien fit. Regelmäßig steigt es mit Bakterien in den Ring, um sich mit diesen zu klopfen. Ebenso regelmäßig geht es als Sieger hervor. Und jeder weiß, wie angenehm es ist zu gewinnen.
Wo wir schon beim gutfühlen sind: Das friedliche Zusammenleben mit Bakterien fördert unsere Stimmung. Also ein nettes entspanntes Frühstück zusammen mit unseren Bakterien versüßt uns den Tag und lässt vieles einschließlich des Essens angenehmer überstehen. Längst hat die Wissenschaft auch die Vorstellung, dass wir mit Bakterien schlauer werden. Kein Wunder, wenn ein ziemlich bekannter amerikanischer Mikrobiologe (Xu und Gordon 2001) daher anregte: „Honor thy symbionts“.
Übersetzt bedeutet dies in etwa: „Pflege und ehre deine bakteriellen Mitarbeiter“.
Das wirkt wie bei einem Staat, der seine Bürger schätzt.
Mit unseren Bakterienfloren leben wir also besser, als wir ohne sie auskommen würden.
Literatur
McFall-Ngai M., et al.. Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences. Proceedings of the National Academy of Science 110 (2013), S. 3229-3236.
Schlegel, H. G.. Allgemeine Mikrobiologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 1972.
Tannock G. W.. Molecular assessment of intestinal microflora. American Journal of Clinical Nutrition 73S (2001), S. 410-4.
Xu J., Gordon J.I.. Honor thy symbionts. Proceedings of the National Academy of Science 100 (2003), S. 10452-10459.
2 BIOLOGISCHE GRUNDREGELN
2-1 Welche Regeln gelten in der Biologie
2-2 Wie hat sich Leben entwickelt
2-3 Wie haben sich Bakterien entwickelt
2-4 Endosymbionten – Bakterien, die in Zellen leben
2-5 Exkurs: Entwicklung der Organsysteme
2 BIOLOGISCHE GRUNDREGELN
2-1 Welche Regeln gelten in der Biologie
VOR CA. 4 MILLIARDEN JAHREN startete das Großprojekt „Leben“. Diese immense Leistung fußt darauf, dass sich die Natur an grundlegende Regeln hielt und noch immer hält. Ordnung ist nach dem Physiknobelpreisträger Erwin Schrödinger ein Grundmerkmal des Lebens. Nur was passiert, wenn Regeln bei vielschichtigen Projekten schwammig gehandhabt werden, zeigt ein Beitrag, über den ich vor Jahren gestolpert bin (vgl. www. telemax.at).
Bill Gates’ Vorwürfe – und die Antwort von General Motors
Bei der Computermesse Com-Dex hat Microsoft-Chef Bill Gates die Computer-Industrie mit der Auto-Industrie verglichen. Dabei stellte er fest: „Wenn General Motors mit der Technologie so mitgehalten hätte wie die Computer-Industrie, dann würden wir heute alle 25-Dollar-Autos fahren, die auf 1000 Meilen nur eine Gallone Sprit verbrauchen.“
Daraufhin hat General Motors eine witzige Presse-Entgegnung veröffentlicht:
Wenn General Motors eine Technologie wie Microsoft und Windows 95 entwickelt hätte, dann würden wir heute alle Autos mit folgenden Eigenschaften fahren:
Ihr Auto würde ohne erkennbaren Grund zweimal am Tag einen Unfall haben.
Jedes Mal, wenn die Mittellinien auf der Straße neu gemalt werden, müsste man ein neues Auto kaufen.
Gelegentlich würde ein Auto ohne erkennbaren Grund auf der Autobahn einfach ausgehen.
Auch bei Linkskurven würde das Auto einfach ausgehen. Man müsste dann den Motor neu installieren.
Die Öl-Kontrollleuchte, die Warnlampen für Temperatur und Batterie würden durch eine Anzeige „Schwerwiegender, genereller Autofehler“ ersetzt werden.
Das Airbag-System würde fragen „Sind Sie sicher?“ bevor es auslöst.
Immer dann, wenn von General Motors ein neues Auto vorgestellt würde, müssten alle Autofahrer das Autofahren neu erlernen, weil keiner der Bedienhebel so funktionieren würde wie in den alten Autos.
Man müsste den „Start“-Knopf drücken, um den Motor auszuschalten. (him)
Der Vergleich mit der Informationstechnologie mag dem einen oder anderen an den Haaren herbeigezogen sein. Dem ist so mitnichten. Leben beruht auf dem Prinzip (Oltvai und Barabasi 2002):
Informationsspeicherung – Verarbeitung der Information – Ausführung. Und der ganze Ablauf wird mit hoher Genauigkeit abgewickelt jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde – jederzeit. Das Erbmaterial bzw. die darin enthaltene Information ist die Blaupause für unseren Organismus. Je nach Bedarf wird ein Teil des Planes, Gene, in eine Arbeitsanleitung abgeschrieben, wissenschaftlich Transkription. Die Informationsspeicherung wird mit dem Erbmaterial, dem Genom, erreicht. Die Verarbeitung der Information entspricht der Umsetzung der Gene in Eiweiße, wissenschaftlich Translation. Diese werden für den Aufbau der Strukturen und Formen benötigt bzw. stellen die Automaten für den Stoffwechsel, wissenschaftlich Enzyme.
In seinem Belfaster Exil hat sich der Physiknobelpreisträger Erwin Schrödinger mit der Frage auseinandergesetzt: Was ist Leben? (Schrödinger 1989). Seine prägnante Schlussfolgerung, die die moderne Biologie maßgeblich beeinflusst hat, war: Leben ist Ordnung aus Ordnung.
Die Informationsspeicherung ist recht zuverlässig, sonst würde, um beim obigen Beispiel zu bleiben, bei jeder Zellteilung, z.B. um neue rote Blutkörperchen zu bilden, ein Neustart des Körpers erforderlich sein. Bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Wunden oder Knochenbrüchen würde ein fataler Fehler gemeldet gefolgt von einem Systemabsturz, der nur von dem Systemadministrator behoben werden kann. Auch die Übersetzung, Translation, ist ein sehr genauer Prozess, der die Herstellung von Eiweißen wie am Fließband mit hoher Qualität garantiert. Erst bei gravierenden Problemen wie Beschädigung oder fehlerhafter Ablesung der Festplatte, der Erbinformation, zum Beispiel durch Alterung oder Gifte, sinkt die Genauigkeit der Verarbeitung. Dies hat dann auch Auswirkung auf die Ausführung, den Stoffwechsel. Der Stoffwechsel kann mit einer Fabrik verglichen werden. Zum einen werden Substanzen zur Energiegewinnung abgebaut. Zum anderen werden Ausgangssubstanzen für Eiweiße, Zucker, Fette und Nukleinsäuren produziert.
Kommen wir noch einmal zur Informationsspeicherung zurück. Der deutsche Nobelpreisträger Manfred Eigen gab zu bedenken, dass man zur Umsetzung eines Bauplanes exakte Anweisungen braucht (Eigen und Winkler 1975). Um festzulegen, was, wo und wie oft zu tun ist, wäre eine enorme Anzahl von Instruktionen erforderlich. Die Menge an Informationen würde um ein vielfaches die Speicherkapazität unseres Informationsspeichers, der DNA, überschreiten. Hier greift die Natur auf zwei Prinzipien zurück. Schon einfache chemische Moleküle haben die Eigenschaft sich selbst zu organisieren (Haken 1991). Ein berühmtes Beispiel ist die Belousov-Shabotinsky-Reaktion. Zwei zusammengeschüttete Farben (Rot und Blau) führen zu einem periodischen Farbumschlag. Dieser Vorgang verläuft rhythmisch in Form von Schwingungen ab. Dieses Prinzip der Selbstorganisation ist typisch für die Biologie. Diese Selbstorganisation finden wir z. B. beim Aufbau der Zellmembrane, der Zellhülle, aus Fettsäureverbindungen. Die Moleküle organisieren sich zu einer doppelschichtigen Membrane mit den Fettsäureresten nach innen. Die Selbstorganisation ermöglicht es, mit weniger Anweisungen auszukommen.
Unterstützt wird sie durch das Vorgehen, wie wir es von der Bauindustrie kennen. Hier wie dort wird mit Standardbauteilen gearbeitet, so dass Strukturen und Funktionen rasch aufgebaut werden können (Riedl 1975). Der Einsatz von Standardbauteilen bzw. Standardmodulen hat einige erhebliche Vorteile. Einmal entwickelt und getestet können sie beliebig eingesetzt werden. Zudem läuft die Produktion bei Bedarf auf Hochtouren wie an einem automatischen Fließband. Fehlerquellen sind minimiert. Daher ist es nicht erstaunlich, wenn sich manche Bakterien wie Escherichia coli unter optimalen Bedingungen alle zwanzig Minuten vermehren. Dazu muss das Bakterium im Vorfeld praktisch jedes Bauteil von der Erbinformation bis zur Zellwand für die Tochterzelle bereitstellen. Ein weiterer Vorteil dieses Prinzips ist der Aufbau sich gleichender, ähnlicher Formen. Dieses ist phantastisch beim Romanescokohl zu sehen. Er ist ein anschauliches Bild sich selbstähnlicher Formen, die wissenschaftlich als Fraktale bezeichnet werden (Strogatz 2005). Fraktale haben die Kunst beflügelt und bei bizarren filigranen Kunstwerken Pate gestanden. Darauf ist jedoch die Bedeutung sich selbstähnlicher Formen in der Biologie nicht beschränkt. Die Aufteilung der Atemwege in der Lunge folgt diesem Prinzip ebenso wie die Aufteilung der Gefäße bis hin zu den Haargefäßen.
Im Darm ist die Aufnahme von Nahrungsstoffen nicht ein konstanter Prozess. Auch hier verwirklicht sich ein selbstähnelndes Muster. Eine große Bedeutung haben fraktale Muster bei den rhythmischen Veränderungen des Herzschlages (Goldberg et al. 2002). Wissenschaftler beschreiben diese Schwingungen als Herzschlagvariabilität,im Englischen heart rate variability. Sie entspricht dem körperlichen Zustand von Anspannung, Belastbarkeit und Erholungsfähigkeit. Bei gesunden Menschen „tanzt“ das Herz in einem beschwingten Rhythmus, der nicht exakt gleich sondern ähnlich ist. Erst wenn das Herz überhaupt nicht mehr reguliert, z. B. vor dem Tod, dann „marschiert“ es, die Abstände von Herzschlag zu Herzschlag sind gleich. Sogar bei dem Aufbau und der Veränderung genetischen Materials scheint sich die Natur der Fraktalen zu bedienen (Fujihara und Furusawa 2016). Noch viele weitere Beispiele lassen sich finden.
Ebenso wie die Autohersteller unterliegt die Natur dem Problem, dass Entwicklung und Testung neuer Bauteile teuer ist und viel Zeit kostet (Riedl 1975). Da die Natur sich eher wie ein penetranter penibler Buchhalter kostensparend verhält, gibt es eben nicht jedes Jahr ein neues Modell wie bei den Autoherstellern. Zudem sind die Module sorgfältig geprüft und haben sich im Alltagsleben bewährt. Diese Module sind gereift, so dass sie nicht wie bei unseren Standardcomputerprogrammen ein fast tägliches „update“ benötigen. Dementsprechend finden wir diese Standardbauteile nicht nur in einem Modell, also Lebewesen, sondern sie ziehen sich mit gewissen Modifikationen in fast allen Lebewesen durch. Insekten haben genauso wie Mäuse, Affen und Menschen ähnliche Atmungsenzyme oder Enzyme zum Abbau von Eiweißen. Zum nicht unerheblichen Anteil sind Prozesse in den Lebensabläufen z. B. Alterungsprozessen vergleichbar. In der Wissenschaft wird diese Konstanz für Standardbauteile als konservativ bezeichnet. Eine solche Kompatibilität würde man sich für die Computertechnologie wünschen und nicht, dass man sich alle paar Jahre einen neuen Rechner kaufen muss, weil der alte Rechner Neuentwicklungen nicht unterstützt. Die Natur hat ihr Prinzip der Konstanz so weit vorangetrieben, dass sie keine Module mehr von Grund auf neu entwickelt. Sie nutzt vorhandene Standardmodule, um sie für andere Aufgaben umzuwidmen. Sie verändert einfach ihre Erfolgsmodelle. Aus den Atmungsenzymen sind Enzyme für die Entgiftung hervorgegangen. Ein anderes sehr wichtiges Modul sind die sogenannten Protein G-gekoppelten Rezeptoren. Ursprünglich aus einem Signalweiterleitungseiweiß der Zellwand hervorgegangen, erfüllen über 2000 Varianten verschiedenste Aufgaben. Sie regulieren den Blutdruck und helfen uns beim Sehen, Hören und Schmecken. Chemisch ist die Grundstruktur im Wesentlichen dabei gleich geblieben. Wissenschaftlich spricht man von Eiweißfamilien.
Da die G-Proteine ebenso eine wichtige Rolle bei einigen Krankheiten spielen, wurden Medikamente entwickelt, die z. B. die Rezeptoren ansprechen, die den Blutdruck regulieren. Allerdings beinhalten diese Medikamente den Nachteil, dass sie auch auf verwandte Module aus der Familie mit anderen Aufgaben wirken. In der Medizin bezeichnet man diese Wirkungen als Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen.
Somit können ganze Netzwerke von Wirkungen entstehen. Das Verständnis solcher Zusammenhänge, die die Regel und nicht die Ausnahme sind, ist für die Biologie und damit auch Medizin hilfreich. Zumindest braucht man dann nicht verwundert zu sein, wenn man an einer Stelle in der Biologie etwas flickt, dass es an einer ganz anderen Stelle zwickt. Der ungarisch-amerikanische Wissenschaftler Barabasi ist Mathematiker und Physiker, der sich insbesondere mit Netzwerken beschäftigt. Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe hat er Netzwerke bei Menschen untersucht (Barabasi 2007). Dabei ist er auf Krankheitsnetzwerke gestoßen. Sie wurden als Diseasome im Englischen, in etwa als Familien von Krankheiten, die miteinander verflochten sind, bezeichnet. Ein solches Beispiel ist das der Zuckerkrankheit. In ihrem Netzwerk sind die Blutdruckerkrankungen, Übergewicht und gewisse Krebserkrankungen verknüpft. Dem Krankheitsnetzwerk entspricht ein typisches Netzwerk von Genen.
Das Konzept der Standardbauteile war jedoch erst durch ein rigoroses Qualitätsmanagement, wissenschaftlich in der Biologie als Selektion bezeichnet, so erfolgreich. Anders als bei der Entwicklung von Software ist die Qualitätskontrolle in der Biologie ein kontinuierlicher Prozess. Der Sparringpartner ist hier die Umwelt und nicht der Programmierer selbst. Der amerikanische Biologe George Gaylord Simpson hat dies überspitzt und witzig in etwa ausgedrückt:
Ein Affe, der nicht ganz klar den Abstand zum Ast, zu dem er springen will, abgeschätzt hat, stürzt ab. Er gehört daher nicht zu unseren Vorfahren.
Die Natur übt immer erst mit einer beta-Version, bevor sie eine funktionierende alte alpha-Version ersetzt. Die Produktion und Verwendung von Standardbauteilen, ihre zeitweise Veränderung und Umwidmung ihrer Aufgaben aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt der Aufbau immer größerer Einheiten, sind für die ungeheure Komplexität von Lebewesen verantwortlich. Aus verschiedenen Modulen werden Zellen. Zellen schließen sich zu Organen zusammen. Organe schließen sich zu Einheiten, zu Lebewesen zusammen und ermöglichen ihnen als solches zu funktionieren.
Ich möchte noch ein weiteres nach meinen Vorstellungen wichtiges Prinzip der Natur darstellen. Die Natur hat ihre Geschöpfe mit der Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen in der Umwelt ausgestattet. Ohne eine solche gäbe es kein Lebewesen auch keine Menschen. Seitdem die Erde existiert, verändert sie sich kontinuierlich. Damit verändern sich die Lebensbedingungen für die Lebewesen auf der Welt. Hitze, Kälte, Austrocknung, UV-Strahlen, Versalzung, Chemikalien sind nur ein Teil der Umweltverschiebungen. Zur Aufrechterhaltung des Lebens und zum Schutz der Erbinformation mussten geeignete Mechanismen entwickelt werden. Diese Tür zur Erbinformation wurde durch ein „zweites genetisches“ System, die Epigenetik, geschaffen (Jablonka und Lamb 1995). Dieses System legt fest, wie das Musikstück bei den vorgegebenen Noten der Erbinformation klingt. Es kann durch chemische Modifikation festlegen, welche Gene umgesetzt werden und welche Gene stumm geschalten werden. So navigiert uns das epigenetische System durch die natürlichen Veränderungen in unserem Leben. Im Wachstum müssen viele andere Gene als im Erwachsenenalter aktiv sein. Während der Pubertät müssen Gene an die Arbeit gescheucht werden, die für die Geschlechtsreife und Bildung von Sexualhormonen gebraucht werden. Eine besondere kritische Phase ist hier die Zeitspanne oder besser das epigenetische Fenster von der Geburt bis hin zum 3. Lebensjahr. Hier werden die Weichen gestellt, die für unsere Gesundheit im späteren Leben entscheidend sind. Dies betrifft auch, wie viele Studien zeigen, die seelische Stabilität, psychische und soziale Reife. Darum haben unsere Großmütter immer wieder gesagt, die ersten drei Lebensjahre sind die wichtigsten und was das Hänschen nicht lernt, lernt der Hans nimmer mehr. Neben diesem epigenetischen Fenster gibt es weitere. In dieser Hinsicht sind die Zeitspannen von der Eibefruchtung bis zur Geburt, der Pubertät und der Zeit des Übergangs zum Erwachsenenalter wichtig. In der Zwischenzeit vermutet man, dass es auch epigenetische Zeitfenster bei der Frau gibt, die zu einer späteren Veranlagung zu Brustkrebs führen können. Darüber hinaus lässt sich an vielen Beispielen zeigen, wie die Epigenetik unser Befinden und unsere Gesundheit beeinflusst.
Das kritische an dem System ist, dass manche Veränderungen an die Kinder, Enkel und Urenkel weitergereicht werden können. Auch hier sind wir in Verantwortung für zukünftige Generationen. Denn: Die Evolution hat nicht mit dem ersten Menschen aufgehört. Die Evolution ist ein laufender Prozess, dem alle Lebewesen auch der Mensch unterworfen sind. Die Folgen unseres individuellen Umgangs mit biologischen Regeln reichen wir auch über solche Systeme wie Epigenetik an die nächsten Generationen weiter und beeinflussen deren zukünftige biologische Entwicklung einschließlich der seelischen und sozialen.
2 BIOLOGISCHE GRUNDREGELN
2-2 Wie hat sich Leben entwickelt
VOR CA. 4.5 MILLIARDEN JAHREN war die Welt ein ungemütlicher Ort und in keinster Weise mit dem zu vergleichen, was sie heute ist. Die Luft war zum Atmen nicht geeignet. Anstatt Sauerstoff gab es dafür Stickstoff, Blausäure und Methan. Alles Gase, die nicht für uns zum erfrischenden Durchatmen geeignet sind. Das Wetter zu der Zeit würde man eher als schmuddelig bezeichnen. Schwere Gewitter und Stürme waren die Regel und das bei einer Sonnenscheindauer unter einer Stunde am Tag. Zudem wackelte der Boden aufgrund unzähliger Erdbeben und Vulkanausbrüche. Meteoriten bombardierten die Welt heftig.
Dennoch entschlossen sich ein paar Moleküle ihr langweiliges Dasein aufzugeben. Sie entschieden sich, etwas völlig Neues, Revolutionäres und noch nicht Dagewesenes anzufangen. Sie begannen sich mit Leben zu beschäftigen. Genau weiß man nicht, wo und wie es begann. Vielleicht entstanden die ersten komplexeren Biomoleküle bei einem der Meteoriteneinschläge (Lossau 2014) oder aber im Bereich heißer unterseeischer Geysire, den „black smokers“ (Martin und Russell 2002). Schritt für Schritt bildeten sich immer mehr Biomoleküle so z. B. die Nukleotide. Sie wurden und sind noch immer die Buchstaben, mit denen die Erbinformation geschrieben wird. Weiterhin traten Aminosäuren auf. Aus ihnen setzen sich unsere Eiweiße zusammen sowie Zucker und Fette, die z. B. beim Aufbau von Zellhüllen, den Zellmembranen, gebraucht werden.
Und irgendwann war es dann soweit, die erste Informationseinheit, die sich selbst vermehren konnte, war entstanden. Sie läutete das Zeitalter der RNA-Welt ein. RNA ist eine Form der Erbinformationsträger, die Ribonukleinsäure. Hiermit war der erste von sieben Großübergängen in der Entwicklung des Lebens geschafft (Smith und Szathmáry 1995). RNA-Moleküle sind reaktionsfähige Bausteine, die auch „Stoffwechselschritte“ durchführen können. Im Laufe der Entwicklung wurde diese Funktion durch Enzyme, hocheffektive Stoffwechselmaschinen, ersetzt. Diese RNA-Moleküle mit der Fähigkeit von Enzymen werden als Ribozyme bezeichnet. Gleichzeitig können sie auch Information speichern, die Grundvoraussetzung für Leben. Die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten eines einfachen Ribozymes mit 170 Bausteinen lassen jeden Computerfreak vor Neid erblassen. Bei dieser Größenordnung gibt es mehr Kombinationsmöglichkeiten als Elektronen im Universum. Somit war das grundlegende Problem des Lebens Informationsspeicherung und Informationsweitergabe gelöst. Wissenschaftlich wird dieser Schritt als erster Großübergang in der Evolution, der Entwicklung von Leben, gewürdigt. In dem Moment, in dem es der Natur gelang die RNA-Moleküle, die durch die Umwelt in ihrer Stabilität gefährdet waren, in eine Hülle von Eiweiß zu verpacken, war der Weg frei zu stabilen infektiösen Einheiten. RNA-Viren sind auch heute noch stabil und erfolgreich, zumindest aus ihrer Sicht. Ein Beispiel für RNA-Viren ist der Auslöser einer höchst aggressiven tödlichen Epidemie, der Ebola-Epidemie, die 2015 in Afrika innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von Todesopfern forderte und das Krisenmanagement der WHO nicht glücklich aussehen ließ. Ein anderes Beispiel ist der HIV-Virus der AIDS auslöst.
RNA-Viren wie auch ihre Kollegen, die DNA-Viren, können in die verschiedensten Zellen eindringen. Die DNA-Viren haben die chemisch verwandten Nukleotide, Desoxyribonukleotide, als Informationsträger. Einmal in einer Zelle angelangt, hacken sie das Vermehrungssystem, das replikative System, wie ein Computer-Hacker und manipulieren es für ihre eigenen Zwecke. Das kann bedeuten, dass die Wirtszelle lauter Virennachkommen herstellt und in ihr virales Erwachsenenleben, Virusleben, entlässt. Dabei opfert sich die Wirtszelle und stirbt.
Allerdings sind die meisten Viren bei der Auswahl, wo sie sich einladen, recht heikel. Nicht jede Zelle entspricht dem Gusto der einzelnen Virusarten. Eine ganze Reihe von Viren fühlt sich in Pflanzenzellen gut aufgehoben. Andere Viren wiederum bevorzugen tierische Zellen, von Insekten bis hin zum Menschen. Eine besondere Gruppe sind die Bakteriophagen, übersetzt die Bakterienfresser. Wie der Name schon ahnen lässt, haben sich diese Zeitgenossen auf Bakterien versteift. Für unser Thema „Die Bakterien und wir“ spielen sie eine bedeutende Rolle. Sie sind keine Statisten sondern eher global player. Weltweit dienen sie der Regulierung von Bakterienfloren sowohl in Seewasser, in der Erde als auch auf dem Menschen. Zudem agieren sie als Waffenlieferant für Bakterien. So übertragen sie Resistenzen gegen Antibiotika oder rüsten Bakterien mit Giftstoffen auf. Nachdem sie sich an ihrem Bakterienwirt gütlich getan und ihn ausgelutscht haben, bleibt noch eine leere Hülle übrig. Nur ein Geist, englisch „ghost“, lässt noch ahnen, dass es einmal ein Bakterium war. Nicht alle Bakteriophagen arbeiten sofort zerstörerisch, wissenschaftlich lytisch. Sie können sich auch in die Erbinformation des Wirtes einschleusen. So können sie viele Vermehrungszyklen dieser Zelle als Schläfer überdauern,