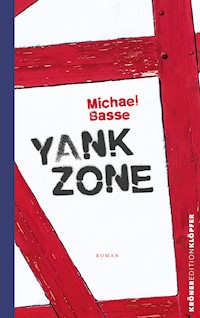
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Klöpfer
- Sprache: Deutsch
Lt. Col. Ross Raymond Hartman, genannt Old Chop, ist vieles zugleich: ehemaliger Kriegsheld im Südpazifik, Karten-Champ, Golfer-Ass, very athletic, besterhaltenes Mannsbild seiner Generation, alleinerziehender Vater – und als solcher ein guide to manhood. Sein fideles guesthouse ist nicht nur ein Anziehungspunkt für die Jugend des 6000-Seelen-Ortes Maulbronn, es repräsentiert auch für alle gut sichtbar die US-amerikanische Präsenz in der schwäbischen Provinz. Wer in Hartmans house of the free and the brave eintritt, muss sich am Colonel und seinem Sohn Jack abarbeiten. Dabei sind sich Hartman junior und senior natürgemäß in allem uneins, außer vielleicht in der einen Überzeugung, »dass noch immer in jedem ein Amerikaner steckt, der rauswill, er weiß es nur noch nicht.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Michael Basse
Yank Zone
Roman
1. Auflage
Edition Klöpfer
Stuttgart, Kröner 2022
ISBN DRUCK: 978-3-520-76201-6
ISBN DRUCK: 978-3-520-76291-7
Umschlaggestaltung: Denis Krnjaić
Unter Verwendung eines Fotos von shutterstock.com
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2022 Alfred Kröner Verlag Stuttgart · Alle Rechte vorbehalten E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt
»Zum jetzigen Zeitpunkt bietet uns die Geschichte eine Chance wie seit 100 Jahren nicht, Einfluss auf die Geisteswelt der Deutschen zu nehmen.«
John J. McCloy über die US-Politik in Deutschland 1945
Bullshit, junger Mann
Du verdammter Mistkerl! Rührst dich einfach nicht. Rufst nicht an, schreibst nicht, kommst nicht vorbei. Nicht ein einziges Mal in fünf Jahren! Dabei geht’s dir gar nicht gut. Als dein Spezi Mani das Weite gesucht hat und diese Bulgarin bei dir eingezogen ist, dachte ich, schau schau, vielleicht kriegt er ja doch noch die Kurve. Immerhin eine resolute Person, diese Lydia. Weiß genau, was sie will. Vielleicht wird aus seiner pubertierenden Männer-WG ja doch noch ein ordentlicher Haushalt. Frauen können ja Wunder wirken, selbst in scheinbar aussichtslosen Fällen. Aber das Wunder blieb aus. Beziehungsweise war nur von kurzer Dauer. Konntest die Frau nicht lange halten. Von da an gings nur noch bergab mit dir. Und jetzt? Vegetierst in einem Ein-Zimmer-Wohnklo vor dich hin – schäbig, stickig, laut, direkt an der Theodor-Heuss-Straße. Da muss man ja Depressionen kriegen. Und eine Bleivergiftung dazu. Hast keinen Job, keine Frau und so gut wie kein Geld. Weiß ich von deinem Anlageberater. Zwielichtiger Typ. Was der mir so erzählt, steckt er sicher auch anderen. Zum Beispiel, dass du schon vor drei Jahren pleite warst. Aber allen Ernstes glaubtest, du könntest das Steuer noch mit Krediten rumreißen. Von wegen! Am Ende standest du mit sechzigtausend in der Kreide. Die Bank weigerte sich, deine Kredite zu verlängern, nachdem du das Haus deiner Großeltern schon verhökert hattest und sonst keine Sicherheiten mehr vorweisen konntest. Hast dann Bekanntschaft mit dem Finanzamt gemacht. Natürlich nicht so wie in den Staaten, wo Bewaffnete aufkreuzen und einen, der partout nicht zahlt, kurzerhand einbuchten. Aber beschlagnahmt haben sie bei dir so ziemlich alles, was sie konnten. Und dann die Lohnpfändung. Malochtest gerade bei Dinkelacker. Schichtarbeit am Fließband. Deine Vorgesetzten sahen das mit der Pfändung gar nicht gern. Haben dich rausgeschmissen. Ohnehin sei die Flaschenabfüllerei ja auf Dauer nichts – für einen Diplomkaufmann. Ha! Ende der Durchsage. Und Totalabsturz. Vom Börsenspekulanten zum Sozialhilfe-Empfänger. Was für ’ne Karriere, Jack!
Ich hätte dir ja geholfen. Aber Hilfe ist so ungefähr das Letzte, was du annimmst. Schon gar nicht von mir. Glaubst bis heute, ich hätte hard man’s guesthouse zerstört. Mein Gott, allein schon der Name – hard man’s guesthouse. Da steckt so ungefähr alles drin, wovon Jungens träumen. Das riecht nach letzter Männer-Bastion. Jedenfalls nichts für Mädchen, Frauen, Schwestern – Weiber! Und am Ende doch nichts andres als eine schlechte Kopie dieser rauch-, schweiß- und alkoholgeschwängerten Hinterzimmer, die man aus B-Movies kennt. Aber von dir und deinen Spießgesellen als letzte Tafelrunde verklärt. Und dann kam ich, der Eindringling, die Fremde. Verfolgte von Anfang an nur ein Ziel: euch euren Karten-Champ auszuspannen, hard man, das Idol, den Kriegsveteranen, ihn vom Männer-Spieltisch wegzuholen und von allem, was er kannte, so gründlich zu entfremden, dass er am Ende sein hard-man’s-guesthouse-Dasein freiwillig aufgab. Und sich ins Unvermeidliche fügte. Und mir, dem Weib, der Hexe, dem Eindringling den Vorzug gab. Selbst vor dem eigenen Sohn.
So oder so ähnlich reimst du dir das alles bis heute zusammen. Du Taugenichts! Glaubst tatsächlich, dass ich es war, die eure ach so ehrenwerte Männerwirtschaft geschleift hat! Vielleicht hätte ich dir den Zahn beizeiten ziehen sollen. Vielleicht hätte es aber auch alles nur noch schlimmer gemacht. Mir hast du ohnehin immer nur Schlechtes zugetraut. Hätte es da überhaupt etwas genutzt, wenn ich einem verzogenen Bastard wie dir reinen Wein eingeschenkt hätte?
Lektion eins: Ich war es nicht, die dich aus dem Haus haben wollte! Ich hatte verdammt nochmal genug Geld, um in meinen eigenen vier Wänden zu leben. Und mehr Platz als im Zimmer von young Master Jack! Und Heiraten stand auch nicht auf meiner Agenda. Raymond war es, der mir ständig damit in den Ohren lag. Ich nenne es seinen amerikanischen Ehekomplex. Männer seiner Generation glauben immer noch, ihre Intim-Beziehungen irgendwie legalisieren zu müssen. So wie amerikanische Frauen unbedingt geheiratet werden wollen, um für den Rest ihres Lebens versorgt zu sein. Aber mir war der Trauschein schnurz piepe. Ich hatte nicht den geringsten Ehrgeiz, in die Rolle einer Mrs. Hartman zu schlüpfen, der bösen Stiefmutti, die dem armen Junior-Halbwaisen auch noch den Vater ausspannte. Weil sie scharf auf sein Geld war. Oder seinen Namen. Nichts von alledem ist wahr. Mich hat einzig und allein der Mann interessiert. Raymond. Ungefähr das aufrichtigste, humorvollste und für seine Altersklasse besterhaltene Mannsbild, das mir je untergekommen ist. That’s it.
Als ich sah, wie er lebte, wie allein er im Grunde war, wollte ich in seiner Nähe sein. Wollte ihm etwas geben. Vielleicht sogar etwas zurückgeben von dem, was er selbst jahrelang an seinen Pleite-Sohn und dessen Zwergpinscher-Bande verschenkt hatte, freizügig und klaglos, ohne je etwas dafür zu verlangen. Oh ja, ich hätte dir die Augen öffnen können, hätte dir sagen können, vielleicht sogar sagen müssen: bullshit, alles bullshit, junger Mann! Das träumst du. Das hast du dir so zurechtgelegt. Weil es dir ins Bild passt. Vor allem in dein verquastes Frauenbild. Im Allgemeinen und von mir im Besonderen. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Master Jack, aber ich war das nicht. Es war dein Vater. Er war es leid, Hausfrau zu spielen, zu putzen, zu waschen und zu kochen, im Zweifel für die ganze Bagage. Weil er ja so viel Zeit hatte, dein Dad, der Alte, der ausgemusterte Soldat, Old Chop, das Mädchen für alles. Jesus Christ, ein Mann von grade mal fünfundsechzig!
Ich hätte dir schon vor Jahren den Kopf waschen müssen. Ein paar unbequeme Wahrheiten für lonesome Jack, den armen verstoßenen Halbwaisen. Aber vor ’ner ordentlichen Standpauke hättest du dich gedrückt. Und mir nicht geglaubt, verbohrt wie du warst. Hättest darin nur den Versuch gesehen, meine Hände in Unschuld zu waschen. Und nach Raymonds Tod wäre es dir erst recht wie Heuchelei vorgekommen. Ein später Versuch der skrupellosen Stiefmutti, sich reinzuwaschen – auf Kosten eines toten Mannes, der sich nicht mehr wehren konnte. Dessen heroisches Bild vom Dschungelkämpfer und Spieler-Ass sie noch posthum beschmutzte, um selbst besser dazustehen. Oder noch armseliger, dass ich – alt, schwach und alleinstehend – plötzlich eine Kehrtwende um 180 Grad vollzöge, um nach dem Tod des Seniors doch noch einen Draht zum Junior zu kriegen. Mein Gott, wie sehr hättest du mich verachtet, verflucht, wenn ich auch nur den kleinsten Annäherungsversuch gewagt hätte.
Du rührst dich nicht. Weder zu Raymonds erstem noch zu seinem fünften Todestag. Naturgemäß auch nicht drei Wochen später. Ist mir sonnenklar, dass dir mein 75. am Arsch vorbeigeht. Schade nur, dass du dich so selbst um ein paar aufschlussreiche Details aus dem Leben deines Dads bringst. Dinge, die dir vielleicht weiterhelfen könnten. Aber ein mieser kleiner Bastard wie du gibt sich natürlich keine Blöße. Jack-the-hard-man-Junior! Oh ja, ich kenne das. Was für ein Dummerjungenstolz. Mir kannst du nichts vormachen. Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Könnte dir und deinen Saufkumpanen einiges erzählen. Aber ihr wollt ja gar nichts wissen, gar nichts begreifen. Glaubt meiner Generation sowieso nichts. Für Rotzbengel wie euch war schon immer jeder über dreißig verdächtig. Ein Fall für die finale Vergruftung. Sogar das kann ich verstehen. Unsereins war ja immer dazu verdonnert, alles zu verstehen. Aber was nützt dir das in deinem Elend, deinem post-pubertären Selbstmitleid? Dein verstockter Junior-Stolz bringt dich um die letzten Reste von Erkenntnis, die jemand wie ich dir vermitteln könnte. Armer Jack, du hast wirklich keine Ahnung.
Teil 1
Hard man’s guesthouse
»Mani, are you a communist?«
Was für eine Frage! Im ersten Moment bin ich nur verdutzt. Sicher wieder einer seiner üblichen Scherze. Dann sehe ich, wie mich seine Augen ernster und schärfer mustern als sonst. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit war überhaupt nicht zu rechnen in diesem Haus. Es klingt wie eine Frage, die eigentlich nicht mir gilt. Eine Frage, die man Erwachsenen stellt, nicht aber einem 15-Jährigen.
»Mani, are you a communist?«
Wie hässlich das klingt! Außerdem ist es eine Gesinnungsfrage. Eine, die Kommissköpfe in Prüfungskommissionen stellen, um Kriegsdienstverweigerern auf den Zahn zu fühlen. Oder sie zu verunsichern. Das aber ist nicht üblich in diesem Haus. Gewiss, Bekenntnisse sind auch hier an der Tagesordnung. Bekenntnisse wie »Ich mag kein gekochtes Huhn« oder »Ich hasse Pfaffen«. Wenn er mich also gefragt hätte »Mani, do you believe in god?«, hätte ich flugs mit »No Sir« geantwortet. Aber dies hier ist eine ganz andere Frage. Eine schwerwiegende, ungleich schwierigere. Eine, die ich mir selbst so direkt noch nie gestellt habe. Bin ich Kommunist? Und wenn ja, was für einer? Denn so viel ist klar: Den einen, zweifelsfreien Kommunisten gibt es nicht. Und dass das kommunistische Lager weltweit einen Haufen revolutionärer Typen im Angebot hat. Und man sich verflucht gut auskennen muss, um die guten von den schlechten zu unterscheiden.
Der Vietcong ist gut. Aber sind das überhaupt richtige Kommunisten? So wie die Russen? Oder sind es Maoisten? Oder was anderes, Drittes? Auch nach längerem Nachdenken hätte ich keine schlüssige Antwort gewusst. Also schaue ich konsterniert zurück und schweige, bis mich Hartman Senior von der Last der Gewissenserforschung erlöst und in seiner lässigen, leicht amüsierten Art fortfährt:
»No, you are t-o-o free-spirited!«
Aufatmen. Durchatmen. Dann, mit einiger Verzögerung, nachvollziehen, was der andere in seiner immer noch fremden Sprache gerade gesagt hat. Too free-spirited? Soll wohl so viel wie zu freisinnig oder freigeistig heißen. Bin ich das? Aber klar doch. Einerseits. Andererseits fühle ich mich weder besonders frei noch besonders geistreich. Eher mittelmäßig, durchschnittlich, zumal im Hinblick auf meine sprachlichen Kenntnisse. Ein Langsamversteher, leicht begriffsstutzig, einer, der oft nachfragen muss. Oder so tut, als ob er verstanden hätte, was dann später auffliegt, weil ich, ohne zu begreifen, ein Einverständnis vorgetäuscht habe oder einer Aufforderung nicht nachgekommen bin. Und schon bin ich nicht mehr Mani, der Klugscheißer, der verbale Rundumschläger, die gefürchtete Allzweckwaffe aus dem Kloster, die jeden unter den Tisch redet, sondern ein Hochstapler, Angeber, der sich verraten hat, der urplötzlich rumdruckst, rumstammelt, rumstottert, aber nicht so wie Jack, der nun mal ein Handicap hat, für das er nichts kann, diesen Sprachfehler, der besonders krass zutage tritt, wenn ein Wort mit »St …« beginnt und er drei-, viermal ansetzt und doch über ein »Scht-t-t-t…« nicht hinauskommt, wofür er einem echt leidtun kann, auch wenn er manchmal ziemlich nervt mit seinem »Scht-t-t… scht-t-t… scht-t-t…«, weil er damit sein Handicap allen anderen aufzwingt, bis sie im Geiste mitstottern, wenn er stottert, und mitschlucken, wenn er schluckt, während ich in diesem Moment ganz und gar selbstverschuldet rumdruckse, rumstammle, rumstottere, weil ich so getan habe, als verstünde ich Englisch, dabei verstehe ich es gar nicht, genauer gesagt nur ein paar Brocken Schulenglisch, aber kein Wort Amerikanisch.
Von allen Arten der Ohnmacht ist Sprachohnmacht die erniedrigendste. Sie verstärkt meinen ohnehin vorhandenen Dauergroll auf alle und alles, lässt mich zur Witzfigur schrumpfen, zur Lachnummer, mich, den zornigen Rebellen, der alle Autoritäten hasst, sich vor niemandem duckt, sich nicht einschüchtern oder gar aus der Fassung bringen lässt, außer – ja – außer es handelt sich um diese eine unbezweifelbare Autorität Hartman Senior, die jeden nach Belieben formt, als wäre er ein Modell aus Ton.
Hartman. Amerikanisch ausgesprochen klingt das wie hardman, woraus in der üblichen gedehnten Sprechweise der Amis ein hard man wird. Lieutenant Colonel Ross Raymond hard man, genannt Old Chop, ist noch keine 60, aber schon retired. Ein hard man ist er dennoch. Einer, wie er im Buche steht. Einer wie er braucht sich und anderen nichts mehr zu beweisen. Der Lt. Colonel gibt Befehle. Sehr freundliche Befehle. Befehle, die einen regelrecht beglücken. »Would you please give me a hand, Mani?« Aber natürlich. Yes Sir. Im Geiste salutiere ich dabei. »Yes Sir, just a moment.« »Yes Sir, just a minute.« Um nicht allzu servil zu erscheinen. Aber dann bin ich sofort zur Stelle, bereit jeden Befehl auszuführen. Vergessen alle Querdenkerei, alles Widerspenstige, aller Groll. Jetzt bin ich nur noch Wachs in Old Chops Händen, hard man’s williger Vollstrecker, komme, was da wolle.
Meistens kommt liebevoller Spott. Zum Beispiel, wenn mein Magen laut knurrt, weil ich, der ausgehungerte Internatszögling, ständig Kohldampf habe. Dann bin ich das Pferd. Das Pferd kriegt heute Gras zu fressen. »Today you’re gonna eat grass.« Während ich ihn ebenso hungrig wie entgeistert anstarre, formen sich schon die ersten Lachfältchen in seinem Gesicht, worauf er mit der denkbar unschuldigsten Engelsstimme fortfährt:
»Hey Mani, how about a sandwich? Chicken? Cheese? Ham?«
Ab und zu ruft er mich Matzky. »Hey Matzky, what’s going on?« Matzky ist hard man Seniors Anspielung auf mein Äußeres – olivgrüner Parka mit rotem Stern, Hammer & Sichel auf dem Aufschlag und einem Peace-Symbol auf dem Rücken. Matzky klingt russisch, klingt nach Kautsky, Trotzki und irgendwelchen Bolschewisten. Gleichzeitig signalisiert dieses wie beiläufig hingestreute Matzky, dass er, hard man senior, retired Lt. Colonel der US-Army, diesem Land gerade bis in die hinterste Provinz nicht nur den American, sondern vor allem den democratic way of life beibringt, was in diesem Fall bedeutet, dass Old Chop, als Repräsentant der Neuen – in jedem Fall aber jungen – Welt, naturgemäß kein Problem hat mit jungen deutschen Matzkys, Kautskys oder Trotzkis, solange sie originalgetreue olivgrüne NATO-Kampfjacken aus dem US-Military-Shop tragen, auch wenn sie sie mit den obligatorischen Insignien der Zeit – verunstaltet haben.
These youngsters don’t have a clue about Charlie. Anyway, even inside every chink and swamp rat – same as in every Krautboy – there’s an American hiding, who wants to get out, he just doesn’t know it, yet. You can’t take these things too seriously. You gotta be more relaxed. Young people rebel – it’s natural. In the States we’ve always known that. But the Germans have an issue with it. Can’t deal with it like we do.
Old Chop, eher kleinwüchsig, untersetzt, rotgesichtig, bierbäuchig, mit dichtem weißen Haar, militärisch kurzgehalten, die Ärmel stets bis zum Ellenbogen aufgekrempelt, nimmt es im Zweifelsfall sportlich. Wenn sie einem wie ihm, der den Inselkrieg im Südpazifik überlebt hat, mit Hanoi-Jane kommen, die im schicken Oliv-Dress auf einem Flugabwehrgeschütz des Vietcongs vor Charlies Kamera posiert –
Sure – she’s sexy. Does her father Henry credit – or should I say, Mister Hollywood, Senator Fonda, Frank the Scoundrel … –,
muss man das sportlich nehmen. Eine Provokation, natürlich. Doch in Wahrheit verbirgt sich dahinter ein Test, eine Herausforderung, ein Spiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Wer sich dem Match erst gar nicht stellt, hat die Partie von vornherein verloren. Genosse Matzky und Hanoi-Jane – sie beide sind letztlich nur Teile des einen großen Spiels, das seit jeher zwischen den Generationen ausgetragen wird. Und das in diesem Spätsommer 1972 im 6000-Seelen-Ort Maulbronn über eine feste Adresse verfügt: Sommerseite 7.
* * *
Das Zwei-Familien-Haus ist das letzte am Ende einer kleinen Straße mit Neubauten, die nach dem Krieg für die Angestellten und Arbeiter der Leichtgussmetallwerke Schenk errichtet wurden. Die Dreizimmer-Wohnung im Obergeschoss wird von einer freundlichen älteren, nahezu tauben Dame bewohnt. Die Dreizimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit kleinem Rasengrundstück, stets offener Terrassentür und einer Garage, die an den Kartoffelacker des benachbarten Bauern grenzt, ist quasi exterritoriales Gelände. Sie gehört schon nicht mehr zur Gemarkung der Gemeinde, sondern untersteht direkt den US Military Forces, also Old Chop höchstpersönlich. Das Ende der Straße ist zugleich Teststrecke für alles, was sich bewegen lässt. Räder und Seifenkisten werden hier ebenso gnadenlosen Härtetests unterzogen wie aufgemotzte Mofas. Aber kein Gerät erheischt so viel Aufmerksamkeit wie Heinz Blickles 50-Kubik-Zentimeter Zündapp. Von einem eigenen Moped träumen alle, allein Heinz, Sohn eines Ingenieurs bei Schenk, hat eines. Selbstredend hat er seine Zündapp aufgemotzt. Mit aufgebohrtem Kolben schafft sie knapp 110 statt der maximal vorgesehen 90, womit sie – ohne entsprechende Bremsen und mit lautem Geheul – unter den Beschleunigungsexperten am Ort als einzige Ein-Zylinder-Trägerrakete neben der Saturn V durchgeht. Freilich braucht Blickle einen gewissen Anlauf, weshalb er bereits 100 Meter vor der Abzweigung in die leicht abschüssige Sommerseite startet, auf der Höhe von Nr. 7 hat er die Höchstgeschwindigkeit fast erreicht, danach bleiben ihm noch knapp 30 Meter Asphaltpiste zum Abbremsen. Meistens reichen sie, aber manchmal patzt er und landet doch noch im Kartoffelacker. Blickle ist der unangefochtene Gott-auf-zwei-Rädern. Blickle ist Beschleunigung pur. Blickle ist jugendlich-männliche Überlegenheit dank schwäbischem Motor-Know-how.
Beim Kartenspielen liegen Chop Senior und Chop Junior vorn, wobei Jack das bessere Pokerface hat, während Old Chop in der Regel beim Skat absahnt. »God damn, open your eyes!«, bekomme ich von Chop Senior regelmäßig zu hören, begleitet von einem theatralischen Augenrollen, wenn ich wieder mal nicht geschmiert habe, als er Trumpf gegen Jack angespielt hat. Ich bin ein lausiger Mitspieler. Sind die Farben verteilt? Wer muss bedienen? Wer kann einstechen? Immer bin ich unsicher. Schmiere ich beim nächsten Mal ein Ass oder eine Zehn, um den Fehler wiedergutzumachen, löse ich beim Senior ein schmerzhaftes Stöhnen aus. »Oh, my goodness! Jesus Christ! Holy smoke!« Schon wieder falsch, auch Old Chop muss bedienen, das hätte ich doch wissen können. Zumindest erahnen. Aber beim Spiel verlassen mich alle Ahnungen. Ich möchte es richtig machen und mache alles falsch. Außer beim Grand. Ein Solo mit zwei Buben ist sogar für mich überschaubar. Wenn ich meinen Gegenspielern gleich beim ersten Stich ihre beiden Trümpfe ziehen kann, sieht sich Old Chop zu einem you lousy bastard oder you son of a bitch veranlasst, wobei er umgehend alle Karten zusammenrafft. So ’ne Nummer wird hier gar nicht erst ausgespielt, nicht in seinem guesthouse, das ist allenfalls was für Masochisten, nicht aber für Spieler mit Köpfchen, mit Leidenschaft. Und doch klingt in seinen Worten eine Spur Anerkennung mit, wenn auch nur in homöopathischer Dosis: Wenigstens beim Grand habe ich nicht gepatzt, den habe ich – son of a bitch – inzwischen drauf, thank the lord, God almighty, thank you so much, Hallelujah!
Im Schein der Esszimmerlampe mischen sich unterschiedliche Rauchschwaden. Old Chop raucht schachtelweise Pall Mall oder kleine, dunkle Zigarillos, die auf den ersten Blick wie Zigaretten aussehen, weil sie einen Filter haben, aber nicht nach Virginia-Tabak riechen, sondern einen aromatisierten Brazil-Geruch verströmen. Chop Junior dreht selbst, wie alle aus der Clique, wobei sich je nach Vorliebe der scharfe Rauch des Schwarzen Krausers mit dem milderen Qualm der Marken Drum oder Van Nelle zu einer einzigen riesigen Dunstglocke vermischt, die das Licht über dem Esszimmertisch zunehmend diffus macht und die Augen der um prestigeträchtige Pfennig-Beträge spielenden Kombattanten mehr und mehr rötet. Mehrere Aschenbecher stehen auf dem Tisch, in denen permanent Zigaretten glühen, einer gibt, einer hört, einer sagt an, es sei denn, es sitzen vier oder mehr Spieler am Tisch, dann setzt der Geber aus. Im Raum herrscht eine angespannte, konzentrierte Stille, hin und wieder unterbrochen vom Knacken eines Eiswürfels in einem der Longdrinks – Whisky Cola, Manhattan, Gin Tonic oder Absacker, eine spezielle Chop-Junior-Mischung aus Campari, weißem und braunem Rum, die meist den baldigen Ausstieg des betreffenden Kombattanten ankündigt.
Old Chop hat ein sicheres Gespür dafür, wann es für die Runde genug ist. Aber das lässt er sie nicht spüren. Das wäre ein Affront. Schließlich sitzen hier Männer, eben noch bereit, in einem dramatischen Karten-Showdown ihre Ehre – sprich: ihr letztes Taschengeld – zu riskieren. So etwas verdient Anerkennung. Also sagt er:
»Hey guys, I think I’ve had enough. How about one last drink? And then it might be time for dinner. What do you say? Mani, Jack – aren’t you hungry?«
Auf Jack kann er dabei naturgemäß nicht bauen. Also nimmt er mich, das Pferd, ins Visier, wohl wissend, dass ich schon die ganze Zeit über Kohldampf habe, ja an nichts anderes mehr denken kann. Den anderen – Heinz, Willy oder den Süß-Brüdern Sigi und Heiner – ruft Old Chops rhetorische Frage in Erinnerung, dass sie samstagabends zu Hause zum Essen erwartet werden, halb- oder volltrunken, ganz egal, in jedem Fall besser, sie kommen vom Ami nebenan heimgetorkelt, vom Kegelbruder Ross Raymond, als aus irgendeiner Kneipe, einem öffentlichen Raum, wo es sich schnell rumspräche, dass die Mitglieder des ehrenwerten Kegelklubs – Ingenieur Blickle, Gemeinderat Tummler und Hausmeister Süß – ihre Sprösslinge nicht mehr unter Kontrolle haben. Dass ihr Nachwuchs nur mehr widerwillig zum Essen, eigentlich nur noch zum Schlafen nach Hause kommt. Während alles andere außer Haus erledigt wird, vorzugsweise in der Sommerseite 7.
Eineinhalb bis zwei Stunden später sind alle wieder da. Der ganze Trupp geht dann zusammen in die Stadt, in den Adler oder den Grünen Baum, die Bier an trinkerprobte Halbwüchsige ausschenken und über Tischfußball und Billard verfügen, während der Scheffelhof oder die Klosterschmiede tunlichst gemieden werden, weil dort die Eltern und deren Kollegen verkehren. Spät nachts, wenn selbst die gutwilligsten Wirte abwinken, geht es wieder zurück in die Sommerseite. Die Terrassentür steht wie immer einen Spalt offen, im Esszimmer brennt noch Licht, was nicht unbedingt heißt, dass Old Chop nicht schon im Bett ist. Wenn nicht, dann weil er auf AFN Stuttgart noch die Sportnachrichten und die jüngsten Kriegsmeldungen aus Indochina hört. Bei Eintritt der Meute dreht er das Radio aus, weil er weiß, dass jetzt das angrenzende Wohnzimmer mit seinem Schwarz-Weiß-Fernseher für die Nachtsession gebraucht wird. Er murmelt ein »Make yourself at home« und »There’s some beer in the icebox« und schlurft in seinen abgetragenen Hauslatschen durch Küche und Diele in den rückwärtigen Teil der Wohnung, wo sich das dank der heruntergelassenen Jalousie komplett abgedunkelte Schlafzimmer befindet. Der Lt. Colonel gibt vorübergehend das Kommando ab, die Truppe übernimmt, wacht über ihn und sein Haus, während sich im Fernsehen John Wayne und Gary Cooper, Clark Gable und Burt Lancaster, Allan Ladd und Audie Murphy, Sterling Hayden und Glenn Ford, Robert Mitchum und Richard Widmark oder Hollywoods einziger echter gentleman actor Gregory Peck auf ihre Einsätze vorbereiten. Old Chop weiß, dass am Ende immer die Guten siegen, dass die Kavallerie kommt, mit einem Marion Robert Morrison alias Big John, der verzweifelte Siedler rettet oder als Teufelshauptmann Nathan Brittles ein Blutvergießen zwischen US Army und Indianern verhindert, tief im Herzen davon überzeugt, dass auch in jeder Rothaut ein Amerikaner steckt, der rauswill, er weiß es nur noch nicht.
That was 1949. Boy, oh boy, what a year. Lieutenant Ross Raymond Hartman, platoon leader in the Pacific War, is promoted to captain and company commander at a training battalion. Even if it is for blacks. Stuff it! They have to be made men as well. And Big John hits the big time with ›She Wore a Yellow Ribbon‹. His first really challenging role. ›You’re an actor, now!‹, big John Ford tells him. No wonder, it was MacArthur’s favorite movie. The old Beau Brummel of the army had a point. As always. There’s no better guide to manhood than Brittles. Not only for the squad. For all of us. The cavalry’s an integrated community, where all are equal, and the ultimate force for good when all hope is lost. You can’t tell the kids that often enough, all night long, if you have to. The hell with it. After all, tomorrow’s Sunday. And by the way, all bets are off in this guesthouse.
In hard man’s guesthouse ist nichts unmöglich. Es ist eine reine Männerwirtschaft. Es gibt keine Mrs. Hartman, keine Hausfrau, keine Mutter, die nach dem Rechten sieht. Was recht ist, darf jeder, muss jeder selbst entscheiden. Dieses Haus steht allen offen, natürlich auch den Frauen, die von Zeit zu Zeit wie Trophäen mitgeschleift werden, um den Wettkämpfen vor und in der Sommerseite 7 beizuwohnen, Backfische, die vom Hausherrn auf väterlich charmante Art mit einem Kuss auf beide Wangen begrüßt werden, bevor er wieder Platz nimmt am großen Esszimmertisch, hinter sich an der Wand in bronzenen Lettern ein, nein das saying schlechthin, Orientierungshilfe für alle Neuankömmlinge, damit sie sich gleich zurechtfinden in diesem house of the free and the brave:
Our house is clean enough
to be healthy
but dirty enough
to be happy in.
* * *
Ich schleiche auf Strümpfen durchs dunkle Zimmer, vorbei an der rechten Seite des Ehebetts, taste mich an der Wand entlang bis zum Stuhl, ziehe mich im Dunklen aus, schlage vorsichtig die Überdecke auf der linken Betthälfte zurück und schlüpfe unter die Decke. Dann liege ich mucksmäuschenstill auf dem Rücken und lausche dem rasselnden Atem des Mannes neben mir. Das alles ist nicht wirklich. Das alles träume ich. Und doch liege ich hier, neben Old Chop, im Ehebett. Manchmal hört der Senior abrupt auf zu atmen und auch mir stockt sogleich der Atem. Nach einigen endlos scheinenden Sekunden setzt Old Chops Atmung mit einem lauten Schnarcher wieder ein und nach ein paar weiteren Schnarchern fällt er zurück in seinen gewohnten, gleichmäßig rasselnden, bisweilen pfeifenden Atemrhythmus.
So, auf dem Rücken liegend, kann ich nicht einschlafen. Das konnte ich noch nie. Aber ich habe Angst, mich im Bett zu bewegen, mich zur Seite zu drehen. Die Matratze ist weich, weicher als alle Matratzen, auf denen ich je gelegen habe, sie federt bei der kleinsten Bewegung nach und ich will nicht, dass der alte Mann aufwacht. Denn just in diesem Augenblick, mitten in der Nacht, mit seinem schweren, unregelmäßigen Atem, kommt er mir alt vor. Ein pensionierter alter Haudegen. Einer, dessen Atmung jederzeit aussetzen kann. Erinnerungsfetzen an mein Jugendasthma steigen in mir hoch. Wie ich nach Luft ringe, wie ich sie so tief wie möglich in mich einsauge – und trotzdem nicht genug Sauerstoff kriege. Wie ich hyperventiliere. Und je mehr meine Aufregung zunimmt, desto mehr hyperventiliere ich. Ich setze mich auf im Bett, versuche, mich zu beruhigen, nur mehr flach über den Bauch zu atmen, versuche den Brustkorb zu ignorieren, sage mir Sprüche auf, die sich reimen, die einen Rhythmus haben, um so wieder zu einem normalen Atemrhythmus zu finden. Ich schwitze. Auch jetzt, auf dem Rücken liegend, merke ich, wie ich anfange zu schwitzen. So kann ich mich nicht entspannen, geschweige denn einschlafen. Also dreh ich mich vorsichtig auf die Seite, um Old Chop nicht zu wecken. Aber die weiche Matratze wippt nach. Von der anderen Betthälfte kommt ein unverständliches Grunzen. Dann geht das Licht an. Ich bleibe auf der Seite liegen und rühre mich nicht. Old Chop richtet sich seufzend im Bett auf. Ich höre ihn fragen: »Are you alright, Mani?« und krächze ein »Yes Sir« zurück, ohne mich umzudrehen. Der Alte steht auf und geht aufs Klo. Eine Minute später erlischt das Licht wieder. Diesmal wippt das Bett nach, weil der Alte sich darin wälzt. Ich bin ausgesprochen erleichtert, dass Chop Senior nachhaltigen Gebrauch von seinem Bett macht und sich nicht um mich schert. Schließlich hatte ich ihn aufgeweckt. Jetzt ist es der alte Mann, der sich ein paar Mal umdreht, um wieder einschlafen zu können. Das Wippen der Matratze hat plötzlich nichts Bedrohliches mehr. Old Chop wiegt nicht nur sich, sondern auch mich in den Schlaf.
Während ich langsam wegdämmere, laufen Filme vor mir ab: Big John als Nordstaaten-Colonel Marlowe in Der letzte Befehl, der mit seinem Kavallerie-Regiment hinter den feindlichen Linien operiert und seine Einheit in allerletzter Minute in Sicherheit bringt. Die Südstaaten-Kavallerie ist schon im Anmarsch, als Big John als letzter Reiter mit seiner Zigarre eine Lunte zündet, auf sein Pferd steigt und im Galopp über die Brücke prescht. Hinter ihm detonieren eine nach der anderen die Sprengladungen und zerstören das Bauwerk. Big John als Captain York, der den Apachen sein Ehrenwort auf den Frieden gibt, aber von seinem Vorgesetzten hintergangen und in ein übles Gemetzel gezwungen wird. Big John als Cowboy-Raubein Doniphon, der in Wahrheit Liberty Valance erschoss, während der junge Anwalt Ransom Stoddard von den Bewohnern Shinbones für seine vermeintliche Heldentat gefeiert und in den Senat gewählt wird. Big John als Bürgerkriegsveteran Ethan Edwards, der nach einem endlos langen Ritt doch noch die entführte Debbie ausfindig macht und aus den Händen der Comanchen befreit. Big John in The Alamo, Big John in Rio Bravo, Big John, wie er reitet und reitet, aber sein Gesicht, seine Physiognomie tragen die Züge Old Chops, wie er heldenhaft sein Leben riskiert für andere, die das nicht immer verdient haben, wie er jedem eine Chance gibt, jugendlichen Heißspornen, Halbstarken, Revolverhelden, Säufern, sogar den Rothäuten. Wie er in jedem den Amerikaner sucht und findet, der rauswill, auch in mir. Wie er mich in einer Kampfpause vor der finalen Angriffswelle der Mexikaner, bei der wir alle sterben werden, zur Seite nimmt und leise fragt:
»Mani, are you a communist …?«
Wie ich erbleiche, wie mir kalter Schweiß den Rücken herunterläuft, bis mich die Lachfältchen des Alten erlösen, er mir die Hand auf die Schulter legt und mit väterlich-sanfter Stimme fortfährt:
»No, you are too free-spirited!«
Wobei er das you so betont, dass kein Zweifel daran besteht, dass er tatsächlich mich meint, was er noch dadurch unterstreicht, dass er mir dabei die Schulter drückt, mir ein letztes Mal tief und ernst in die Augen schaut, bevor er sich abwendet und ich ordnungsgemäß salutiere:
»Sir, yes Sir«, wobei ich auf dem linken Absatz kehrtmache und Old Chop vorschriftsmäßig nachblicke, wie er die Reihen der Wachtposten auf den Palisaden Fort Alamos abschreitet. Jetzt kann ich endlich schlafen, einschlafen, sterben, der Lt. Colonel hat mich persönlich gewogen und für wert befunden. Er hat meine innerste Natur erkannt. Jetzt bin ich einer seiner Männer, komme, was da wolle, jetzt habe ich einen Platz in der Welt, einen Platz zum Sterben, endlich einen Platz, den hatte ich noch nie.
* * *
Wann Chop Senior aufsteht, kriege ich nicht mit. Wahrscheinlich recht früh, denn der Alte hat einen eisernen militärischen Rhythmus, auch als Pensionär und Zivilist. Während die Meute sonntagmorgens ihren Rausch ausschläft – Jack, Heinz, Willy, die Süß-Brüder. Vor elf geht da gar nichts. Wer immer als Erster aus seinem Rausch erwacht und noch halb benebelt von der letzten Nacht ins Esszimmer gewankt kommt, trifft auf einen ausgeschlafenen Chop Senior, der längst gefrühstückt hat. Während im Radio AFN Stuttgart läuft, tippt er auf seinem American typewriter, auf dem die Umlaute fehlen, Briefe an Bruder Cole und Schwester Rebecca. Oder er schmökert. Old Chop schmökert unglaublich viel – neben Stars & Stripes liest er die Wochenmagazine Newsweek und Life, Letzteres dank seiner spektakulären Fotostrecken, Cartoons und Pin-up-Girls auch von der Meute heiß begehrt. Schließlich schmökert er sich durch jede Menge Romanschwarten, die er sich in der Bibliothek der Robinson Barracks ausgeliehen hat. Am liebsten Bestseller von Morris L. West, einem Ex-Klosterschüler der Christian Brothers in St. Kilda/Melbourne, der zur gleichen Zeit wie er selbst im Südpazifik gekämpft hat. Umso mehr überrascht es mich, als ich von Old Chop erfahre, dass Wests frühe Romane gar nicht vom Krieg, sondern von seinen Klostererfahrungen, den Geheimnissen der römischen Kurie und Kindern in den Slums von Neapel handeln. Im Augenblick gilt Old Chops Aufmerksamkeit allerdings James A. Michener – auch er ein Südpazifik-Veteran – und seinem Roman The Drifters. Der handelt von sechs Globetrottern, die sich zufällig in Torremolinos treffen und zusammen nach Marrakesch weiterreisen. Vermutlich mit jeder Menge Dope im Gepäck. Doch darüber schweigt Old Chop. Als ich ihm an diesem Morgen verkatert und übernächtigt wie eines der Torremolinos-Kids gegenübertrete, blickt der Alte prüfend, aber nicht unfreundlich zu mir auf, gerade so, als wisse er bestens Bescheid über die Schlachten der vergangenen Nacht – die im Fernsehen und die in meinen Träumen.
»How are you, Mani?«
Genau die Art von Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Will der Senior das wirklich wissen? Und wie genau will er es wissen? Oder ist es nur eine rhetorische Frage, eine Höflichkeitsfloskel, wie so häufig unter Amerikanern, so viel habe ich inzwischen kapiert.
»I’m alright, Sir. Maybe a little dizzy.«
»Don’t worry, it’ll go away. How about some breakfast?«
»What about Jack? Shouldn’t we wait for him?«
»Goddamn it, that old lazybones, kick him out of bed.«
»I’m not sure, he’d be happy about that …«
»It doesn’t make a damned bit of a difference. Just kick him out … It’s high time now. What do you want for breakfast? Bacon and eggs?«
»Yes Sir.«
»And pancakes?«
»Yes Sir.«
»Toast with peanut butter and jelly?«
»Yes Sir.«
»How many eggs? Two or three?«
»Two, Sir.«
Natürlich macht er dann drei für Mani, das Pferd, das immer Kohldampf hat, drei Spiegeleier nach Art des Hauses, also fachmännisch gewendet und auf der Oberseite kurz angebraten, so dass kein Glibber überbleibt. Zu den Pancakes gibt es Ahornsirup und als krönenden Abschluss noch eine aufgeschnittene Florida-Grapefruit, die man, wie Jack mich belehrt, ein paar Minuten vor dem Verzehr mit Salz zu bestreuen hat.
»Damit sie den bitteren Geschmack verliert.«
Der Sonntag in hard man’s guesthouse beginnt als Frühstücksfest. Im Kloster gibt es nur einmal in der Woche ein Ei zum Frühstück und das ist in der Regel hart gekocht. Jack schlitzt sein Eigelb mit der Messerspitze auf, gerade so weit, dass kein Eigelb herausläuft. Dann tunkt er eine geröstete Bacon-Scheibe hinein und beißt schlürfend ein kleines Stück ab. Das wiederholt er mehrmals, bis er das ganze flüssige Eigelb samt Bacon verdrückt hat. Schließlich schleckt er sich genüsslich die Finger ab und greift zum Kleenex.
»Hey, Dad, what are you up to today?«
»You know exactly, what I’m up to, lazybone.«
»No Sir, I’ve not the slightest idea.«
Old Chop schaut erst auf seine Uhr und dann, mit finsterer Miene, auf Jack.
»Son …«
»Yes Sir?«
»You know damned well, what I’m up to …«
Noch ein Widerspruch wäre jetzt nicht opportun. Also schweigt Jack und wartet auf Chop Seniors Fortsetzung. Das morgendliche Fingerhakeln zwischen den beiden fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Beide scheinen genau zu wissen, was der andere denkt, insgeheim fühlt, aber sie tun beide so, als seien sie völlig ahnungslos, als könne kein Wässerchen ihre Stimmung trüben, Vater und Sohn, wie sie sich gegenseitig belauern, einander tänzelnd umkreisen, zwei Boxer, die am Morgen noch die Distanz wahren, bevor sie irgendwann überraschend den ersten jab oder punch landen, ein morgendliches Abtasten in hard man’s guesthouse, dessen heimlicher Mittelpunkt stets der Ring ist, ein magisches Quadrat zwischen dehnbaren Seilen, in dem es nicht immer über die volle Distanz von zwölf Runden geht, das am Ende aber nur drei Aggregatzustände kennt: Knock-Out, Technischen K.O. oder Sieg nach Punkten.
»I’m expected at the bowling club.«
»You’re going for ›Frühschoppen‹?«
»Of course. If it’s not all over by the time I get there …«
Leicht verunsichert schaut Jack auf die Uhr. Kurz nach halb zwölf. Die Kegelbrüder trudeln ab elf zum Frühschoppen im Scheffelhof ein. Der Vierteles-Umtrunk der Honoratioren-Riege reicht in der Regel bis in den frühen Nachmittag hinein.
»You’ll be there in time, Dad.«
»Let’s hope so, my goodness. And when you guys have finished here, you’re gonna do the dishes …«
»Sure, Dad, alles klar …«
Jacks ›Dad‹ wirkt auf mich immer etwas liebedienerisch, schmeichlerisch, geradezu Besänftigung heischend, als wolle der Junior dem Senior signalisieren, dass er fürs Erste nur folgsamer Sohn, also verletzlich, schutzbefohlen und noch nicht bereit für Herausforderungen aller Art sei. Gleichzeitig macht es mich eifersüchtig. Rasend eifersüchtig. Jack kann wahlweise Old Chop, Sir oder Dad sagen. Ich kann das nicht. Niemals. Eben noch lag ich neben dem Alten im Bett. In seinem Ehebett! Näher bei ihm als sein leiblicher Sohn. Näher als irgendjemand sonst. Und am Morgen trete ich noch vor Jack in den Ring, zur Lagebesprechung, zur Befehlsausgabe, während Jack selig pennt. Ich bin es, der um Old Chops Zuneigung buhlt, nein, um seine Liebe, die Liebe eines Mannes, der für Jack Vater und Mutter in einer Person ist, der täglich für ihn kocht, seine Klamotten wäscht, zum Trocknen aufhängt und dann sorgfältig gefaltet in sein Zimmer legt, während ich meine Wäsche im Kloster von Hand waschen muss, weil meine Leute meine Klamotten längst nicht mehr waschen. Mani, der Einzelgänger, der nicht wie alle anderen am vierten Wochenende des Monats, dem Reisewochenende, nach Hause fährt, sondern am Ort bleibt und für zwei Tage zu seinem Freund übersiedelt, der kein Klosterschüler ist und dessen Vater, der rein altersmäßig auch mein Vater sein könnte, es aber nicht ist, mit ihm in einer Sprache spricht, die ich nur mangelhaft verstehe und die auf der Schule nicht gelehrt wird, nicht wirklich, der mich mangels Gästezimmer im Ehebett neben sich schlafen lässt und der so ungefähr alles verkörpert, was ich mir jemals von einem Vater erträumt habe, der mich fast wie seinen zweiten Sohn behandelt, aber eben nur fast, denn Dad – so kann ich, so darf ich ihn nicht nennen. Das bleibt allein Jacks Privileg.
Jack, der nie meinen Hunger teilen wird, der einen Heißhunger wie den meinen gar nicht kennt, der beim Essen endlos trödelt, bis die Hälfte kalt, vertrocknet, ungenießbar ist, also unweigerlich im Müll landen wird, wenn ich nicht doch noch nach einem der kalten Toasts oder Pfannkuchen greife, ich, Mani, Mülleimer, Müllschlucker, garbage can, der nie genug kriegen kann. Im Gegensatz zu Jack, der schnell genug hat: vom Essen, von einem Spiel, einem Film, einem Wettkampf, dessen Ehrgeiz immer nur kurz und jäh aufblitzt, wenn er unerwartet bei einem Skat-Winner die Faust ballt und leidenschaftlich auf den Tisch knallt oder bei einer Billard-Serie plötzlich in eine Art konzentrierter Trance fällt, in der er seine Umgebung nicht mehr wahrnimmt, bis sein Lauf abrupt endet und damit auch seine Konzentration, seine Leidenschaft, sein Ehrgeiz, so dass er wie nach einer großen Anstrengung erschöpft den Queue zu Boden krachen lässt. Jack, der erst einmal abwartet, die Dinge auf sich zukommen lässt und dann entscheidet, wie er darauf reagieren soll, eine Eigenschaft, die je nach Situation unentschlossen wirkt oder nervenstark, wenn Jack, wo andere längst nervös werden, stoisch abwartet, bis ihm der geeignete Moment gekommen zu sein scheint. Warum auch die Dinge forcieren? Manches löst sich von ganz allein in Wohlgefallen auf. Andererseits kann Jack blitzschnell und schlagfertig reagieren, wie ich es überhaupt noch nie bei jemand anderem erlebt habe. Jack, der in fast allem das genaue Gegenteil ist von mir, dem jedes Phlegma, jedes Sichtreibenlassen zuwider ist, der entscheidungsschwache Menschen nicht ausstehen kann, Zauderer, die alles und jedes hinauszögern müssen, die nicht wissen, was sie wollen, und andere dadurch zwingen, ihnen auf die Sprünge zu helfen, ihre Wünsche zu erraten und für sie die Initiative zu ergreifen. Aber Jack ist beides, Zauderer und nervenstark, Verweigerer und schlagfertig, langsam bis zum Abwinken und unglaublich reaktionsschnell. Jack, der hinter seiner Gleichgültigkeit ein starken, ja unbezwingbaren Willen verbirgt, der sich manchmal im Jähzorn, ja in Hassausbrüchen entlädt, dessen Pokerface aber meist die Oberhand behält, Jack, der seine wahre Gemütslage selten preisgibt und nur durch gelegentliches Stottern verrät, dass er unter Stress steht, Jack, der rein altersmäßig mein Bruder sein könnte, vielleicht sogar sein sollte, denn zum Abschied eines Besuchswochenendes sagte mir der Alte kürzlich mit einer Stimme, die seltsam entrückt klang, fast wie ein Bekenntnis, ja ein Auftrag, der mich durchaus peinlich berührte:
»Mani, I think you’re good for Jack.«
Seither frage ich mich, was zum Teufel gut an mir sein soll für Jack, welche Erwartungen der Alte da in mich setzt, und das ausgerechnet gegenüber Jack, der für die Freunde, für mich und auch für Old Chop selbst vor allem eines ist: unberechenbar.
* * *
Mittwoch und Sonntag sind die beiden Ausgehtage in Old Chops Woche. Mittwochabends zum Kegeln, sonntagmittags zum Frühschoppen. Jack und ich sitzen bereits beim Frühschoppen: beim Offiziersskat mit Cola und Whisky, als Hartman Senior frisch herausgeputzt das Esszimmer betritt. Ich habe Sonntagsklamotten gehasst, solange ich zurückdenken kann. Anzug und Krawatte sind für mich der Inbegriff des Spießertums. Doch Old Chops Garderobe löst bei mir nicht den üblichen Widerwillen aus. Zwar trägt der Alte eine schwarze Hose mit tadelloser Bügelfalte, dazu aber schwarzweiß lackierte italienische Halbschuhe und ein blau-weißgestreiftes irisches Stehkragenhemd, die Ärmel zweimal aufgeschlagen, so dass sich seine braunen Unterarme deutlich abheben. Statt der Spießerkrawatte schmückt ihn eine lederne Bola Tie mit Silberenden, auf der Brust lässig zusammengehalten von einer türkisblauen Brosche. Old Chop zieht sein Zippo aus der Hosentasche und zündet sich stilecht, also einhändig, eine Pall Mall an. Vom Kopf bis zur Sohle perfekt aufeinander abgestimmt, geht es mir durch den Sinn, dieser schlohweiße, raspelkurze Bürstenhaarschnitt, dazu das passende Grandfather Shirt mit Türkis-Brosche und statt der Cowboystiefel italienische Ganoven-Halbschuhe. Eine unorthodoxe, eine imposante Erscheinung!
»You trying to pick up a lady, Dad?«
Old Chops entspannte, in sich ruhende Miene verdunkelt sich abrupt. Chop Senior weiß, dass Chop Junior verdammt genau weiß, dass beim Frühschoppen keine Frauen zugegen sind.
»You know damn well, there aren’t any womenfolks at Frühschoppen, but if you wanna play popinjay, you’re welcome to.«
»I wasn’t trying to bust your chops, Dad. You look spleeeendid, magniiiificent, reeeeally!«
»Cut it out. Is that how you treat your old man?«
Ohne sich nochmal umzudrehen, schreitet Chop Senior durch die Terrassentür Richtung Garage. Jack wirft einen vielsagenden Blick zu mir herüber.
»Jetzt ist er in Schusslaune.«
»Schusslaune?«
»Ja. Sonntagmorgens, bevor er zum Kegeln geht, drischt er einen Golfball in den Wald!«
Ich schaue einigermaßen ratlos drein. Jack präzisiert:
»Einen oder mehrere, wenn er wütend ist, wie jetzt. Du hast doch die ganzen Pokale im Gang gesehen. Hat er alle bei army-tournaments abgeräumt. In seiner aktiven Zeit war er ein Scratcher. Hat sogar unter Par gespielt. Gegen Bogey-Golfer sähe er heute noch gut aus …«
Ich verstehe nur Bahnhof. Jack erklärt mir alles bereitwillig. Der Bogey-Golfer sei ein Amateur, der in der Regel einen Schlag mehr zum Einlochen brauche als für den Parcours vorgesehen. Old Chop lasse noch immer jeden Bogey-Golfer alt aussehen. Gegen echte Profis habe er als Scratcher, der Par spiele, aber keine Chance.
Hartman Senior hat in der Zwischenzeit einen Trolley mit O.C.S Army Golf Bag aus der Garage geholt.
»Let’s have some fun, folks!«, ruft er zu uns herauf, woraufhin wir ihm und dem Trolley bis ans Ende der Straße folgen. Mit etwas Phantasie könnte man sich die asphaltene Wendeplatte auch als eine Art Grün vorstellen. Old Chop stellt den Trolley ab und kramt einen Ball und einen Schläger heraus.
»Das ist der Driver für den Abschlag«, erklärt Jack leise.
»And that’s my fairway«, ergänzt Scratcher Hartman laut und vernehmlich, wobei er sich auf die schmale, vielleicht eineinhalb Meter breite Grasnarbe zwischen Wendeplatte und Kartoffelacker begibt, dort einen Stift in den Boden rammt und einen Golfball darauf legt.
»Let’s see, if I’ve still got it …«
Wir halten die Luft an. Keiner will dem Lt. Colonel seinen ersten Strike am Sonntagmorgen versauen. Hartman Senior macht ein paar Lockerungsübungen. Er holt mehrmals mit dem Holz aus und deutet Abschläge an, wobei sich sein massiger Körper elegant und ganz ohne Kraftaufwand um die eigene Achse zu drehen scheint. Dann tritt er näher an den Stift heran und nimmt Maß. Mit einer entschlossenen, aber keineswegs ruckartigen, sondern eher gleitenden Drehbewegung holt er erneut aus und trifft exakt den Ball. Der jagt in einem merkwürdigen Steigflug davon, hält dann überraschend lang seine Höhe, als sei er schwerelos, bis sich die Flugbahn wieder senkt. Wo er landet, sehen wir nicht mehr. Jedenfalls nicht im Kartoffelacker, soviel ist sicher, sondern irgendwo im Wald. Bis dorthin sind es ungefähr zweihundert Meter.
»Yep, still got it«, raunzt Old Chop sichtlich zufrieden, wobei er den ausgestreckten Driver nur langsam, fast wie in Zeitlupe, wieder zu Boden sinken lässt.
»Der is weg«, kommentiert Jack. Ich muss an all die Pokale im Flur denken, denen ich bislang kaum Beachtung geschenkt hatte. Pokale! Sowas wird in Sportlerheimen neben Vereinswimpeln und Jahrgangsfotos ausgestellt. Pokale, Wimpel, Fotos – das liegt auf der gleichen Wellenlänge wie Gartenzwerge in Spießer-Vorgärten. Vor hard man’s guesthouse stehen aber keine Gartenzwerge, und seine Pokale – nicht nur fürs Golfen, sondern auch für gewonnene Preisschießen, wahlweise mit Pistolen oder Gewehr – stehen auf einer Vitrine in einer dunklen Ecke gleich neben der Garderobe. Old Chop hat sie eben nicht ausgestellt, sondern lieblos in eine Ecke verbannt. Aber Sieger-Pokale sind Sieger-Pokale und von nichts kommt nichts, denke ich. Während ich über den jungen, schneidigen Offizier Hartman nachsinne, der seine Jahrgangsgenossen beim Preisschießen, Golfen und was weiß ich nicht noch alles ausgestochen hat, legt sich Hartman Senior den zweiten Ball auf den Tee. Und wieder surrt er in einer langen, ausgedehnten Flugbahn über den Kartoffelacker, ohne dass man mit bloßem Auge entscheiden könnte, ob er vor oder im Wald zu Boden geht.
»Yeah, that’s how it’s done. Did you guys see that?«
Das Schauspiel wiederholt sich noch ein paar Mal, bis endgültig klar ist, dass der massige alte Mann kein massiger alter Mann ist, sondern ein veritabler Golfer, ein Wettkämpfer, ein Sieger.
Captain Nathan Brittles is back, schießt es mir durch den Kopf, die Kavallerie hat einmal mehr bewiesen, dass sie überall einsetzbar ist, an jedem x-beliebigen Sonntagmorgen, in der hintersten Provinz, um auch dem letzten schwäbischen Indianer klar zu machen, dass ein Ami in ihm steckt, der rauswill. An diesem Sonntagmorgen bin ich der Indianer. Und mein einziges brennendes Verlangen ist es, ein Ami zu sein, einer von Captain Brittles’ Schwadron, koste es, was es wolle. Big Old Chop aber, der Befreier, der Kämpfer, der Sportsmann, hat an diesem Sonntagmorgen nach einigen erfolgreichen, d.h. präzise in den Wald gedroschenen Strikes seine gute Laune wiedergefunden, zieht den Tee aus der Grasnarbe, lässt das Einser-Holz im Army Golf Bag verschwinden und macht kehrt in Richtung Garage.
Dort wartet ein blitzblanker Opel Rekord C, Baujahr 71, mit siriusblauer Lackierung auf seinen Einsatz. Die 1900er Sport-Version mit 106 PS ist erst vor einem Jahr auf den Markt gekommen und weist revolutionäre Neuerungen auf. Der Radabstand ist länger als bei früheren Modellen, die Vorderachse hat einen eigens entwickelten Doppel-Querlenker mit Drehstabilisator, an Stelle der blattgefederten Hinterachse gibt es eine Fünf-Lenker-Startachse mit Schraubenfedern, die ein stabiles Fahrverhalten garantiert, das Modell C hat Scheibenbremsen und Bremskraftverstärker auf die Vorderräder und im Falle von Old Chops viertüriger Limousine noch ein paar unauffällige Extras wie beheizbare Heckscheibe, Nackenstützen und Automatikgetriebe. Am aufregendsten ist freilich die Karosserie, die dem der Chevrolet Chevelle von General Motors ähnelt: ein erotischer Hüftschwung im Heckbereich, der dank seiner Rundungen an eine liegende Cola-Flasche erinnert, weswegen alle Welt vom Coke-Bottle-Design spricht. Der Rekord C ist der erste deutsche Mittelklasse-Wagen, der ein bisschen wie ein amerikanischer Straßenkreuzer aussieht, ohne dessen gigantische Ausmaße zu haben, ein auf westdeutsche Straßenverhältnisse getrimmter Kompaktwagen, der wie die Muscle-Cars in den Staaten einiges unter der Haube hat, so dass der Motor beim Kick-Down ehrfurchtgebietend aufheult und die Tacho-Nadel ruckzuck von 80 auf 160 Kilometer pro Stunde klettern lässt, wobei man angenehm in den Sitz gepresst wird.
Mit Hartman Seniors siriusblauem Rekord verhält es sich wie mit seinen Pokalen und seinem Outfit: imposant, aber nicht protzig. So wie der Dollar im Kurs steht, hätte er sich auch einen Opel Commodore oder Admiral leisten können. Aber die wären zu groß, zu angeberisch und für Hartman Seniors sportliches Temperament viel zu lahm. Der Lt. Colonel braucht eine Limousine mit genug Ladefläche für den wöchentlichen Einkauf im PX-Store, die aber gleichzeitig schnell genug sprintet, um jeden auf der B 10 überholen zu können. Der Mann hat einfach Stil, denke ich, er weiß genau, was zu ihm passt.
* * *
Es riecht nach ofenwarmem Hefezopf und frisch aufgebrühtem Kaffee. Sonntagnachmittags ist Jacks Besuch bei den Großeltern fällig. Die Parterre-Wohnung mit Terrasse und Garten auf dem Schefenackerhügel im Norden der Gemeinde, wo die älteren Ein- und Zweifamilienhäuser stehen, gleicht in Größe und Raumaufteilung aufs Haar hard man’s guesthouse am unteren südlichen Ortsausgang. Ansonsten ist alles anders: keine halbvollen Aschenbecher auf den Tischen oder im Klo, keine gelb-roten Spuren der Fliegenklatsche an den Wänden, kein AFN Stuttgart im Hintergrund, keine Geschirrstapel in der Spüle, keine Dunstwolke aus Männerschweiß, Alkohol, Bratfett und kaltem Rauch; statt dessen spiegelblankes Parkett, alte Läufer, die wie neu aussehen, weil sie ausschließlich mit Hauspantoffeln in Berührung kommen, durchsichtige Tischdeckenüberzieher im Zitrusglanz; wohin man auch blickt: auf Leisten, Rahmen, Lampenschirme, nicht das kleinste Körnchen Staub. Eine Wohnung, die den Geist der Kehrwoche atmet, ein Musterfall schwäbischer Sauberkeit und Pietät, eine Vorzeigewohnung für künftige Mieter, möbliert im Stil der 50er Jahre, eine Behausung, die unbenutzt wirkt. Obwohl dort seit einem halben Jahrhundert ein Ehepaar lebt, dessen einzige Tochter nach dem verlorenen Krieg einen Amerikaner heiratete, der sie mitnahm über den großen Teich ins Land der Sieger, in Gods own country, in das schon so viele auswanderten, um ihr Glück zu machen, wirkt die Behausung vollkommen unbenutzt. Aufwendig vergrößerte, silbergerahmte Schwarz-Weiß-Fotos auf den Regalen, Vitrinen und an den Wänden künden vom Aufbruch des frisch vermählten Paares in die Neue Welt, von seinen Stationen im Traumland der 50er und 60er Jahre – Flitterwochen in Reno und bei den Niagara Falls, dann Fort Worth, Fort Riley, Minneapolis –, allein der frisch Vermählten, die nach der Heirat auf Wunsch ihres Mannes den Namen Susan anstelle von Susanne akzeptierte, so wie ihre Eltern Gertrud und Herbert in seinem Sprachgebrauch flugs zu Trudy und Herb mutierten, allein der über alles geliebten Tochter scheint die Luftveränderung nicht bekommen zu sein. An keinem der Orte, an die ihr Mann versetzt wurde, fühlte sie sich wohl, auch nicht auf dem Familiensitz der Hartmans in Alberta / Minnesota, immerhin seit Generationen Sitz einer deutschen Community, die die Tradition hochhält, aber die langen Winter, die Blizzards, die trotz allem fremden Gebräuche an Fest- und Feiertagen sorgten dafür, dass die tief in ihrer Heimat verwurzelte Susan, aufgewachsen in Badisch-Kongo, an der Grenze zwischen Nordschwaben und Baden, in der Neuen Welt nicht heimisch wurde. Sie wollte zurück.





























