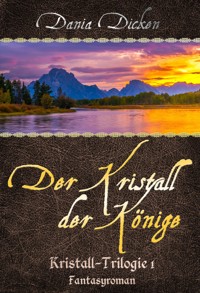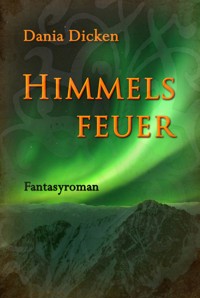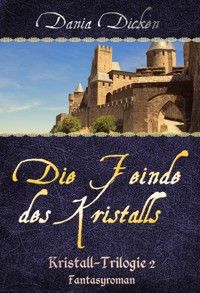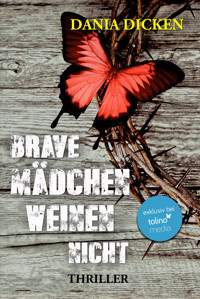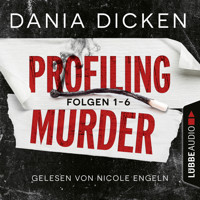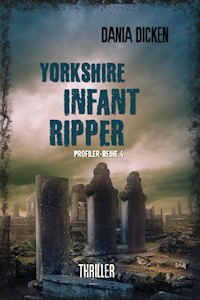
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf einem Yorker Friedhof wird die grausam entstellte Leiche eines Säuglings gefunden, der kurz zuvor aus dem Krankenhaus entführt wurde. Profilerin Andrea und ihr Kollege Joshua ermitteln gemeinsam mit der Polizei, denn es ist bereits der zweite Fall eines ermordeten und verstümmelten Kindes. Vom Täter fehlt jede Spur.
Doch neben diesem schwierigen Fall beschäftigt Andrea noch ihr eigenes Familienleben, das allmählich zu entgleisen droht...
Neuauflage des unter dem Titel "Für immer sollst du schlafen" veröffentlichten Thrillers von be.thrilled (2017)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dania Dicken
Yorkshire Infant Ripper
Profiler- Reihe 4
Psychothriller
Neuauflage 2023
Zuerst erschienen unter dem Titel „Für immer sollst du schlafen“ bei be.thrilled, Köln (2017)
Immer dort, wo Kinder sterben,
werden die leisesten Dinge heimatlos.
Nelly Sachs
Norwich, Donnerstag, 14. Juni
Die Sonne schien ihr ins Gesicht, als sie die Praxis verließ und zu ihrem Auto schlenderte. Beim bloßen Gedanken an die bevorstehende Operation fühlte Andrea sich befreit. Aber sie hatte auch jeden Grund, sich auf den Eingriff zu freuen.
Gut gelaunt setzte sie sich in den Wagen und schaltete das Radio ein. Bon Jovi, Have a nice day. Wenn das nicht passte!
Pfeifend und in aller Ruhe fuhr sie zurück zur Arbeit. Auf der Ringstraße war um diese Zeit am Vormittag nicht allzu viel Verkehr, deshalb kam sie gut voran. Über den Dächern der Häuser konnte Andrea den weißen Turm der Norwich Cathedral ausmachen. Als sie an einer Ampel stand, beobachtete sie für einen kurzen Moment die Menschen auf dem Parkplatz eines co-op-Supermarktes, die ihre Einkäufe im Kofferraum verstauten. Das wirkte so herrlich normal. Unaufgeregt.
Über solche Dinge konnte man sich freuen, wenn man wie sie als Kriminalpsychologin und Profilerin arbeitete. Normalität war das, was sie erdete.
Die Ampel schaltete auf Grün. Der Radiomoderator machte Späße mit dem Nachrichtensprecher und brachte Andrea damit zum Lachen. Sie liebte den britischen Humor.
Die Nachrichten begannen. Erst hörte sie nur mit halbem Ohr zu, doch bei dem Wort Kinderleiche wurde sie hellhörig.
„Wie die Polizei in York bekanntgab, wurde gestern Abend der Leichnam der seit vier Tagen vermissten Abigail Mercer gefunden. Der Säugling war nur etwa einen Tag nach seiner Geburt von der Säuglingsstation eines städtischen Krankenhauses verschwunden. Noch hat die Polizei keine heiße Spur, die zum Mörder des Neugeborenen führen könnte. Ein Polizeisprecher gab jedoch bekannt, dass eine Sonderkommission gebildet wurde, um den Täter zu ermitteln. Man erhofft sich Erkenntnisse aus den Verletzungen, die am Körper des Babys gefunden wurden. Der Fall weckt Erinnerungen an die Ermordung des vierzehn Monate alten Billy Harder, der im Februar letzten Jahres in York entführt und Tage später ermordet und verstümmelt aufgefunden wurde. Dass ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht, wollte die Polizei nicht bestätigen.“
Andrea ertappte sich dabei, wie sie das Radio für einen kurzen Moment ungläubig anstarrte. Ganz in Gedanken lenkte sie den Blick wieder auf die Straße und fuhr das letzte Stück bis zur Polizeistation.
Sie erinnerte sich an den Fall des ermordeten Jungen. Ihr Kollege Joshua, Leiter des Profiler-Teams des Birkbeck College in London, war um seine Expertise gebeten worden und hatte für die Beamten in York ein Profil erarbeitet. Einzelheiten des Falles kannte Andrea nicht, aber sie erinnerte sich, dass sie der Gedanke an ein verstümmeltes Kleinkind entsetzt hatte. Und jetzt war wieder ein Neugeborenes aus dem Krankenhaus verschwunden und ermordet worden. Andrea wagte kaum, sich die Verzweiflung der Eltern vorzustellen. Schließlich war sie selbst Mutter. Aber ihre Tochter Julie war gerade im Kindergarten, gesund und munter.
Gedankenversunken parkte Andrea vor der Polizeistation im Stadtzentrum von Norwich und betrat das Gebäude. Irgendwo klingelte ein Telefon, einer der Kollegen lachte. Es war nicht mehr lang bis zur Mittagspause und klang nach einem ganz normalen Arbeitstag. Sie folgte dem Flur, bis sie das Büro der Detective Sergeants Christopher McKenzie und Martin Collins erreichte, und steckte kurz den Kopf hinein.
„Bin wieder da“, sagte sie.
Christopher blickte von einer Akte auf und lächelte schelmisch, was typisch für ihn war und in der Hauptsache an seinen strubbeligen Haaren lag. Er war allein, Martin saß nicht an seinem Platz.
„Und, was sagt der Doc?“, fragte er.
„Wir machen den Eingriff wie geplant in zwei Wochen. Danach wird es wohl wieder ein Weilchen weh tun, dafür ist die Fläche einfach zu groß. Er kann mir auch nicht versprechen, dass die Narben komplett verschwinden.“
„Ach, dann sonnst du dich einfach zwei Sommer lang ausgiebig und schon ist alles weg“, sagte Christopher augenzwinkernd.
„Na ja, ich meine, du hast es ja gesehen“, erwiderte Andrea, die nicht ganz überzeugt von seinem Vorschlag war.
„Hm“, machte er. „War nicht sehr schön. Aber hey, ich habe auch noch die Narben vom Rapist. Die sind gar nicht übel.“
„Das sind auch keine Buchstaben“, entgegnete sie.
„Wohl wahr. Na ja, wird Zeit, dass die von deinem Bauch verschwinden.“
Andrea nickte und gab ihm mit einer Handbewegung zu verstehen, dass sie in ihr Büro gehen würde. Er steckte den Kopf wortlos zurück in die Akte.
Es war jetzt ein knappes halbes Jahr her, dass Amy Harrow ihr mit einem schmutzigen Butterflymesser den Namen Jon in den Bauch geritzt hatte – in Großbuchstaben, quer von links nach rechts. Anfangs war das sehr schmerzhaft gewesen und nur langsam verheilt. Manche Stellen hatten sich entzündet. Erst jetzt war alles abgeheilt und sie konnte darüber nachdenken, die Narben weglasern zu lassen. Niemand verlangte von Andrea, dass sie für den Rest ihres Lebens den Spitznamen des Mannes auf ihrem Bauch trug, der beinahe ihr Leben zerstört hätte. Jonathan Harold, der Campus Rapist von Norwich und siebenfacher Mörder, der auch sie entführt und achtzehn Stunden in seinen Keller gesperrt hatte. Zwar war sie nicht verletzt worden, aber was sie dort gesehen und erlebt hatte, hatte sich eingebrannt. Da hatte es auch nicht viel geholfen, dass ihr Mann Gregory ihn erschossen hatte.
Nur hatte er damit Amy Christine Harrow gegen sich aufgebracht, die Jonathan Harold verehrt und sich zum Vorbild genommen hatte. Eine Frau, die als Kind missbraucht worden war und, um ihrer Opferrolle zu entkommen, den Sexualsadisten Jonathan Harold nachgeahmt hatte und selbst zur Mörderin geworden war. Zum Ziel hatte sie sich gesetzt, an Andrea das zu vollenden, was Jonathan Harold nicht mehr geschafft hatte. Sie hatte Andrea vor Gregorys Augen foltern und töten und anschließend ihn erschießen wollen, doch glücklicherweise war es dazu nicht gekommen. Christopher hatte sie gefunden und Amy überwältigt, bevor es zum Schlimmsten gekommen war. Nur hatte sie es bis dahin schon geschafft, Andrea den Namen Jon in den Bauch zu schneiden.
Diese Narben sollten jetzt entfernt werden. Andrea konnte es kaum erwarten. Endlich würde sie sich nicht mehr heimlich am Spiegel vorbeistehlen oder darauf bestehen müssen, immer ein Unterhemd zu tragen, egal zu welcher Gelegenheit. Gregory behauptete zwar standhaft, es würde ihm nichts ausmachen, aber so ganz glaubte sie ihm das nicht. Schließlich hatte er es nicht mehr gesehen, seit es passiert war, und Andrea konnte sich nicht vorstellen, dass er in Stimmung kam, wenn er das sah.
Diese Narben machten ihr etwas aus. Mit seinem steifen Finger kam Greg besser zurecht. Durch Gordons Hilfe kam er mit allem zurecht. Er hatte sich nie beschwert, obwohl er beinahe an einer Blutvergiftung gestorben wäre. Drei Tage lang hatte Amy ihm das Leben zur Hölle gemacht, ihn hungern lassen, ihn geschlagen, versucht, ihm den Finger abzuschneiden. Darüber hörte Andrea kein Wort.
Überhaupt hörte sie nicht sonderlich viel von ihm. Schweigsam war er immer schon gewesen.
Dass er für einige Wochen ausgefallen war, hatte seinen Chef nicht gestört. Vor kurzem war sein Gehalt erhöht worden und als Innenarchitekt verdiente Gregory ohnehin nicht schlecht. Er liebte seinen Job genauso sehr wie Andrea ihren.
Sie schaltete ihren Computer wieder ein und überlegte, wie sie sich vor dem langweiligen Bericht drücken konnte, der sie erwartete. Papierkram war der unangenehme Aspekt ihres Jobs. Aber leider musste sie immer wieder Gutachten verfassen und es kam auch in regelmäßigen Abständen vor, dass sie diese vor Gericht erörtern musste.
Das Telefon klingelte. Sie war nur halb bei der Sache, als sie das Gespräch entgegennahm, denn auf dem Bildschirm ihres Computers erschien eine merkwürdige Fehlermeldung.
„Ich bin es, Jack“, vernahm sie die Stimme ihres Schwagers am anderen Ende. Im Hintergrund waren Stimmen zu hören. Die Umgebungsgeräusche waren sehr stark.
„Hey, was gibt es?“, fragte Andrea. Dass er mitten am Tag anrief, war ungewöhnlich.
„Ich bin im Krankenhaus, mit Rachel. Kannst du vorbeikommen?“
Irritiert runzelte Andrea die Stirn. Es waren noch fünf Wochen bis zu Rachels Geburtstermin, deshalb beschlich sie ein ungutes Gefühl.
„Was ist denn los? Ist alles in Ordnung?“
Jack schniefte. „Das Baby ist tot, Andrea.“
Beinahe hätte sie das Telefon vor Schreck fallengelassen. Tot. Das Wort hallte unbarmherzig in ihrem Kopf wider. „Oh Gott ...“
„Ich kann das nicht“, riss Jack sie aus ihrer Starre. „Rachel ist völlig neben der Spur und ich, ehrlich gesagt, auch ... kannst du uns helfen? Bitte.“
Andrea antwortete nicht gleich, der Schock hatte ihr die Sprache verschlagen. Dann atmete sie tief durch. „Okay. Bin gleich da.“
Sie legte auf, schaltete den Computer über den Anschaltknopf wieder aus und lief hinüber zu Christopher. Neugierig schaute er auf.
„Ich würde nicht darum bitten, wenn es nicht sein müsste“, begann sie, „aber ich muss ins Krankenhaus. Jack hat angerufen. Das Baby ist tot.“
Konsterniert erwiderte Christopher ihren Blick. „Ach du meine Güte. Es war doch schon fast so weit ...“
Sie nickte langsam, hielt den Kopf gesenkt. „Ist das okay für dich?“
„Natürlich. Die beiden brauchen dich jetzt dringender als ich.“
Dafür war Andrea ihm dankbar. Offiziell war er ihr Vorgesetzter, deshalb konnte sie das mit ihm besprechen. Sie wusste seine Freundschaft zu schätzen.
Mit hastigen Schritten machte sie sich auf den Weg nach draußen. Gleichzeitig kramte sie ihr Handy heraus, denn sie musste Gregory anrufen. Zum Glück war er gleich am Apparat.
„Hat Jack schon mit dir gesprochen?“, fragte sie unmittelbar.
„Nein, warum? Was ist los?“
„Das Baby ist tot.“
Er holte tief Luft. „Das kann nicht sein ...“
„Ich fahre hin. Er hat mich darum gebeten. Kannst du später Julie abholen?“
„Ja. Na klar. Soll ich auch kommen?“
„Lass mal“, sagte Andrea. „Bestimmt muss ich auch als Psychologin hin, nicht nur als Freundin.“
„Wahrscheinlich. Du kannst ihnen sicher helfen.“
Andrea hatte ihre Zweifel, aber das sagte sie nicht laut. Mit zitternden Fingern schloss sie ihr Auto auf und setzte sich auf den Fahrersitz. „Ich muss los. Bis später.“
„Okay. Mach‘s gut.“ Mehr fiel ihm auch nicht dazu ein. Andrea legte auf und fuhr los.
Ihr Kopf war leer. Sie spürte nichts außer einem dumpfen Gefühl, mehr Verwirrung als Schock. In fünf Wochen hätte Rachel eigentlich ein gesundes kleines Mädchen zur Welt bringen sollen. Drei Wochen nach der Hochzeit. Sie hatten sich so gefreut. Jack war zuletzt kaum noch zu halten gewesen, obwohl die Schwangerschaft ihn anfänglich entsetzt hatte.
Und jetzt war das Baby tot.
Rachel war erst wenige Tage zuvor beim Arzt zu einer Untersuchung gewesen. Alles bestens, hatte sie gesagt. Andrea hatte ihr längst Julies alte Sachen gebracht. Jack und Rachel hatten ein Zimmer für ihre Tochter hergerichtet, sich über die Namensgebung gestritten, immer wieder die Ultraschallaufnahmen angeschaut. Mit der bereits erfahrenen Andrea hatte Rachel sich über alle Belange der Schwangerschaft ausgetauscht.
Alle hatten sich gefreut. Andreas Schwiegermutter hatte ihr Glück kaum fassen können, dass auch ihr zweiter Sohn sie endlich zur Großmutter machte. Er hatte sich sogar dazu überreden lassen, zu heiraten. Alles war perfekt gewesen.
Andrea fuhr mit einem dicken Kloß im Hals. Zehn Minuten später war sie am Krankenhaus und überquerte den Parkplatz mit schweren Schritten. Zu ihrer Überraschung entdeckte sie am Haupteingang Jack, der sich mit einer Zigarette in den zitternden Fingern neben dem Mülleimer herumdrückte und sie gehetzt ansah. Hastig drückte er die Zigarette aus und kam zu ihr. Seine Umarmung fiel unerwartet fest aus. Andrea erschrak, als Jack sie danach ansah, denn so bedrückt hatte sie ihn noch nie gesehen.
„Sie sagte gestern Abend schon, dass die Kleine sich nicht bewegt. Weißt du, der Arzt meinte letztens, das könne schon mal vorkommen“, platzte er mit gepresster Stimme heraus.
„Ich weiß“, erwiderte Andrea.
„Aber heute Morgen war da immer noch nichts. Ich bin mit ihr zum Arzt gefahren, weil sie keine Ruhe gab. Und dann kamen beim CTG keine Herztöne ...“
Wortlos umarmte Andrea ihn erneut. Er war am ganzen Körper angespannt, in seinen Augen standen Tränen.
„Wahrscheinlich eine akute Plazentainsuffizienz, haben sie gesagt. Rachel gibt sich die Schuld.“ Jack holte tief Luft.
„Das ist Unsinn!“, widersprach Andrea sofort.
„Haben sie auch gesagt ... aber sie meinte, sie hätte es merken müssen. Früher kommen müssen. Aber als die Kleine sich nicht mehr bewegt hat, war es doch schon zu spät ...“
„Komm“, sagte Andrea. „Lass uns zu Rachel gehen. Sie ist doch ganz allein.“
„Ich war bis vorhin oben bei ihr. Hab nicht lang hier gestanden. Aber ich musste mal raus.“
Andrea verzog die Lippen zu einem gequälten Lächeln und folgte Jack ins Gebäude. Die Geburtsstation des Krankenhauses von Norwich kannte sie nicht, weil Julie in London geboren war.
„Hast du irgendwem Bescheid gesagt?“, fragte Jack, ohne sich umzudrehen.
„Christopher musste es wissen – und ich habe Greg angerufen. Wegen Julie.“
„Okay. Er kommt aber nicht, oder?“
„Nein.“
„Ich muss Mum noch anrufen. Ich wünschte, das hätte ich schon hinter mir.“
Andrea erwiderte nichts. Ihr fiel nichts ein. Augenblicke später öffnete Jack die Tür zum Kreißsaal, denn auch tote Kinder mussten meist normal entbunden werden. Beim Gedanken daran schnürte sich ihr die Kehle zu.
Auf einer Liege hatte Rachel sich seitlich zusammengerollt und starrte mit leerem Blick ins Nichts. Neben ihr saß eine Hebamme, die Jack und Andrea zunickte.
Rachel hatte furchtbar gerötete Augen, sah verweint aus. Ihr hübsches Gesicht zeugte von ihrem Schmerz. Andrea schluckte.
Jack kniete sich vor Rachel, strich ihr übers Haar und drückte ihre Hand. Stumm begann sie erneut zu weinen. Die Hände zu Fäusten geballt, blickte Andrea auf Rachels großen runden Bauch. Sie war nicht fähig, sich vorzustellen, dass das Kind darin tot sein sollte. Alles sah so normal aus. Gesund.
Schließlich schaute Rachel auf und lächelte flüchtig in Andreas Richtung. „Danke, dass du gekommen bist.“
„Ist doch klar.“ Andrea kniete sich neben Jack. „Wenn ich dir helfen kann, dann tue ich das.“
„Ja ... ich habe Angst, verstehst du? Die hatte ich sowieso. Aber jetzt ... Du hattest doch selbst schon eine Geburt, ich meine …“ sagte Rachel mit brüchiger Stimme.
„Ist alles gut. Ich bin die ganze Zeit bei dir, wenn du willst“, versprach Andrea.
Rachel nickte stumm und schluchzte, was es Andrea erschwerte, die aufsteigenden Tränen zurückzuhalten. Sie half Rachel nicht, wenn sie auch noch in Tränen ausbrach.
„Soll ich dann den Arzt holen?“, fragte die Hebamme. Rachel reagierte nicht.
„Bist du einverstanden?“, fragte Jack sie. Erst darauf nickte sie geistesabwesend.
Andreas Gefühl von Beklemmung wuchs, als die Hebamme Augenblicke später mit einem Arzt zurückkehrte. Er legte Rachel einen Tropf, um ihr wehenfördernde Mittel zu verabreichen und dann einen zweiten mit Schmerzmitteln. Anschließend sprach er noch einmal alles mit ihr durch. In Teilen erinnerte es Andrea sehr an Julies Geburt.
Sie sprachen nicht viel, während sie darauf warteten, dass die Geburt voranschritt. Jack saß neben Rachel und hielt ihre Hand, Andrea tat auf der anderen Seite dasselbe.
Im Moment gab es nichts zu reden. Das würde noch kommen. Andrea wusste genau, was diese Schwangerschaft Rachel bedeutet hatte. Sie hatte für ein Kind sogar ihre Beziehung zu Jack aufs Spiel gesetzt.
Aber das Leben war noch nie gerecht gewesen.
Arzt und Hebamme waren fast die ganze Zeit dabei und überwachten den Fortschritt der Geburt. Rachel sah nicht so aus, als wäre sie willens und in der Lage, das durchzustehen, was Andrea ihr gut nachfühlen konnte. Sie fragte sich, ob sich das tote Kind nicht wie ein Fremdkörper für Rachel anfühlen musste.
Die Hebamme redete Rachel gut zu und versuchte, sie zum Mitmachen zu bewegen. Auch als die Wehen stärker wurden, lag Rachel nur apathisch da und machte den Eindruck, als wäre sie am liebsten gestorben.
Weil sie auf die Hebamme nicht reagierte, schaltete Andrea sich ein.
„Fühlt es sich unangenehm an?“, fragte sie.
Verwirrt schüttelte Rachel den Kopf. „Nein. Es ist nicht komisch. Es ist doch mein Kind.“
Das beruhigte Andrea. Rachel erlebte es also nicht so traumatisch, wie sie befürchtet hatte. „Ich weiß, das ist unglaublich schwer. Es war ja noch nicht soweit ... das hätte anders laufen sollen.“
„Warum ist sie denn tot?“ Rachel schluchzte. „Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe nie getrunken, Jack hat nie in meiner Nähe geraucht, ich habe gesund gegessen ...“
„Das ist keine Frage von Schuld, Rachel. Du hast nichts falsch gemacht.“
„Aber warum ist sie dann tot?“
Seufzend drückte Andrea ihre Hand. „Ich weiß es nicht. Ehrlich. Das kann passieren. Jeder Frau kann das passieren.“
„Dir nicht.“
„Unsinn. Ich hatte Glück, bei Julie gab es keine Komplikationen. Und beim nächsten Mal wird es bei dir auch keine geben.“
„Ihr Kinderzimmer war schon fertig!“, rief Rachel unter Tränen.
„Ich weiß. Wir haben uns alle so auf die Kleine gefreut. Aber mach dir keine Sorgen, wir sind alle für dich da, das weißt du doch. Nur jetzt musst du stark sein. Die Kleine ist tot. Lass los.“
„Ich kann nicht ...“
„Doch, du kannst“, beharrte Andrea. „Wir sind die ganze Zeit bei dir und helfen dir, aber zur Welt bringen musst du sie. Verstehst du? Das ist wichtig. Komm schon. Danach wird es besser.“
„Wird es nicht“, sagte Rachel trotzig.
„Doch, natürlich. Du wirst sehen, es ist umso schneller vorbei, je besser du mithilfst.“
Endlich verstand sie und nickte. Die Hebamme zeigte ihr die richtige Atmung und zu Andreas Erleichterung tat Rachel einfach, was ihr gesagt wurde. Sie reagierte völlig mechanisch, aber sie tat es. Kurz darauf setzten die Presswehen ein, so dass sie zum ersten Mal trotz des Schmerzmitteltropfs laut vor Schmerzen schrie. Während der Arzt und die Hebamme noch etwas beratschlagten, stürzte Jack plötzlich fluchtartig aus dem Raum, jedoch nicht ohne Rachel noch einmal voller Sorge angesehen zu haben.
„Jack!“, rief sie und streckte die Hand nach ihm aus. „Jack ...“
„Ich sehe nach ihm“, sagte Andrea, stand jedoch erst auf, als Rachel nickte.
Draußen auf dem Flur stand Jack, am ganzen Leib zitternd, und blickte aus dem Fenster. Langsam trat Andrea neben ihn und legte ihre Hand auf seine Schulter.
Hilflos sah er sie an. „Bleibst du bei ihr?“
„Ja, natürlich, Jack. Aber was ist mit dir?“
„Ich kann das nicht mehr. Eigentlich wollte ich schon die ganze Zeit raus. Ich ertrage es nicht, sie so zu sehen. So habe ich sie auch noch nie gesehen! So traurig, so furchtbar gleichgültig ...“
„Mir war vorhin auch nach Weinen zumute“, gab Andrea zu.
„Das ist es bei mir die ganze Zeit. Ich weiß, was ihr das Kind bedeutet hat. Sie war so glücklich. Und jetzt – sieh sie dir doch mal an! Ich kann das nicht mehr. Ich würde ihr so gern helfen und die Kleine wieder lebendig machen, ihr die Schmerzen nehmen ... aber ich sitze nur da und sehe sie leiden. Wenn ich da noch länger drin bleibe, können die mich gleich auch noch vom Boden aufkratzen.“ Er ließ die Schultern hängen und wandte sich halb von ihr ab. „Ich kann das nicht mehr und ich habe ihr nichts gesagt, weil ich mich dafür schäme. So, jetzt ist es raus.“
„Du musst dich nicht schämen, Jack. Keiner erwartet von dir, dass du den Fels in der Brandung spielst. Es war auch dein Kind“, versuchte Andrea, ihm Trost zu spenden.
„Ich erwarte das von mir, verstehst du? Ich müsste jetzt für sie da sein, aber ich fühle mich selbst so schwach. Sie soll nicht sehen, wie ich da drin zusammenbreche.“
Andrea nickte verstehend. „Okay, dann gehe ich allein wieder zu ihr. Ruf doch Greg an, wenn du willst. Er kommt bestimmt vorbei.“
„Hm. Vielleicht“, sagte Jack zögerlich. „Sagst du ihr, dass es mir leidtut? Ich liebe sie.“
Bevor Andrea die Tür öffnete und wieder hineinging, lächelte sie und nickte.
Rachel musterte sie mit großen Augen, als sie zu ihr zurückkehrte. „Wo ist Jack?“
„Er bleibt draußen vor der Tür. Er ist nicht weit weg.“
„Aber warum bleibt er nicht bei mir?“
„Ihm gehen die Nerven durch. Er glaubt, er klappt noch zusammen, wenn er hierbleibt. Das will er nicht. Sei ihm nicht böse; du weißt, dass er dich liebt“, erklärte Andrea ruhig.
Rachel erwiderte nichts, sondern stöhnte nur vor Schmerz und presste. Der Druck ihrer Hand auf Andreas wuchs. Dann schrie sie ihre Qualen hinaus.
Ihr war entsetzlich kalt. In ihrem Kopf hallten immer noch Rachels Schreie nach, was ihr immer wieder die Tränen in die Augen trieb.
Seit Julies Geburt hatte sie vergessen, was für ein Gewaltakt das eigentlich war – und diesmal war es noch schlimmer. Diesmal ging es um eine Mutter, die keinen Grund hatte, sich zu freuen. Rachel war verzweifelt und weinte auch aus Traurigkeit, nicht nur aus Schmerz. Sie hatte es hinausgeschrien. Das hatte anders geklungen – schlimmer. Verzweifelt. Hoffnungslos.
Obwohl es vorbei war, saß Andrea gespannt wie eine Feder neben Rachel und beobachtete, wie sie ihre Tochter im Arm hielt. Der kleine Säugling hatte nicht ganz die gesunde Farbe eines Neugeborenen, wie Andrea sie kannte. Daran störte Rachel sich jedoch nicht. Die Haare klebten ihr an der Stirn, sie war verschwitzt und weinte noch immer. Daneben fühlte Andrea sich taub. Für einen Augenblick musste sie an Jack denken, der das ganz bestimmt nicht verkraftet hätte.
Er stand immer noch draußen. Ihm hatte noch niemand Bescheid gesagt. Andrea legte eine Hand auf Rachels Unterarm und wartete, bis sie ihren Blick matt erwiderte.
„Soll ich Jack holen?“, fragte sie.
Rachels Miene versteinerte. „Was würde er hier noch wollen?“
Andrea seufzte. „Lass ihn die Kleine auch sehen. Er hat es nicht böse gemeint, als er rausgegangen ist, aber er hätte das nicht durchgestanden.“
„Und wer hat mich gefragt?“
„Er wollte stark für dich sein und das konnte er nicht. Wahrscheinlich war es wirklich besser so. Ich war an seiner Stelle da.“
Rachel erwiderte nichts. Mit zitternden Fingern strich sie über den Kopf ihres toten Kindes.
„Bist du einverstanden?“, fragte Andrea noch einmal.
„Mach, wie du meinst“, erwiderte Rachel bitter.
Langsam stand Andrea auf und machte einige Schritte zur Tür, aber dann blieb sie stehen und fuhr sich durchs Haar. Sie verstand Rachels Zorn, obwohl er ungerecht war. Zwar war sie auch der Meinung, dass ein Vater bei der Geburt dabei sein sollte, aber es gab Ausnahmen. Schwächelnde Väter waren den werdenden Müttern keine Hilfe, eher im Gegenteil.
Rachel war wütend auf Jack, deshalb war es schwierig, ihn dazu zu holen. Doch es war auch sein Kind und außerdem hoffte Andrea, dass sich alles einrenken würde, wenn die beiden erst wieder zusammen waren. Sie musste es darauf ankommen lassen.
Deshalb öffnete sie die Tür und entdeckte ein Stück weiter den Gang entlang an der gegenüberliegenden Wand Jack und Gregory, die auf harten Stühlen Platz genommen hatten. Als sie Andrea bemerkten, erhoben sich beide.
„Wie geht es Rachel?“, bestürmte Jack Andrea.
„Es ist okay“, sagte sie. „Es ist alles geschafft. Ich dachte, vielleicht willst du die Kleine auch sehen.“
Hastig nickte er und folgte ihr.
„Ich warte“, tat Gregory kund und setzte sich wieder. Über die Schulter warf Andrea ihm einen liebevollen Blick und ein mattes Lächeln zu, das er gleich erwiderte. Am liebsten wäre sie bei ihm geblieben, aber sie hatte im Gefühl, dass Rachel und Jack sie brauchten.
Arzt und Hebamme waren gerade fertig. Rachel mit dem Kind im Arm wirkte so friedlich, beinahe perfekt – wäre das Kind nicht tot gewesen. Zaghaft ging Jack zu ihr und strich ihr über den Kopf.
„Ich hätte dich gebraucht“, stieß sie mit tränenerstickter Stimme hervor. Andrea beeilte sich, neben Jack zu kommen.
„Ich konnte nicht. Bitte sei nicht böse“, sagte er.
Rachel erwiderte nichts, sondern weinte nur. Jack schwieg ebenfalls und streckte langsam den Arm nach der Kleinen aus. Er legte die Hand auf ihren Kopf, streichelte sie und wandte sich dann schlagartig ab. Seine Wangen waren tränennass, als er Andrea umarmte und sich nicht mehr länger um Fassung bemühte. Tröstend drückte Andrea ihn an sich. So hatte sie ihn noch nie erlebt.
„Sie wäre so ein hübsches Mädchen gewesen“, sagte Rachel traurig. Jack war nicht in der Lage, zu reagieren, aber Rachel deutete das völlig falsch.
„Was ist mit dir?“, schrie sie plötzlich. „Willst du sie denn gar nicht halten?“
Er drehte sich um und rief gereizt: „Ich kann nicht, Rachel! Ich kann das alles nicht, verstehst du? Ich reagiere nicht so wie du! Es tut zu weh!“
„Das glaubst du doch selbst nicht. Dir kommt das doch gelegen, nicht wahr? Du wolltest sie doch sowieso nicht!“
„Hört auf!“, rief Andrea und hob abwehrend die Hände. „Hört jetzt auf, das bringt doch nichts. Du hast keinen Grund, ihm böse zu sein, Rachel. Er kann nichts dafür, dass das passiert ist. Ich weiß, du suchst einen Schuldigen, aber es ist nicht Jack!“
„Aber warum ...“ begann sie, ohne den Satz zu vollenden.
„Ich falle wahrscheinlich um, wenn ich sie nehme“, sagte er. „Das ist meine Art, damit umzugehen. Weglaufen. Wenn ich das an mich ranlasse, halte ich das nicht mehr aus.“
Rachel wischte sich über die Augen. „Ich habe mich noch nie so allein gefühlt.“
Daraufhin beugte Jack sich über Rachel und umarmte sie. Andrea rang um Fassung, als sie die beiden weinen sah, und schlich leise aus dem Zimmer. Jetzt war es so weit, dass sie die beiden allein lassen konnte.
Als sie auf dem Flur stand, schloss sie die Tür hinter sich und lehnte sich schwer gegen die Wand. Gregory kam gleich zu ihr und blieb mit ernstem Blick vor ihr stehen. Stumm schaute sie zu ihm auf und flüchtete sich in seine Umarmung.
„Alles okay bei dir?“, fragte er.
„Ja, auch wenn das ganz schön hart war. Aber die beiden machen mir Sorgen.“
„Ich habe sie gehört.“
„Es ist furchtbar“, sagte sie leise. „Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie Rachel sich fühlt. Und Jack ... so habe ich ihn noch nie gesehen.“
„Ich auch nicht. Was denkst du, können wir nach Hause?“
Andrea ging noch einmal in den Kreißsaal, um das zu klären. Rachel schaute dankbar zu ihr auf und drängte sie geradezu, nach Hause zu fahren – zu Julie. Andrea sagte nichts dazu und ging bedrückt.
Während der gesamten Fahrt zu ihrer Schwiegermutter schwieg sie. Die Gedanken an Rachel jedoch lärmten noch immer in ihrem Kopf. Sie dachte ständig daran, wie es Rachel ging und wie sehr sie litt. Das wurde auch nicht besser, als sie kurz darauf bei Anna eintrafen. Sie erwartete die beiden mit Julie an der Tür.
Jetzt ihre Tochter zu sehen, machte alles beinahe noch schlimmer für Andrea. Julie trug ihre dunklen Locken in zwei Zöpfen und ihre Augen leuchteten, als sie ihre Eltern sah. Sie war so ein hübsches kleines Mädchen. Weil sie Andrea und Greg sehnsüchtig erwartet hatte, lief sie ihnen entgegen und umarmte ihre Mutter fröhlich quiekend, denn sie hatte sie seit dem Morgen nicht gesehen. „Mami!“
„Na, mein Liebling.“ Andrea küsste sie auf die Stirn und gab ihr Bestes, sie auf dem Arm zu halten. Dass sie schon als Dreijährige so schwer sein musste!
„Hallo, ihr beiden“, sagte Anna betrübt. „Wie geht es Rachel und Jack?“
„Es ist deprimierend“, erwiderte Andrea auf dem Weg ins Haus. Gemeinsam nahmen sie auf dem Sofa im Wohnzimmer Platz, wo sie Anna alles erzählte. Schließlich war Andrea die Einzige, die alles wusste. Ihr blieben fast die Worte im Hals stecken, aber Anna machte es ihr leicht, indem sie ihre Fassung wahrte.
„Arme Rachel“, sagte sie schließlich. „Vor solchen Komplikationen hat jede Frau Angst.“
Andrea nickte nur und dachte an das kleine Mädchen in Rachels Armen. So ein winziger Säugling. Dieser Tod war so sinnlos.
„Ich will nach Hause“, murmelte sie, sich die Schläfen reibend. Sie hatte Kopfschmerzen. Anna verabschiedete sie mit ernster Miene, Gregory brachte Julie mit unvergleichlicher Geduld ins Auto und schnallte sie auf ihrem Kindersitz fest. Andrea war ihm dankbar, dass er sich um sie kümmerte.
Gleich nach ihrer Ankunft zu Hause holte sie sich eine Kopfschmerztablette und kochte Tee. Von oben hörte sie die Stimmen von Greg und ihrer Tochter. Julie kicherte vergnügt. Gregory sprach in dem speziellen sanften Ton mit ihr, der nur für sie reserviert war. Andrea verstand zwar nicht, was er sagte, aber allein der Klang seiner Stimme wirkte ungemein beruhigend auf sie.
Mit der Teetasse in der Hand lief sie durchs Wohnzimmer und schaute auf die Uhr. Schon neun. Julie würde im Handumdrehen einschlafen. Still war es inzwischen seit einigen Minuten. Als sich etwas später immer noch nichts rührte, ging Andrea leise nach oben, um nach den beiden zu sehen.
Sie war wenig überrascht, Gregory an Julies Bettchen sitzen zu sehen. Die Kleine war tatsächlich schon eingeschlafen, hatte ein seliges Lächeln auf den Lippen und ihr Krokodil Leelu im Arm. Gregory blickte auf zu seiner Frau.
„Mein armer Bruder“, sagte er leise. Andrea wusste, wie er das meinte. Er ließ Rachel nicht außer Acht, das war nicht seine Absicht. Aber sein Bruder war sein bester Freund, ein fröhlicher und aufgeschlossener Mensch. Heute war jedoch mit dem Kind etwas in Jack gestorben.
„Ich kann das noch gar nicht fassen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn Julie jetzt nicht hier wäre.“ Gregory seufzte traurig. „Und ich habe ihm auch noch lauthals davon vorgeschwärmt, wie toll das ist.“
„Das konnte doch niemand ahnen.“
Leise stand er auf und ging zu seiner Frau. Als sie draußen auf dem Flur standen, lehnte er die Tür des Kinderzimmers an und seufzte nachdenklich. „Es gibt nichts Wichtigeres.“
Andrea nickte stumm und blickte ihm nach, während er nach unten ging.
Norwich, Freitag, 15. Juni
„Das ist verdammt übel. Tut mir echt leid für die beiden.“ Christopher hatte die Hände um die Kaffeetasse gelegt und blickte nachdenklich hinein. „Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, so ohne Familie, aber ich mag mir das gar nicht vorstellen. Es war bestimmt gut, dass du da warst.“
Das vermutete Andrea auch. „Die beiden gehen so unterschiedlich damit um, verstehst du? Deshalb haben sie sich gestritten. Das war das schwerste. Es tat weh, zu sehen, dass sie in diesem Moment nicht zusammenhalten konnten.“
Christopher verzog das Gesicht. „Und wie bist du damit umgegangen?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Gute Frage. Ich habe versucht, ganz der Profi zu sein und nicht die werdende Tante.“
„Solange es hilft.“
„Professionalität hilft immer. Das ist reiner Selbstschutz“, sagte Andrea. „Besonders gestern. Ich bin selbst Mutter. Aber ich habe nicht alles auf den Kopf gestellt, um ein Kind zu bekommen, nur um dann seinen Tod zu erleben.“
„Das Leben war noch nie fair“, postulierte Christopher bedeutsam und nahm noch einen Schluck Kaffee.
Grinsend hob Andrea eine Augenbraue. „Das Wort zum Freitag von Detective Sergeant McKenzie.“
Er erwiderte das Grinsen halbherzig. „Ich wollte noch über eine andere Sache mit dir sprechen. Der Staatsanwalt hat gestern angerufen. Amy Harrows Pflichtverteidiger will sie mit allerhand obskuren Gutachten rauspauken. Im Augenblick wird diskutiert, ob sie überhaupt schuldfähig ist, sollte bei ihr eine dissoziative Persönlichkeitsstörung vorliegen.“
Wenig begeistert verzog Andrea das Gesicht. So etwas hatte Joshua bereits befürchtet. „Und jetzt?“
„Der Staatsanwalt würde gern einen Gegengutachter bestellen. Normalerweise wärst das du, aber wegen Befangenheit scheidest du wohl aus. Nichtsdestotrotz würde er gern deine Meinung hören, bevor er einen anderen Experten herbestellt und auf sie loslässt.“
Fragend runzelte Andrea die Stirn. „Was soll das denn bringen?“
„Er schätzt dich sehr und hofft, dass sie sich dir gegenüber verrät. Er glaubt, sie täuscht es vor.“
Langsam schüttelte Andrea den Kopf. „Ich glaube das nicht. Du hast sie doch auch erlebt, dieser abrupte Wechsel ...“
„Ja, ich erinnere mich. Aber sie ist schlau. Wenn ich sie wäre, würde ich das auch vortäuschen.“
„Vor einem halben Jahr habe ich mit Joshua schon darüber gesprochen. Es würde einfach alles erklären: Den Wechsel zwischen Opfer- und Täterrolle, den wir nie ganz nachvollziehen konnten, und Augenblicke wie den, in dem sie Greg nur geritzt hat, obwohl sie ihn doch eigentlich umbringen wollte. Außerdem lautet die Frage nicht unbedingt, ob sie eine multiple Persönlichkeit hat, sondern wie die Juristen damit umgehen. Das sollte sich in keiner Weise schuldmindernd auswirken.“
„Das denke ich auch“, stimmte Christopher zu. „Ich habe meine Skepsis geäußert, aber fragen wollte ich dich trotzdem. Ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst und ob du bereit dazu bist, aber ich würde dich begleiten, wenn du möchtest.“
Andrea konnte sich zwar etwas Besseres vorstellen, als der Frau gegenüberzutreten, die sie beinahe verstümmelt hätte. Allerdings hatte der Staatsanwalt ein überzeugendes Argument: Sie konnte Amy Dinge entlocken, die ihr sonst niemand abpresste.
Wie so viele Serienmörder zeigte Amy stark narzisstisches Verhalten und verherrlichte ihre Taten. Joshua und Gordon hatten Andrea nach ihrem ersten Gespräch mit Amy ein halbes Jahr zuvor davon erzählt. Sie hatten sich Amy nicht nur als Psychologen vorgestellt, weil sie befürchtet hatten, dass sie dann mauern würde. Mit Psychologen hatte sie schließlich im Vorfeld keine allzu befriedigenden Erfahrungen gesammelt.
Also waren sie aufs Ganze gegangen und hatten sich als Andreas Kollegen vorgestellt. Daraufhin hatte Amy sich als sehr gesprächig erwiesen. Sie hatte die beiden mit dem schockieren wollen, was sie Greg und Andrea hatte antun wollen – und mit dem, was sie bereits getan hatte.
Insofern hatte der Staatsanwalt vermutlich Recht und Amy würde mit Andrea über Dinge reden, die sie niemandem sonst erzählen würde. Sie würde sich keine Möglichkeit entgehen lassen, Andrea zu ängstigen.
Wollte Andrea sich das antun?
Dabei hatte sie sich schon längst entschieden.
„Lass uns fahren“, sagte sie zu Christopher. Er war verdutzt über ihre rasche Entscheidung, stellte sie aber nicht in Frage.
Im Streifenwagen machte Andrea es sich auf dem Beifahrersitz bequem und lauschte auf die gutgelaunte Musik aus dem Radio. Amy Harrow befand sich im Frauengefängnis in Peterborough, der Heimat ihrer Freundin Sarah. Eine fast zweistündige Fahrt lag vor ihnen, aber das machte ihr nichts aus.
Trotzdem fragte sie sich, warum sie das immer wieder tat. Ganz egal, was es war – Kindesmissbrauch, brutal zugerichtete Leichen, Gespräche mit psychisch kranken Verbrechern – Andrea scheute nichts. Bislang hatte sie noch nichts abgelehnt, sich um jeden Fall gekümmert und würde jetzt der Frau gegenübertreten, die sie tot sehen wollte. Aber sie machte hier ihren Job. Wie sie damit umgehen musste, wusste sie.
Blieb die Frage, was mit Amy los war. Warum wurde ein Missbrauchsopfer zu einem solch brutalen Täter? Das ließ sich auch anders als durch eine multiple Persönlichkeit erklären, denn eine Opfer-Täter-Karriere war nichts Außergewöhnliches. Nur in dieser Größenordnung vielleicht. Und genau daran stieß Andrea sich.
Ebenso hatte sie oft darüber nachgedacht, warum Amy Greg geritzt hatte. Sie hatte ihm Zähne ausgeschlagen, ihn verletzt, ihn halb verhungern lassen - aber als er über Schmerzen geklagt hatte, hatte sie zu ihrem Mittel der Linderung gegriffen und ihn geritzt. Ganz zu schweigen von den plötzlichen Verhaltenswechseln, die sie Andrea und auch Christopher gegenüber gezeigt hatte. Es hatte sich angefühlt, als säße ihr ein ganz anderer Mensch gegenüber. Eine multiple Persönlichkeit konnte das erklären.
Joshua war anfänglich mehr als skeptisch gewesen. Zum ersten Mal eingelenkt hatte er, nachdem er mit Amy gesprochen hatte. Was er über sie wusste, ließ ihn an seiner Haltung zweifeln. Er fand keine andere Erklärung für ihr Verhalten und hatte deshalb das Bedürfnis, sich in dieser Richtung weiter zu informieren. Andrea wusste, dass er Fallstudien durchging, um sich ein genaues Bild zu machen.
Gab es diese Störung tatsächlich, war Amy prädestiniert dafür. Opfer frühkindlichen sexuellen Missbrauchs entwickelten sie, um mit dem Unaussprechlichen fertig zu werden. Da die kindliche Persönlichkeit das nicht allein bewältigen konnte, spaltete sie sich ab und bildete mehrere Persönlichkeiten – eine starke etwa, die mit den Umweltanforderungen fertig wurde, wohingegen auch die ursprüngliche, verletzte Persönlichkeit übrig blieb und geschützt werden sollte.
Die anderen Persönlichkeiten konnten in einem Maße gestaltet werden, dass sie das genaue Gegenteil dessen darstellten, was sie schützen sollten. War Amy ein schutzloses, verunsichertes kleines Mädchen, konnte eine ihrer anderen Persönlichkeiten vielleicht Züge eines dominanten Mannes tragen.
Problematisch an dieser Persönlichkeitsstörung war, dass die Patienten oft angaben, nichts von den anderen Persönlichkeiten zu wissen, die über eigene Wissens- und Erfahrungsschätze verfügten. Alle Persönlichkeiten existierten und agierten unwissend voneinander. Ein eigenartiger Gedanke, wie Andrea fand.
Doch in Amys Fall hätte alles Sinn ergeben. Sie war eine Borderline-Patientin; das wurde auch von vielen anderen Patienten mit dissoziativer Identitätsstörung postuliert. Sollte es diese Störung wirklich geben, war Amy ein Paradebeispiel. Die hilflose Amy hätte Greg geritzt, um ihm zu helfen, während die dominante, böse Amy zur Serienmörderin wurde.
Als sie die Autobahn erreicht hatten, holte Andrea ihr Handy heraus und rief Joshua an. Sie hatte seine Büronummer gewählt, doch niemand hob ab. Nach dem fünften Freizeichen knackte es in der Leitung und ein anderes Freizeichen ertönte. Die Rufumleitung, also war er nicht im Büro.
„Carter“, sagte er. Es klang dumpf.
„Hey, Joshua. Andrea hier.“
Etwas raschelte. „Mit dir habe ich nicht gerechnet. Dachte, es wären die ungeduldigen Polizisten aus York.“
„Oh. Du fährst hin?“, fragte sie.
„Zusammen mit Mike. Der Fall wächst ihnen über den Kopf. Dem Säugling fehlte das Herz.“
Die Schultern gestrafft, sagte Andrea: „Okay. Das klingt nach Arbeit.“
„Das denke ich auch. Dem kleinen Billy fehlten letztes Jahr die Augen. Ich glaube, da ist irgendein Irrer am Werk.“ Er lachte leise. „Na, das sind sie immer. Aber du rufst nicht an, weil du dabei sein wolltest, oder?“
„Nein. Ich rufe an wegen Amy.“
„Was ist mit ihr?“, fragte er.
„Ich bin gerade auf dem Weg zu ihr.“ So detailliert wie eben nötig erzählte sie Joshua, worum es ging.
„Der Staatsanwalt ist ein Fuchs“, sagte er.
„Allerdings. Ich muss verrückt sein, dass ich das mache.“
„Eindeutig. Klingt schon ganz nach dir. Und jetzt?“
„Wie soll ich vorgehen? Wie kann ich herausfinden, ob sie tatsächlich eine dissoziative Persönlichkeit hat? Weißt du etwas darüber?“
Er antwortete nicht gleich, sondern überlegte. „Wir bräuchten einen Beweis. Am besten wäre es, wenn du das Auftreten ihrer verschiedenen Persönlichkeiten provozierst. Du hast mir doch erzählt, dass du sie gefragt hast, wie du sie nennen sollst. Spiel mit ihrem Namen. Wenn es stimmt, was ich vermute, ist Amy der Name ihrer labilen Innenperson und Christine der Name ihrer dominanten Persönlichkeit, dem Host.“
„Du denkst also auch, dass es stimmt?”, fragte Andrea.
„Ich wüsste nicht, wie wir einige Dinge sonst erklären sollten.“
„Aber ist sie schuldfähig?“
„Na klar. Eine kriminelle Persönlichkeit reicht“, sagte Joshua.
„Dann ist doch egal, ob sie es ist oder nicht“, fand Andrea.
„Natürlich, aber der Richter will gute Argumente haben.“
Da musste sie ihm Recht geben. Nach kurzem, belanglosem Geplauder verabschiedeten sie sich. Christopher schielte neugierig in ihre Richtung, als sie aufgelegt hatte, deshalb gab sie wieder, was Joshua ihr geraten hatte.
„Klingt doch gut“, fand Christopher. „Soll ich denn mitkommen?“
Andrea überlegte kurz, doch dann schüttelte sie den Kopf. „Bei mir allein wird sie gesprächiger sein.“
„Aber ich bleibe in der Nähe.“
Das wusste Andrea zu schätzen. Sie fühlte sich sicherer, wenn sie wusste, dass er in der Nähe war.
Links und rechts der Straße erstreckten sich Wiesen und Felder, soweit das Auge reichte. Immer wieder löste ein kleines Dorf die Eintönigkeit ab. Die langweilige Fahrt geradeaus lud nur so zu einem kleinen Nickerchen ein, doch Andrea verkniff es sich.
Schließlich erreichten sie Peterborough. Andrea kannte die Stadt, sie war schon mit Sarah dort gewesen. Nur das Gefängnis kannte sie nicht.
Es war ein ziemlich unspektakulärer Gebäudekomplex, den ein umsichtiger Mensch in warmen Farben hatte streichen lassen. Das und die umgebenden Rasenflächen täuschten fast über die hohen Zäune und das wenig einladende Tor hinweg.
Christopher stellte sie am Eingang vor und regelte alles. Ohne große Umstände wurden sie eingelassen. Vorausschauend hatte er seine Waffe und sonstige Dinge, die man ihm abgenommen hätte, gar nicht erst mitgebracht. Trotzdem wurden sie ein wenig gefilzt und mit einigen Hinweisen versorgt, während ein Wärter sie zum Besuchsraum führte.
Der Gang dorthin wirkte zwar hoch und offen, aber überall erinnerten Gitter daran, wo sie eigentlich gerade waren. Andrea fand es befremdlich.
Christopher klärte, dass er nebenan bleiben würde, weil Amy ihn nicht zu Gesicht bekommen sollte. Andrea blieb also allein im Besuchsraum zurück, der außer einem Tisch und Stühlen nicht viel Einladendes zu bieten hatte. Augenblicke später ertappte sie sich dabei, wie sie sich unsicher in einer Ecke herumdrückte, und atmete tief durch. Sie musste keine Angst vor Amy haben. Es war noch ein Wärter dabei, der aufpassen würde.
Entschlossen stellte Andrea sich aufrecht und wartete. Trotzdem wurde sie nervös, als sie Schritte auf dem Gang hörte. Augenblicke später betrat Amy Harrow den Raum und blieb stehen, als sie Andrea erkannte.
„Als von Besuch aus Norwich die Rede war, dachte ich nicht an dich“, sagte sie mit spöttischer Miene. Andrea zeigte keine Reaktion.
„Bitte setzen Sie sich“, richtete der Schließer sich an Amy, während er hinter ihr den Raum betrat und die Tür verriegelte. Er blieb in Reichweite stehen.
Amy wirkte nicht mehr so ungepflegt wie beim letzten Mal, als Andrea sie gesehen hatte. Sie hatte eine ziemlich undefinierbare Haarfarbe, nun da ihre Blondierung weit herausgewachsen war. Aschblond war wohl die zutreffendste Beschreibung. Allerdings war sie immer noch genauso dürr wie ein halbes Jahr zuvor und wirkte bei jeder Bewegung unsicher. Sie war ein wandelnder Widerspruch.
Nachdem sie sich gesetzt hatte, tat Andrea es ihr gleich und nahm auf der anderen Seite des Tisches Platz.
„Und was treibt dich her?“, fragte Amy interessiert.
Andrea wollte ein Spiel mit ihren Namen spielen; erfahren, mit wem sie es gerade zu tun hatte. „Ich wollte mit dir reden, Amy.“
„Mit mir reden? Das hast du damals auch schon versucht. Reden und reden. Ihr Psychofreaks redet den ganzen Tag. Das haben meine Therapeuten auch getan. Brauchst du jetzt eigentlich auch einen?“
Sie war zu aggressiv. Das war weit entfernt von der Amy, die Greg geritzt hatte. Andrea würde wechseln müssen.
„Nein“, beantwortete sie Amys Frage. „Eher einen Schönheitschirurgen.“
„Ach, die Narben sind also noch da, ja?“
Andrea nickte. „Man könnte denken, du seist stolz, Christine.“
Sie merkte nicht, dass Andrea sie anders ansprach. Ihre Aggression blieb, auf Andrea ruhte ein feindseliger, verächtlicher, beinahe hasserfüllter Blick.
„Hältst du das eigentlich aus? Sein Andenken auf deinem Körper? Verewigt in deinem Fleisch?“ Sie sagte das beinahe genüsslich.
„Es macht mir nichts aus, wenn du das meinst“, erwiderte Andrea ruhig.
„Ich soll denken, ich hätte keinen Erfolg gehabt, nicht wahr?“, giftete Amy.
„Den hattest du nicht. Wir leben schließlich noch.“
„Ah, natürlich! Wie geht es denn deinem Mann? Hat er alles überstanden, der vorlaute Gregory?“ Hohn troff aus Amys Stimme.
„Es geht ihm gut“, sagte Andrea. „Ich bin hier, weil ich mit dir über ihn sprechen wollte, Christine.“
Sie reagierte immer noch nicht. Es war nur ihr zweiter Vorname und sicherlich sprach niemand sie sonst damit an, aber vielleicht war das im Augenblick der richtige Name.
„Was willst du wissen? Keine Angst, ich habe ihn schon nicht zu wilden Spielchen gezwungen.“ Sie lachte schrill und lehnte sich entspannt auf ihrem Stuhl zurück. „Er hätte Jon nicht das Wasser gereicht, obwohl er recht ansehnlich ist.“
„Erinnerst du dich noch gut?“, fragte Andrea, ohne auf die Provokationen einzugehen.
„Woran?“
„An die drei Tage, in denen du mit ihm allein warst.“
Selbstgefällig grinsend taxierte sie Andrea. „Na klar. Weißt du, was wir getrieben haben? Hat er es dir erzählt? Oder deine Kollegen?“
Noch immer ließ Andrea alles an sich abprallen. „Das haben sie getan. Ich weiß Bescheid.“
„Hat er dir erzählt, wie er vor Schmerz gebrüllt hat, als ich ihn mit dem Messer bearbeitet habe?“
Allmählich spürte Andrea doch Wut und Abscheu wachsen, aber sie überspielte es weiterhin. „Er hatte deshalb eine Blutvergiftung, wusstest du das?“
Amy schüttelte den Kopf. „Würde aber erklären, warum es ihm so mies ging.“
Jetzt hatte Andrea sie da, wo sie Amy haben wollte. „Und deshalb hast du ihn geritzt.“
Tatsächlich runzelte Amy irritiert die Stirn. „Nein. Was für ein Unsinn! Wer hat dir das erzählt?“
„Die Narben auf seinem Arm.“
„Ich habe ihn nicht geritzt. Wozu?“
„Amy hat es getan.“ Andrea wusste, das war dünnes Eis.
Amy erwiderte ihren Blick, wollte sie schier aufspießen. Reglos saß sie da, die Arme vor der Brust verschränkt, und gab nicht zu erkennen, was sie dachte.
„Du hast die Narben doch auch“, versuchte Andrea es weiter.
Amy starrte immer noch. „Er hätte sehen sollen, wie du verblutest.“
Andrea ging nicht darauf ein. „Zieh mal deine Ärmel hoch.“
„Warum?“
„Mach doch mal.“
Tatsächlich tat Amy es. Zum Vorschein kamen die hellen, nadelfeinen Schnittnarben, die ihre gesamten Unterarme bedeckten. Bewegungslos schaute sie darauf, hielt den Kopf gesenkt, schien alles um sich herum vergessen zu haben.
„Das macht es leichter, nicht wahr?“, fragte Andrea. Jetzt sah Amy wieder auf. Eine Veränderung war in ihren Blick getreten. Sie wirkte nicht mehr aggressiv, sondern ängstlich. Traurig.
„Das ist das Einzige, was hilft“, sagte sie leise.
„Das ist nicht wahr, Amy.“
„Sonst tut es zu weh.“
„Sollte Jon dir die Schmerzen nehmen?“
Sie wirkte irritiert. „Ein Mann?“
„Erinnerst du dich nicht?“
„Männer sind Scheißkerle.“
„Alle?“
„Alle.“
„Christine sieht das nicht so“, wagte Andrea sich weiter vor.
Amys Blick verriet ihre Unsicherheit. Ernst, geradezu niedergeschlagen sah sie Andrea an, zögerte. „Christine ist stark. Sehr stark.“
Unwillkürlich ballte Andrea die Hände zu Fäusten und versuchte angestrengt, sich ihre Aufregung nicht anmerken zu lassen. Amy hatte sich über ihre andere Persönlichkeit geäußert. Das war selten, aber nicht unmöglich.
„Seit wann ist sie da?“, fragte Andrea und beugte sich vor.
Desinteressiert zuckte Amy mit den Schultern. „Eine Weile.“
„Habt ihr Kontakt?“
Amy schüttelte den Kopf. „Fast nie.“
„Erinnerst du dich, wie du Gregory geritzt hast?“
Diesmal nickte sie. „Ja. Er sah furchtbar krank aus. Sagte, er habe Schmerzen. Ich wollte ihm helfen.“ Sie sah Andrea beinahe an, als wolle sie um Verzeihung bitten. „Eigentlich wollte ich ihm das auch sagen. Ich wollte ihm immer sagen, dass ich nicht dafür kann.“
Andrea klammerte sich an den Stuhl. „Christine war schuld.“
„Christine ist so stark ...“ murmelte Amy andächtig.
„Sie hat Menschen getötet“, erinnerte Andrea sie.
Amy nickte bloß. Sie hatte die Schultern sinken lassen, zog die Ärmel wieder herunter und versteckte die Hände darin.
„Jon muss ihr sehr fehlen“, sagte Andrea provokant.
„Was daran liegen könnte, dass dein toller Mann ihn erschossen hat!“, zischte Amy in einem völlig anderen Tonfall. Ihr Verhalten war blitzartig umgeschlagen, ihr Blick hatte sich wieder verdüstert.
„Greg hat ihn erschossen, weil er mich umbringen wollte”, sagte Andrea.
„Ja, aber du lebst du immer noch, verdammt noch mal!“ Amy sprang auf und schlug mit den Händen auf den Tisch. „Du hättest elendig verrecken sollen, du verfluchtes Miststück! Weißt du, was ich mit dir gemacht hätte, wenn Jon mich damals dazu geholt hätte? Ja? Willst du es wissen?“
Der Wärter hatte noch nichts gesagt, aber als Amy um den Tisch herum lief und auf Andrea losgehen wollte, fasste er sie von hinten an den Oberarmen und hielt sie eisern fest. Trotzdem war Andrea aufgestanden und zurückgewichen. Die Härchen in ihrem Nacken hatten sich aufgestellt.
„Ich weiß genau, was weh tut!“, schrie Amy. Losreißen wollte sie sich nicht, obwohl sie sich unruhig gebärdete.