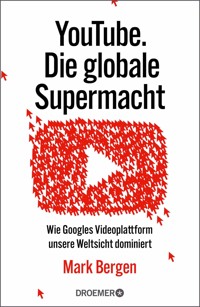
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Like. Comment. Subscribe. YouTube bestimmt, was wir sehen. Mark Bergen deckt auf, was hinter den Kulissen des Tech-Giganten aus dem Silicon Valley abläuft. NOMINIERT FÜR DEN DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSBUCHPREIS 2023 »Eine Erkenntnis des Buches ist, dass man die wirtschaftliche Macht von YouTube nicht von seiner emotionalen und psychologischen trennen kann - Voyeurismus war die treibende Kraft dahinter…Solange die Plattform der Ort ist, an dem jeder im Internet seine Hausaufgaben macht und seine Klempnerarbeit erledigt, wird YouTube weiterhin eine der unverzichtbaren Seiten im Internet sein.« The New Yorker - Wie YouTube das Weltbild formt: ein exklusiver Investigativ-Bericht - Der Aufstieg der Video-Plattform zur globalen Supermacht - Die Macht des YouTube-Algorithmus über den Alltag seiner Nutzer*innen YouTube ist weit mehr als eine Video-Plattform: Mit mehr als zwei Milliarden User*innen und 500 Stunden Video-Uploads pro Minute ist die Google-Tochter die mächtigste Bildmaschine aller Zeiten. Der YouTube-Algorithmus entscheidet, wie wir die Welt sehen. Der Tech-Insider und renommierte Journalist Mark Bergen schreibt nun das definitive Buch über diesen global einflussreichsten Kultur-Produzenten. Packend und scharfsichtig erzählt er vom Aufstieg einer kleinen, hochinnovativen Plattform, die später mitverantwortlich sein wird für Googles Billionen-Monopol. Seine explosive Geschichte über Korruption, Gier und Profit im Silicon Valley zeigt, wie mit YouTube ein digitaler Macht-Apparat entstanden ist, in dem sich die Frage nach der Moral erst stellt, wenn die Bilanzsumme stimmt. Seit mehreren Jahren bereits berichtet Mark Bergen über die Geschäfts-Praktiken von Google und YouTube, unter anderem für Bloomberg, die New York Times, das Wall Street Journal und den New Yorker. Basierend auf jahrelangen Recherchen zeigt sein Buch nun erstmals, wie es YouTube vom kleinen Start-up hin zu einem der wichtigsten Player auf dem weltweiten Medienmarkt geschafft hat – mit einem skrupellosen Geschäfts-Modell und Algorithmen, die ethische Fragen ausklammern, solange das Wachstum gesichert ist. Wer verstehen will, wie die digitale Öffentlichkeit heute funktioniert, muss dieses Buch lesen. »Noch vor Kurzem glaubte praktisch niemand an das Geschäftsmodell oder die sozialen Auswirkungen von YouTube. Niemand kümmerte sich um seine Parolen. Inzwischen war YouTube, getrieben von blinder Technologiegläubigkeit, so schnell und in so viele Richtungen gewachsen – und versuchte dann verzweifelt, die eigene Schöpfung zu bändigen.«Mark Bergen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mark Bergen
YouTube.Die globale Supermacht
Wie Googles Videoplattform unsere Weltsicht dominiert
Aus dem Englischen von Cornelius Hartz, Alexandra Jordan, Hella Reese und Judith Wenk
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
YouTube ist weit mehr als eine Website: Mit mehr als zwei Milliarden Usern ist die Videoplattform die mächtigste Bildmaschine aller Zeiten. Der Tech-Insider und renommierte Journalist Mark Bergen schildert präzise und hoch spannend den Aufstieg eines innovativen Start-ups, das später mitverantwortlich sein wird für Googles Billionen-Monopol. Seine explosive Geschichte über Korruption und Gier im Silicon Valley legt offen, wie mit YouTube ein digitaler Machtapparat entstanden ist, in dem sich die Frage nach der Moral erst stellt, wenn die Bilanzsumme stimmt.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog: 15. März 2019
TEIL I
Leute wie du und ich
Krude und willkürlich
Zwei Könige
Die Sturmtruppen
Clown & Co.
Die Bardin von Google
Mit Vollgas voraus
TEIL II
Die Diamantenfabrik
Nerdfighters
Kitesurfing TV
YouTube wird erwachsen
Wird das Boot dadurch schneller?
Let’s Play
Disney Baby Pop-up Pals Ü-Ei Ostereier Kinderüberraschung
Die fünf Familien
Lehn dich einfach zurück
Die Mutter von Google
TEIL III
Down the ’Tube
True Fake News
Unglaublich
Ein Junge und sein Spielzeug
Scheinwerferlicht
Lächerlich, gefährlich, selbstverständlich
Die Party ist vorbei
Boykott
Verstärkung
Elsagate
Schlechte Akteure
901 Cherry Avenue
Bringt den Ozean zum Kochen!
Die Werkzeuge des Meisters
TEIL IV
Roomba
Kompromisse
Epilog
Danksagung
Anmerkung zu den Quellen
Für Annie, meine Liebe
So viel bis jetzt auch geschehen sein mag – hörte ich die Seele Frankensteins rufen – viel, viel mehr will ich noch vollenden. Als Pionier will ich neue, unbekannte Kräfte entdecken und vor der Welt die tiefsten Geheimnisse der Schöpfung ausbreiten.
Mary Shelley, Frankenstein, 1818
Es sollte ein Scherz sein. Das sollte alles bloß ein Scherz sein. Warum ist es so real geworden?
Logan Paul, »We found a dead body in the Japanese suicide forest«, YouTube, 2017
Prolog
15. März 2019
Haji-Daoud Nabi, ein Großvater mit weißem Vollbart, der für jeden ein freundliches Lächeln übrig hatte, traf den Mann, der ihn töten würde, an einem sonnigen Freitagnachmittag im neuseeländischen Christchurch. Nabi stand am Eingang der Moschee. Als sich der junge Mann ihm näherte, nahm Nabi an, er käme ebenfalls zum Freitagsgebet, und begrüßte ihn herzlich: »Hallo, Bruder!«
Vor seiner Ankunft hatte der junge Mann eine E-Mail herumgeschickt. Die Betreffzeile lautete: »Über den Anschlag in Neuseeland heute«. Die Mail begann mit einem Geständnis – »Ich war der Mann, der den Anschlag begangen hat« – und enthielt ein ausführliches Manifest. Sie war an diverse Zeitungsredakteure und TV-Produzenten gegangen, jene Leute, die vor noch gar nicht allzu langer Zeit kontrolliert hatten, welche Meldungen in die Welt hinausgesendet wurden. Alle hatten die diffuse E-Mail als Spam oder Spinnerei abgetan.
Dann kamen die Anrufe. Um den Hagley Park in Christchurch herum waren Schüsse zu hören. Vor den zwei Moscheen auf beiden Seiten des grünen Parks lagen leblose, blutüberströmte Körper. Mindestens fünfzig Tote, darunter ein dreijähriges Kind. Und Nabi. Als die Reporterin Kirsty Johnston am Tatort eintraf, fand sie ein Blutbad vor. Verwundete Überlebende, die verzweifelt nach Taxis winkten, um zum Krankenhaus zu fahren. Sie war in einem friedlichen Inselstaat aufgewachsen, in dem die Polizisten keine Waffen trugen. Gewalttaten und Amokläufe – das kannte man höchstens aus den Nachrichten. So etwas geschah im Ausland. Aber doch nicht hier!
Doch Neuseeland hatte sich verändert, und so auch die Nachrichten. Bald erfuhr man, dass der Terrorist, der das Blutbad angerichtet hatte, ein 28-jähriger Weißer war, der sich eine Bodycam umgeschnallt und seine grausame Tat 17 Minuten lang live im Internet übertragen hatte. Die erwähnten Zeitungsredakteure und TV-Produzenten durchforsteten sein Filmmaterial und sein Manifest nach Hinweisen auf den schlimmsten Massenmord, den das Land je erlebt hatte. Sie wühlten sich durch obskure Anspielungen auf die Politik in Serbien, auf die Kriegsführung im 16. Jahrhundert und auf diverse Internet-Subkulturen. Kaum etwas ergab Sinn. Nur eine Stelle verstand man sofort – den Namen eines YouTube-Stars. »Denkt dran, lads«, hatte der Terrorist, kurz bevor er geschossen hatte, in das Mikrofon seiner Kamera gesagt, »abonniert PewDiePie!«
Die Tage vor der Bluttat verbrachten einige Mitarbeiter von YouTube auf der anderen Seite des Erdballs in einem riesigen, warmen Hotelpool. Sie waren wie immer mit Shuttlebussen angereist. Die Busse waren nach Norden gefahren, durch San Francisco und Berkeley, durch schicke Vororte und Städte und durch bewaldete Naturschutzgebiete mit hoch aufragenden Mammutbäumen, bis sie schließlich im Herzen des kalifornischen Weinanbaugebietes angekommen waren, am Indian Springs, einem malerischen Hotel an einer natürlichen heißen Quelle in Calistoga. Der erste Siedler hier war im Jahr 1859 Kaliforniens erster Millionär gewesen. Ein Mann, der reich geworden war, weil er bei allen Zeitgenossen, die es hatten hören wollen, Werbung für den Goldrausch gemacht hatte.
In einem der Bungalows der Hotelanlage packte die Managerin Claire Stapleton ihre Koffer aus. Seit sie bei YouTube war, hatte sie schon viele, viele Male an solchen Betriebsausflügen teilgenommen. Dieses Mal waren nur die Kollegen aus der Marketingabteilung dabei, die sich um das öffentliche Image kümmerten, um die Marke YouTube. Sie sollte zum letzten Mal mit von der Partie sein. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, aber sie ahnte es bereits.
Stapleton war blass und hatte dunkelbraunes, beinahe schwarzes Haar. Normalerweise hatte sie eine betont unbekümmerte Ausstrahlung, aber sie konnte auch streng wirken, wie vier Monate vorher auf einem Foto in der New York Times, für das sie als Gesicht eines Streiks im Silicon Valley in einem schwarzen Rollkragenpullover abgelichtet worden war.1 Im Resort schlenderte Stapleton an einem Springbrunnen vorbei, passierte einen Garten, in dem Spalierobst angebaut wurde, und einen Meditationskreis, bis sie die kleinen Konferenzräume erreichte, die die Namen River und Reflection trugen.
Firmen zahlten hier für ihre Angestellten rund 350 Dollar pro Übernachtung. Kein Problem für YouTube, das im Vorjahr über elf Milliarden Dollar Umsatz gemacht hatte. Aber diese Gäste hier waren unter dem Namen eines anderen Unternehmens angemeldet: Google, seit 2006 Eigentümer und Mutterkonzern von YouTube. Google hatte im Jahr 2018 über 136 Milliarden Dollar umgesetzt. Inzwischen gab sich der Technologie-Gigant jedoch alle Mühe, mit seinem Reichtum ein wenig diskreter umzugehen. Eine neue CFO war von der Wall Street herübergewechselt und hatte dem Unternehmen eine strenge Haushaltsdisziplin verordnet. Zwei Jahre nach Donald Trumps Amtsantritt standen die großen Player im Silicon Valley, die es gewohnt waren, als Innovatoren und Underdogs gefeiert zu werden, plötzlich im Ruf, gierig, verantwortungslos und allzu mächtig zu sein. Zum Establishment zu gehören. Sogar einige Mitarbeiter von Google sahen das mittlerweile so.
Um sich aus der Schusslinie zu nehmen, veranstaltete Google nun nicht mehr ganz so viele Firmen-Retreats in Luxusresorts. Indian Springs besaß genau das richtige Maß an Understatement. Von außen wirkte die Anlage mitihren gedrungenen, zweistöckigen Bungalows im Missionsstil fast wie ein einfaches Motel aus den Fünfzigern. Doch im Inneren verfügte es über einen subtilen Hauch von Luxus: Bio-Shampoo, Be-Well-Wasserfilterstationen und künstliche Kamine. Wie durch ein Wunder war es dem Resort gelungen, das sanfte, beruhigende Wasser der heißen Quellen in einen Swimmingpool mit Fünfzig-Meter-Bahn zu leiten.
Stapleton und ihre Kollegen waren angehalten, sich zu amüsieren. Sie hatten ein paar ziemlich stressige Jahre hinter sich. Jeder wusste, dass Google besonders zufriedene Mitarbeiter hatte. Doch kürzlich hatte »Googlegeist«, die regelmäßige interne Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit, recht beunruhigende Ergebnisse geliefert – das Vertrauen in die Führungskompetenz und die Prioritäten des Unternehmens war gesunken, und nahezu die Hälfte der Angestellten hielten ihr Gehalt für »nicht angemessen«.2 In jenem Herbst war Stapleton Rädelsführerin eines Streiks gewesen, mit dem Tausende Mitarbeiter gegen Googles Umgang mit Vorwürfen zu sexueller Belästigung protestiert hatten. Google verfügte über ein bewährtes Alarmsystem für sein riesiges Computernetzwerk. »Code Yellow« bedeutete, dass Softwareentwickler Überstunden machen mussten, um einen Fehler oder Bug zu beheben. »Code Orange« signalisierte die Vorstufe zu einem Notfall. »Code Red« wurde aktiviert, wenn die Google-Suche oder Gmail nicht mehr funktionierte. »Code Red« hieß: Sofort handeln! Irgendwann hatte das Unternehmen dieses Alarmsystem auf nicht technische Belange wie die Mitarbeiterzufriedenheit ausgeweitet.
Das aktuelle YouTube-Retreat in Indian Springs trug die inoffizielle Bezeichnung »Wohlbefinden: Code Red«.3
Stapleton und ihr Marketingteam nahmen in der Stadt an Weinverkostungen teil und absolvierten Kurse im Pizzabacken. Sie flanierten durch den penibel gepflegten Agavengarten des Resorts und schlenderten am Buddha-Teich vorbei. Sie rösteten Marshmallows über einer Feuerstelle. Sie ließen es sich gut gehen. Und sie tranken. In einer altmodischen Eisdiele namens »The Chaise Lounge« erstanden die YouTube-Mitarbeiter Leckereien, die sie sich in den Liegestühlen unter der blau-weiß gestreiften Retro-Markise schmecken ließen. Am Eingang zum Pool wehte über einer altmodischen Uhr mit Pepsi-Cola-Schriftzug eine große US-amerikanische Flagge. Das Indian Springs nannte diesen Stil »Old Hollywood«, und es mutete wie eine Ironie des Schicksals an, dass ausgerechnet die Gäste von YouTube diese Details bewunderten, obwohl YouTube wie kaum ein anderes Unternehmen das »Alte« an Hollywood – die Studios, die Agenten, die Filmstars, die Unterhaltung, für die man bezahlte – nahm und in die Luft jagte.
Nachdem sich Stapleton und ihre Kollegen in den Konferenzräumen River und Reflection eingefunden hatten, schauten sie sich pflichtgemäß ein YouTube-Video an, das sie alle schon kannten. Jemand rief die Website mit dem Video auf und klickte auf das allseits bekannte dreieckige Play-Symbol.
YouTube: »Our Brand Mission«, 22. Juni 2017,1:48.4
Das Video beginnt mit einem niedlichen kleinen Jungen in seinem Kinderzimmer, der auf einer viel zu großen E-Gitarre spielt. Dann sieht man ein anderes Kind, irgendwo in Asien, das Schafe hütet; dann weint eine Frau; ein Mann macht einen Skateboardtrick. »Sieh dir diese Momente an«, sagt eine weibliche Stimme aus dem Off. »All diese Geschichten, Geheimnisse, Enthüllungen aus den verschiedensten Ecken der Welt.« Es handelt sich um eine Montage aus inspirierenden YouTube-Clips. Babys, Sportler, nette Gesten, eine Frau mit einem Hijab, ein Gruppentanz, eine Gruppenumarmung, noch mehr Menschen, die weinen. »Dies ist das ehrlichste und authentischste Porträt von uns als Menschen«, sagt die Erzählerin. »Das kommt heraus, wenn man jedem eine Stimme gibt, eine Chance, gehört zu werden, eine Bühne, um gesehen zu werden.«
Das Video endete mit einem wohlbekannten Spruch, der Markenmission: »Gib allen eine Stimme und zeige ihnen die Welt.« »Einfach nur skurril«, dachte Stapleton. Die Welt hatte sich so sehr verändert, seit ihr Team dieses Motivationsvideo 2017 erstmals zusammengeschnitten hatte. YouTube hatte sich so sehr verändert. Seither hatten sie unzählige Diskussionen darüber geführt, wie man die »Markenmission« überarbeiten könne. Und trotzdem zeigten sie immer noch ein ums andere Mal dasselbe alte Video, um die Leute zu motivieren. Aber diese Gedanken behielt sie für sich.
Obwohl YouTube.com schon seit 14 Jahren existierte, war es doch nach wie vor ein Wunderwerk der modernen Welt. Binnen weniger als zwei Jahrzehnten hatte sich das blitzschnelle On-Demand-Internetfernsehen von einer schieren Unmöglichkeit zu einer simplen Tatsache entwickelt. YouTube war nun der Ort, wo man sich online kostenlose Videos anschaute. »Das Video-Baugerüst des Internets«, nannte es ein Mitarbeiter. Über zwei Milliarden Menschen besuchten YouTube jeden Monat. Es war die am zweithäufigsten aufgerufene Website der Welt (nach Google) und die zweitbeliebteste Suchmaschine der Welt (nach Google). 1,7 Milliarden Menschen gingen Mitte 2019 täglich auf YouTubes Website – das war mehr als ein Drittel aller Internetnutzer weltweit.5 Ein Besuch auf YouTube bot ihnen Unterhaltung und Informationen und spendete Trost. Umfragen zeigten, dass ein Viertel der Amerikaner ihre Nachrichten über YouTube bezogen. YouTube hatte mehr regelmäßige Besucher als Facebook, Instagram und jede andere Social-Media-Plattform. Eine ganze Generation von Kindern schaute kein Fernsehen mehr, sondern nur noch YouTube. In vielen Ländern war YouTube das Fernsehen. Regenbogenpresse und Gebrauchsanweisungen bekamen auf YouTube einen neuen Anstrich. Manche besonders progressive Köpfe im Silicon Valley malten sich sogar aus, dass YouTube bald Professoren und Ärztinnen ersetzen würde.
Und im Gegensatz zu praktisch jeder anderen der breiten Masse zugänglichen Website konnte man mit YouTube Geld verdienen. Dieses Novum hatte eine neue Kreativbranche hervorgebracht, einen ganzen Stall voller Entertainer, Persönlichkeiten, Künstlerinnen, Influencer, Dozentinnen und Franchises. In nur wenigen Jahren war so ein neues Medium entstanden, das nicht weniger revolutionär war als seinerzeit Radio und Fernsehen. Dank YouTube konnte nun jeder auf Sendung gehen. YouTube hat uns den »Gangnam Style« geschenkt, »Charlie bit my finger!«, den »Baby Shark Dance«, BibisBeautyPalace, Yoga with Adriene, professionelle Minecraft-Spieler, Julien Bam und Gronkh – ein ganzes Heer von Menschen mit unterschiedlichsten Talenten, die von den alten Medienunternehmen ignoriert oder übersehen wurden. Tausende kleiner Stars, die Sie vielleicht gar nicht kennen, Millionen junger Fans aber schon, und sie schauen sich deren Clips mit einer Begeisterung an, die sie für Film- oder Fernsehstars kaum noch aufbringen.
YouTubes Gründung fiel in dieselbe Zeit wie eine ganze Reihe weiterer schriller, neuer aufstrebender Internetunternehmungen und hat diese fast alle überlebt – außer Facebook. Doch anders als Facebook, das sich seinen Status bei jungen Leuten immer wieder erkämpft, hat sich YouTube diese Mühe nie machen müssen. Jahr für Jahr zieht es ein immer jüngeres Publikum an. Kein Unternehmen hat mehr zur Entstehung der Aufmerksamkeitsökonomie, die uns heute im Internet umgibt, beigetragen. YouTube bezahlte die Leute schon für ihre Videos, als Facebook noch ein Forum für Liebeleien im Studentenwohnheim war und nur Technikfreaks Twitter kannten. Ein ganzes Jahrzehnt bevor es TikTok gab. All diese Unternehmen machten sich Googles Philosophie (je mehr Informationen online sind, desto besser) zu eigen – und Googles Geschäftsmodell: Bringe so viele Leute wie nur möglich dazu, deinen kostenlosen Dienst zu nutzen, und durchforste ihre Klicks, Gewohnheiten und Daten, um mit Werbeanzeigen Geld zu verdienen. Influencerinnen, präpubertäre Millionäre, Falschmeldungen, Internetsucht und Hochstapelei – Google und YouTube machten viele der hässlichen Seiten der sozialen Medien überhaupt erst möglich. »Google hat das Rad erfunden«, sagte ein altgedienter Mitarbeiter von Google und Facebook. »Und Facebook und all die anderen Online-Unternehmen haben es nachgemacht.«
YouTube war immer da, wenn man es brauchte, und es war so riesig wie ein Ozean. Kurz vor dem Retreat im Indian Springs Hotel veröffentlichte das Unternehmen eine schier unglaubliche Zahl: Pro Minute wurden 450 Stunden Videomaterial auf die Plattform hochgeladen. Stellen Sie sich den längsten Film vor, den Sie je gesehen haben. Einen Teil von Der Herr der Ringe vielleicht. Nun stellen Sie sich vor, dass Sie ihn sich einhundertmal hintereinander ansehen – dann haben Sie immer noch nicht so viel geschaut, wie alle sechzig Sekunden auf YouTube veröffentlicht wird. Seit 2016 schauen sich die Nutzer dort täglich Videomaterial in der Länge von über einer Milliarde Stunden an. Man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen. Suchen Sie ein Video zu einem komplett abseitigen Thema? Sie werden mit Sicherheit fündig. Tipp, tipp, klick. Liken, kommentieren, abonnieren. Milliarden Menschen tun tagtäglich genau das, ohne groß zu wissen, wie ausgerechnet das Video, das sie sich gerade anschauen, dort gelandet ist.
Jeder kennt YouTube. Doch nur wenige wissen, wie es funktioniert – wer es betreibt, welche Entscheidungen die Betreibenden treffen und was diese Entscheidungen bedeuten. Dieses Buch wurde mit der Absicht geschrieben, Licht ins Dunkel zu bringen. Es erzählt die Geschichte einer Geschäftsidee, die sich von einem veritablen Millionengrab zu einem wirtschaftlichen Hit entwickelt hat, einem der Grundpfeiler des Internets, der Google dazu verhalf, eines der mächtigsten und profitabelsten Unternehmen weltweit zu werden. Es erzählt die Geschichte einer neuen Art Massenmedium, dessen Programmausrichtung nicht von Redaktionen, Künstlerinnen oder pädagogischem Personal bestimmt wird, sondern von Algorithmen. Und es erzählt auch die Geschichte von einigen sehr bedeutsamen und seltsamen aktuellen Ereignissen, von denen die meisten Leute, die YouTube.com besuchen, noch nie gehört haben.
Die meisten Leute nutzten YouTube als mehr oder weniger nützliche Informationsquelle oder zum harmlosen Zeitvertreib.
Doch YouTube war viel mehr als das. Das Marketingteam von YouTube nahm längst eine ganz andere, ziemlich besorgniserregende Seite des Ganzen wahr. Und als sie jetzt im Resort in den Konferenzräumen River und Reflection saßen und sich ihre eigenen Marketingvideos anschauten, diese ach so berührenden und warmherzigen Marketingvideos, konnten sie nicht umhin, daran zu denken, wie weit weg das alles vom »Albtraum-Futter« war.
»Albtraum-Futter« – diesen düsteren Spitznamen hatten einige im Team der täglichen E-Mail verpasst, mit der sie über die Presseberichterstattung und die Online-Kommentare über YouTube informiert wurden, aber ebenso über die Schmuddelecken der Website mit all den Absonderlichkeiten und Schrecken, die man dort finden konnte. Eingebürgert hatte sich der Begriff »Albtraum-Futter« im Jahr zuvor, als ein YouTube-Star ein Video veröffentlicht hatte, auf dem ein Toter zu sehen gewesen war, der in einem japanischen Wald an einem Baum hing. Da das Marketingteam sämtliche offiziellen Online-Konten von YouTube verwaltete und darüber befand, welche Videos und Kanäle dort beworben wurden, musste es von solchen Vorfällen sofort in Kenntnis gesetzt werden, um eine öffentliche Kontroverse abzuwenden. Als zum Beispiel plötzlich zahllose Teenager Videos hochluden, auf denen sie in Waschmittelkapseln hineinbissen, lautete die Anweisung: Keine Videos über Waschmittel mehr promoten! Oder als ein 13-jähriges Mädchen für ihre ASMR-Videos unangenehm anzügliche Kommentare erhielt: Möglichst nichts mehr mit ASMR promoten und vielleicht auch nichts mehr mit Mädchen im Teenager-Alter! Oder als eine Nachrichtenseite berichtete, auf YouTube gebe es Videos, die Menschen beim Sex mit Pferden zeigten: Keinen Pferdecontent mehr promoten! Jeden Morgen fanden sie in ihren E-Mails Unmengen solcher Videos und Hinweise auf fragwürdige Berichterstattung. Stapleton fürchtete, die schiere Masse an schlechten Nachrichten könne ihr Team dazu veranlassen, zu glauben, dass YouTube vor allem das Böse im Menschen widerspiegelte.
Der Ausflug war eine willkommene Ablenkung davon. Bis auf eine Sache, über die man während des Retreats diskutierte: Ihrem Team wurde mitgeteilt, dass ein langes Moratorium beendet werden würde und mithilfe von YouTubes offiziellen Social-Media-Konten wieder PewDiePie promotet werden sollte. Dieser Erlass, so erfuhren die Marketingmitarbeiter vor Ort, kam von ganz oben, »von Susan«. Gemeint war Susan Wojcicki, Googles erste Marketingmanagerin und seit 2014CEO von YouTube.
Alle, die an dem Retreat teilnahmen, kannten die Geschichte von PewDiePie.
Bürgerlicher Name: Felix Kjellberg, ein Schwede, noch keine dreißig, der seine Videos gern damit begann, dass er mit einer Falsettstimme sein Online-Pseudonym kreischte: Pjuuu-di-peiiii! Er war YouTubes größter Star, gemessen an einer Maßzahl, die sie eigens für die Plattform entwickelt hatten: »Abonnenten«. Die Zuschauer konnten auf eine kleine rote Schaltfläche klicken und so Videomacher »abonnieren« (so, wie sie eine Zeitschrift oder einen Streamingdienst abonnieren würden, nur kostenlos). Als YouTube diese Funktion einführte, hätte man nie gedacht, dass – wenn überhaupt – mehr als nur ein paar Millionen Zuschauer irgendein Konto abonnieren würden. Bis März 2019 hatten knapp einhundert Millionen Menschen PewDiePie abonniert, das glich den Instagram-Followerzahlen von Promis wie Miley Cyrus und Katy Perry. Kjellbergs Debüt als PewDiePie war inzwischen neun Jahre her – in YouTube-Jahren waren das ganze Äonen. Er hatte sich selbst beim Zocken aufgenommen und seine Filmchen, wie jeder andere, nach eigenem Ermessen direkt in den großen Videoteppich eingewoben. Im Laufe der Zeit hatte er sich eine treu ergebene Fangemeinde aufgebaut.
Gemeinsam verdienten Kjellberg und Google einen Haufen Geld. Google wusste das. Google zählte alles – es hatte sich selbst nach einer Zahl benannt, einer unglaublich großen Zahl (Googol), und bestand selbst aus nichts als den Nullen und Einsen der Computersprache. Google zählte jede Minute des Filmmaterials, das auf YouTube abgerufen wurde. Internen Aufzeichnungen zufolge hatte die Menschheit seit 2012, also über einen Zeitraum von sieben Jahren, 130.322.387.624 Minuten lang die Videos von PewDiePie konsumiert. Im selben Zeitraum hatte Kjellberg 38.814.561,79 Dollar verdient. Der Löwenanteil (95 Prozent) kam von Werbespots, die YouTube Videos vorschaltete und in Videos einfügte. Von jedem Dollar, den ein Werbetreibender ausgab, um einen Werbeplatz zu buchen, leitete YouTube dem YouTuber 55 Cent weiter und behielt die restlichen 45 Cent – als Gebühr für das Hosten des Filmmaterials und die enorme Maschinerie, die den Betrieb der Website sicherte. Mit den Videos von PewDiePie hatte YouTube in dieser Zeit also ungefähr 32 Millionen Dollar umgesetzt. Angesichts der Größe seines Publikums und der Gehälter, die Filmstars verlangten, konnte man trotz allem den Eindruck haben, dass Kjellberg unterbezahlt war.
Und dennoch machte ihnen der Schwede immer wieder Sorgen. Alle im Marketingteam erinnerten sich daran, wie das Wall Street Journal2017 einen Bericht mit einem Standbild von YouTube brachte, auf dem PewDiePie neben einem Schild mit der Aufschrift »Tod allen Juden« zu sehen war. Wie Google im Zuge des Chaos, das daraus erwuchs, und der Diskussionen über Missverständnisse, schlechte Witze, Neonazis und aus dem Kontext gerissene Standbilder einen großen kommerziellen Deal mit Kjellberg aufkündigte. Wie Kjellberg sieben Monate später ganz beiläufig in einem Videospiel-Stream das N-Wort fallen ließ, wofür er anschließend um Entschuldigung bat, seine Zuschauer dann aber gleich noch auf einen anderen YouTuber aufmerksam machte, der antisemitische Propaganda vom Stapel ließ. Wie Kritiker ihn als »gefährlich« bezeichneten und ihm vorwarfen, »mit den Rechten zu flirten«. Wie eine Schlagzeile über ihn lautete: »Wann ist Faschismus eigentlich cool geworden?« Wie er mit Donald Trump verglichen wurde.
Zugleich war dem Marketingteam aber auch klar, dass all das seine Fans, seine »Bro Army«, die »Armee der guten Kumpel«, wie er sie nannte, letztlich nur noch stärker zusammenschweißte. Als es in jenem Herbst so aussah, als würde ein YouTube-Kanal mit Bollywood-Songs PewDiePie hinsichtlich seiner Abonnentenzahl den Rang ablaufen, hatte sich seine Armee einen Schlachtruf ausgedacht, um ihren König gegen Kritiker zu verteidigen und ihn davor zu bewahren, vom Thron gestoßen zu werden: Abonniert PewDiePie!
Überall im Internet war dieser Aufruf zu sehen. Er war auf Schildern beim Super Bowl in Atlanta aufgetaucht, während eines Basketballspiels in Litauen und im Twitterfeed einer britischen Partei. Eine Truppe bunter Gestalten hatte den Schlachtruf verbreitet: MrBeast, HackerGiraffe, Goose Wayne Batman, Elon Musk. Es war ein Anti-Establishment-Mantra, ein Stinkefinger in Richtung der Internet-Konzernchefs, ein kulturelles Phänomen. Ein Meme. Dieser Schlachtruf hatte Formen angenommen, die das Unternehmen nie hatte kommen sehen, und das galt auch für YouTube.com.
Seit der Sache mit dem antisemitischen Slogan hatte YouTube seinen größten Star auf Distanz gehalten, hatte ihn weder öffentlich unterstützt noch Werbeaktionen gestartet, wie bei anderen YouTubern üblich. Doch jetzt hatte das Unternehmen einen Kurswechsel beschlossen. Das Marketingteam diskutierte diese Entscheidung während des Retreats. Und am Donnerstag, dem 14. März, erhielt das Team von Stapletons Chefin, Marion Dickson, eine E-Mail, in der sie schrieb, dass man PewDiePie nun »reaktivieren« werde. »Ich möchte sicherstellen, dass wir für uns ein paar Regeln festlegen, wie wir dabei vorgehen wollen, um für mögliche Gegenreaktionen gewappnet zu sein«, schrieb Dickson und wies darauf hin, wie wichtig es sei, »dabei klar herauszuarbeiten, wie wir diesen Schritt mit unseren Markenwerten und unserer Botschaft in Einklang bringen können«.
Kurz darauf stiegen die Teammitglieder in die Busse ein, die auf dem Parkplatz der Hotelanlage warteten, fuhren an den Palmen und den Mammutbäumen vorbei, verließen das Weinanbaugebiet und kehrten nach Hause zurück. Sie brüteten über angemessene Richtlinien, über die Prinzipien und Markenwerte ihrer Firma. An jenem Abend war es in Neuseeland bereits Freitag. Auf den Handys von Stapleton und ihren Kollegen leuchteten Push-Mitteilungen von Nachrichtenseiten auf, zahllose E-Mails trudelten ein. Es hatte einen Terroranschlag mit vielen Toten gegeben, und der Täter hatte die Bluttat online live übertragen. Es war, als sähe man den Mitschnitt eines Egoshooters. Mit Kindern als Zielobjekten. Als Erstes tauchte das Video auf Facebook Live auf, YouTubes Konkurrenz, dann auch bald auf YouTube, wo immer wieder Kopien des Videos hochgeladen wurden, obwohl das Unternehmen sich hastig darum bemühte, das Video zu entfernen. Der PewDiePie-Schlachtruf des Täters war einer der wenigen Hinweise darauf, was er mit der Tat bezweckte.
Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte niemand YouTube wirklich ernst genommen. Niemand hatte sich darum geschert, ob dort irgendjemand irgendwelche Schlachtrufe absonderte. In den vergangenen Jahren hatte YouTube sein Geschäftsmodell ganz zielstrebig und massiv ausgebaut. Voll blindem Vertrauen in die zugrunde liegenden Technologien hatte YouTube unwissentlich eine Maschinerie erschaffen, die die abscheulichsten menschlichen Abgründe offenlegte. Manch einer außerhalb des Unternehmens dachte, genau diese Abgründe seien der Grund für YouTubes geschäftlichen Erfolg. Erst im Jahr 2019 begann die Welt sich so richtig mit der Wirkung der sozialen Medien auseinanderzusetzen, nämlich mit der Tatsache, dass ein paar IT-Unternehmen aus Kalifornien plötzlich zu großen Teilen bestimmten, welche Wege Meinungsäußerungen und Informationen nahmen. Soweit es vermeidbar war, hielt sich YouTube aus dieser Auseinandersetzung heraus. Und doch hatte das Unternehmen im Verlauf der Zeit auf vielfältige Weise den Weg für die modernen sozialen Medien bereitet, indem es mit seinen Entscheidungen Einfluss darauf nahm, wie das Zusammenspiel von Aufmerksamkeit, Geld, Ideologien und allem anderen im Netz funktionierte.
Als Stapleton und ihr Team an jenem Donnerstag im März das Retreat verließen, hatte das Unternehmen zwei höllische Jahre voller hitziger Auseinandersetzungen hinter sich. Zwei Jahre mit widerspenstigen Stars, Spinnern, Verschwörungstheorien, Vorwürfen von Kindesmissbrauch und einer existenzbedrohenden Krise. Man wollte all das nur allzu gern hinter sich lassen. Die öffentliche Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit PewDiePie fühlte sich wie ein erster Schritt in diese Richtung an. Und genau dann ereignete sich der Amoklauf in Christchurch. Eine Tragödie, die sich auf der Website von YouTube entfaltete und in der, wie es den Anschein hatte, dem größten YouTube-Kanal eine tragende Rolle zukam. Stapleton war beim Gedanken an YouTube und die gesellschaftliche Rolle des Unternehmens schon öfter etwas flau im Magen gewesen. Nun war ihr richtig übel. Während sie noch versuchte, den Schrecken zu verarbeiten, der sich da abspielte, dachte sie an das Marketingvideo, das sie und ihr Team sich erst vor ein paar Stunden wieder einmal angeschaut hatten. War diese grausame Tat das, wie es im Video hieß, »authentischste Porträt von uns als Menschen«?
Niemand im Unternehmen wollte, dass das so war. Andererseits war es längst nicht das erste Mal, dass sich YouTubes Schöpfung in atemberaubendem Tempo in eine Richtung entwickelte, die das Unternehmen nicht mehr kontrollieren konnte.
TEIL I
Kapitel 1
Leute wie du und ich
Chad Hurley wollte irgendetwas kreieren. Etwas Neues schaffen. Er wusste nur noch nicht so recht, was.
Das war Anfang 2005, und Hurley hing den Großteil seiner Zeit in North Carolina vor seinem Rechner. Er entsprach nicht gerade dem Bild des superschlauen Nerds aus dem Silicon Valley. Mit seinem breiten Kreuz, der athletischen Figur, der hohen Stirn und den straßenköterblonden, lässig gestylten Surferlocken war er eher der Typ Highschool-Schwarm. Er mochte Bier und die Philadelphia Eagles und hielt sich selbst für eine Art Künstler. Die Laptoptaschen, die es so gab, fand er hässlich und langweilig. Deswegen hatte er gerade erst zusammen mit einem Freund, der so ähnlich tickte wie er, ein Label für Herrenmode gegründet, bei dem sie Laptoptaschen herausbrachten.
Doch als Web- und Grafikdesigner wusste Hurley sehr wohl, dass mit IT das große Geld zu holen war, nicht mit Taschen. Und genau damit wollten er und seine beiden Entwicklerkumpel, Jawed Karim und Steve Chen, nun ihr Glück versuchen. Mit 28 Jahren war Hurley (mit einem Jahr Abstand) der Älteste der drei und de facto ihr Anführer. Er hatte einen Sohn im Krabbelalter und hatte in den Kreis der Silicon-Valley-Eliten eingeheiratet: Jim Clark, ein weithin bekannter Internetunternehmer, war sein Schwiegervater. Als das Web 2.0 aufkam – Websites, die ganz normale Leute mit ihren Inhalten füllten statt Profis –, hatte Hurley angefangen, von einem eigenen Unternehmen zu träumen. Die Leute stellten alles Mögliche online: Tagebucheinträge, Fotoalben, Gedichte, Rezepte, Schmähschriften. »Leute wie du und ich«, sagte Hurley immer. Monatelang wälzte Hurley mit seinen Freunden Ideen für ein neues Internetunternehmen. Sie trafen sich bei ihm zu Hause in Menlo Park oder in einem der umliegenden Cafés und unterhielten sich darüber, was im Web 2.0 gerade angesagt war, zum Beispiel das soziale Netzwerk Friendster und die Blogs, die wie Unkraut aus dem Boden schossen. Immer wieder kam die Sprache auf Hot or Not, ein Portal, auf dem man ein Foto von seinem Gesicht hochladen und andere Benutzer bewerten lassen konnte, wie attraktiv sie einen fanden. Eine ziemlich rudimentär gehaltene Website, aber dennoch sehr beliebt. Aus einem Café, in das sie häufig gegangen waren, als sie noch in ihren alten Jobs gearbeitet hatten, kannte das Trio einen der Schöpfer von Hot or Not, und sie wussten, dass er mit der Seite gutes Geld verdiente. Das fanden sie cool.
Die drei setzten schließlich auf die Idee für eine Website, wo die Leute Videos hochladen und anschauen können sollten. Am Valentinstag hatten sie sich zusammen mit Hurleys Hund in seine Garage gequetscht, waren viel zu lange aufgeblieben und hatten sich einen Namen für ihre Idee überlegt. Es sollte etwas mit Fernsehen zu tun haben. Hurley brachte einen alten, umgangssprachlichen Begriff aus der Zeit der Bildröhren ins Spiel, »the boob tube«. Daraus machte er »a tube for you«, eine Röhre für dich. Das gaben sie auf Google ein. Keine Treffer. Noch am selben Abend kauften sie die Web-Domain YouTube.com – ein Anfang war gemacht.
Acht Tage später öffnete Hurley eine E-Mail von Karim mit dem Betreff »Strategie: Meinungen bitte«.
Die Seite soll gut aussehen, aber nicht zu professionell. Sie sollte aussehen, als hätten sie ein paar Jungs zusammengeschustert. Immer schön dran denken: hotornot und friendster sind ganz einfach zu bedienen, sehen überhaupt nicht professionell aus und hatten trotzdem enormen Erfolg. Wir dürfen nicht zu professionell wirken, weil das die Leute abschreckt …
Das Wichtigste beim Design ist die Benutzerfreundlichkeit. Auch unsere Mütter sollten die Seite problemlos nutzen können.
Timing/Konkurrenz:
----------
Ich finde, unser Timing ist perfekt. Digitale Videos sind erst letztes Jahr richtig durchgestartet, da man nun mit den meisten Digitalkameras Videos aufnehmen kann.
Ich kenne nur eine Seite, die Videos hostet und wo Zuschauer die Videos bewerten können: stupidvideos.com. Zum Glück hat sich die Seite nicht so richtig durchgesetzt. Wir sollten besprechen, warum das so ist und warum wir glauben, dass unsere Website besser ankommen wird.
Hurley las weiter.
Fokus der Seite:
----------
Unser Fokus sollte implizit auf Dating liegen, genau wie bei hotornot. Denkt dran, hotornot ist ein Datingportal, wirkt aber nicht so. Dadurch sind die Leute entspannt. Ich glaube, einer auf Dating ausgerichteten Videoseite würden die Leute viel mehr Beachtung schenken als stupidvideos. Warum? Weil die meisten Leute, die nicht verheiratet sind, vor allem eines wollen: daten und Frauen kennenlernen. Und wie viele dumme Videos kann man sich schon nacheinander anschauen?
Hurley war zwar verheiratet, aber er musste Karim recht geben: Mit Dating konnte man Nutzer motivieren, Videos aufzunehmen und sich anzuschauen. »Sehen und gesehen werden – das wollen die Leute«, schrieb er einige Wochen später. Karims E-Mail endete mit dem anvisierten Startdatum von YouTube: 15. Mai 2005. Bis dahin blieben kaum drei Monate Zeit.
Sie machten sich gleich an die Arbeit. Hurley bastelte am Look der Website herum, Chen und Karim schrieben den Code, mit dem sie YouTube.com zum Leben erweckten. Dann, am 22. März, gab Yahoo bekannt, dass es Flickr kaufen würde. Yahoo war ein echter Internet-Titan, ein Portal für diverse Online-Aktivitäten mit jährlichen Umsätzen in Milliardenhöhe. Flickr war ein schnittiger Dienst des Web 2.0, über den man digitale Fotos hochladen konnte. Laut Presseberichten sollte Yahoo erstaunliche 25 Millionen Dollar für den Erwerb von Flickr gezahlt haben. Karim schickte eine weitere E-Mail, der Betreff lautete »Neue Richtung«:
Chad und ich haben heute darüber gesprochen, dass unsere Seite eher so einen Fokus wie Flickr haben sollte. Im Grunde ein Online-Depot für eigene Videos aller Art.
Der Flickr-Deal motivierte sie enorm. In den kommenden Wochen verdoppelten Hurley, Chen und Karim ihre Anstrengungen und diskutierten immer wieder darüber, wie die Website funktionieren sollte. Soll es eine Dating-Seite oder eine Foto-Seite werden? In einer E-Mail schrieb Chen, die Zielgruppe von Hot or Not seien »hormongesteuerte College-Kids«, Flickr hingegen wende sich an »Designer, Künstler und Kreative«. Wer würde YouTube nutzen? Oder sollten sie gleich zwei Websites aufsetzen? Hurley hatte seine Zweifel, ob sie sich wirklich an Flickr orientieren sollten – er fürchtete, dass es schwieriger sein würde, Videos hochzuladen und online zu bearbeiten als Fotos. Andererseits wollte er auch nicht, dass YouTube.com sofort in die Dating-Schublade gesteckt würde. Spätabends am Sonntag, dem 3. April, mailte Hurley den anderen beiden, dass sie die Website einfach veröffentlichen sollten. Sie könnten »dann immer noch im laufenden Betrieb entscheiden, wohin die Reise gehen soll«.
Zehn Tage später wurden sie auf ihrer Reise dann aber plötzlich ausgebremst, als Google seine Nutzer auf einmal dazu aufrief, Amateurvideos einzusenden. Die Videos wollte das Unternehmen anschließend für alle Welt sichtbar ins Netz stellen. (Hurleys Reaktion darauf war laut seiner Erinnerung: »Ach du Scheiße!«) Google war noch furchteinflößender als Yahoo. Am Anfang war die Online-Suchmaschine nur eine unter vielen gewesen, aber inzwischen hatte sie alle ihre Konkurrenten pulverisiert, und langsam zeigte sich, wonach Google eigentlich strebte. Am 1. April 2004 hatte Google mit Gmail einen eigenen E-Mail-Dienst gestartet, der den Nutzern so viel kostenlosen Speicherplatz zur Verfügung stellte, dass viele Leute es zunächst für einen Aprilscherz gehalten hatten. Anschließend hatte es die Bereitstellung einer riesigen, kostenlosen digitalen Weltkarte angekündigt. Und jetzt grub Google, das Unternehmen, das einer Geldmaschine gleichkam und zahlreiche brillante Programmierer im Schlepptau hatte, auch noch YouTube das Wasser ab.
Als sich Hurley und seine Freunde das nächste Mal trafen, hatten sie einen neuen Punkt auf ihrer Agenda: Sollen wir es sein lassen?
Chad Hurley, aufgewachsen in Reading, Pennsylvania, war in Kalifornien gelandet wie so viele: auf einer Matratze auf dem Fußboden eines Wohnzimmers. Nachdem er in Pennsylvania zunächst ein kleines College besucht und nebenbei gelegentlich die eine oder andere Website gestaltet hatte, war er wieder bei seinen Eltern eingezogen. Ohne Plan und ohne Ziel. Eines Tages blätterte Hurley gelangweilt in der Zeitschrift Wired herum und stieß auf einen Artikel über Confinity. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen hatte eine Methode entwickelt, über den Palm Pilot, einen der ersten Handheld-PCs, Geld zu verschicken. Confinity brauchte einen Designer. Hurley schickte ihnen kurzerhand seinen Lebenslauf. Schon am nächsten Tag erhielt er eine Antwort: Ob er gleich morgen zum Vorstellungsgespräch kommen könne?
Das war 1999, also die Zeit, in der das Silicon Valley nur so vor Geld strotzte und frisches Blut immer willkommen war. Bei Confinity bat man Hurley, ein Logo für ihren neuen Online-Bezahldienst PayPal zu entwerfen, und bot ihm sofort einen Job an. Und so zog er in den Norden von Kalifornien, ins Epizentrum der Innovationen und des wirtschaftlichen Erfolgs, wo er zunächst auf einer Matratze auf dem Fußboden im Wohnzimmer nächtigte. Sein Gastgeber Erik Klein, ein Programmierer aus Illinois, war auf ganz ähnliche Weise in sein neues Leben in Kalifornien gestartet. So gut wie alle von Confinity rekrutierten Nachwuchskräfte waren zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt und schliefen erst mal irgendwo in der Nähe der Geschäftsräume auf Matratzen oder Sofas, bis ihnen von einem dafür berüchtigten Makler ohne weitere Auskünfte oder Bürgschaften eine Wohnung vermittelt wurde.
Bei Confinity lernte Hurley schon bald einen weiteren Neuling kennen, einen jungen Programmierer namens Steve Chen, der ein rundes Gesicht, stacheliges schwarzes Haar und ein fröhliches Gemüt hatte. Chen kam aus Chicago und war ein Semester vor dem Abschluss vom College abgegangen, sehr zum Missfallen seiner Eltern. Eine Ticket für den Rückflug hatte er gar nicht erst gelöst. Chen stammte aus Taipeh. Im Alter von acht Jahren war er mit seiner Familie in die USA gezogen. Auf dem Flug von Taiwan hatte er die Stewardess auf Englisch noch nicht einmal um ein Glas Wasser bitten können. Einen Großteil seiner Jugend in einem Vorort von Chicago brachte er damit zu, Englisch zu lernen. Mit 15 ging er dann auf ein Internat, die Illinois Mathematics and Science Academy, wo er gleich noch eine Sprache lernte: die Sprache der Computer. Chen bekam einen riesigen PC geschenkt. Da dort keine Eltern waren, die ihn ins Bett schickten, blieb er nächtelang auf, trank einen Kaffee nach dem anderen und schrieb kleine Programme, mit denen man Bilder animieren konnte. Er studierte Informatik an der University of Illinois, schwänzte aber oft die Vorlesungen. Bei allen Aufgaben ging es darum, ein Programm oder einen Algorithmus zu schreiben – Code, der für eine bestimmte Aufgabe optimiert war. Wenn dies, dann das. Dafür brauchte Chen keine Vorlesungen, das konnte er sich mit einem Buch und einer Tastatur selbst beibringen. Und er kannte jemanden, der schon im Geschäft war. Einer der Gründer von Confinity, Max Levchin, hatte ebenfalls an der University of Illinois studiert und stellte mit Vorliebe neue Mitarbeiter ein, die dieselbe Highschool wie Chen besucht hatten. Einmal erwähnte er einem Reporter gegenüber, die Illinois Mathematics and Science Academy bringe »stets extrem intelligente, fleißige, nicht verwöhnte« Programmierer hervor, perfekt für ein Start-up.6 Chens erster Arbeitstag bei Confinity war ein Sonntag. Als er im Büro ankam, saßen da schon vier andere Programmierer und spielten Videospiele. Wahnsinn!
Er arbeitete gern lange, ernährte sich von Cappuccino und Zigaretten und kam manchmal erst mittags ins Büro gestolpert. Seine Kollegen bezeichneten ihn als schlitzohrigen Spaßvogel – er machte ständig Raucherpausen und programmierte immer wieder »Shortcuts«, technisch wenig elegante Workarounds, die andere versuchten zu vermeiden. Am liebsten codete er in Python, einer obskuren Programmiersprache, die niemand außer ihm benutzte. Chen liebte Python, weil es sich um »Open Source« handelte, eine Sprache also, die von Menschen überall auf der Welt entwickelt und gepflegt wurde. Er mochte diese freigeistige Strukturlosigkeit. So sah er sich auch selbst: als strukturlosen Freigeist.
Gelegentlich arbeitete Chen mit Jawed Karim zusammen, einem anderen, ebenso begabten und eigensinnigen Einwanderer, der genau wie er an der University of Illinois studiert hatte. Karim liebte das Internet, weil es einem dort niemand krummnahm, wenn man gegen Regeln verstieß. Während seiner Zeit an der Uni hatte Karim einige Monate vor dem Erscheinen von Napster den Musiktauschdienst MP3 Voyeur entwickelt, der sich unter technisch interessierten Studierenden großer Beliebtheit erfreute.
Chen, Karim und Hurley erlebten bei Confinity einige turbulente Jahre. Damals handelten Start-ups so wie Haie, wenn sie Blut – oder in diesem Fall: Geld – rochen. Confinity hatte seine ursprüngliche Idee, eine Sicherheitssoftware, inzwischen zugunsten einer anderen aufgegeben, und zwar eines Online-Bezahldienstes. Das Unternehmen schaffte es im Gegensatz zu manch anderem jungen Internetunternehmen, den Zusammenbruch der Märkte infolge der Dotcom-Blase zu überleben, und benannte sich anschließend in PayPal um. PayPal erhob sich wie ein Phönix aus der Asche, ging an die Börse und ließ sich 2002 vom Online-Auktionshaus eBay kaufen.
PayPals Belegschaft bestand zu Beginn aus einer eingeschworenen Gruppe von Überfliegern der obersten Liga. Nach der Übernahme durch eBay wechselten etliche von ihnen zu einer der auf Blue-Chip-Unternehmen spezialisierten Kapitalanlagegesellschaften und gründeten legendäre Unternehmen wie Yelp, LinkedIn und SpaceX. Die Presse taufte die (überwiegend männlichen) Mitglieder der Gruppe die »PayPal-Mafia«. Die Gründer von YouTube gehörten bei PayPal eher der zweiten Riege an. Hurley hatte PayPal bald nach der Übernahme verlassen. Es war ihm dort einfach zu spießig. Chen arbeitete noch an PayPals Expansion nach China mit, doch zugleich wuchs seine Verachtung für eine Unternehmenskultur, in der, wie er fand, der finanzielle Gewinn wichtiger war als die Begeisterung fürs Programmieren.
Als die drei Anfang 2005 anfingen, von ihrer neuen Idee für ein Video-Dating-Portal zu erzählen, wurden sie kaum ernst genommen. Im April schickte Chen einem ehemaligen Kollegen die Testversion ihrer Website.
»Chic«, schrieb der Ex-Kollege zurück, »funktioniert echt gut. Aber wie willst du die Parnos draußen halten?« (Er hatte sich bei dem Wort »Pornos« vertippt.) Chen versicherte ihm, dass sie das schon hinkriegen würden, und fragte dann: »Magst du nicht mal ein Video hochladen??????«
Das Internet war damals noch keine große öffentliche Bühne, wo jeder ganz selbstverständlich alles Mögliche und Unmögliche mit anderen teilte. Dinge aus dem eigenen Privatleben einfach so zu posten, fühlte sich merkwürdig an. Chens Ex-Kollege schrieb zurück: »Ich weiß nicht genau, ob ich welche habe.«
Diese mittelmäßige Begeisterung schreckte die YouTube-Gründer genauso wenig ab wie der Einstieg von Google in das Amateur-Webvideo-Geschäft. Zumal Google damit nicht allein war. Microsoft hatte eine Seite für Webvideos. Und dann gab es da auch noch eine ganze Reihe weiterer Start-ups wie Revver und Metacafe sowie Portale für besonders krasse Clips wie Big Boys und eBaum’s World. All diese zeigten Filme auf ihren Websites bzw. in ihren Apps, doch ihnen allen fehlte eine Funktion, mit der sich ihre Videos auch anderswo im Netz abspielen ließen. Das war nur mit YouTube möglich.
Auf einer privaten Party demonstrierte Jawed Karim einem befreundeten Programmierer von PayPal, Yu Pan, wie das funktionierte. »Dahinter steckt Flash«, erklärte Karim ihm. Mithilfe von Flash, einem Softwaresystem zum Rendern von Text, Audio und Videografik, konnte YouTube seine Videoplayer-Box in andere Seiten einbetten. Das war der brillanteste Schachzug des Trios, eine Innovation, mit der YouTube all seine Konkurrenten übertrumpfen konnte. Auf der Party öffnete Karim für Pan ein Testvideo. Pan, der bei PayPal bereits mit Flash herumexperimentiert hatte, erkannte sofort das technische Potenzial. Auf Hurleys Bildschirm war ein einfaches Rechteck aus Pixeln und ein klitzekleiner, dreieckiger Play-Button zu sehen – der Entwurf eines Mini-Fernsehers, den man online überall platzieren konnte.
Videos mithilfe von Flash abzuspielen war ganz einfach. Weniger einfach war es, dafür zu sorgen, dass Bild und Ton übereinstimmten. Chen drehte zahllose Vier-Sekunden-Filmchen von sich selbst, in denen er einfach nur redete, und passte nach jeder Aufnahme den Code an, damit seine Lippenbewegungen zu den gesprochenen Wörtern passten. Als sie sich endlich sicher waren, dass es funktionierte, postete Karim unter seinem Benutzernamen »jawed« das erste richtige Video auf YouTube – einen 18-sekündigen Clip mit viel Geblinzel.
jawed: »Me at the zoo«, 23. April 2005,0:18.
Karim steht im Zoo von San Diego. Er trägt eine schwarze Skijacke. Seine Stimme wird beinahe von dem Kindergeplapper im Hintergrund übertönt, aber sein Mund bewegt sich synchron zum Ton des Videos. »Okay, wir sind hier also bei den Elefanten«, sagt er und schaut direkt in die Kamera. »Das Coole an denen ist, dass sie sehr, sehr, sehr« – Pause – »lange Rüssel haben. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.«
Karim lud Clips von startenden und landenden Boeings 747 hoch, um die Seite zu bestücken. Chen postete unter seinem Pseudonym tunafat Clips von seiner Katze PJ.
Doch sie brauchten noch mehr Videos. Sie hatten die Dating-Idee noch nicht ganz aufgegeben, doch damit sie funktionierte, mussten vor allem Videos von Frauen her. »Kreative Inhalte für YouTube gesucht!«, schrieb Chen in einem Post auf dem Anzeigenportal Craigslist. »Du bist eine Frau oder ein extrem kreativer Mann zwischen 18 und 45 Jahren und hast eine Digitalkamera zur Hand, mit der man kurze Videoclips aufnehmen kann? Dann befolge diese Anweisungen und verdiene 20 $.« Die Anweisungen lauteten: auf YouTube.com gehen, ein Konto anlegen, drei Videos von sich hochladen. In einem Dropdown-Menü konnten Besucher anklicken: »Ich bin eine FRAU und suche einen MANN zwischen 18 und 45.«
Sie posteten ihren Aufruf in Las Vegas und Los Angeles. Die Reaktion war gleich null.
Also fingen sie noch mal von vorne an. Hurley war der Ansicht, dass es die Leute eher abschreckte, wenn man an ihre Kreativität appellierte. Er war der Meinung, dass sie vor allem »echte persönliche Clips, die von normalen Menschen aufgenommen wurden« bräuchten. Ihr größtes Handicap war seiner Ansicht nach, dass man nicht genau erkennen konnte, was eigentlich der Sinn und Zweck der Website war. Nutzte man YouTube, um seine Meinung kundzutun oder um sich selbst von der attraktivsten Seite zu zeigen? »Ich bekomme von euch beiden ständig unterschiedliche Signale«, schrieb er verärgert in einer E-Mail. »Gehen wir in Richtung Bloggen oder Dating?« Karim schrieb zurück: »Scheiß auf Bloggen. Auf unserer Seite sollte man einfach Videos von sich selbst posten können. Quasi selbst auf Sendung gehen können. Fertig.« Der Slogan, den die drei bis dahin für ihre Website verwendet hatten – tune in, hook up (»Schalte ein, lerne jemanden kennen«) – war damit raus. Karim schlug broadcast yourself (»Geh auf Sendung«) als Motto vor, und dabei blieben sie.
Karims Mitstreiter störten sich schon bald immer mehr an dessen forschem Auftreten. Doch seine Entschlossenheit und das Motto wirkten sich in jenem Mai zweifellos positiv auf den Start ihrer Website aus. Die eigentliche Initialzündung waren jedoch ein paar kleine Optimierungen, die das Trio in weiser Voraussicht einen Monat später vornahm. Sie fügten neue Funktionen hinzu: Die Leute konnten nun Kommentare hinterlassen, und es gab eine kleine Schaltfläche, mit der man Freunden ganz einfach den Link zu einem Clip senden konnte. Und sobald man auf ein Video klickte, wurden am rechten Rand der Seite eine ganze Reihe ähnlicher Videos angezeigt, was einen dazu anregte, noch weiterzuschauen.
In den Jahren vor YouTubes Gründung hatten die vier großen US-amerikanischen TV-Networks – NBC, ABC, CBS und Fox – gerade erst einigermaßen unbeschadet den Kampf gegen ihren bis dahin größten Feind überstanden: das Kabelfernsehen. Nachdem die Regulierungsbehörden grünes Licht gegeben hatten, waren in den Neunzigern zahllose Kabelsender auf den Plan getreten und hatten den Networks, die das Fernsehen in den USA von Anfang an dominiert hatten, Zuschauer und Werbekunden abspenstig gemacht. Doch die Networks schlugen zurück, gründeten eigene Nachrichtensender (MSNBC, Fox News) und konsolidierten ihre Macht: Der Medienkonzern Viacom, dem CBS gehörte, kaufte innerhalb von ein paar Jahren TNN, BET und MTV auf. Aber die Waffe, mit der sie am Ende siegten, war das Reality-TV. Sendungen, in denen Amateure auftraten und für die man (quasi) kein Drehbuch brauchte, waren billig zu produzieren, und doch war das Fernsehpublikum ganz verrückt danach.
2005 ließ das Interesse der Zuschauer jedoch bereits wieder nach. Von The Real World lief die sechzehnte Staffel, von Survivor die zehnte. Das Künstliche am Reality-TV war kaum zu übersehen – das Publikum wusste, dass die Sendungen geskriptet, die Charaktere überzeichnet und die Dramen inszeniert waren und dass man dort maximal für 15 Minuten berühmt wurde, wenn überhaupt. Die Networks reagierten und passten ihre Formate an. Sie heuerten C-Promis an (z.B. für Dancing with the Stars auf ABC) und entwickelten Formate, die echten, dauerhaften Ruhm verhießen: Mit 26 Millionen Zuschauern pro Folge hatte Fox’ neue Show American Idol Rekord-Einschaltquoten. Ein Jahr zuvor hatte man sich bei NBC noch darüber geärgert, dass der Megahit Friends zu Ende war, doch dann hatte man plötzlich mit The Apprentice, einer Reality-Wettbewerbsshow mit dem halbseidenen Immobilienerben Donald Trump in der Hauptrolle, einen Überraschungserfolg gelandet. Die Fernsehmoguln waren Zeuge davon, wie das Internet die Musikbranche in Aufruhr versetzte. Eine Piratenseite namens Napster, auf der man kostenlos MP3s herunterladen konnte, zwang eine ganze Branche in die Knie. Zwar guckten Leute über vierzig nach wie vor gerne Reality-TV, aber das jüngere Publikum, dessen Vorlieben notorisch schwer zu prognostizieren waren, orientierte sich bereits anderweitig.
Als George W. Bush Präsident war, schauten sie Jon Stewart auf Comedy Central, wenn sie wissen wollten, was in der Welt geschah. Und sie tummelten sich auf MySpace. Im Sommer 2005 war MySpace das große Ding im Internet und mit 16 Millionen Besuchern pro Monat die fünftbeliebteste Adresse im Netz. Im Juli jenes Jahres kaufte die News Corporation, die Muttergesellschaft von Fox, MySpace mitsamt seinem jungen Publikum für sage und schreibe 580 Millionen Dollar.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Steve Chen bereits einen Plan, wie sie sich MySpace zunutze machen konnten, um YouTubes Wachstum anzukurbeln.
MySpace bestand aus einem chaotischen Sammelsurium von Blogs, Chats, sozialen Kontakten, Musik und Kleinanzeigen. Aber es gab dort keine Videos. Chen fand, die MySpace-Fans seien die ideale Zielgruppe für YouTube. Fotos teilten sie ohnehin bereits. Warum nicht auch Videos? Dank Flash konnte YouTube seine Videodateien direkt auf MySpace-Seiten laufen lassen und darüber Besucher zu sich locken. Neue Nutzer kamen und posteten Filme vom Familienurlaub, Katzenvideos und Kuriositäten, die man so im Fernsehen nicht zu sehen bekam. Der Traffic von MySpace und die neuen Funktionen brachten YouTube einen steten Zufluss neuer Nutzer, der nicht mehr nachlassen sollte.
Vielleicht half Chen auch ein anderes soziales Netzwerk auf die Sprünge. Nachdem er PayPal verlassen hatte, hatte er bei Facebook angefangen, einem damals noch ganz neuen, von Harvard-Studenten gegründeten Start-up. Ein früherer Facebook-Mitarbeiter erinnerte sich daran, wie Chen im Büro einmal ganz stolz YouTube.com vorführte. Als Chen dann zu YouTube wechselte, behielt er kurzerhand den von Facebook zur Verfügung gestellten Computer. Manch einer bei Facebook vermutete, dass er auf dem Computer Code für YouTube geschrieben hatte, den Facebook somit als geistiges Eigentum für sich hätte beanspruchen können. (Chen stritt das ab und behauptete, er sei nur noch nicht dazu gekommen, das Gerät zu Facebook zurückzubringen. Facebook hat daraus in der Öffentlichkeit nie ein Thema gemacht.7)
Chen war in jenem Jahr sehr beschäftigt. Im Sommer wurde ihm angesichts der Scharen von Zuschauern, die von MySpace herüberkamen, und der zunehmenden Zahl von Uploads schnell klar, dass sie Hilfe brauchten, um YouTube am Laufen zu halten. Er wandte sich an seine Freunde bei PayPal. Chen holte den Profientwickler Yu Pan ins Boot, der von seinen Kollegen als »verrückter Wissenschaftler« beschrieben wurde. Erik Klein kündigte an einem Donnerstag bei PayPal, sprach am Montagmorgen mit Chen und hatte noch am selben Nachmittag einen neuen Laptop und einen neuen Job. Ihm folgten noch einige weitere ehemalige PayPal-Mitarbeiter.
Die wichtigste Aufgabe des Teams war jeden Tag dieselbe, und sie war ganz simpel: dafür zu sorgen, dass YouTube.com nicht abstürzt. Manchmal brachten Bugs oder die schiere Menge an Videos die Website zum Erliegen. YouTube hatte ein kleines Büro angemietet. Die Entwickler nahmen immer den Zug und packten während der Fahrt wuchtige Laptops und drahtlose Modems aus, um zu arbeiten. Chen, der eine echte Nachteule war, las sich nach Mitternacht noch Beschwerde-E-Mails von Nutzern durch, und schon am Morgen fand sein Team einen Haufen frischer Bugfixes vor. Um sämtliche Videos abspielen zu können, benötigte YouTube Unmengen an Rechenleistung. Chen kaufte ganze Lkw-Ladungen voller 42-HE-Racks – riesige Serverschränke, größer als Kühlschränke. Doch das war nur eine Übergangslösung. Im September wurden die Videos auf YouTube schon mehr als 100000-mal pro Tag angeklickt. Schließlich fand Chen eine Firma in Texas, die Serverkapazitäten vermietete. Er bezahlte alles mit seiner Kreditkarte, deren Limit er regelmäßig ausschöpfte.
Die Programmierer von PayPal bezahlten im Alltag lieber bar als mit ihrem eigenen Dienst, denn wegen der explosiv in die Höhe schnellenden Zugriffszahlen war das System so fragil, dass schon eine Transaktion zu viel ausreichte, und alles brach zusammen. Bei YouTube war es ähnlich: Die Jungs, die die Mechanismen hinter der Seite kreiert hatten, schauten sich nur sehr selten YouTube-Videos an.
Die Gründer, die die Seite verantworteten, versuchten es zumindest. Es dauerte nicht lang, bis sich unter den Heimvideos und Kuriositäten auch Filmchen fanden, die verdammt nach Fernsehen aussahen. Im Juli entdeckte Hurley mehrere als »budlight commercials« betitelte Videos – Raubkopien von TV-Werbespots. Er war dafür, sie gleich wieder zu löschen. Der Bierbrauer Budweiser besaß die Rechte an den TV-Spots, und Hurley wusste, dass YouTube in rechtliche Schwierigkeiten geraten könnte, wenn diese Videos ohne das Einverständnis des Rechteinhabers auf ihrer Seite auftauchten. Karim war anderer Meinung und stellte 28 bereits gelöschte Videos wieder online. In einer E-Mail schrieb er, dass solche Clips das Potenzial hätten, sich sehr weit zu verbreiten, wodurch wieder mehr Menschen auf die Seite aufmerksam würden. Das ist das Risiko wert.
»Ok Mann«, schrieb Hurley ihm zurück, »dann spar dir mal besser dein Essensgeld für ein paar Gerichtsverfahren! ;)«
Im Monat darauf war Hurley dann nicht mehr nach Zwinker-Smileys zumute, als er auf YouTube Clips einer NASA-Spaceshuttle-Landung fand, die jemand einfach so direkt von CNN übernommen hatte. »Wenn die Jungs von Turner« – dem Besitzer von CNN – »das auf unserer Seite sehen, meint ihr nicht, dass die dann sauer werden?«, mailte er. »Leute wie die werden uns später mal für viel Geld kaufen, also sollten wir sie bei Laune halten.«
Während sich Hurley den Kopf über »die Jungs von Turner« zerbrach und Chen sich darum bemühte, dass bei ihnen nicht die Lichter ausgingen, war Karim schon drauf und dran, sich von YouTube zu verabschieden. Karim hatte das College, genau wie Chen, frühzeitig verlassen, um bei einer da noch unbekannten Internetfirma anzufangen. Sein Bachelorstudium hatte er online abgeschlossen, aber Karims Eltern waren beide in der Wissenschaft tätig, und obgleich PayPal zu der Zeit schon erfolgreich war, drängten sie ihn dazu, seinen Master zu machen. Im Herbst verließ er YouTube. Chen fühlte sich von Karim allein gelassen – gerade, wo sie auf jede fachliche Unterstützung angewiesen waren, die sie kriegen konnten, hatten sie plötzlich einen erfahrenen Programmierer weniger. Später gab es Auseinandersetzungen darüber, welche Rolle Karim eigentlich bei der Unternehmensgründung gespielt hatte. Er erzählte herum, dass ursprünglich er auf die Idee mit YouTube gekommen sei, weil er frustriert darüber gewesen sei, dass er denkwürdige Ereignisse im Fernsehen verpasst habe – so etwas wie den Tsunami 2004 oder Janet Jacksons Auftritt beim Super Bowl, bei dem aus Versehen ihre Brustwarze zu sehen war. Wenn solche Ereignisse schon einmal ausgestrahlt worden sind, warum kann man sich das dann nirgendwo noch einmal angucken? Chen hingegen sagte, eine Unterhaltung während eines Abendessens bei ihm zu Hause habe ihn auf die Idee gebracht.
Nach Karims Ausstieg nahm YouTube plötzlich so richtig an Fahrt auf, und zwar ganz ohne das Zutun seiner Mitstreiter. Einige junge, kreative Sonderlinge hatten angefangen, sich ständig auf der Seite zu tummeln und dort auf ganz eigene Weise kulturell zu verewigen.
Brooke Brodack war zehn Jahre alt, als sie an Weihnachten ihre erste eigene Videokamera geschenkt bekam. Vielleicht war sie auch schon elf – sie weiß es selbst nicht mehr ganz genau. Umso besser kann sie sich aber an die aufwendigen Erkundigungstouren im Garten erinnern, die sie mit der Kamera festhielt, und an die Feiertage, an denen sie ihre Familie beim Truthahnessen filmte und später alle zusammentrommelte, um ihnen ihre neuesten Filme vorzuführen. Mit 13 schrieb sie ihre ersten Sketche und lernte, wie man Videos bearbeitete und einzelne Einstellungen plante. Auf dem College, wo sie Rundfunktechnik studierte, behielt sie ihr Hobby bei. Neben der Uni jobbte sie als Kellnerin im Lucky 99, einem Surf-and-Turf-Restaurant in Worcester, Massachusetts.
Im Herbst 2005 entdeckte sie zwischen zwei Schichten im Restaurant ein neues Forum für ihre Filme.
Brookers: »CRAZED NUMA FAN !!!!«, 4:03.8
Auf dem Bildschirm erscheint in Großbuchstaben eine Warnung: »Dieses Video enthält einen sehr eingängigen Song mit dazugehörigem Tanz. Manche leicht beeinflussbaren Zuschauer könnten versuchen, ihn zu kopieren, um berühmt zu werden.« Eine junge Frau erscheint. Sie trägt zwei schiefe Pferdeschwänze und hat eine große Lücke zwischen den Schneidezähnen. An ihr Shirt hat sie ein Blatt Papier geheftet. Darauf steht »#1NUMA FAN«, ein Internet-Insiderwitz.
Nachdem sie sich bei YouTube angemeldet hatte, veröffentlichte Brodack, damals 19 Jahre alt, unter dem Namen »Brookers« eine ganze Reihe verrückter Heimvideos. In einem sang sie Playback zu einem Song der Band Chicago, während sie ein Samuraischwert schwang. In »CRAZED NUMA FAN!!!!« präsentierte sie sich als Riesenfan eines anderen bekannten Heimvideo-Darstellers: Gary Brolsma. Im Jahr 2004, noch bevor es YouTube gab, hatte Brolsma ein Video ins Internet gestellt, auf dem er, Kopfhörer auf den Ohren und den Blick neben die Kamera gerichtet, zu dröhnenden elektrischen Beats die Lippen bewegt. Der Refrain des auf Rumänisch gesungenen Songs Dragostea din tei klingt wie »Numa Numa«. Brolsma ist erst noch relativ ruhig und bewegt nur seine Lippen, aber als der Song Fahrt aufnimmt, wirft er plötzlich die Arme hoch und singt begeistert mit. Das Ganze wirkte, als würde man jemandem bei einem ganz privaten Moment zuschauen, einem Moment großer Freude. Brodacks Version, in der sie wild ihre Gliedmaßen schüttelnd durchs Bild tanzt, war länger und wilder und wurde auf YouTube ein Riesenhit.
Die meisten Leute, die 2006 YouTube für sich entdeckten, insbesondere die jüngeren, kannten Brolsmas kleine Playback-Show vom heimischen PC. Brodack fand seinen Enthusiasmus ansteckend. Ihr kam es vor, als würde sie einem Introvertierten dabei zusehen, wie er endlich einmal aus sich herauskam. Ihr eigener Clip stand symbolisch für eine YouTube-Ästhetik, die sich gerade herausbildete: Er war eine alberne, ausgelassene Hommage. Die Kopie einer Kopie, jede genauso bekannt wie die davor.
Kapitel 2
Krude und willkürlich
Ratten. Überall wimmelte es von Ratten. Zwischen den Ventilatoren und der Decke, unter den Dielen. Und jeden Tag wurden es mehr.
Um dem überraschend schnellen Wachstum Rechnung zu tragen, war YouTube Anfang 2006 in größere Büroräume nach San Mateo umgezogen, einer Satellitenstadt bei San Francisco, das man von dort aus bequem per Zug erreichte. Es herrschten chaotische Zustände. Die Räume befanden sich im ersten Stock über der Pizzeria Amici’s, und die jungen Softwareingenieure ließen dauernd ihre Essensreste herumstehen, was ihnen eine Nagetierplage bescherte, der sie kaum Herr wurden.9 Irgendjemand setzte zwei Plüschratten auf den Empfangstresen, als Firmenmaskottchen von YouTube. Die Büroräume waren hufeisenförmig angeordnet, in der Mitte befand sich das Treppenhaus. Reihen behelfsmäßiger Schreibtische, nackte Neonröhren, grauer Teppichboden. Hurley und Chen teilten sich einen Ecktisch in der Nähe der wenigen Fenster. Hurley hatte einen Künstler damit beauftragt, als Anspielung auf die Bandbreite im Internet Spiralen aus roten und grauen Streifen an die Wände zu malen und so nach Möglichkeit die Räumlichkeiten auch gleich etwas aufzupeppen. Billige weiße Laken hingen als Raumteiler von der Decke. Wie bei Google wurden die Mitarbeiter mit Snacks aus Großpackungen von Costco versorgt, die zum Teil in der hintersten Ecke des Kühlschranks vor sich hin gammelten. Jedes neue Teammitglied bekam einen Schreibtisch und einen Bürostuhl von IKEA, die man selbst zusammenbauen musste, ein Ritual, das verdeutlichen sollte, wie sparsam man bei dem Start-up war.
Hurley und Chen bildeten den Vorstand und stellten noch ein paar Betriebswirtschaftler ein, die sich zu den Programmierern gesellten. Selbst als das Unternehmen immer bekannter wurde, hielt man an den unkonventionellen Gepflogenheiten fest. MC Hammer, ein Star aus längst vergangenen Zeiten, stattete den Machern der hippen neuen Website im Februar einen Besuch ab, und Kevin Donahue, der erst kürzlich eingestellt worden war, führte ihn herum. Die Mitarbeiter filmten die zwei dabei und luden den Clip auf YouTube hoch (Titel: »Hammer Time!«). Einmal kam ein Reporter von Forbes vorbei, um sich einen beliebten Clip anzuschauen, in dem ein Mann seinem Stiefkind einen fiesen Streich spielt: Das Kind, das gerade noch völlig vertieft in ein Videospiel gewesen war, erschreckt sich und bricht in Tränen aus, als plötzlich eine unheimliche Fratze auf dem Bildschirm erscheint. »So was macht man nicht«, sagte Chris Maxcy, der ebenfalls neu bei YouTube war. Andere lachten. Donahue bezeichnete die Website Forbes gegenüber als »krude und willkürlich«.
Nur wenige Monate zuvor hatte Chen alle laufenden Kosten mit seiner Kreditkarte beglichen. Sie hatten das Unternehmen gerade noch so am Laufen halten können. Doch glücklicherweise hatte sich ein Retter für YouTube gefunden. Chen und Hurley war in jenem Sommer beim Durchsehen der neu angelegten Konten auf YouTube – damals war das noch Teil ihrer Routine – ein Name ins Auge gefallen: Roelof Botha. Botha hatte Geld. Bei PayPal war er als CFOder Typ mit dem Geld gewesen, und anschließend war er zu Sequoia Capital gewechselt, einer bekannten Risikokapital-Beteiligungsgesellschaft, die einst in Google investiert hatte. Botha war ein hochgewachsener, pragmatisch veranlagter Südafrikaner mit einem Uni-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einer Vorliebe für neuartige Technologien. Er hatte vor Kurzem seine neue Digitalkamera in die Flitterwochen nach Italien mitgenommen und ein paar Clips von seiner Reise auf die neue Seite gestellt, von der er über das alte PayPal-Netzwerk erfahren hatte. Inzwischen wurde die Seite auch außerhalb des Netzwerks gehypt. Im August wurde YouTube auf der einflussreichen Tech-News-Seite Slashdot erwähnt, zu deren Lesern auch die Gründer von Google zählten. Der Artikel sorgte für eine ganze Welle neuer Besucher. Botha setzte sich mit seinen ehemaligen PayPal-Kollegen in Verbindung und verfasste noch im selben Monat ein Memorandum, das die Partner von Sequoia dazu bewegte, zu investieren.
Ende August hatte YouTube täglich 8000 Besucher, die über 15000 Videos hochluden. Botha rechnete das Ganze durch: YouTube zahlte etwa 4000 Dollar pro Monat für die Server, auf denen die Videos gespeichert wurden, und jedes Mal, wenn ein Video abgespielt wurde, kostete die Rechenleistung einen winzigen Bruchteil eines Cents. Zwei Optionen waren denkbar: Entweder ließ YouTube sich Funktionen wie spezielle Videoeffekte bezahlen, oder es verdiente Geld mit Werbung, so wie Google. In seinem Memo verwies Botha auf den jüngsten Erfolg von anderen »Web 2.0«-Unternehmen mit »nutzergenerierten Inhalten« wie Flickr und Tripadvisor, ein Reiseportal, das für über 100 Millionen Dollar verkauft worden war. YouTube würde mindestens genauso viel einbringen.10
Das Memorandum verfehlte seine Wirkung nicht. Im November kündigte Sequoia an, dass es 3,5 Millionen Dollar in YouTube investieren wolle. Die Investmentfirma staunte, dass das Unternehmen acht Terabyte an Filmmaterial speicherte: »Das ist, als würde man jeden Tag eine ganze Blockbuster-Videothek über das Internet verschicken« – so etwas konnte man sich damals kaum vorstellen. Michael Moritz, ein Partner von Sequoia, sagte später, YouTube sei nach Amazon, Microsoft und Google »der vierte apokalyptische Reiter des Internets«.11 Sequoia platzierte Botha im Vorstand von YouTube und übernahm 30 Prozent der Anteile.





























