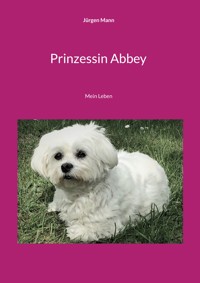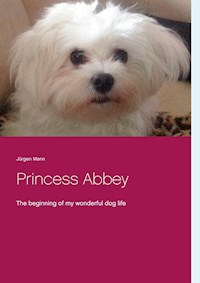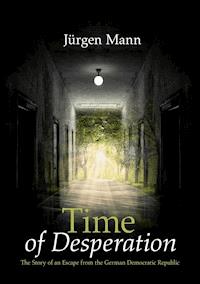Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sondershausen, eine kleine Stadt in der DDR im Jahr 1959: Ferdi und Helga Mann führen mit ihren Söhnen Roland und Jürgen ein unbeschwertes Familienleben, bis ein an sich nichtiger Vorfall schlagartig alles ändert: Ferdi, der bei der Kriminalpolizei arbeitet, nickt während eines Wachdienstes ein und verliert seinen Rang als Offizier. Er quittiert den Polizeidienst und findet bald eine andere Stelle, aber der Vorgang macht ihm und Helga, die mittlerweile mit Zwillingen schwanger ist, die Perfidität der Behörden mit voller Wucht bewußt. Sie, die ohnehin nie Freunde des Regimes waren, wollen nicht weiter in einem Land leben, das ihre Existenz und Zukunft jederzeit zerstören kann. Als Helga ein Visum erhält und mit den mittlerweile vier Kindern für zehn Tage zu ihren Eltern in den Westen reisen darf, steht ihr lange angedachter Plan fest. Ferdi folgt ihnen einige Tage später, heimlich und ohne Visum. Doch die Behörden sind längst misstrauisch geworden und senden ihre Handlanger, um Ferdi zu suchen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÜRGEN MANN, 1951 in Sondershausen/Thüringen geboren, lebt seit 1961 in Westdeutschland. Er studierte Elektrotechnik und war danach im Management mehrerer internationaler Firmen tätig, die auch einen jahrelangen Aufenthalt in den USA notwendig machten. Er ist verheiratet und lebt heute in Bayern.
Dieses Buch ist meinen Eltern gewidmet, denen ich hiermit Dank sage
für ihren Mut, ihre Durchsetzungskraft und ihre Courage,
die groß genug war, ihnen selbst und ihren Kindern
eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Dafür werde ich euch immer dankbar sein.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Nachwort
1.
Kein Zweifel, wir alle waren total begeistert: mein Bruder Roland, die anderen Kinder in unseren Klassen und ich selbst. Roland war zehn Jahre alt, ich gerade sieben. Er war schon in der vierten Klasse, ich in der ersten. Ich kann mir vorstellen, daß dieser Nachmittag nicht nur einer ganzen Menge der älteren Mitschüler gefallen hätte – sondern auch unseren Vätern! Du mußtest diese Rotarmisten einfach in dein Herz schließen, weil sie uns eine solche unvergeßliche Erfahrung bescherten.
Unsere Familie lebte in einer schmalen Straße in der oberen Stadt von Sondershausen in Thüringen. Sondershausen liegt ungefähr fünfundvierzig Kilometer nördlich von Erfurt, der Hauptstadt von Thüringen, und ungefähr gleich weit entfernt vom Harz, eines der schönsten Mittelgebirge in Deutschland. Die höchste Erhebung ist der berühmte Brocken. Das Plateau war überfüllt mit Radaranlagen, die nichts anderes machten, als westlichen Funkverkehr abzuhören. Der Brocken war komplett abgeriegelt und ein sicheres Zeichen für die Präsenz der Russen. Solcherlei Merkmale waren darüber hinaus überall zu beobachten.
Eine weitere berühmte Sehenswürdigkeit in der Nähe war das Denkmal des Kaisers Barbarossa am Kyffhäuser: Man sieht den mächtigen Körper des Kaisers sitzend auf einem Thron, alles aus rotem Sandstein gehauen. Er lebte im 12. Jahrhundert und ist berühmt geworden durch seine Kreuzzüge ins Heilige Land.
Drei Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde – basierend auf dem Ergebnis des Potsdamer Abkommens – dieser mittlere Teil von Deutschland, der von der Ostsee im Norden bis zur damals tschechoslowakischen Grenze reichte, eine sowjetische Besatzungszone (SBZ) unter der Führung der Sowjetunion. Der östliche Teil von Gesamtdeutschland, der bei Frankfurt an der Oder begann, wurde von der Oder-Neiße-Grenze ab Polen zugerechnet – ebenfalls basierend auf diesem Abkommen vom August 1945. Dieser östliche Teil reichte von den baltischen Staaten im Nordosten bis nach Schlesien im Südosten und sah fast aus wie eine abnehmende Mondsichel. Zu dieser Zeit wurde der neue Teil von Mitteldeutschland mit den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gebildet. Hauptstadt des neuen Ostdeutschlands wurde Ostberlin. Westberlin war somit eine Insel, umgeben von Ostdeutschland, und wurde von den Alliierten Frankreich, USA und Großbritannien kontrolliert, während Ostberlin unter der Aufsicht der Sowjetunion stand. Viele Leute bezeichnen bis heute dieses neue Ostdeutschland als Mitteldeutschland und beziehen sich dabei auf die Grenzen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg.
Thüringen war ein Land an der Grenze zu Westdeutschland, dem »freien Westen«, und wurde – und wird bis heute – das »grüne Herz Deutschlands« genannt: Es ist tatsächlich grün – aber auch hügelig, und einige Gegenden sind sogar bergig. Ich würde Thüringen ein wenig mit dem US-Staat Oregon vergleichen oder auch teilweise mit den englischen Midlands. Es ist ein bisschen von beiden und sicherlich nicht so »überfüllt« wie andere Landesteile.
Eine Straße von fünfhundert Metern Länge, der Possenweg, führte von der Stadtmitte hinauf zu unserem Viertel und von dort weiter bis in den Wald und zu einem dort lokalisierten Ausflugsziel: dem Possen. Der Belag der Straße war zunächst Asphalt, dann Kopfsteinpflaster und schließlich erdiger Schotter. Es dauerte eine gute Stunde, den ganzen Weg durch den Wald zu laufen. Die Leute liebten diesen Spaziergang am Wochenende und genossen es, danach im Possen Mittag zu essen oder sich bei Kaffee und Kuchen auszuruhen. Bevor der Possenweg von der Stadt kommend in den etwas steileren Anstieg in den Wald mündete, teilte er sich in einem kleinen runden Platz in zwei weitere Straßen, einer nach links, unsere kleine Straße, und einer nach rechts.
Wenn ich sage »obere Stadt«, dann gilt das in Bezug auf die geographische Lage wie auf die Bevölkerung: Geographisch lagen wir etwa hundert Meter oberhalb der Stadtmitte. Wenn man in der Mitte des Possenweges stand und zur Stadt sah, konnte man den Kirchturm sehen. In diesen Zeiten konnte man ohne Gefahr beruhigt in der Mitte der Straße stehen, da nur ganz wenige Autos oder andere Fahrzeuge fuhren.
»Obere Stadt« auch im Sinne der Leute und deren Status: Die meisten hatten wichtige Funktionen oder Positionen bei der Stadt oder in der Partei, der SED, und waren gut situiert. Die SED – die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Nichts anderes eigentlich als die neuen Kommunisten.
Das Schönste an dem kleinen runden Platz, von dem sich die beiden Straßen links und rechts abzweigten, waren die mächtigen alten Kastanienbäume, die den Weg bis zum Wald säumten. Ihre Kastanien waren oft die Basis für das Basteln von kleinen Schiffchen oder Skulpturen während der Wintermonate. Folgte man dem Weg nach rechts, konnte man eines der politischen Zentren der Stadt erreichen, das Gebäude des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB). Meine Eltern verbrachten viele Abende dort, um sich die Informationen anzuhören, die die SED für wichtig hielt für ihre Mitglieder und die Arbeiterklasse. Weiter oben in dieser Straße war auch das öffentliche Bad »Sonnenblick«.
Wir wohnten in der Edmund-König-Straße Nummer vier. Auf beiden Seiten der Straße reihten sich wunderschöne alte Villen und Häuser aneinander. Die meisten waren in ganz gutem Zustand, wenn man berücksichtigt, daß es Nachkriegszeit war.
Nummer vier war auch eine alte Villa, die einmal von einer einzigen Familie bewohnt worden war. Ich nenne es hier unser Haus, obwohl wir nur das große Erdgeschoß gemietet hatten. Auf ungefähr siebzig Quadratmetern befanden sich ein Wohnzimmer mit angrenzender Veranda, zwei Schlafzimmer, eine Küche und eine Toilette. Zwei Kellerräume gehörten dazu und ein Waschraum im Keller. Aber wir hatten auch einen kleinen Garten, den wir von der Veranda aus begehen konnten. Der Garten war besonders schön zum Spielen für uns Kinder. Zwei alte Bäume standen in den Ecken, eine Trauerweide und ein Kirschbaum, die im Sommer Schatten spendeten.
Es gab kein Bad, das war Teil der Wohnung in der ersten Etage. Diese Wohnung war von einem Paar mittleren Alters gemietet, den Pantels. Es war keine innige Nachbarschaft, trotzdem hatte Mutti vielleicht einmal die Woche eine kleine Unterhaltung mit Frau Pantel im Flur, um die wichtigsten Neuigkeiten auszutauschen. Herr Pantel spielte Cello im Stadtorchester. Das einzig Störende daran waren die stundenlangen Übungen für sein nächstes Konzert – und das war nicht zu selten.
Über ihnen in der zweiten Etage, unter dem Dach sozusagen, lebte ein älteres Ehepaar um die sechzig, das wir sehr mochten. Wir nannten sie Tante Rosa und Onkel Walter. Ihnen gehörte der Garten, der hinter unserem Haus lag. Einige Hühner gackerten dort und manchmal bekamen wir ein paar frische Eier. Diese waren selten in dieser Zeit, selten wie Schokolade, Bananen, Orangen, Gemüse, Butter und fast jede Art von Fleischwaren.
Ausgenommen Pferdefleisch. Ich kann mich erinnern, daß ich mit Mutti einkaufen gegangen bin. Mutti nannten wir meine Mutter; sie akzeptierte nur diesen Kosenamen, bis heute, und würde niemals einen anderen Namen, wie zum Beispiel »Mutter«, hören wollen. Manchmal haben wir Mutti damit geärgert, sie Mutter zu rufen.
Wir standen stundenlang in der Reihe mit vielen anderen Kunden und warteten geduldig, um die genannten Lebensmittel zu kaufen. Wenn man Pech hatte, kaufte die Person vor einem gerade die letzten Eier oder Würstchen weg.
Verbindungen zum Westen, zu Verwandten, die Päckchen mit Kaffee, Süßigkeiten oder Medikamenten schickten, waren Gold wert. Unglücklicherweise wurden alle Päckchen von den Grenz- und Zollbehörden kontrolliert beziehungsweise geöffnet – und was die brauchen konnten, fehlte dann, und wir bekamen nur den Rest. Unsere Großeltern und andere Verwandte lebten in Westdeutschland. Die hatten die SBZ gleich nach dem Zweiten Weltkrieg unter meist abenteuerlichen und gefährlichen Umständen verlassen. Viele Leute flohen bei Nacht über die – so hofften sie – von der Polizei nicht beobachtete Grenze in den Westen.
Wir blieben aus gutem Grund im Osten: Für den Aufbau des neuen Staates DDR nach dem Krieg brauchte man eine Menge Beamte und Polizisten und dazu alle möglichen gut ausgebildeten und arbeitswilligen Arbeiter. Die Polizei machte eine Menge Propaganda, um neue Mitarbeiter anzuwerben. Mein Vater – wir sagten Papa zu ihm – hatte sich für eine solche Anstellung beworben und wurde im Jahr 1947 auch angenommen. Später wurde er sogar Chef der Kriminalpolizei in Sondershausen. Der Rang war dem eines Leutnants bei der Armee ähnlich. Nebenbei gesagt, das ist auch der Grund, warum unsere Familie eines der wenigen Telefone der Stadt hatte.
Nach unserem Haus mit der Nummer vier reihten sich noch fünf weitere Häuser auf. Der Bürgermeister wohnte gleich neben uns in Nummer sechs. Auf der linken Seite stand das Haus mit der Nummer eins, eine Villa, die als Heim für kleine Kinder und Waisen diente. Heute würde man das wahrscheinlich einen Kinderhort nennen oder einfach eine Kindertagestätte. Daneben stand ebenfalls eine alte Villa, in der zwei unserer Schulkameraden lebten. Beide Villen standen auf großen Grundstücken, wahrscheinlich drei- oder viertausend Quadratmeter groß und mit vielen Obstbäumen bepflanzt. Danach schloß sich ein Blumenfeld an, das zu einer mächtigen Gärtnerei gehörte. Dann kamen noch zwei andere Häuser. Natürlich waren alle Häuser solide aus Stein oder mit Ziegeln gebaut und zwei oder drei Etagen hoch. In den meisten Häusern lebten ein bis zwei Familien.
Die Edmund-König-Straße war nicht gepflastert, sie war ein Gemisch von Sand, Steinen und Geröll und hatte eine paar schöne Löcher und Mulden. Nichtsdestotrotz hatten wir Gehsteige links und rechts! Die Straße endete nach etwa sechshundert Metern an einer kleinen Kreuzung, wo sich der Blick in ein weites Tal mit Feldern voll von Weizen, Gemüse und Kartoffeln öffnete. Wir erfreuten uns oft an diesem Blick, der für Kilometer von keinerlei Gebäuden oder Hindernissen eingeschränkt wurde. In weiter Entfernung konnte man die vagen Silhouetten von zwei Städtchen sehen. Eine davon war Jecha. Besonders in der Sommerzeit, wenn die Sonne hoch am Himmel stand und einige Kumuluswolken ihre Schatten über die Felder bewegten, war es ein wunderschöner Anblick.
Wandte man sich nach rechts und passierte eine große Hecke und eine hängende Wiese, erreichte man über einen einfachen Feldweg den Wald. Auf dieser Wiese liefen wir im Winter Ski oder rodelten, Papa, Roland und ich. Die Wiese war steil genug und deshalb rasant genug für unser Alter. Es war nicht selten, daß wir mit Skiern oder Schlitten Unfälle hatten. Einmal schossen Roland und ich zusammen ziemlich schnell über einige eisige Huckel und wir brachen die Kufen und landeten im Zaun des angrenzenden Feldes. Außer den üblichen blauen Flecken war uns aber nichts passiert.
Von der kleinen Kreuzung schlängelte sich ein Schotterweg an dem angrenzenden Kartoffelfeld entlang. Mit den Bäumen an beiden Seiten machte der Weg den Eindruck einer Allee. Im Herbst – nach der offiziellen Ernte – durfte man die restlichen Kartoffeln auflesen beziehungsweise das zurückgelassene Gemüse auf anderen Feldern ernten. Wir taten das jedes Jahr, wann immer wir Zeit hatten. Ich bin sicher, daß es nicht wegen des Geldes war, sondern weil wir es schwer hatten, Kartoffeln und Gemüse zu kaufen. Aber es machte auch Spaß! Manchmal gingen wir auch vor der Ernte aufs Feld – das war natürlich gefährlich. Wenn es irgendjemand gesehen hätte, es wäre vermutlich teuer geworden. Mutti hat sicherlich öfter gewisse Risiken in Kauf genommen, um für die Familie etwas mehr als nur Brot und eine Wassersuppe auf dem Essenstisch zu haben.
Wenn man nach links ging, verwandelte sich der Schotterweg in eine gute asphaltierte Straße. Sie führte über eine stählerne Eisenbahnbrücke zurück zur Stadt. Es war nur ein Gleis, aber ich werde nie das Gefühl vergessen, wenn wir auf der Brücke standen und ein Zug, gezogen von einer Dampflokomotive, unter ihr durchfuhr! Die Dampflokomotive hüllte uns in eine große weiße Wolke. Der Nebeneffekt war allerdings nicht sehr glücklich, denn der schwarze Ruß des Feuerrosses hinterließ seine Spuren – etwas, das Mutti wirklich nicht sehr gerne sah! Wenn sich die Wolke verzogen hatte, sah man, wohin die Straße weiterführte. Häuser auf der linken Seite und eine lange, fünf Meter hohe Ziegelmauer auf der rechten Seite, die sich entlang der Bahnlinie fortsetzte, fast wie die Wände eines Gefängnisses. Diese Wände versteckten die großen Kasernen der sowjetischen Armee, die dort stationiert war; ungefähr dreihundert Soldaten waren es.
Unseres Wissens hatten diese Mauern nur eine Öffnung: das mächtige Stahltor mit seinen wachhabenden Soldaten. Das Tor war ungefähr zehn Meter von der Straße zurückversetzt, so daß sich eine weite Einfahrt bildete, notwendig, um besonders mit den übergroßen Militärfahrzeugen in die Kasernen zu gelangen.
Die Soldaten trugen ihre typischen dunkelgrünen Uniformen mit Stiefeln und der unvergleichlichen Art, ihre Gürtel über den Uniformjacken zu tragen. Das läßt die kurzen Jacken fast wie ein Minirock abstehen, der gerade mal die Hüften bedeckt. Natürlich waren sie mit Maschinengewehren bewaffnet: Kalaschnikovs, benannt nach dem berühmten russischen Soldaten, der als deren Erfinder gilt.
Die Soldaten mußten das Tor von Hand öffnen, wenn ihre Fahrzeuge passieren wollten. Es war allerdings eher selten, daß die schweren Panzer in die schmalen Straßen von Sondershausen ausrollten. Andererseits war es nicht ungewöhnlich, sie auf unseren Straßen zu sehen, begleitet von diesem typischen metallischen Klicken der schweren Ketten und den brüllenden Motoren; sie hinterließen viel ruinierten Asphalt. Bei Dunkelheit war das Tor immer hell erleuchtet von vier grellen Scheinwerfern.
Neben dem Tor, in der Ecke des Eingangs, hatte man einen etwa achtzig Quadratmeter großen und zwei Meter hohen Block aus Beton gebaut. Darauf stand majestätisch ein militärgrüner Panzer. Es war ein T-34, ein sowjetisches Modell aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese wurden während des Krieges in Werken im Uralgebirge hergestellt. Man sagt, daß sie trotz der dreißig Tonnen Gewicht sehr wendig und schnell waren. Er hatte eine 76-Millimeter-Kanone an seinem mächtigen Turm, und zwei beindruckende 16-Millimeter-Maschinengewehre schauten aus jeder der zwei vorderen Luken. Für uns war der Panzer nicht nur als Monument äußerst beeindrukkend, sondern auch ein Symbol für die Präsenz »unserer Freunde« und der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg.
Ich bin oft an diesem Panzer vorbeigegangen auf dem Weg von oder zur Schule. Er stand bis vor einigen Jahren immer noch auf seinem Platz.
2.
Die Schule war sicherlich nützlich und nahm auf uns großen Einfluß. Das meine ich nicht nur im politischen Sinn; wir lernten nicht nur viele allgemein nützliche Dinge, auch der generelle Unterricht war sehr gut. Es war schon verblüffend, wie viel Stoff wir in kurzer Zeit lernten oder lernen mußten. Das bemerkte ich später in meinem Leben. Unsere Zeit mit Lehrern und anderen Autoritäten diente vor allem auch dazu, uns auf den richtigen politischen Weg zu bringen: Die Information über den neuen Staat DDR, seine Grundsteine und Ziele, sollte uns überzeugen, daß dieser Staat der bessere der zwei deutschen war. Der Staat und seine Politik waren sowieso allgegenwärtig: in der Schule, bei der Arbeit und sogar in der Freizeit.
Es war normal und galt als notwendig, viel Zeit mit dem »System« zu verbringen. Ich erinnere mich, daß wir jeden Schultag mit einem Appell zur Flagge der Pioniere begannen, die sehr einflußreiche Jugendorganisation in der DDR. Wir hatten ein Bild des Präsidenten Wilhelm Pieck in unserem Klassenzimmer hängen. Mädchen und Jungen wurden »Pioniere« genannt und trugen weiße Hemden mit dem Symbol der Organisation und darüber ein blaues Tuch, gebunden mit einem speziellen Knoten. Diese ganze Bewegung könnte man ein wenig mit den Pfadfindern vergleichen. Natürlich, der Unterschied hier war der Einfluß der SED und der Regierung auf die Organisation. Man könnte auch sagen der Sowjets. Jungen und Mädchen waren automatisch Mitglieder der Pioniere. Später, als Jugendlicher, wurde man Mitglied der FDJ, der »Freien Deutschen Jugend«.
Die Pioniere waren sehr gut organisiert. Spezielle Ausflüge oder Zusammenkünfte wurden normalerweise einmal die Woche veranstaltet: Sport, Besuche von Gedenkstätten oder Monumenten, Industrieunternehmen und deren Fabriken und anderes. Wir unternahmen auch Wanderungen durch die Natur und lernten eine Menge darüber. Ein Höhepunkt war immer der Besuch der Sowjetarmee, wenigsten für die Jungen – wahrscheinlich eher nicht für die Mädchen.
Ich erinnere mich an diesen besonderen Morgen in der Schule, als wir unseren nächsten Pioniernachmittag besprachen. Es müßte etwa zwei Monate vor den großen Sommerferien gewesen sein, die sieben Wochen Freizeit bescherten. Sie begannen Mitte Juli und endeten mit Schulbeginn am ersten September.
Unsere Schule lag etwa zwei Kilometer von unserem Haus entfernt und wir liefen jeden Tag hin und zurück: Sommer wie Winter, bei Sonnenschein, Regen oder Sturm. Wir hatten keine Fahrräder, so etwas war selten in diesen Tagen. Und wenn es denn eines gab, benutzten es wahrscheinlich die Eltern, um zur Arbeit zu fahren oder Besorgungen zu machen. Wir mußten den Possenweg runterlaufen, ungefähr 300 Meter, über die Bahnschienen und dann ein paar kleine Straßen entlang. Wir passierten den sowjetischen Militärfriedhof, da das Schulgebäude direkt daran anschloß. Auf dem Friedhof stand in der Mitte ein Monolith aus Stein mit einem großen Sowjetstern am oberen Ende. Umgeben von einem Park mit hohen, alten Eichen, war es ein wirklich angemessen ruhiger Ort. Wir liefen durch diesen Park, um die massiven, hölzernen Eingangstüren der Schule zu erreichen. Unsere Schule hatte den Namen »Käthe-Kollwitz-Mittelschule«. Käthe Kollwitz war eine Widerstandskämpferin während des Dritten Reiches und politisch den Sozialisten zugehörig. Sie wurde auch berühmt als Künstlerin und Bildhauerin.
Die Schule hatte ein Walmdach, war aus Sandstein gebaut und formte ein großes L mit vier Etagen. Zwei größere Türen führten in den Schulhof, den wir für unsere Pausen nutzten.
Unsere Klassenlehrerin Frau Rosenstiel war mit dem Schuldirektor verheiratet. Wir empfanden sie als eine sehr gute Lehrerin und mochten sie alle gern. Die meisten Fächer wurden von ihr unterrichtet: Lesen und Schreiben, Grammatik, Mathematik, Sport und Musik. Ich habe immer noch meine Zeugnisse, die von ihr unterschrieben sind. Ich war ein Jahr älter als die meisten meiner Mitschüler, da ich mit fünf, sechs immer etwas kränklich war. Meine Eltern entschieden deshalb, mich erst im Alter von sieben einzuschulen.
An diesem Donnerstagmorgen hatte Frau Rosenstiel den Führer der lokalen Pionierorganisation eingeladen. Er war um die dreißig, an seinen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Nach einer kurzen Erläuterung von möglichen Plänen für unsere Pioniernachmittage setzte er seine Ausführungen mit etwas fort, das uns alle begeistern sollte:
»Meine lieben jungen Pioniere! Ich habe einen sehr speziellen Nachmittag mit unseren Freunden der Roten Armee geplant. Ich bin sehr erfreut, euch sagen zu können, daß wir einen Nachmittag mit den Soldaten draußen im Manövergebiet verbringen werden. Sie werden uns nicht nur das Gebiet und das schwere Gerät zeigen, sondern uns auch mit ihren Panzern mitfahren lassen.«
Zunächst war es still, aber dann gab es ein lautes Gebrüll der Klasse, wobei ich sagen sollte, daß die Jungen am lautesten schrien. Das waren wirklich außergewöhnlich gute Neuigkeiten, und wir konnten wochenlang gar nicht aufhören, darüber zu reden. Es war Frühling, Mai, um genau zu sein, und die Zeit war gut gewählt für ein solches Abenteuer. Es war kaum zu glauben, daß wir so etwas erleben würden!
Später an diesem Tag erzählte mir mein Bruder Roland, daß wir nicht die einzige Klasse seien, die eingeladen sei. Auch seine Klasse und ein paar andere würden mit den Panzern fahren. Ich konnte es nicht erwarten! Wir erzählten es natürlich gleich Mutti und Papa – wir erzählten ihnen immer, was in der Schule passierte. Sie waren allerdings nicht so begeistert darüber, vielleicht nur, weil sie sich immer Sorgen um uns machten. Früher oder später habe ich dann die Bedenken verstanden.
Die Tage vergingen, ohne daß wir aufhörten, daran zu denken und uns vorzustellen, wie es denn sein mag, in einem dieser Panzer zu fahren.
3.
Es war sonnig, der Himmel war strahlend blau und das Thermometer zeigte um die fünfundzwanzig Grad. Wetter, das man für Juni erwarten konnte. Aber wie wir alle wissen, es ist nicht notwendigerweise gegeben, daß man so ein Wetter hat zu dieser Jahreszeit. Wir hatten eben Glück. Ein wirklich herrlicher Tag für unseren Pioniernachmittag. Es war ein bißchen windig, und hier und da stieben ein paar Staubwolken auf.
Es war Mittwoch, und wir waren noch in der Schule – das war der große Tag! Am frühen Nachmittag, nach dem Mittagessen, hatten wir uns endlich auf dem Schulhof versammelt, in einer Formation, die Soldaten vor einem Marsch einnehmen: also in Reih und Glied. Unser Jugendleiter gab uns noch ein paar Instruktionen zum Ablauf und zu den bevorstehenden Ereignissen. Wir verließen auf Kommando den Schulhof und marschierten zur Straße. Ich sollte hier erwähnen, daß wie zu erwarten nur wenige Mädchen gekommen waren, wirklich keine Überraschung. Mädchen haben eben andere Interessen!
Wir brauchten ungefähr zehn Minuten bis zum großen Eisentor vor der Kaserne. Es waren nur etwa vierhundert Meter dorthin. Einige Formalitäten waren mit den Wachmännern zu erledigen. Da einige von ihnen Deutsch sprachen, gab es keine Probleme mit der Verständigung. Und natürlich wurden wir erwartet!
Man ließ uns alsbald durch das Tor. Es war allerdings nicht das erste Mal für die meisten von uns, daß sie innerhalb der Mauern waren. Jedes Jahr gab es einen Tag der offenen Tür, an dem die Besucher die Kasernen und alle Einrichtungen der Soldaten besichtigen konnten. Spezielle Tafeln mit Information für die Besucher wurden dann aufgestellt, und jeder konnte eine Schüssel mit Suppe aus einer Gulaschkanone genießen, wie wir die fahrenden Küchen liebevoll bezeichneten.
Wir marschierten weiter über den großen Exerzierhof, der von Kasernen mit je drei Etagen und Garagen eingerahmt war. Vor den übergroßen Garagen machten wir Halt. Dort warteten einige der offenen Militär-Lkws. Diese hatten Frontkabinen und boten für drei Soldaten Platz, den Fahrer und zwei Beifahrer. Dahinter waren Holzplanken auf einer Stahlkonstruktion montiert, auf denen man allerlei Material hätte aufladen können. Oder man montierte Holzbänke, um Soldaten zu transportieren. Armee-Lkws sind wirklich nicht komfortabel: Wenn man auf diesen harten Holzbänken sitzt, konnte man nun wirklich keine Luxusfahrt erwarten!
Ich drehte mich um und sah meinen Bruder Roland ein paar Meter entfernt von mir. Ich konnte die Begeisterung in seinem Gesicht sehen; er konnte es nicht erwarten, raus ins Manöverfeld zu kommen und einen dieser Panzer zu besteigen.
Wir Jungen waren alle in kurzen Hosen, weißen Hemden und hatten auch unsere blauen Halstücher umgebunden. Die wenigen Mädchen hatten Sommerkleider an und ebenfalls ihre blauen Halstücher umgebunden. Ich war mir nicht sicher, wie passend die Sommerkleider waren an diesem Nachmittag. Vielleicht waren die Mädchen ja auch nur interessiert daran, die Panzer zu sehen und uns Jungen zu beobachten, wie wir unseren Spaß hatten.
Eines der Mädchen war Rolands Klassenkameradin Bärbel. Sie war die Tochter des Bürgermeisters und lebte neben uns in der Nummer sechs. Ich denke noch heute, daß Roland sie sehr mochte, sogar Jahre später: Er hielt lange Kontakt mit ihr. Sie war hübsch und ziemlich groß, hatte blonde Haare und große, blaue Augen. Auch sie trug ein Sommerkleid.
Jetzt war es an der Zeit, auf die Lkws zu klettern. Da wir noch nicht so groß waren, brauchten wir die Hilfe der Soldaten und unserer Jugendleiter, um auf die Plattform zu steigen. Jeder der Lkws hatte sechzehn Sitze, Platz sollte also genug sein. Manchmal blies der Wind, und wir Jungen lachten, wenn die Sommerkleider etwas mehr enthüllten, als den Mädchen lieb war.
Nachdem wir alle Platz genommen hatten, wurden wir angewiesen, uns gut an den Metallstangen festzuhalten, an denen normalerweise die Planen befestigt wurden, denn wir würden uns bald auf die Fahrt machen – und was das für eine Fahrt werden sollte!
Die Felder und Manöverreviere waren nur ein paar Kilometer entfernt. Sie fuhren uns über alte, schmutzige und holperige Straßen und Felder, die aus gutem Grund nicht gerade eben oder flach waren. Auf und nieder, steile Rampen und Hügel, flache Teilstücke, Löcher und Hänge aller nur denkbarer Größen. Mutter Natur hatte die richtige Umgebung bereitgestellt, und durch die Manöver waren diese Gebiete erst recht verunstaltet worden. Integriert waren auch Bunkeranlagen und Grabengänge, also genau das Richtige für die Soldaten, um Krieg zu spielen.
Die Fahrt auf diesen spartanischen Militär-Lkws war schon allein ein Abenteuer. Wir flogen fast von Huckel zu Huckel, wurden von den Bänken in die Luft geworfen, um danach gleich wieder auf dem harten Holz zu landen. Ich hörte einige der Mädchen schreien – aber auch ein paar Jungen. Ich bin ganz sicher, daß jeder von uns am Abend seine blauen Flecke zählte beziehungsweise am nächsten Morgen. Ich war einer von ihnen. Ich denke, daß wir so begeistert waren, daß wir die Schmerzen erleiden konnten; aber wir waren auch heilfroh, als die Lkws endlich das Feld erreichten, wo wir abrupt stoppten. Staubwolken hüllten uns und die Umgebung ein. Aber war das wirklich wichtig? Nein, natürlich nicht!
Ich habe vergessen zu erwähnen, daß die sowjetischen Soldaten, die uns begleiteten, unglücklicherweise kaum Deutsch sprachen. Allerdings sprach unser Pionierleiter Russisch, was uns bei der wichtigsten Kommunikation half. Russisch war die erste Fremdsprache, die wir ab der dritten Klasse lernen mußten. Um weiterzukommen und eventuell Englisch zu lernen, bedurfte es zunächst einer sehr guten Russischnote. Das Erlernen des Englischen war aber auch nicht gewünscht, immerhin repräsentierte die englische Sprache in gewisser Weise die westliche kapitalistische Kultur.
Einer nach dem anderen stieg mit etwas Hilfe der Soldaten vom Lkw. Unsere Kleidung zeigte ganz deutlich, daß es eine schmutzige Fahrt war. Mutti würde diese waschen müssen. Und ohne Waschmaschine wie im Westen war das wirklich ein Stück harte Arbeit. Gott segne Mutti! Natürlich war uns das nicht so sehr bewußt, und wir nahmen es als selbstverständlich an, immer saubere Wäsche zu haben, wann immer wir sie brauchten.
Wir sahen uns um und bemerkten, daß da nirgendwo irgendein Panzer zu sehen war. Kein Lärm, der angezeigt hätte, daß ein solches Monster um die Ecke käme oder von den Hügeln hinter uns anrollen würde. Auch keiner vor uns oder auf der steilen Erdrampe rechts von uns, ein paar hundert Meter entfernt. Aber wir erkannten die Spuren von großen Reifen und Profile der Ketten, die überall sichtbar waren auf diesem erdigen Untergrund. Wir mußten also an der richtigen Stelle sein!
Wir gingen ein bisschen umher und erkundeten unsere Umgebung: Mit jedem Schritt wirbelte ein bisschen Staub auf, und bald darauf waren unsere Schuhe und Strümpfe von einer grau-braunen Schicht bedeckt. Trotz des relativ offenen Feldes waren nicht alle Teile des Manövergebietes zu überblicken. Auch war auf der rechten Seite ein kleines Waldstück, etwa zweihundert Meter weg. Die Bäume und Büsche davor behinderten den Blick nach rechts. In weiter Entfernung konnte man Sondershausen sehen, ein bißchen höher gelegen, als wir jetzt waren. Vor uns sah es kilometerweit aus wie eine Mondlandschaft, wahrscheinlich von der Größe einiger Quadratkilometer – wenn nicht noch größer.
Ich ging zu meinem Bruder und fragte: »Wann, denkst du, kommen die Panzer?«
Er war nun mal mein großer Bruder und ich schaute immer zu ihm auf. Er zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, aber ich hoffe, die kommen bald!« Das zeigte deutlich, daß er mindestens so ungeduldig war wie ich.
Erst dachte ich, daß eine Biene oder Hummel um meinen Kopf schwirrte; dann bemerkte ich, daß das Geräusch, welches an mein Ohr drang, viel zu sehr ein Rumpeln war, als daß es von einer Biene stammen könnte. Der ständig steigende Lärm von mächtigen Dieselmotoren, verbunden mit dem kreischenden Geklirr von metallenen Ketten. Die Panzer waren auf dem Weg zu uns! Wir konnten sie noch nicht sehen, aber unser Adrenalinspiegel stieg mit jeder Sekunde. Unsere Herzen schlugen schneller und jeder von uns versuchte, den ersten Blick auf sie zu erhaschen. Die Luft vibrierte.
Plötzlich erschien, am Ende des kleinen Waldes rechts von uns, einer der Panzer, zuerst nur das lange Kanonenrohr am Turm, dann die massive Front aus Metallplatten. Sekunden später konnten wir den kompletten Panzer erkennen. Wir beobachteten, wie die Ketten auf der linken Seite über die Stahlräder ratterten. Der Panzer hinterließ eine ganz schöne Staubwolke. Als er näher kam, sah ich mehr und mehr der Details, wie zum Beispiel die offene Luke des Fahrers, das Maschinengewehr, das drohend neben ihm herausschaute, die metallischen Aufbauten für Geräte und Werkzeuge oben hinter dem Turm. Und natürlich schaute der Kommandeur aus der offenen Luke zu uns herüber. Der Panzer steuerte direkt auf uns zu − mit einer ziemlichen Geschwindigkeit. Ich hätte auf etwa fünfzig Stundenkilometer getippt.
Der Panzer hüpfte ein wenig beim Überqueren der Huckel und Löcher. Er hatte natürlich keine Schwierigkeiten, die Rampe herunterzufahren. Wir mußten uns jetzt schon die Ohren zuhalten wegen des ansteigenden Lärmes.
Im gleichen Moment kurvte ein zweiter Panzer um das Ende des Waldstückes und fuhr in nicht weniger furchterregender Weise auf uns zu. Wir sprangen vorsichtshalber zur Seite, um genügend Platz zu machen für die Ungetüme. Einer der sowjetischen Soldaten winkte dem Kommandeur zu, um ihm zu zeigen, wo er halten sollte. Nur ein paar Schritte von uns entfernt stoppte der erste T-34 mit einem lauten Gequietsche; der Motor brummte noch. Jetzt kam der zweite näher und machte eine kleine Richtungsänderung, indem er die linke Kette für zwei Sekunden anhielt. Auf diesem Weg bewegte er sich parallel zu dem ersten und stoppte etwa drei Meter von ihm entfernt. All das verursachte noch mehr Staubwolken, und ein paar von uns mußten husten. Einige Kommandos wurden gerufen, und dann wurden auch die Motoren abgestellt.
Wir staunten. Direkt vor uns standen zwei dieser massiven Kriegspanzer, von denen wir soviel gehört hatten. Dreißig Tonnen gepanzerter Stahl mit einem so großen Kanonenrohr, daß ich wahrscheinlich meinen Arm hineinstecken konnte, und einem Maschinengewehr, das erhebliche Mengen von Kugeln in die Luft feuern konnte. Die Ketten waren wenigstens einen Meter breit und mußten allein schon Tonnen wiegen. Beide Türme waren nach vorne und genau auf uns gerichtet.
Der Kommandeur des ersten Panzers kletterte aus seinem Turm, sprang auf die Kettenverkleidung und dann auf den Boden. Er ging zu den Soldaten hinüber und diskutierte mit ihnen über das, was – so vermuteten wir − die nächsten Schritte an diesem abenteuerlichen Nachmittag sein würden. In der Zwischenzeit erschien auch der zweite Kommandeur auf seinem Panzer. Wir schauten zu unserem Leiter mit offensichtlich fragenden Blicken, denn er antwortete, bevor wir unsere Frage formuliert hatten:
»Soweit ich die Vorgehensweise verstanden habe, werden wir maximal zu viert auf einen Panzer gehen. Einer wird vorne beim Fahrer sitzen; einer wird auf dem Sitz des Kommandeurs Platz nehmen unterhalb des Turmes. Ein weiterer wird im Turm stehen mit dem Kommandeur. Eventuell werden da auch zwei stehen, es gibt nicht allzu viel Platz innen drin. Ihr solltet mir nun sagen, wer wirklich mitfahren will und wer nicht. Am besten treten die einen Schritt nach vorne, die fahren wollen, damit wir sehen können, wie viele Touren wir machen müssen.«
Wir schauten uns alle an und bewegten uns vorwärts, allerdings nicht alle. Ich denke, daß dieses fast angsteinflößende Erscheinen der Panzer in manchen der Kameraden Fragezeichen hinterlassen hatte. Überraschenderweise gab es zwei Mädchen, die mitfahren wollten. Mehr als zwei Drittel der Jungen wollte natürlich mitfahren. Das machte wahrscheinlich vier Fahrten mit den beiden Panzern notwendig. Wir hatten Zeit genug, und natürlich interessierte es uns überhaupt nicht, wie spät es heute Nachmittag werden würde. Unser Pionierleiter hatte ähnlich gerechnet: Er plante etwa fünfundzwanzig bis dreißig Minuten für jede Fahrt ein. Wir bildeten Gruppen und konnten es einfach nicht erwarten, auf und in die Panzer zu klettern.
Roland und ich waren in der gleichen Gruppe mit zwei anderen Jungen. Es würde etwas ganz Besonders sein, mit meinem Bruder zu fahren, ich wußte das.
Die meisten Kinder in unserer Straße gingen zur selben Schule wie Roland und ich. Wir kannten uns gut und spielten sehr viel zusammen. Besonders die Ferienzeit hat uns begeistert, und unsere landschaftliche Umgebung mit Wäldern, Wiesen und Feldern brachte uns zu allerlei gemeinsamen Spielen und Aktivitäten.
Die ersten beiden Gruppen erklommen nun die Panzer. Die kleineren Kinder brauchten schon Hilfe, um auf die Panzer zu steigen, und allen wurde genau gesagt, wo sie stehen oder sitzen sollten. Ich sah nur einen Jungen in jedem Turm stehen, also mußte da irgendwo innen ein zusätzlicher Sitz sein. Aber was wußte ich schon. Und es war eigentlich auch egal. Bald würde ich es selbst erkunden. Ich fühlte, wie mich das alles mehr und mehr begeisterte. Noch eine halbe Stunde und ich würde selbst auf den Panzer klettern. Wo würde ich sitzen? Im Inneren? Im Turm? Oder vielleicht vorne, unten, neben dem Fahrer?
Meine Gedanken wurden plötzlich unterbrochen, als man die brummenden Motoren hörte. Dicker schwarzer Qualm kam jetzt aus den beiden Auspuffrohren hinten. Ganz automatisch sprangen wir zur Seite, um den Panzern genügend Raum zu lassen auszurollen. Der erste wendete nach rechts, indem er die rechte Kette stoppte und nur die linke laufen ließ, mit diesem typischen Gequietsche, wenn Metall auf Metall kommt. Es war schon verblüffend zu sehen, wie einfach es war, den T-34 zu lenken. Er machte langsam und vorsichtig eine halbe Drehung und fuhr dann von uns weg.
Der Fahrer trat auf das Gaspedal; eigentlich war da gar keines, wie wir später herausfanden. Er hatte einige Hebel zum Lenken und auch zum Beschleunigen. Wir mußten uns die Ohren zuhalten. Das Brummen war überaus laut. Der Panzer fuhr davon, nicht ohne ein paar kleine Hügel und Löcher zu durchkreuzen und dabei wieder Staub aufzuwirbeln. Nun wendete auch der zweite, indem er nicht nur die eine Kette stehen ließ, sondern sie dazu noch rückwärts drehte. Dann folgte er dem anderen. Wir sahen ihnen nach und verfolgten, wie sie Kurven fuhren und eine ganz gute Geschwindigkeit erreichten. Sie fuhren auf die Hügel, um dann gleich wieder in kleinere Täler abzutauchen. Der zweite Panzer sprang einmal fast vom Boden, als er über einen Hügel fuhr, wobei er vorne für eine Sekunde halbwegs in die Luft ragte. Ich bedauere immer noch, daß niemand irgendwelche Fotos gemacht hat an diesem Nachmittag. Nichts als gute Erinnerungen sind geblieben.
In der gleichen eindrucksvollen Weise, wie sie an diesem Nachmittag erschienen waren, kamen die Panzer zurück. Nun war es an uns, eine solche Fahrt zu erleben! Die Panzer standen wieder an der gleichen Stelle und nachdem die anderen diese verlassen hatten, kletterten wir hinauf, um unsere Plätze einzunehmen. Na klar, Roland war der Erste, er hatte das Glück und saß rechts neben dem Fahrer. Während des Krieges war das der Platz des Soldaten, der das Maschinengewehr bediente. Es gab zwei weitere Sitze: einer etwas hinter dem Fahrer und einer genau unter dem Turm. Das wurde mein Sitz. Es war eine Halbschale aus Metall, und ich kann mich erinnern, daß ich mit den Füßen nicht auf den Boden kam. Zuerst war das in Ordnung. Ich sah Roland unten, wie er versuchte, mit dem Fahrer zu sprechen. Wenn ich mich umsah, konnte ich noch mehr Ausrüstung erkennen, die ich aber nicht einordnen konnte. Es könnten auch Munitions- oder Werkzeugkisten gewesen sein. Und da war auch ein Radargerät. Die Antenne dafür war auf dem Turm installiert. Während des Zweiten Weltkrieges hatte der T-34 eine vierköpfige Mannschaft: Kommandeur, Fahrer, Soldat für das Maschinengewehr und Funker.
Die obere Luke blieb während der Fahrt offen. Wir starteten, und da ich nicht stand, konnte ich nur durch die Frontluke sehen. Nur wenn der Panzer abwärts fuhr, hatte ich einen Blick nach draußen. Die Fahrt über die Hügel war so schlimm, daß mir mein Hintern richtig weh tat. Kein Kissen auf dem Sitz und kaum eine Art von Federung. Egal, es hat riesig Spaß gemacht. Wir machten einige Wendungen, fuhren Hügel rauf und runter, manchmal ziemlich steile. Einmal blieben wir stehen. Ich versuchte herauszufinden, was vorne im dunklen Panzer los war: Roland und der Fahrer sprachen mit Händen und Füßen. Roland kannte ein paar russische Worte, ich bin nicht sicher, ob die geholfen haben. Nichtsdestotrotz sah ich ihn kurz darauf, wie er einen der Hebel mit beiden Händen hielt und daran zog. Der Panzer rollte vorwärts! Nach ein paar hundert Metern stoppte er wieder. Später hat mir Roland erzählt, daß er tatsächlich den Panzer ins Rollen gebracht hatte. Nicht weit, aber immerhin hat er es geschafft!
Am Ende unserer Fahrt sprangen wir mit Hilfe der Soldaten aus dem Panzer und wieder auf sicheren Grund. Meine Knie waren etwas zitterig, mein Hintern und meine Beine schmerzten, aber das war nicht wichtig! Wir gingen zu den anderen und tauschten unsere Erfahrungen aus. Roland war richtig stolz darauf, daß er den Panzer gefahren hatte.
Die anderen Kinder hatten ein paar Gräben und Bunker besucht. Es war sicherlich nicht uninteressant zu sehen, wie Soldaten während eines Manövers leben, aber natürlich kein Vergleich mit unserer Abenteuerfahrt auf den Panzern.
In diesen Tagen, Jahrzehnte nach diesem Nachmittag, sprechen Roland und ich immer noch von diesem Ereignis. Es gibt heute sogar Möglichkeiten, solche Panzer zu fahren oder sogar zu besitzen – man braucht sie einfach nur kaufen.
4.
Zu dieser Zeit, im Jahr 1958, war Mutti gerade einmal Anfang dreißig, Papa fünf Jahre älter. Papa war jetzt Chef der städtischen Kriminalpolizei. In einer solchen Position mußte man Mitglied der SED sein, keine Frage. Und Mutti auch. Man mußte politisch »sauber« sein, also das politische System in allen Belangen unterstützen, in öffentlicher und auch privater Umgebung. Konsequenterweise waren Beziehungen und Kontakte zum Westen, auch zu Verwandten, zu unterbinden. Kein Hören von West-Radio, keine westlichen Zeitungen oder Magazine. Die offiziellen Stellen wollten das nicht sehen, mußten aber doch realisieren, daß der Kontakt zu Familienangehörigen nicht ganz zu unterbinden war. Wenn sie nur die leiseste Information bekamen über solche Kontakte, mußte man diese bekanntgeben und wurde gleichzeitig dazu aufgefordert, diese abzubrechen. Einmal verwarnt, stand man unter ständiger Beobachtung, und alle Aktivitäten der gesamten Familie würden untersucht. Diese Untersuchungen wurden dann fast ausschließlich von der Stasi geführt, dem Staatssicherheitsdienst. Man könnte diese Organisation ohne Weiteres mit dem CIA oder dem KGB vergleichen – auch wenn jede Organisation natürlich ihre eigenen Regeln und Prinzipien hat. Es war an einem Dienstagnachmittag. Roland und ich kamen fast zur gleichen Zeit von der Schule nach Hause. Mutti hatte ein Päckchen von meiner Oma in Nürnberg bekommen. Sie war Papas Mutter und lebte im Haus seines Bruders und seiner Schwägerin. Es war immer ein großes Ereignis, wenn wir ein Päckchen aus Westdeutschland bekamen. Diesmal war es sogar noch besser, weil das Päckchen ungeöffnet und unversehrt war, nicht mit den üblichen Löchern, die die Grenzpolizei mit ihren dicken Nadeln beim Durchstoßen verursachten. Das war ihre Art, den Inhalt zu überprüfen. Das Paket war ziemlich groß, etwa dreißig mal dreißig mal sechzig Zentimeter. Mutti öffnete es und Roland und ich beobachteten sie ungeduldig. Warum? Wir hofften inständig, daß Schokolade und andere Süßigkeiten darin waren, an denen wir uns hier selten erfreuen konnten, weil es sie einfach nicht gab. Und wenn, schmeckten sie furchtbar. Auch Apfelsinen oder Bananen gab es nicht zu kaufen.
Wir hatten eine große Küche, gemessen an dem kleinen Apartment von etwa siebzig Quadratmetern: eine große, keramische Doppelspüle, ein Küchenschrank, ein Herd, der mit Gas gefeuert wurde, und ein kleiner Abstellraum. Und natürlich ein Küchentisch mit vier Stühlen. Um warmes Wasser zu machen, hatten wir einen Gasboiler, den man jedes Mal anzünden mußte. Ich erinnere mich sehr gut an den Besuch meiner Oma aus Nürnberg. Sie mußte den Boiler anzünden, hatte aber die Streichhölzer vergessen. Und bis sie zurück war mit den Hölzern, hatte sich schon eine Menge Gas im Raum verteilt. Wir hörten nur einen großen Knall. Gott sei Dank war es gar nicht so schlimm. Sie hat das niemals wieder getan – und wir hätten sie auch daran gehindert.
Mutti nahm die Schere, legte das Päckchen auf den Küchentisch und begann es zu öffnen. Es war ein Ritual. Solche Ereignisse waren vergleichbar mit Weihnachten oder Ostern oder Geburtstag; du konntest es einfach nicht erwarten, deine Geschenke aufzumachen! Das Päckchen war wirklich unberührt, und wir brannten darauf zu sehen, was drin war. Nach dem Aufklappen des Kartons und dem Entfernen des ersten Papieres sahen wir zwei Tafeln Schokolade, ein paar Päckchen Kaugummi, drei Orangen und irgendeine Medizin. Wir waren letztlich nicht krank. Es war allerdings nicht selten, daß wir um Medizin aus dem Westen baten, weil auch in dieser Hinsicht hier wenig verfügbar war. Besonders wenn es eine spezielle Krankheit war, mußten wir uns gänzlich auf unsere Verwandten verlassen. Mutti war nicht sonderlich überrascht, sie hatte offensichtlich danach gefragt.
Ich kann mich noch an das Scharlachfieber erinnern, das ich mit fünf hatte. Mutti ging zu unserem Hausarzt, der in einer großen alten weißen Villa am Ende der Karl-Marx-Allee praktizierte. Sein Name war Dr. Dönitz. Wir mochten ihn, er war hilfreich und ein guter Arzt. Mutti ging zu ihm, wann immer wir etwas Schlimmeres als die übliche Erkältung hatten. Ich war mehrmals sehr krank gewesen in meinen ersten Lebensjahren, hatte Masern, Scharlach und anderes.
Es war jedes Mal ein Albtraum, uns die richtige Medizin zu besorgen. Fast immer war die einzige Antwort: »Ich kann Ihnen nicht helfen, da wir die entsprechende Medizin nicht haben, Frau Mann. Es wäre gut, wenn Sie ein paar Verwandte im Westen hätten. Sagen Sie denen, was Sie brauchen, ich werde es Ihnen aufschreiben.« Mutti schrieb dann einen Brief, der eine Woche brauchte oder mehr, und dann mußten unsere Verwandten die Medizin senden, was wieder wenigstens eine Woche dauerte. Und immer mußten wir bangen, daß es ohne Weiteres durch die Zollkontrollen kam!
Nachdem wir also die Süßigkeiten herausgenommen hatten, entdeckten wir etwas Stoffartiges. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, daß es Hosen waren! Drei Paar, eine größere für Papa und zwei etwas kleinere für Roland und für mich. Sie waren dunkelgrün und aus diesem Samt, der nach der Stadt Manchester benannt war, die zu dieser Zeit im letzten Jahrhundert das Textilindustriezentrum Europas war. Irgendwie wußten wir das.
Wir zogen sie raus und betrachteten sie. Sie hatten einen Gürtel und zwei Taschen vorn und Aufschläge. Sie sahen sehr klassisch aus und würden mit Sicherheit Blicke auf sich ziehen. Wir verliebten uns gleich in sie und zogen sie an. Wir sahen wie richtige Männer aus, stolzierten durch die Wohnung und zeigten sie Mutti. Sie war sehr glücklich mit uns. Man muß sagen, daß Mutti immer sehr glücklich war, wenn uns Kindern Gutes widerfuhr. Sie war und ist einfach, was du von einer Mutti erwartest oder was du dir von einer fabelhaften Mutter erträumst. Wir konnten es kaum erwarten, die Hosen bei unserem nächsten Sonntagsspaziergang zu tragen. Und wir waren auch sicher, daß Papa ganz genau derselben Meinung war.
Am Boden des Päckchens war ein Brief von Oma mit Grüßen und besten Wünschen für uns. Sie hoffte natürlich, daß uns die Hosen gefallen würden und daß sie paßten. Mutti gab uns ein Stückchen Schokolade und rettete den Rest – wir hätten sonst wahrscheinlich alles auf einmal gegessen. Sie behielt auch die Orangen und die Medizin.
Alsbald wechselten wir unsere neuen Hosen gegen unsere Straßensachen. Es war ein wunderschöner Dienstagnachmittag und unsere Nachbarkinder waren schon draußen und hatten Spaß.
Muttis Regel war, daß wir an jedem Nachmittag beim Läuten der Kirchturmglocken um achtzehn Uhr nach Hause kommen mußten. Wir mochten das natürlich nicht, besonders nicht im Sommer, wenn es noch so hell war und die Sonne immer noch schien. Und die Mütter der anderen Kinder waren dahingehend etwas toleranter.
Wie auch immer, wir taten auch an diesem Tag, was von uns erwartet wurde. Gerade als wir in unsere kleine Straße einbogen, hörten wir ein Auto hinter uns, das von der Stadt kam. Der Zweitaktmotor machte einen knatternden Höllenlärm. Das Auto war grün: ein Polizeiauto. Die sahen alle wie Militärfahrzeuge aus, ein bißchen wie ein Jeep, aber nicht so robust gebaut und aussehend. Die Polizisten nannten diese Fahrzeuge »Kübel«. Das Auto bog in unsere Straße ein, und wir wußten sogleich, daß es Papa war. Er kam eigentlich selten so früh von der Arbeit nach Hause, aber das hing eben von seiner Arbeit ab. Es passierten immer ein paar überraschende Dinge in unserer Stadt oder im Bezirk. Manchmal riefen sie Papa mitten in der Nacht an und holten ihn ab, um zu einem Tatort zu fahren. Andere Male kam er die ganze Nacht gar nicht nach Hause, und wir sahen ihn zwei oder drei Tage überhaupt nicht. Papa fuhr nicht selbst, er hatte immer einen Chauffeur, der ihn von zu Hause abholte und wieder zurückbrachte.
Das Auto hielt vor dem Haus und Papa stieg aus. Wir rannten zu ihm und begrüßten ihn. Mutti hatte das Auto offensichtlich auch gehört und stand oben auf der Steintreppe, die zur Haustür führte. Wir rannten die Treppe rauf und Mutti schickte uns erst einmal weg, uns sauber zu machen, während sie Papa küßte. Mutti glühte förmlich. Vielleicht war es das Päckchen, das wir heute von Oma bekommen hatten. Nachdem er seine Aktentasche hingestellt und seine Hausschuhe angezogen hatte, zeigte Mutti ihm die Geschenke und seine neue Hose. Er mochte sie auch – auch wenn er nicht so begeistert war wie wir Kinder.
Ich fragte mich: Warum?
5.
Der Grund, warum Papa an diesem Tag so früh nach Hause gekommen war, lag eigentlich auf der Hand. Normalerweise arbeitete er sehr lange, hatte Besprechungen oder mußte mal wieder zu einem Tatort. Aber heute mußten er und Mutti zu einem Parteiabend der SED. Beide fühlten sich niemals wohl bei diesen Abenden, was daran lag, daß sie mit der Regierung der DDR und dem kommunistischen Führungsstil nicht einverstanden waren. Die Regierung bezeichnete die DDR als eine sozialistische Republik, wobei in der Realität eher eine Diktatur der SED herrschte, unterstützt von den Sowjets. Der politische Druck auf jeden war enorm und besonders auf zwei Erwachsene, die in der Gesellschaft bestens bekannt waren wie unsere Eltern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie in Thüringen geblieben, nachdem sie in den letzten Kriegstagen ihre Heimat verlassen mußten. Sie kamen aus dem Sudetenland, einem schmalen Landstrich im Norden der damals tschechoslowakischen Republik, die heute in zwei autonome Länder geteilt ist.
Reichenberg war durch seine floriende Textilindustrie wahrscheinlich die reichste Stadt im Sudetenland. Meine Großeltern besaßen dort ein paar Fabriken. Ferdinand Porsche, der Mann, der den ersten Volkswagen für Hitler gebaut hat, wurde in dieser Gegend geboren. Später gründete er die Porsche-Fabrik und fing an, die berühmten Sportwagen zu bauen.
Nach dem verlorenen Krieg wurden meine Eltern vertrieben mit nichts außer den Sachen, die sie trugen, und ein paar Habseligkeiten. Dieser Teil ist sicher einer der traurigsten und tragischen in der deutschen Geschichte. Alle unsere Verwandten mußten ihr Heimatland zusammen mit Mutti und Papa verlassen und kamen letztendlich nach Thüringen, einer der Staaten, der zu Mitteldeutschland gehörte und – wie bereits erwähnt – nach der Übernahme der Sowjets Ostdeutschland war.
Meine Eltern entschieden sich damals, nicht nach Westdeutschland zu gehen, und versuchten, Fuß zu fassen, ein Zuhause und Arbeit zu finden. Papa ging zur Polizei und ihm wurde auch bei der Suche nach einer kleinen Wohnung geholfen. Trotz allem waren meine Eltern immer gegen das Regime und seine Politik. Sie fühlten immer, daß der praktizierte Sozialismus eher ein verkleideter Kommunismus war. Freie Rede und freier Wille wurden unterdrückt. Man durfte die Regierung nicht kritisieren oder irgendetwas Kritisches über die Lebensbedingungen oder das Versagen der Behörden bei der Beschaffung von Lebensmittel sagen. Die geringste Bemerkung konnte wenigstens zu einem strengen Verhör führen oder im Ernstfall zu einem vorrübergehenden Gefängnisaufenthalt.
Mutti und Papa vermieden es meistens, irgendetwas vor uns Kindern oder ihren Freunden kritisch zu diskutieren. Freunde waren schwer zu finden und jeder war sehr vorsichtig mit Bemerkungen über die Regierung oder die Befriedigung der täglichen Bedürfnisse. Jede noch so kleine Information konnte von anderen Leuten zu ihrem eigenen Vorteil genutzt werden, beispielsweise um vorwärtszukommen. Oder sie konnten dich einfach nur nicht leiden. Gerade in der Öffentlichkeit mußte man immer extravorsichtig sein.
Wegen der unzureichenden Versorgungslage mußten Mutti und ich oft lange anstehen, um Butter Eier, Gemüse, Fleisch und sogar das berühmte Sauerkraut zu bekommen. Die Versorgung war mangelhaft, besonders wenn man in einer kleinen Stadt wie Sondershausen lebte. Wichtige und gut beobachtete Städte wie Ostberlin oder Leipzig hatten es da besser, da die Regierung sie als Aushängeschild benutzten für die westliche Welt: Seht, wie gut es uns geht und wie gut wir für unsere Bürger sorgen. Im Grunde aber machten die Sowjets die Regeln und gaben die Instruktionen; sie bestimmten, wohin die Waren gingen.
Einmal warteten wir vor einem Lebensmittelladen, von dem wir gehört hatten, daß es dort Eier und Butter zu kaufen gab. Butter war nur begrenzt vorhanden und nur gegen Lebensmittelmarken zu erhalten. Wir zogen uns schnell an und eilten den langen Possenweg in Richtung Stadt. Einige Leute wußten immer früher als andere, wenn es etwas Besonderes gab, und erzählten es dann den Nachbarn und Freunden, damit diese davon profitieren konnten. Ziemlich häufig war es allerdings so, daß man nichts bekam, weil alles schon ausverkauft war, bevor man am Laden ankam. Das war immer sehr enttäuschend, und die Leute waren ärgerlich. Eine Stunde oder länger in der Schlange zu stehen und dann nicht zu bekommen, wofür man gekommen war, konnte schon unbeschreiblich hart sein. Man war sehr frustriert, und einige konnten ihren Mund einfach nicht halten.
Als wir endlich an diesem bestimmten Lebensmittelladen ankamen, erzählte man sich, daß Eier und auch Bananen geliefert worden waren. Es hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet von Müttern mit Kindern und Hausfrauen, die sich nach diesem speziellen Angebot sehnten und sich wahrscheinlich bereits ein besonderes Abendessen ausmalten.
Man stand da, ruhig und darauf hoffend, daß man eine der glücklichen Personen sein würde, die etwas bekamen. Mutti erinnerte mich dann, still zu sein und nichts zu sagen.
Ich konnte nicht viel von dem beobachten, was vorne passierte, nur daß wir uns langsam vorwärtsbewegten. Mutti observierte immer die anderen Leute um uns herum; sie war sehr vorsichtig und auf alles bedacht. Vielleicht war es die Tatsache, daß sie mit einem Polizisten verheiratet war, die diese zusätzliche Aufmerksamkeit in ihr aufkommen ließ. Besonders aufmerksam war Mutti, wenn Männer in der Reihe standen. Ich folgte ihren Blicken, so gut ich konnte, und sah ebenfalls den Mann etwa drei Schritte vor uns. Er war ungefähr einen Meter achtzig groß und trug ein weißes Hemd, ein braunes Jackett und schwarze Hosen. Er war niemand, dem man in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Nur ein Mann, der die gleichen Dinge einkaufen wollte wie wir alle: Bananen oder Eier oder beides.
Die Schlange wurde kürzer. Schon bald würden wir an der Reihe sein und das Vergnügen haben, zumindest Eier zum Abendbrot zu haben. Bananen waren sowieso immer zuerst ausverkauft. Einige Leute hatten Hühner und deshalb selbst Eier. Mutti machte immer weiche Eier für uns, indem sie sie einige Minuten im kochenden Wasser kochte.
Wir hatten immer Spaß daran, die Eierschale aufzuklopfen und das Ei dann mit einem kleinen Löffel zu öffnen. Es mit einem Butterbrot und etwas Salz zu essen war schon etwas Außergewöhnliches für uns. Mir lief schon das Wasser im Mund zusammen.
Ich hörte, wie sich ein paar Frauen unterhielten; einige Worte wurden ausgetauscht. Plötzlich wurde es laut. Irgendetwas mußte passiert sein. Ich wollte aus der Reihe gehen, um zu sehen, was los war, aber Mutti hielt meine Hand fest in ihrer und hielt mich an ihrer Seite. Vorne gab es Bewegung und das Einzige, was ich sehen konnte, war, daß ein paar Leute gegen die Tür des Ladens drückten. »Ich warte jetzt schon über eine Stunde hier!«, schrie eine Frau, »ich will meine Eier haben!«
»Gibt es noch Bananen?«, fragte eine andere Frau lautstark die Verkäuferinnen. »Wir haben das gleiche Recht wie die in Berlin, welche zu bekommen. Warum habt ihr nicht genug? Wahrscheinlich habt ihr sie wieder alle dorthin geschickt!«
Andere verhielten sich ruhig und sagten lieber nichts; sie waren enttäuscht und niedergeschlagen, daß ihr Versuch nicht erfolgreich gewesen war. Es sah so aus, als ob gerade die letzten Eier und Bananen verkauft worden waren.
Während einige Frauen schon weggegangen waren, trat der Mann im braunen Jackett aus der Reihe nach vorne und sprach sehr ernst die Person an, die den Kommentar über Berlin gemacht hatte: »Bitte kommen Sie mit mir auf die Wache!« Die Frau wich erschrocken zurück. Die Angst war ihr ins Gesicht geschrieben. Sie antwortete nicht, sondern folgte dem Mann stillschweigend.
Der Mann war von der Geheimen Staatspolizei, der Stasi. Diese haßte kritische Kommentare.
6.
Mutti und Papa zogen sich um. Mutti trug meistens Röcke oder Kostüme mit Blusen und Papa Hosen, Jacketts und weiße Hemden. Sie brauchten eigentlich nur drei Minuten für die zweihundert Meter bis zum FDGB-Gebäude.
Die SED-Versammlungen begannen immer um zwanzig Uhr. Alle Teilnehmer wurden pünktlich erwartet oder besser: früher als pünktlich. Die Teilnahme war ein Muß. Man wollte wirklich nicht auf die schwarze Liste der offiziellen Stellen und der Stasi. Sie registrierten alles über dich. Sie wußten, wie du aufgewachsen warst, sie kannten deinen Lebenslauf, deine Familie, deine Arbeit, deine Hobbies, deine speziellen Verhaltensmerkmale, einfach alles. Sie kannten die Adressen der Familienmitglieder im Westen. Wenn man nicht Mitglied der SED war, wurde man von vornherein als Angehöriger der unteren Klasse, als Außenseiter gesehen, nicht als wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Es wurde zu jederzeit unter allen Umständen die bedingungslose Unterstützung des Systems verlangt. Auch nur die leisesten Zweifel zu zeigen oder zu äußern, war absolut nicht akzeptiert. Solcherlei Verfehlungen bei der Unterstützung der Regierung wurden natürlich auch publiziert. Die Stasi zögerte keinen Moment, solche Informationen an die Öffentlichkeit zu geben, um sie als warnendes Beispiel zu präsentieren, manchmal während einer dieser Zusammenkünfte, zu denen auch Mutti und Papa immer gingen.
Es waren immer etwa um die fünfzig Teilnehmer anwesend, gewissermaßen eine Auslese der »Wer-ist-wer« von Sondershausen. Noch einmal, man mußte nicht unbedingt ein SED-Mitglied sein, auch nicht als Lehrer oder wenn man in anderer exponierter Position war, aber es war ein »empfohlenes« Muß. Die Abende – so hat man mir später erzählt – waren gefüllt von Präsentationen und Diskussionen über die praktizierte Politik und die Köpfe von Sozialismus und Kommunismus: Marx, Engels und Lenin.
Die SED mußte eben sicherstellen, daß ihre wichtigen Mitglieder in die richtige Richtung »segelten«, um es einmal so auszudrücken. Die Doktrinen mußten immer wieder eingetrichtert werden, damit sie im täglichen Leben halfen und angewendet wurden.
Mutti und Papa fühlten sich immer unwohl an diesen Abenden. Sie hatten ihre eigenen grausamen Erlebnisse mit den Russen während der Flucht aus dem Sudetenland und fanden sich ungewollt wieder mitten unter ihnen und unter ihrem Einfluß. Aber sie mußten das Spiel mitspielen.