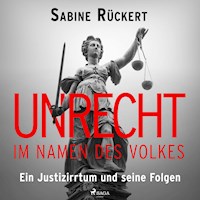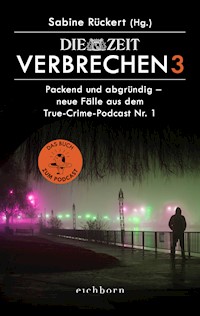12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Tödliche Mutterliebe - Die letzten Szenen einer Ehe - Tod im Vorüberfahren: Spannende Kriminalfälle wie diese beschreibt Sabine Rückert im Buch zum beliebten Podcast Zeit Verbrechen. Dabei erweckt sie sachliche Gerichtsurteile zum Leben, stellt Fragen an unsere Gesellschaft, nimmt das Justizsystem genau unter die Lupe und beschäftigt sich intensiv mit Kriminalpsychologie. Vor allem aber sieht sie immer die Menschen hinter einem Fall - ob Täter oder Opfer. Lehrreich und aufrüttelnd!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Änderungshinweis
Zu diesem Buch: SABINE RÜCKERT UND ANDREAS SENTKER ZU DIESEM BUCH
Familiengewalt: DIE LETZTE SZENE EINER EHE
Zeugen (1): NICHTS ALS DIE UNWAHRHEIT
Zeugen (2): EIN PLÖTZLICHER KINDSTOD
Geständnis: GESTEHEN SIE ENDLICH!
Eskalation (1): EIN GANZ PRIVATER FRIEDHOF
Eskalation (2): DIE FRAUEN DES ORGANISTEN
Politische Tat: WEN WÜRDEN SIE HEUTE OHRFEIGEN, FRAU KLARSFELD?
Kindesmisshandlung: MUTTERSEELENALLEIN
Verkehrsdelikte: TOD IM VORÜBERFAHREN
Genanalyse: DIE EINKREISUNG
Jugendgewalt: ZUR FALSCHEN ZEIT AM FALSCHEN ORT
Historischer Doppelmord: DIE WAHRHAFTIGE LÜGNERIN
Epilog: JE FRIEDLICHER, DESTO BLUTRÜNSTIGER
Über das Buch
Tödliche Mutterliebe – Die letzten Szenen einer Ehe – Tod im Vorüberfahren: Spannende Kriminalfälle wie diese beschreibt Sabine Rückert im Buch zum beliebten Podcast Zeit Verbrechen. Dabei erweckt sie sachliche Gerichtsurteile zum Leben, stellt Fragen an unsere Gesellschaft, nimmt das Justizsystem genau unter die Lupe und beschäftigt sich intensiv mit Kriminalpsychologie. Vor allem aber sieht sie immer die Menschen hinter einem Fall – ob Täter oder Opfer. Lehrreich und aufrüttelnd!
Über die Autorin
Sabine Rückert, Jahrgang 1961, ist stellvertretende Chefredakteurin der ZEIt, Herausgeberin des ZEIT-Magazins Verbrechen und Autorin mehrerer Bücher zum Thema Kriminalistik. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie als ressortunabhängige Gerichtsreporterin und erhielt für ihre Reportagen zahlreiche renommierte Journalisten-Preise, darunter den Egon-Erwin-Kisch-Preis, den Henri-Nannen-Preis oder den Deutschen Reporterpreis; sie deckte zwei Justizirrtümer auf. Seit 2018 ist sie Host des höchst erfolgreichen ZEIT Verbrechen-Podcasts, in dem sie Hunderttausende Zuhörer mit spannenden Kriminalfällen begeistert.
Sabine Rückert (Hg.)
VERBRECHEN
Echte Kriminalfälle aus Deutschland
DAS BUCH ZUM PODCAST
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen.
Für die Originalausgabe:Copyright © 2020 by Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, KölnUmschlaggestaltung: FAVORITBUERO, MünchenEinband-/Umschlagmotiv: © grafxart/shhutterstockE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-9503-7
www.eichborn.dewww.luebbe.dewww.lesejury.de
Änderungshinweis: Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes haben wir die Namen und andere persönliche Details mehrerer Protagonisten in den Texten geändert. Des Weiteren haben wir uns vorbehalten, die älteren ZEIT-Artikel an die heutigen sprachlichen Gepflogenheiten anzupassen.
ZU DIESEM BUCHSABINE RÜCKERT UND ANDREAS SENTKER ZU DIESEM BUCH
Andreas Sentker: Liebe Sabine, der Podcast ZEIT Verbrechen war ja eigentlich gar nicht deine Idee!
Sabine Rückert: Nein, es war die Idee von Jochen Wegner, dem Chef von ZEIT ONLINE. Der fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, die vielen Geschichten, die ich als Gerichts- und Kriminalreporterin erlebt und für die ZEIT aufgeschrieben habe, noch mal zu erzählen. Kriminalität ist ja etwas, das immer aktuell ist.
Andreas Sentker: Das Verbrechen ist zeitlos.
Sabine Rückert: Und die Motive fürs Verbrechen sind es auch, weil sie in der Natur des Menschen begründet sind. Ich hatte zu dem Zeitpunkt außerdem gerade das Kriminalmagazin gegründet, ZEIT Verbrechen, in dem wir alte Fälle nachgedruckt und die Frage beantwortet haben: Wie ging es weiter? Darauf konnte ich im Podcast hinweisen. Also hab ich mir gedacht – mach ich! Aber nicht allein, sondern mit einem anderen. Dieser Mensch sollte drei Bedingungen erfüllen: Er sollte klar denken, er sollte sich nicht vor mir fürchten, und es sollte ein Mann sein, damit sich die Stimmen deutlich unterscheiden. Und jetzt war die Auswahl schon relativ klein …
Andreas Sentker: Ein Mann, der sich nicht vor Sabine fürchtet?!
Sabine Rückert: Da blieben nicht viele, aber: Andreas Sentker! Also du! Du hast Rhetorik studiert, und das merkt man, etwa wenn in der Redaktionskonferenz der ZEIT die Ressortleiter die Inhalte ihrer nächsten Ausgabe vorstellen – mit welcher Akribie du das machst und mit welchem Enthusiasmus, sodass man auf jeden Fall das »Wissen« lesen will. Da dachte ich, der ist der Richtige!
Andreas Sentker: Und ich war völlig unschuldig! Die Faszination für das Verbrechen hast du, Sabine, erst bei mir geweckt. Dieser Blick in die Abgründe des Menschen. Aber das eigentlich Faszinierende daran ist, was Verbrechen über die Normalität des Menschen verraten, also über das, was in uns allen steckt. Das ist ein unfassbar spannender Lernprozess, den ich da durchmache, von Folge zu Folge.
Sabine Rückert: Der Podcast ist ja eine Hörveranstaltung, doch zu jeder Folge gibt es mindestens einen Text, der sehr ausgefeilt ist, eine durchdachte Dramaturgie hat. Wir haben uns gedacht: Die Hörerinnen und Hörer sollten nun auch etwas zum Anschauen und zum Nachlesen und Vertiefen bekommen, nämlich die ursprünglichen Artikel zu ausgewählten Podcast-Folgen.
In diesem Buch finden sie zum Beispiel den Fall Jessica, der davon handelt, dass eine Mutter und ein Vater ihr Kind im Nebenzimmer verhungern ließen, während sie fernsahen. Ein Fall, der einen an den Menschen zweifeln lässt. Die Eltern waren ganz normale Leute, die ihr Kind eben verhungern ließen. Dieser Motivlage nachzugehen, das hat mich Nerven gekostet.
Andreas Sentker: Fälle mit Kindern – die gehen einem sehr, sehr nah. Aber es gibt noch einen anderen Fall, der mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, weil er zeigt, wie zufällig und schicksalhaft das Leben manchmal spielt: der Fall des jungen Mannes, der in der U-Bahn erstochen wird. Einfach, weil er da sitzt und weil er lacht.
Sabine Rückert: Ohne Grund. Die Tat dauerte zwei Sekunden. Es gab auf den ersten Blick kein Motiv. Auch diesem Fall sind wir nachgegangen, und unsere Hörerinnen und Hörer können ihn hier noch einmal nachlesen.
Es ist das Unvorstellbare hinter der ganz normalen Fassade. Das verhungerte Kind hinter einer Fassade in Hamburg-Jenfeld, und drum herum leben Leute und sehen es nicht. Und es ist ein tödlicher Messerstich in einem überfüllten U-Bahnhof, hier in Hamburg, am Jungfernstieg, und drum herum tobt das Leben, und mittendrin steht einer, der hat sich vollkommen von der Gesellschaft verabschiedet und begeht diese Tat. Öffentlich. Da nachzufragen: Wie kommt es dazu? – das ist unsere Aufgabe.
Andreas Sentker: Und einen kleinen Einblick in das, was dieses Nachforschen bedeutet, liefert dieses Buch.
Hamburg, im Januar 2020
FAMILIENGEWALTDIE LETZTE SZENE EINER EHE
Kein Blut, keine Leiche, keine Spur: In Lübeck geht ein spektakulärer Mordprozess in die nächste Runde.
Welchen Familienstand hat ein Mann, dessen Frau verschwunden ist, der angeklagt ist, sie getötet und ihre Leiche unauffindbar verborgen oder gänzlich vernichtet zu haben? »In Ihren Personalien steht: Verheiratet«, sagt der Vorsitzende Richter zu Hartmut C. Der Angeklagte nickt: »Das stimmt.«
Dann sagt C. nichts mehr in diesem Mordprozess, der im Sommer 2002 am Landgericht Lübeck seinen qualvollen Gang geht. Er sitzt dabei, studiert Akten, schiebt seinen Anwälten Zettel um Zettel zu, macht Notizen – eine gepflegte, kalte Erscheinung Mitte 50, ein Manager in eigener Sache. C. bestreitet die Vorwürfe, die Staatsanwaltschaft und Nebenklage gegen ihn erheben. Er macht von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern. Das Reden obliegt inzwischen seinen Verteidigern. Besser für ihn, denn früher hat er sich durch allerlei Erklärungen selbst hineingeritten und erst richtig verdächtig gemacht: Seine angeblichen Alibis für die Zeit, in der Monika C. verschwand, wurden widerlegt, und die Kriminalpolizei hat ihm Lügen und Irreführungen nachgewiesen. Das ist misslich für einen Angeklagten, vor allem, wenn er durchaus Motive hatte, seine Frau aus dem Weg zu räumen, und die Familie ihn geschlossen für den Mörder hält. Stefan C., 32 Jahre alt, beschuldigt seinen Vater am 28. Juni 2002 vor Gericht ganz offen: »Er hat meine Mutter umgebracht.« – »Davon sind Sie überzeugt?«, fragt der Vorsitzende. »Mit hundertprozentiger Sicherheit, er hat meine Mutter kaltblütig ermordet.«
Vieles, eigentlich alles spricht gegen C., und doch kann man über das Kerngeschehen letztlich nur spekulieren. »Sind irgendwelche Spuren gefunden worden, die als Beweis für eine Mordtat gelten könnten?«, fragt der Vorsitzende den Kriminalbeamten Hartleben. »Nein«, antwortet der, »direkte Beweise gibt es nicht.« Leichensuchhunde haben in jenem Ratzeburger Eigenheim, in dem sich die Geschäftsfrau Monika C. am 6. Januar 1999 um die Mittagszeit in Luft auflöste, nicht angeschlagen. Auch im BMW des Angeklagten, in dem er den Körper seiner Frau weggeschafft haben soll, erschnüffelten sie nichts. Es gibt keine Mordwerkzeuge, keine Kampfspuren, keine Blutspritzer, keine Zeugen und vor allem – keine Leiche. Alle persönlichen Sachen der Monika C. sind zurückgeblieben: Schlüssel, Auto, Ausweise, Kreditkarten, Portemonnaie. Es fehlt nur das, was sie am Leibe trug, ihr Handy und sie selbst.
Niemand soll behaupten, der Rechtsstaat mache sich keine Mühe mit Hartmut C. Sein Fall beschäftigt die Gerichte bereits seit drei Jahren. Ein erster Indizienprozess am Lübecker Landgericht dauerte 14 Monate und endete am 20. Dezember 2000 mit einem Schuldspruch: lebenslange Freiheitsstrafe für Hartmut C. wegen Mordes an seiner Ehefrau Monika. C. wechselte den Anwalt: Der bekannte Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate ging für C. in Revision und hatte Erfolg. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil genau ein Jahr später auf und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück an das Landgericht Lübeck, wo sich nun eine andere Schwurgerichtskammer seit dem 23. April 2002 mit der Sache herumschlägt.
Bis zum 6. Januar 1999 treten Hartmut und Monika C. nach außen als Durchschnittspaar mittleren Alters in Erscheinung. Sie sind seit 25 Jahren verheiratet, leben in materiellem Wohlstand und haben drei Kinder. Welche Abgründe sich zwischen den Eheleuten längst aufgetan haben, welche Truppen in aller Stille zusammengezogen, welche Fallen heimlich gestellt und welche Gruben gegraben sind – das wird erst später durch die Ermittlungen der Mordkommission offenbar. Vorerst betreibt man in scheinbarer Harmonie mehrere Sonnen- und Fitnessstudios in Lübeck, Ratzeburg und Hamburg, die einen Haufen Geld abwerfen. Bis plötzlich die Frau verschwindet. »Tschüss, Mama!«, ruft ihr Jüngster, damals 13 Jahre alt, am 6. Januar mittags in den Keller, wo Monika C. ihr Büro hat. »Auch tschüss!«, kommt es von unten herauf. Das ist das Letzte, was der Junge von seiner Mutter hört. Dann trägt er mit den Nachbarskindern Zeitungen aus und übt gerade Skateboardfahren auf der Straße vor dem Haus, als kurz nach 16 Uhr der Vater in seinem mit Mülltüten vollgepackten BMW zügig aus der Einfahrt strebt. Angeblich will er Müll wegbringen. Aber die Mülltüten sind immer noch im Wagen, als er gegen 19.30 Uhr wiederkehrt. Nur die Mutter ist weg.
Was geschieht im Haus, als die Eheleute zwischen 13 Uhr und 16 Uhr allein sind? Wo steckt Hartmut C. zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr? Er sagt, er sei umhergefahren und habe eine Baustelle besichtigt. Das glauben ihm weder Polizei noch Staatsanwaltschaft, denn im Januar ist es um diese Zeit stockdunkel. Warum verschwieg C. den Beamten, dass er just am 6. Januar 1999 einen Ford Kombi angemietet hatte, wobei er – mit der Begründung, er müsse Leuchtröhren für Sonnenbänke transportieren – auf einer besonders großen Ladefläche bestand? Wenn nicht zufällig eine Angestellte der Autovermietung sein Bild in der Zeitung gesehen und sich an C. erinnert hätte, wäre die Kripo niemals auf das Leihauto gestoßen. 255 Kilometer fuhr C. damit an jenem 6. Januar. Wohin? Und warum bleibt Hartmut C. später so gelassen, obwohl seine Frau nicht mehr auftaucht? Warum sucht er nicht? Warum sieht es so aus, als ob er sich keine Sorgen macht? Warum wiegelt er bei der Polizei ab? Warum wirft er seine anderen, bereits erwachsenen Kinder hinaus, als die das Elternhaus durchsuchen wollen? Auf keine dieser Fragen hatte Hartmut C. eine plausible Antwort. Während um ihn herum alle verrückt vor Sorge sind, interessiert er sich nur dafür, die Geschäfte seiner Frau zu übernehmen.
Nach der Überzeugung des ersten Lübecker Gerichts hat C. seine Frau, als er am 6. Januar 1999 nachmittags mit ihr allein daheim war, überfallen und sie tot oder bewusstlos im Kofferraum seines BMW aus dem Haus geschafft. Er hat sie in den unauffälligen Ford Kombi umgeladen und irgendwo entsorgt. Ob er sie in den menschenleeren Weiten Mecklenburg-Vorpommerns vergraben, in einem der zahllosen Seen versenkt oder in einer Müllverbrennungsanlage in Rauch aufgelöst hat – wer weiß das? Die Polizei hat keine Spur gefunden. Sicher ist aber, dass das Ehedrama seine Klimax erreicht hatte: Monika C. hatte ihren Mann in aller Stille aus den gemeinsamen Geschäften gedrängt. Einst, als die Pleite drohte, hatte er ihr alles überschrieben. Nun, da die Unternehmen dicke Gewinne einfuhren, war sie die Chefin und ließ sich von ihm nichts mehr sagen. Hartmut C. leitete dafür heimlich Geld von gemeinsamen Depots auf eigene um, seine Frau sperrte ihm daraufhin die Konten, sie erteilte ihm in diversen Studios Hausverbot, sie plante die Scheidung, und – sie fing an, um ihr Leben zu fürchten. Die Ehe war an jenen Punkt gelangt, wo die Frau die Radmuttern kontrolliert, bevor sie ins Auto steigt, wo sie es vermeidet, mit dem Gatten aufs Meer zu fahren, aus Argwohn, nicht mehr zurückzukehren. Eine Generalvollmacht, die dem Mann im Falle ihrer Verhinderung alle Macht über die Firmen verliehen hätte, unterschreibt Monika C. nicht. »Das wäre mein Todesurteil«, sagt sie zu Zeugen.
Mit einer falschen Vollmacht versucht C., wenige Tage nachdem seine Frau vermisst wird, die Firma wieder in seine Gewalt zu bringen. Er will unbedingt an das Codewort für den Geschäftscomputer gelangen und die Hoheit über die Konten zurückerobern. Auch dieses Auftreten wertete das Gericht in jenem ersten Prozess als ihn belastendes Nachtatverhalten. 156 Zeugen ließen die Richter aufmarschieren, um jede Minute jenes Januartages zu rekonstruieren. Wer hat Frau C. zuletzt gesehen? Was sagte sie? Was trug sie?
Was für ein Mordprozess! Die Fantasie der Hörer wird an ihre Grenzen getrieben. Niemand vernahm Schreie oder sah Blut fließen, es gibt keine rechtsmedizinischen Berichte und keine Polizeifotos von der Toten. Das Verbrechen, um das es hier geht, ist mit Sinnen nicht fassbar, das Unvorstellbare muss in der Vorstellung dessen entstehen, der an der Hauptverhandlung teilnimmt. Doch Beweis um Beweis trugen die Richter zusammen, und wer das 216 Seiten starke Urteil liest, ist von der Schuld des Hartmut C. überzeugt. Es bleibt kein vernünftiger Zweifel: Auch die theoretischen Varianten, Frau C. könnte Suizid begangen oder sich mit einem Geliebten davongemacht haben, fallen in sich zusammen.
Zu den Indizien passt die Persönlichkeit des Angeklagten. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigt ihm eine »Als-ob-Persönlichkeit«, die immense Unsicherheiten und Ängste mit der Fassade des Machers, des Herrn-im-Haus kaschiere. Kontrolle über die Umgebung sei C. das Wichtigste, mit Reichtum und Statussymbolen versuche er sein schwaches Ego zu stabilisieren. Gerate sein glanzvolles Selbstbild aber in Konflikt mit der Realität, so tue er »vieles, wenn nicht gar alles dafür«, die schöne Illusion zu retten.
All das hat dem Landgericht im Jahre 2000 die Gewissheit verschafft, dass Hartmut C. seine Frau getötet haben muss. Daran fand der Bundesgerichtshof nichts auszusetzen. Die Schwurgerichtskammer habe sich »rechtsfehlerfrei davon überzeugt«, heißt es in der Aufhebungsentscheidung. Allerdings sei nicht sicher nachgewiesen, dass Monika C. tatsächlich einem Mord zum Opfer fiel, dass sie planvoll »aus niedrigen Beweggründen« beseitigt wurde. Sie könnte schließlich auch aus Versehen im Kofferraum erstickt oder beim Herumgeschlepptwerden so heftig mit dem Kopf aufgeschlagen sein, dass sie starb. Und auf Körperverletzung oder Freiheitsberaubung mit Todesfolge beziehungsweise fahrlässige Tötung steht nicht »lebenslänglich«.
Deshalb also dieser zweite Prozess, er kann sich weit ins Jahr 2003 hineinziehen. Doch was soll er noch zutage fördern? Die Tat selbst wird für alle Ewigkeit im Dunkeln bleiben, wenn C. nicht gesteht. Seine Frau ist nach wie vor verschwunden. Kein Lebenszeichen, keine Leiche. Die Beweislage ist dieselbe geblieben, dieselben Zeugen treten wieder auf und sagen, was sie schon einmal gesagt haben, nur ungenauer. Aus vielen ist so gut wie gar nichts mehr herauszuholen. Der Vorsitzende Richter, Fritz Vilmar, ein freundlicher Mann, müht sich redlich. Hat die Zeugin K., damals Angestellte im Fitnessstudio, einen Ford Kombi gesehen? »Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her.« War etwas auffällig an Herrn C. in jener Zeit? Frau K. erinnert sich nicht. Auch mit Frau T., Rezeptionistin im Sonnenstudio, hat der Vorsitzende wenig Glück. Ihr ist so gut wie alles entfallen. Vilmar wendet seine ganze Nachsicht auf: »Wie kam C. denn an beim Personal? Das werden Sie doch noch wissen!« Pause. Dann flüstert die Frau: »Wenn schon sein Auto vor der Tür stand, hatte ich Angst.«
Zähe Tage im Saal 163. Das Gericht schürft im Gedächtnis der Zeugen. Viele haben 1999 bloß eine beiläufige Wahrnehmung gemacht, die sie inzwischen vergessen haben; den meisten muss mit Vorlesungen aus dem Polizeiprotokoll auf die Sprünge geholfen werden. Draußen zieht der Sommer heran, es wird heiß und stickig. Die Verfahrensbeteiligten leiden in ihren schwarzen Roben. Verstohlenes Gähnen. Welch packender Kriminalfall, welch langweilige Verhandlung.
Es ist, als ginge man ein zweites Mal in denselben Film, und die Spannung ist dahin. Vielleicht liegt die Öde am Klein-Klein eines Indizienprozesses. Vielleicht liegt sie an der sinnentleerten Welt der Sonnenstudios und Fitnessclubs, in der die Menschen letztlich nichts voneinander wissen und nichts übereinander sagen können. Das Opfer scheint eine Frau ohne Eigenschaften gewesen zu sein. Frau C. war »nett und freundlich«, lautet die stereotype Beschreibung, »hilfsbereit und ein Familienmensch«. Und sonst? Warum lebt eine Frau so lange mit einem Mann, der vor allem finstere Charakterzüge hat? Hat sie ihn nicht durchschaut? Was hat sie an ihm fasziniert? Was bei ihm gehalten?
Kein großes Drama. Kein Blut. Keine Spur. Wenn C. seine Frau umgebracht hat, dann diskret und feige, so wie es in dieser Ehe eben zuging. Eine Ehe ohne offen ausgetragene Konflikte, ohne Tränen, Wut, Krach und Leidenschaft. Ohne Aussprachen, ohne Ausbrüche, ohne Aus-der-Rolle-Fallen. Man sperrte sich hinterrücks die Konten und ging gemeinsam aus. Man stahl sich Verträge aus dem Aktenkoffer und aß höflich zusammen das Frühstücksei. Man machte den Termin beim Scheidungsanwalt und feierte gemeinsam Weihnachten. Man hasste einander – doch wahrte stets die Contenance. Welch tödliche Maskerade! Kein Schriftsteller hätte ein konsequenteres Ende dieser Ehe ersinnen können.
Bisher läuft der zweite C.-Prozess ganz in den Geleisen des ersten. Auch die Fragen des Verteidigers Strate und seiner Kollegin bringen die Stimmung nicht ins Kippen. Dennoch scheint der Anwalt guter Dinge. Gleich zu Beginn der Hauptverhandlung hat er eine Besetzungsrüge platziert, in der er nachweist, dass sich hier die falschen Richter mit dem Fall befassen. Sollte sein Mandant erneut verurteilt werden, könnte es Strate deshalb noch einmal gelingen, beim Bundesgerichtshof eine Urteilsaufhebung zu erreichen. Die Folge wäre ein dritter C.-Prozess, der wieder Unsummen kosten und noch dickflüssiger dahinkriechen dürfte. Die Justiz wird den »Mord ohne Leiche« so schnell nicht los.
»Wenn man rational an die Dinge herangeht, dann dürfte C. nicht verurteilt werden«, findet Strate. Vor ihm liegt das Verschollenheitsgesetz, von dessen Vorschriften er sich die Lösung seiner Probleme verspricht. Und dann erzählt er den Schwank von jenem amerikanischen Staranwalt, der einen Mann, dessen Ehefrau spurlos verschwunden war, in einem Mordprozess verteidigte: »Durch diese Tür wird die Verschwundene gleich eintreten«, kündigt der Verteidiger im Gerichtssaal den Geschworenen an. Alle blicken gespannt zur Tür. Nichts geschieht. »Sehen Sie«, hält der Verteidiger den Geschworenen entgegen, »Sie hegen ja selbst im Stillen Zweifel, ob die Frau wirklich tot ist. Sonst hätten Sie nicht so gebannt zur Tür gestarrt. Sie können meinen Mandanten jetzt nicht mehr verurteilen.« Doch das Gericht verurteilt den Angeklagten. »Ihnen ist etwas entgangen«, sagt der Richter zum Verteidiger. »Ihr Mandant hat nicht zur Tür geschaut.«
So weit die Geschichte. Strate wird das Experiment jenes amerikanischen Kollegen in Lübeck wohl nicht wiederholen.
Aus: DIE ZEIT 33/2002, 8. August 2002, von Sabine Rückert
ZEUGEN (1)NICHTS ALS DIE UNWAHRHEIT
Sie behaupten, von Neonazis oder Sexualverbrechern überfallen worden zu sein. Geschichten, von denen oft kein Wort wahr ist. Falsche Zeugen werden für die Justiz zunehmend zum Problem. Leidtragende sind die echten Opfer.
Im Rathaus sind Blumen abgegeben worden, spontan haben sich Demonstrationen gebildet. Bestürzte Bürger aus der Region haben Kerzen am Tatort aufgestellt, Fanpost und Geld geschickt an die tapfere junge Frau von Mittweida. Rebecca K. ist am Abend des 3. November 2007 einem kleinen Kind zu Hilfe geeilt, das von Rechtsradikalen drangsaliert wurde, und hat ihren Mut bitter büßen müssen: Die vier martialischen Gestalten haben sie gepackt und ihr mit einer skalpellartigen Waffe ein Hakenkreuz in die Hüfte geritzt – obwohl sie sich nach Kräften gewehrt hat.
Diese Geschichte jedenfalls erzählte Rebecca K., und als Matthias Damm, Bürgermeister des sächsischen Städtchens, der 17-Jährigen in die Augen schaute, schenkte er ihr Glauben. Damm dachte bei sich: »Sollte sie gelogen haben, wird sie mir jetzt nicht ins Gesicht sehen können.« Doch Rebecca hielt seinem Blick stand. Heute weiß der Bürgermeister allerdings nicht mehr, was er von Rebecca halten soll. Fast alles, was die Polizei ermittelt hat, spricht dafür, dass das Mädchen sich diese brutale Szene bloß ausgedacht hat.
Im November 2007 jedenfalls schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Reporter und Kamerateams strömten nach Mittweida. Hatte man nicht geradezu auf das nächste Nazidelikt im Osten gewartet? Und jetzt hatte es sogar ein hilfloses Kind und ein unerschrockenes junges Mädchen getroffen! Die Polizei gab vorschnell bekannt, die Zeugin sei glaubwürdig.
Dabei gab es von Anfang an Ungereimtheiten in Rebeccas Geschichte: So ist sie nach ihrem traumatischen Erlebnis nicht einmal zur Polizei gegangen. Auch ihre Eltern erfuhren erst durch einen Verwandten von dem Überfall auf ihre Tochter; sie waren es, die Rebecca schließlich dazu drängten, den Vorfall anzuzeigen – neun Tage nach der Tat.
Auch von den zahlreichen Augenzeugen, die nach Rebeccas Angaben deren Martyrium tatenlos auf Balkonen stehend mitangesehen haben sollen, meldete sich keiner, nicht einmal, als 5000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt wurden. Die Polizei ermittelte zwar eine Sechsjährige, die das schikanierte kleine Kind hätte sein können, doch auch diese Spur löste sich im Nichts auf.
Blieb das in die Hüfte eingeritzte Hakenkreuz als einziger Beweis. Eine Rechtsmedizinerin hielt es für möglich, dass Rebecca sich die Wunde selbst zugefügt haben könnte, legte sich aber nicht fest. Erst als die Staatsanwaltschaft Chemnitz den Chef der Gerichtsmedizin Hamburg, Klaus Püschel, um ein Gutachten bat, kam Licht in die Sache. Püschel ist ein Fachmann für selbst beigebrachte Hautläsionen in Hakenkreuzform, er hat darüber zahlreiche Aufsätze veröffentlicht und verfügt über eine ansehnliche Fotosammlung von blutunterlaufenen Hakenkreuzen auf Stirnen, Bäuchen, Armen und Beinen – die alle von der Hand der vermeintlichen Opfer stammen. Als Püschel die Fotos von Rebeccas Wunden analysiert, hat er keinen Zweifel, dass es sich um Selbstbeschädigungen handelt.
Vorgetäuschte Straftaten gehören zum Alltag der Gerichtsmedizin. Selbst beigebrachte Wunden erkennt der Fachmann zum Beispiel daran, dass sie an für die eigenen Hände leicht zugänglichen Körperpartien liegen, vor allem an Armen, Brust und Gesicht. Wichtige Funktionsbereiche wie Augen und Ohren oder schmerzempfindliche Regionen – Lippen oder Brustwarzen – bleiben ausgespart. Bei den Verletzungen handelt es sich meistens um sehr oberflächliche Ritz- und Schnittverletzungen, die sorgfältig parallel und gerade gezogen sind – so sehen gewaltsam beigebrachte Wunden nicht aus, schon gar nicht nach heftiger Gegenwehr. Eine polizeiliche Anzeige komme bei diesen Patienten fast ausschließlich auf Druck der Eltern oder Partner zustande.
Allein in der Hamburger Rechtsmedizin melden sich pro Monat zwei bis drei junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren, die versuchen, sich als angebliche Opfer von Gewalt- und Sexualdelikten vorzustellen. Die meisten werden rasch enttarnt, denn die Befunde decken sich nicht mit ihren Schilderungen. Viele gestehen alsbald. Die Motive der Frauen sind unterschiedlich, manche wollen jemandem gezielt Schaden zufügen, andere flüchten sich in die Opferrolle, um einem Konflikt in der Familie oder am Arbeitsplatz zu entrinnen, wieder andere wollen einfach nur die Zuwendung der Umwelt erzwingen.
Das selbst geritzte Hakenkreuz kommt vornehmlich im Osten vor. 1994 erregte eine junge Rollstuhlfahrerin aus Halle international Aufsehen: Sie gab sich medienwirksam als Opfer von Rechtsextremisten aus, nachdem sie sich das Nazimal eigenhändig ins Gesicht geschnitten hatte. Manfred Kleiber, dem Chef der örtlichen Gerichtsmedizin, genügte damals eine Blickdiagnose. Ihm kommt alle ein bis zwei Jahre so ein Hakenkreuz unter die Augen – die Presse erfährt in den meisten Fällen nichts, und die Staatsanwaltschaft stellt die Verfahren in aller Stille ein. »Auch deshalb, weil die Selbstbeschädiger oft an einer psychischen Störung leiden«, sagt Kleiber. Ihre Wunden seien Appelle an die Umwelt, sich ihrer endlich anzunehmen. Und das Hakenkreuz stelle eine »maximale Tabuverletzung« dar und damit eine »Optimierung der öffentlichen Aufmerksamkeit«.
Eine Lüge ist umso effizienter, je perfekter sie die Erwartungen der Belogenen bedient. Mancher Zeitungsleser erinnert sich noch an den Rummel um eine mit einem Iraker verheiratete Frau aus einem sächsischen Städtchen, die im Jahr 2000 behauptet hatte, ihr kleiner dunkelhaariger Sohn Joseph sei von einer Horde Rechtsradikaler im städtischen Freibad ertränkt worden. Alle Badegäste hätten zugesehen. Die Medienreaktion erschütterte die Republik. Josephs Mutter ließ sich als Pietà von Sachsen tausendfach interviewen und fotografieren, sie geisterte durch Talkshows und wurde vom damaligen Bundeskanzler Schröder empfangen. Einige junge Leute wurden als Verdächtige festgenommen. Kaum jemand bezweifelte, dass die Geschichte von den mörderischen Rassisten stimmte.
Dem Rausch folgte die Ernüchterung. Die Staatsanwaltschaft Dresden ließ alle Inhaftierten nach wenigen Tagen wieder frei, sämtliche Vorwürfe der Frau waren erfunden gewesen. Der sechsjährige Joseph hatte einen tödlichen Badeunfall erlitten; seine grausame Ermordung durch grölende Neonazis war nichts anderes gewesen als das Fantasiegespinst einer Mutter, die über den Tod ihres Kindes nicht hinwegkam.
Und nun Rebecca aus Mittweida. Welche Motive mochten sich hinter der vermuteten Selbstverletzung verbergen? Ihr Fall jedenfalls nahm einen grotesken Verlauf: Das Berliner Bündnis für Demokratie und Toleranz, eine im Jahr 2000 vom Bundesinnen- und Bundesjustizministerium ins Leben gerufene Initiative gegen rechte Gewalt, entschloss sich, ihr den Ehrenpreis für Zivilcourage zu verleihen – unbeeindruckt von der Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen die designierte Preisträgerin mittlerweile wegen des Verdachts der Vortäuschung einer Straftat ermittelte. Es gehe in erster Linie darum, »Zivilcourage zu loben, und nicht um die Frage, ob das Mädchen sich diese Verletzung, von der immer wieder die Rede ist, selbst beigebracht« habe, sagte Rebeccas Laudatorin, die ehemalige parlamentarische Staatssekretärin Cornelie Sonntag-Wolgast, in das Mikrofon des Lokalsenders 99drei Radio Mittweida.
Am 1. Februar 2008 findet der Festakt im Rathaus Mittweida statt – und Rebecca kommt. Ihre Eltern und ihr Anwalt Axel Schweppe schirmen sie vor lästigen Fragern ab. In einer kleinen Rede dankt sie unter Schluchzern all jenen, die »trotz all dem Schwachsinn, der verbreitet wurde, zu mir gehalten haben«. Anschließend präsentiert sie sich »profihaft dem Medienansturm«, wie die Freie Presse befremdet registriert. Sie dreht und wendet sich bereitwillig vor den Kameras und nimmt die Gratulationen strahlend entgegen. Ob die Staatsanwaltschaft das Mädchen jetzt anklagen oder das Verfahren – wie es auch sonst meist geschieht – einstellen wird, ist noch offen. Sollte sie selbst die Urheberin des Hakenkreuzes sein, ist ein Geständnis von Rebecca jetzt nicht mehr zu erwarten, der Gesichtsverlust wäre zu gewaltig. Spätestens die Preisverleihung hat ihr den Rückweg zur Wahrheit abgeschnitten.
Falsche Zeugen, die ein großes Interesse am Ausgang eines Verfahrens haben, kommen bei den unterschiedlichsten Delikten vor. Alle aber eint, dass sie die Wahrheitsliebe dem eigenen Vorteil unterordnen – der für jeden anders aussehen kann: Der Unfallfahrer beharrt darauf, dass ihm die Vorfahrt genommen worden sei; der diebische Geldbote gibt an, die Geldbombe sei ihm entrissen worden; die verlassene Geliebte will vom einstigen Liebhaber vergewaltigt worden sein; der enttäuschte Geschäftsmann bezichtigt seinen ehemaligen Kompagnon des Betrugs; und dann gibt es noch das Heer jener, deren Motiv zunächst gar nicht erkennbar ist, die es aber auf das höchste Gut einer Mediengesellschaft abgesehen haben: die Währung Aufmerksamkeit. Es sind die psychisch Fragilen, die die Justiz mit ihren Erzählungen in Atem halten. Menschen, die an Persönlichkeitsstörungen leiden, die in Selbstwertkrisen stecken, Personen, die sich ungeliebt und verstoßen fühlen. Wichtigtuer sind der Schrecken der Strafverfolger, es gibt sie schon so lange wie die Justiz selbst – doch ihre Zahl wächst. Liegt es daran, dass mehr und mehr Menschen vereinsamen, in seelische und soziale Not geraten? Liegt es an der Allgegenwart des Fernsehens, das den Unbeachteten Macht suggeriert, in Doku-Soaps und Gerichtsshows?