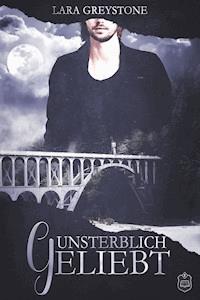Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeit zum Überleben
- Sprache: Deutsch
Jessica und Marc fanden in Espoir Zuflucht und haben sich hinter den Stadtmauern verbarrikadiert. Aber nach dem ersten, überstandenen Angriff rückt eine gefürchtete Bande aus Gefängnisinsassen in ihre Region vor. Marc ist es gelungen, Jessicas Herz zu erobern, aber nicht in erster Linie mit seinem Charme, dem durchtrainierten Body und seinen seidigen, rotbraunen Locken. Nein, er hat es geschafft, mit ihren sexuellem Trauma umzugehen und lockt sie allmählich aus ihrem Schneckenhaus. Doch plötzlich behauptet er, ein Mörder zu sein und dann taucht da auch noch der Albtraum aus Jessicas Vergangenheit auf. Währenddessen stehen sie vor der Herausforderung, in einer fast von Menschen ausgerotteten Welt, in der jegliche Elektronik durch EMP-Wellen zerstört wurde, Felder abzuernten, Wintervorräte anzulegen und eine Kuh zu melken – und das ohne Erfahrung und teils mittelalterlichen Methoden… Zweiter & letzter Teil von "Zeit zum Überleben"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lara Greystone
Zeit zum Überleben - Zukunft
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Nachwort
„Sanft berührte Narben“
Bisher erschienen von Lara Greystone:
Cover & Korrektorat
Danksagung
Über den Autor
Rechtliches
Leseprobe aus „Sanft berührte Narben“
Impressum neobooks
Prolog
Zeit zum Überleben – Zukunft
Ein Roman von Lara Greystone
Ich bin Jessy und meine ganz normale, spießige Welt wurde vor einigen Monaten völlig aus den Angeln gehoben.
Dieses Land und seine Nachbarländer sind leer und still geworden. Na ja, bis auf den Hahn, der mir mit seinem Gekrächze schon vor Sonnenaufgang den letzten Nerv raubt.
Still – denn der Lärm der modernen Zivilisation ist verstummt.
Leer – denn es leben kaum noch Menschen.
Das liegt an dem Krieg, wobei es kein Krieg im herkömmlichen Sinne war. Eigentlich ging es nur um Rohstoffe, denn die waren der stetig wachsenden und riesigen Exportnation im Osten ausgegangen. Die anderen Länder hatten selbst nicht mehr genug für den Verkauf, denn es war für alle knapp geworden. Aber zum Exportieren braucht man eben Rohstoffe, von Öl mal ganz abgesehen.
Es fielen keine Bomben.
Es gab auch keine Kriegserklärung.
Es brach nur plötzlich eine neue Welle der Vogelgrippe aus, und zwar ein extrem ansteckender Virenstamm.
So fing alles an …
Still und heimlich hatte die Nation im Osten zuvor ihre Bürger geimpft. Heute kalkuliert man, dass nur 60 Prozent der Bevölkerung dieser Grippe zum Opfer gefallen wären. Aber da gab es jenen Pharmakonzern, der mit ebenso viel finanzieller Gier wie Hastigkeit einen Impfstoff entwickelt hatte. Angesichts der Sterberate war die Angst größer als die Vorsicht und es war ja auch das einzige Mittel auf dem Markt. Und mit dem grassierenden Tod vor Augen fragte niemand nach, nur das Überleben zählte noch.
In Windeseile ließ sich die gesamte Bevölkerung impfen und der Konzern wurde unsagbar reich. Aber erst starben Tausende wegen unerwarteter Nebenwirkungen und dann mutierte der Virus sogar noch in eine weitaus aggressivere Form. Die Experten waren sich später einig, dass der nicht ausreichend getestete Impfstoff dafür verantwortlich war.
Unterm Strich starben in manchen Regionen über 99 Prozent der Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit.
Nun brauchen wir nicht mehr so viele Rohstoffe.
Zur ursprünglichen Strategie der Armee aus dem Osten gehörten auch Pläne, Teile von Mitteleuropa und Afrika zu überrennen. Dazu setzten sie flächendeckende sogenannte EMP-Wellen ein. Die sorgten dafür, dass alle elektronischen Geräte von einer Sekunde auf die andere dauerhaft funktionsunfähig waren.
»Ohne einen Tropfen Blut erleben wir den verheerendsten Krieg aller Zeiten«, betitelte es die letzte Ausgabe einer Zeitung, die nur noch auf einem gefalteten DIN-A3-Blatt erschien.
Unser Land war am Boden.
Ein öffentliches Leben existierte nicht mehr. Alles war geschlossen, die Straßen menschenleer. Unser komplettes System – Kommunikation, Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen – hatte sozusagen einen tödlichen Kollaps erlitten.
Unsere Bündnispartner schafften es zwar, die Invasionspläne des Ostens zu vereiteln, doch aufgrund des extrem aggressiven Virus wurden sämtliche Landesgrenzen dicht gemacht. Ein paar Inseln wie Australien, Neuseeland und Island gelang es auf diese Weise, einigermaßen verschont zu bleiben. In den anderen Staaten regierte die nackte Angst. Überall summierte man tagtäglich die Toten und gab neue Hochrechnungen heraus.
Ich hatte Glück und war eine unter Tausenden, die immun gegen diesen Virus war. Aber auch für mich hatten sich die Zeiten gründlich geändert: Es wurde nämlich Zeit zum Überleben.
Jeden Tag musste ich aufs Neue Nahrung und frisches Trinkwasser suchen und das in ständiger Angst vor den Hellhounds, denen ich mehrmals nur knapp entwischt war. Hellhounds nennt man die Plündererbanden, die wie Wanderheuschrecken in Städte einfallen, verwüsten, vergewaltigen und morden. Oft war für mich nur noch Zeit zum Überleben – zumindest, bis ich Marc traf. Er sagte mir, dass Überleben nicht alles ist. Statt uns zu verstecken und zu flüchten, versuchen wir nun, uns hier in Espoir ein neues Leben aufzubauen, doch die Hellhounds könnten jederzeit auftauchen …
Kapitel 1
»Ich bringe diesen Hahn um! Ich geh raus und dreh ihm die Gurgel um!«
Ich zerre das Federkissen unter mir hervor und presse es zornig auf mein Gesicht.
»Kann halt nicht alles perfekt sein, Jessy«, murmelt Marc schlaftrunken neben mir. »Sonst wären wir in Utopia und nicht in einer vom Krieg auf den Kopf gestellten Welt.«
Da hat er leider recht.
Vor ein paar Monaten hatte ich noch einen Job. Ein Leben ohne mein Handy wäre für mich undenkbar gewesen und ich hätte mir nie vorstellen können, für warmes Badewasser einen Ofen mit Holz zu heizen! Aber dieser Krieg um Ressourcen hat fast alle Menschen durch diesen Virus ausgerottet und die EMP-Angriffe haben jegliche Elektronik in Schrott verwandelt. Der Todesstoß für unsere gesamte Kommunikation und Infrastruktur.
Früher habe ich mich immer über Strafzettel und Tempolimits aufgeregt. Heute würde ich mit Freuden jedes Bußgeld zahlen, wenn es dafür noch eine Polizei gäbe, die mich vor den Hellhounds schützt. Wir könnten nämlich jederzeit von einer dieser Plündererbanden überfallen werden und ich würde mir eher die Kehle durchschneiden, als von so einer Horde vergewaltigt zu werden.
Eines ihrer Opfer liegt unten im Wohnzimmer. Sie haben die blutjunge Frau so schlimm zugerichtet, dass sie die Nacht wohl nicht überlebt haben wird. Dann sind wir nur noch zu zweit in diesem Dorf.
Als Marc sie gestern fand, war sie schon nicht mehr bei Bewusstsein und ohne Ärzte stehen die Chancen in so einem Fall fast gleich null. Sie ist eine Fremde für uns, wir kennen noch nicht mal ihren Namen. Aber Marc hätte es trotzdem nie übers Herz gebracht, sie mutterseelenallein dem Sterben zu überlassen. Also transportierte er die halb tot Geprügelte hierher zu uns nach Espoir, was übersetzt Hoffnung heißt.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich Marc liebe: Er hat Charakter, Mitgefühl und einen Beschützerinstinkt, der mir bereits mehr als einmal das Leben gerettet hat. Als ich ihn das erste Mal traf, dachte ich, er gehört zu den Hellhounds und würde über mich herfallen. Doch das tat er nicht. Er hat mein Nein akzeptiert und mich trotzdem kurz darauf vor einer dieser Banden beschützt. Dabei hat er sich einen Bauchschuss eingefangen und wäre beinahe gestorben.
Der dämliche Hahn, der demnächst zum Brathähnchen befördert wird, krächzt schon wieder!
Ich kapituliere seufzend und schiebe das Kissen von meinem Kopf.
»Ich sollte nach ihr sehen.«
Gestern Abend habe ich die Misshandelte, die womöglich noch ein Teenager ist, gebadet. Habe mit Lavendelseife abgewaschen, was die Hellhounds auf ihr hinterlassen hatten. Ihre langen, blonden Haare wurden von mir mit Rosenshampoo vom Dreck befreit. Ich habe ihr Gesicht eingecremt, zwei Zöpfe geflochten und ihr ein weiches Flanellnachthemd mit unzähligen, kleinen Blümchen angezogen, das so himmelblau ist wie ihre Augen. Ich schätze, sie hat von alldem nichts mitbekommen und vielleicht lebt sie gar nicht mehr. Trotzdem konnte ich nicht anders. Ich wollte ihr dadurch ein Stück Würde zurückgeben.
Dass eine so zarte, junge Frau das Ausmaß an Brutalität überlebt, das sich auf ihrem Körper abgezeichnet hat, glaube ich kaum.
Gerade will ich mich aufraffen und aus dem Bett quälen, da zieht uns Marc die gemeinsame Bettdecke über den Kopf.
»Warte noch.«
»Worauf?«, frage ich skeptisch, denn immerhin liegen wir nur mit T‑Shirt im Bett und Marc ist stärker als ich.
Meine erste Erfahrung mit Sex als Teenager war unfreiwillig und hat ein Trauma hinterlassen. Und vor Kurzem bin ich bei zwei nächtlichen Übergriffen von Hellhounds nur knapp entkommen. Alles in allem habe ich dadurch einen ganz schönen Knacks in Sachen Sex.
»Schsch«, murmelt Marc unter der Decke und streicht mir sanft eine meiner langen, feuerroten Locken aus dem Gesicht.
»Bevor wir uns durch diesen neuen Tag kämpfen, wollte ich dich noch mal ansehen und …«
»Und?«, frage ich und spüre schon Panik in mir aufsteigen.
»Dir sagen, dass ich froh bin, dich gefunden zu haben.«
Dabei küsst er mich mit seinen unglaublich weichen Lippen auf die Stirn.
»Du magst eben Rothaarige«, erwidere ich und versuche lapidar zu klingen. Das war eines der ersten Dinge, die er mir bei unserer ersten Begegnung machohaft mitteilte, vermutlich um cool zu wirken.
Für seinen zarten Kuss hat sich Marc allerdings halb auf mich gelegt und das macht mir eine höllische Angst. Dabei hat er das wirklich nicht verdient! Er war bisher immer nett und sanft zu mir, hat mich schon zweimal davor bewahrt, den Hellhounds in die Hände zu fallen. Außerdem sieht er zum Anbeißen aus: Marc hat breite Schultern und kein Gramm Fett. Er ist über 1,80 Meter groß und auf der gesamten Länge äußerst gut gebaut und durchtrainiert, ohne dabei ein Meister Proper zu sein.
Ich mag seine üppigen, kastanienbraunen Haare, die ihm bis auf die Schulterblätter reichen. Sie fühlen sich seidig an, wenn ich mit meinen Finger hindurchfahre. Bindet er sie nicht im Nacken zusammen, dann kommen wie jetzt seine Locken zum Vorschein. Im Blick von Marcs warmen, bernsteinfarbenen Augen möchte ich oft nur versinken und alle Probleme um mich herum vergessen. Seine viel zu verführerischen, vollen Lippen zu küssen, ist zum Dahinschmelzen, und sie stellen auch anderswo wunderbare Dinge an. Gestern Abend hat er mit kaltem Wasser seine Haare gewaschen und nun duften sie herrlich nach Minze. Er hatte sich auch rasiert, nur sein süßer, kleiner Spitzbart am Kinn ist übrig geblieben und der kann an intimen Orten neckisch kitzeln. Dass Marc trotz der widrigen Umstände immer noch Wert auf ein sauberes Äußeres legt und recht gepflegte Hände hat, zeigt ebenfalls seinen Charakter. Obwohl unsere Zivilisation am Boden liegt, lässt sich nicht jeder gehen und zwingt dem Schwächeren seinen Willen auf.
»Du bist steif wie ein Brett«, bemerkt Marc und ich höre die Enttäuschung heraus.
Ich bin es so leid, Angst zu haben, vor allem vor ihm! Diese ständige Angst ist wie eine würgende Hand, die sich immer enger um meine Kehle legt.
Die Situation wird mir zu viel.
Mir brennt eine Sicherung durch.
Ich werfe Marc fast von mir herunter und stolpere aus dem Bett.
»Tut mir leid, Marc«, stammle ich noch und greife dann hastig nach meinen Klamotten.
Mit fahrigen Bewegungen ziehe ich mich hektisch an.
»Das hat nichts mit dir zu tun, Marc. Es passiert einfach.«
Ich stecke meinen zweiten Fuß gerade in den Wanderstiefel – die sind eindeutig besser für den Überlebenskampf geeignet als High Heels von Gucci –, da streckt Marc auf dem Bett liegend seine Hand aus und hält mich am Arm fest. Ich presse die Kiefer aufeinander, um mich nicht panikartig loszureißen.
»Gib mir einfach Zeit, Marc. Okay?«
»Du musst endlich mit mir darüber reden, Jessy.«
Ja klar! Reicht es nicht, dass ich einen ziemlichen Knacks habe? Muss ich das auch noch in aller Ausführlichkeit erklären und die verhassten Erinnerungen aus ihrem Kerker lassen? Wobei es mir ja eh nicht immer gelingt, sie dort gefangen zu halten!
Ich antworte also lieber gar nicht und sage stattdessen: »Ich heize den Herd unten in der Küche an. Kochst du dann den Kaffee? Deiner schmeckt nämlich besser.«
Vorbei die Zeit, in der man nur Kaffeepulver einfüllte und auf ein Knöpfchen gedrückt hat. Wenn man heutzutage einen Kaffee trinken will, bedeutet das einen ziemlich Aufwand: Man muss den Holzherd in der Küche anfeuern, einen Kessel mit Wasser aufsetzen und erst mal warten, bis es endlich kocht. Dann wird Schluck für Schluck das kochende Wasser auf den Kaffee im Filter gegossen, unter dem eine Kanne steht. Wenn man auch noch Milch dazu haben möchte, muss man vorher die Kuh in unserem Stall melken und darin bin ich leider eine Niete. Also wird mein Kaffee schwarz sein.
Ich eile aus dem Schlafzimmer, drücke mich aber davor, sofort hinunter ins Wohnzimmer zu gehen, wo wir die misshandelte Frau auf das Sofa gelegt haben. Ich schließe Menschen nämlich schnell ins Herz und genau das wird mir brechen, wenn ich gleich die Leiche der blutjungen Frau in ein Betttuch wickeln muss. Und ich werde noch nicht mal ihren Namen in ein Kreuz ritzen können, denn sie war nicht mehr in der Lage, ihn uns zu mitzuteilen.
Also trödle ich, während ich oben im Bad meine widerspenstigen, feuerroten Locken zu einem langen Zopf flechte. Das ist in diesen Zeiten leider praktischer, als sie offen zu tragen. Erst als ich auch meine Zähne recht ausgiebig geputzt habe, zwinge ich mich, die Treppe hinunterzugehen.
Dabei fällt mein Blick auf die Wanderstiefel und ich bekomme ein schlechtes Gewissen. Früher wäre ich nie mit solchen Schuhen im Haus herumgelaufen. Mir sind gute Manieren wichtiger denn je, weil ich mich sehr nach dem normalen Leben vor dem Krieg zurücksehne. Aber wenn man jederzeit überfallen werden kann und gezwungen ist, um sein Leben zu kämpfen oder wegzulaufen, dann müssen die guten Manieren doch hier und da zurückstehen.
Ich schleiche mich zur »guten Stube« von Berta – unsere Generation würde Wohnzimmer dazu sagen. Berta war die liebenswürdige, alte Dame mit Kittelschürze, die bis gestern hier gewohnt hat und um die ich sicher lange trauern werde.
Leise öffne ich die Tür und trete zögernd an die misshandelte Frau heran. Eines ihrer Augen ist lila und zugeschwollen, ihre Lippe aufgeplatzt, vom schrecklichen Rest will ich gar nicht reden. Überrascht stelle ich fest, dass sich ihr Brustkorb hebt und senkt. Sie ist tatsächlich noch am Leben!
Kapitel 2
Ich strecke meine Hand nach der Stirn der Unbekannten aus, um zu fühlen, ob sie Fieber hat.
Plötzlich reißt sie die Augen auf und kreischt drauflos. Ich schreie, weil ich mich zu Tode erschrecke.
Dann starren wir uns gegenseitig an.
Ich höre, dass Marc die Treppe herunterpoltert. Als er Sekunden später mit nichts als seiner Unterhose, einem T‑Shirt und einem Fleischermesser zu uns hereinstürmt, kreischt die blutjunge Frau abermals.
Kein Wunder, wenn man mehrfach vergewaltigt wurde. Geduckt, als würde gleich jemand über uns herfallen, schaut sich Marc hektisch um.
»Woher?! Wie viele?!«
»Wir werden nicht angegriffen, Marc.«
Er atmet tief durch, richtet sich auf und fährt sich durch die Haare.
»Mensch, ich dachte, ihr werdet gerade abgestochen!«
»Alles gut, Marc. Wir haben nur …«
»Euch mit Gebrüll vorgestellt?«
»So ungefähr. Aber du hast recht, wir sollten uns wirklich anständig vorstellen. Also«, sage ich und schaue zu der jungen Frau, die krampfhaft ihre Decke umklammert, die sie bis zum Kinn hochgezogen hat. Sie starrt Marc mit einem Ausdruck der Panik an. »Das ist Marc.« An ihn gewendet presse ich leise hervor: »Mensch, leg das Messer endlich weg!«
»Ach so, ja«, murmelt er und legt das gut 30 cm lange Ding auf den Tisch neben das Sofa, auf dem die Frau liegt.
Sie reißt die Waffe sofort an sich und hält sie schützend vor ihre Brust.
Marc seufzt und zeigt dann auf sein T‑Shirt, das ich ihm als Nachtwäsche aufgebrummt habe. Es ist ihm peinlich, sein Gesichtsausdruck verrät das. Darauf ist nämlich Snoopy abgebildet, der Woodstock – den kleinen gelben Vogel – innig drückt, dazu noch zwei Herzchen.
»Mal ehrlich«, erklärt er der jungen Frau, »muss man sich vor einem Kerl fürchten, der so was trägt? Ein Typ, der so was anzieht, produziert vermutlich gar kein Testosteron mehr, sondern nur noch weibliche Hormone.«
»Snoopy ist süß!«, verteidige ich das Shirt und blicke lächelnd zu der Unbekannten. »Komm schon, schlag dich auf meine Seite!«
Sie schaut erst zu mir, dann wieder auf Marcs Shirt – und fängt an zu kichern.
»Ihr habt beide recht.«
»Ich geb auf und feuer den Herd an«, stöhnt Marc, und wendet sich in Richtung Küche ab. »Süß!«, stößt er kopfschüttelnd aus. »Welcher Kerl will denn auf diese Art süß aussehen? Ein Eunuch?«
Ich muss inzwischen auch kichern und bin froh, dass wir auf diese Weise das Eis gebrochen haben.
Ihre Hand krampft sich immer noch um das Messer, doch mit sichtbarer Überwindung legt sie das Messer schließlich doch auf den Wohnzimmertisch zurück.
»Und ich bin übrigens Jessica«, stelle ich mich schließlich vor.
»Du hast den Zettel geschrieben?«, fragt sie. »Und die Lampe angelassen?«
Ich nicke. Ihr treten Tränen in die Augen.
»Danke für alles. Ohne deine Notiz hätte ich geglaubt, die nächste Bande hätte mich geschnappt. Und ohne das Licht der Lampe hätte ich nicht wieder einschlafen können.«
»Ich kann auch nicht im Stockdunkeln einschlafen«, gebe ich zu. »Aber du solltest wissen, dass es Marc war, der dich gefunden und hierher in Sicherheit gebracht hat.«
»Und wo ist hier?«, fragt sie und schaut sich in der gemütlichen Stube von Berta um.
»Du bist in einem elsässischen Dorf mit Namen Espoir und erst mal in Sicherheit. Wir haben eine Stadtmauer und Tore und …«
»Eine Stadtmauer?«
»Ja, eine mittelalterliche Mauer, die wieder ihren Dienst gegen Plünderer aufgenommen hat«, erkläre ich lächelnd.
»Habt ihr auch Kanonen und Brandpfeile?«, fragt sie skeptisch.
Aber ich bin irgendwie stolz, auf das, was wir schon erreicht haben und gebe Kontra.
»Na ja, statt Kanonen haben wir Pistole und Schrotflinte, und anstelle von Brandpfeilen basteln wir Brandsätze. Aber bevor wir weiter mittelalterliche Waffen diskutieren, hätte ich echt gern deinen Namen gewusst.«
Sie blickt auf ihre Hände und zögert.
»Ich«, beginnt sie und hält dann inne. Ihre Finger kneten die Wolldecke. Ich lasse ihr Zeit. »Ich«, fängt sie erneut an und blinzelt, als ob sie Tränen verdrängt. »Kann – kann ich mir einen neuen Namen geben? Ich will vergessen, was mir passiert ist. Nie mehr dran denken. Jemand anderes sein. Neu anfangen.«
»Such dir ruhig einen aus, wenn du magst«, ermutige ich sie und schaue dann auf meine Hände. »Verdrängen wird nur leider nicht helfen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber vielleicht fängt ja jeder so an.«
Ich reiße den Blick wieder hoch.
»Aber jetzt sag mir erst mal, wie es dir geht. Brauchst du etwas?«
»Ich habe heute Nacht alle Schmerzmittel auf dem Tisch geschluckt. Mir tat jeder Knochen im Leib weh. Habt ihr noch mehr?«
Sie hält sich die Hände dabei auf den Unterleib und ich muss schlucken. Natürlich denke ich sofort daran, dass sie vergewaltigt wurde, und ein Schwall Magensäure kommt mir hoch. Ich schlucke ihn mit Gewalt herunter und reiße mich zusammen, um nicht aus dem Raum zu rennen und mich zu übergeben. Böse Erinnerungen, wie schon gesagt.
»Ja, ich war neulich in der Apotheke«, scherze ich regelrecht, denn es klingt so normal. In Wahrheit bin ich natürlich nicht in eine Apotheke spaziert und habe dort auf Rezept Medikamente vom Fachpersonal erhalten. Nein, während Marc draußen fast verblutete, bin ich in eine bereits geplünderte Apotheke gerannt und habe panisch alle Schubladen aufgerissen. »Ich bringe dir gleich noch welche. Kannst du aufstehen?«
»Nein, ich habe mir das Bein gebrochen, als ich geflohen bin.«
Tränen laufen ihr aus den Augen. Im Gegensatz zu dem, was sie vorhin behauptete, glaube ich, sie will sich ihre Geschichte doch von der Seele reden. Am liebsten würde ich mir jetzt die Ohren zuhalten und aus dem Haus rennen, denn dadurch kommen sicher meine eigenen schlimmen Erinnerungen wieder hoch.
Ich bin eben keine Heilige. Ich schaue zur Tür.
Schließlich knie ich mich doch vor das Sofa und lege meine Hand auf ihre.
Sie weiß nicht, wie sie anfangen soll, das merke ich.
Noch einmal wandert mein Blick flüchtig zur Tür. Wieder schlucke ich mit Gewalt einen Schwall Magensäure herunter. Dann schaue ich stur auf eines der Millefleurs-Blümchen ihres himmelblauen Flanellnachthemds und beginne für sie.
»Ich habe dich gestern gebadet. Alles ist abgewaschen.« Auch die widerlich klebrigen Spuren zwischen deinen Oberschenkeln.
Die beiden kurzen Sätze reichen und schluchzend stottert sie: »Sie haben regelrecht Schlange gestanden, um über mich herzufallen. Ich habe mich aus Leibeskräften gewehrt. Der Erste hat mich brutal gewürgt, sodass ich zwischenzeitlich ohnmächtig wurde, der Zweite hat mich gleich zu Beginn bewusstlos geschlagen.«
Ich drücke ihre Hand fester und sie meine. Hilflos starre ich krampfhaft von einem Blümchen zum nächsten auf ihrem Nachthemd.
»Er hat gesagt, ich wäre selbst dran schuld. Ich hätte nicht abhauen sollen. Aber da ich jetzt ein gebrochenes Bein hätte, wäre ich nur noch eine Belastung. Er könnte mich nicht weiter mitschleppen und seine Männer wollten auch endlich was von mir abhaben.«
Oh – mein – Gott!
Mit eisernem Willen unterdrücke ich den Impuls zu brechen.
»Es hat damit angefangen, dass ich vor einigen Wochen allein auf Nahrungssuche unterwegs war«, fährt sie fort und schluchzt immer wieder. »Da hat Karls Bande mich gefunden und eingekreist. Er hat gesagt, wenn ich seine Freundin werde, würden mich die anderen nicht anrühren. Ich hatte Todesangst und er sah mich freundlich an, also habe ich eingewilligt. In der ersten Nacht war er noch nett und sanft, aber je länger ich bei ihm war, desto gröber und rücksichtsloser wurde er. Es gefiel ihm, mich vor seinen Leuten anzugrapschen und zu knutschen, aber die wurden immer neidischer, ihre Blicke immer gieriger. Ich musste für sie kochen und alle möglichen Drecksarbeiten verrichten. Abends dann hatte ich jeden von Karls Wünschen zu erfüllen. Eines Tages wurde mir klar, dass ich für ihn nur eine rechtlose Sklavin war. An diesem Tag wurde ich aufmüpfig und bekam das erste Mal Schläge von ihm. Von da an habe ich nur noch nach einer Fluchtmöglichkeit gesucht. Ich wurde rebellischer und bekam mehr Prügel. Schließlich flüchtete ich eines Nachts heimlich. Seine Bande verfolgte mich, und als sie mich einholten, brachten sie mein Motorrad bei voller Fahrt zum Umkippen. Dabei brach ich mir das Bein …«
Meine freie Hand hat sich inzwischen zur Faust geballt und gleichzeitig verschwimmen die weißen Blümchen vor meinen Augen. Ich muss heftig blinzeln, um nicht zu heulen.
Als sie am Ende ihrer Geschichte angekommen ist, sieht sie mich mit großen Augen an. Eine Frage steht darin.
Ich kenne diese Frage, auch wenn meine Geschichte eine andere ist und weit harmloser: Was wird jetzt aus mir?
Das ist eine sehr zerbrechliche Phase, die man da durchmacht. Auch das weiß ich aus eigener Erfahrung. Meine Eltern liebten mich, dennoch waren sie damals nicht in der Lage, mir die Hilfe zu geben, die ich gebraucht hätte. Mir selbst konnte und kann ich nicht helfen, aber was ich ihr sagen muss, das weiß ich genau. Ich hoffe, es hilft ihr und sie bekommt ihr Leben danach besser in den Griff als ich.
»Wie alt bist du?«, frage ich zunächst.
»In zwei Tagen werde ich 17.«
Ich sehe in ihr Gesicht. Sie sieht viel jünger aus.
Mir schnürt sich die Kehle zu.
Es ist für mich unfassbar, dass jemand fähig ist, auf ein so jugendlich unschuldiges und zartes Gesicht dermaßen brutal einzuschlagen! Zudem ist ihr Körper zierlich und dünn, sie ist sicher unter 1,60 Meter und hat feine Glieder – wie konnte sie dieses Martyrium nur ertragen? Wobei ich annehme, dass sie nicht von Haus aus so eine dünne Statur besitzt, sondern eher abgemagert ist, weil sie nicht genug zu essen hatte.
Als sie vorhin aufwachte, hatte ich zuerst Horror davor, dass sie zu schwer traumatisiert und nur eine Last für uns sein würde. Ich weiß, ich sollte nicht so denken. Da merkt man wieder, dass ich keine Heilige bin. Aber wir stecken nun mal in einer Situation, in der wir gesunde, kräftige Menschen brauchen, die arbeiten können, um unser aller Überleben zu sichern. Während sie erzählte, habe ich jedoch Hoffnung geschöpft und ich wünsche mir, dass meine Worte ihr eine Starthilfe geben, um dieses Trauma zu überwinden.
Ich drücke ihre Hand. Ihr Gesicht ist zerschlagen, die Würgemale an ihrem Hals schüren den Zorn in mir. Entschlossen schaue ich ihr direkt in die Augen, von denen eines ja immer noch lila und zugeschwollen ist.
»Zuallererst mach dir klar, dass Karl dich von Anfang an manipuliert und in diese Rolle gezwungen hat. Du hattest keine echte Wahl. Du wolltest nur überleben. Und dass du an irgendetwas selbst Schuld hast, ist vollkommener Bullshit!«
Ich warte, bis das bei ihr gesackt ist, und sie nickt, erst dann fahre ich fort: »Und das zu überleben, was du durchgemacht, ist ein Wunder. Du hast eine rebellische Natur und bist viel stärker, als du denkst. Darauf kannst du verdammt stolz sein! Du hast diese Schweine überlebt. Jetzt bist du frei und hast dein Leben zurück, also mach auch was draus. Zeig es denen! Werde die, die du sein willst. Und wenn sie dich in deinen Erinnerungen heimsuchen, dann spuck ihnen ins Gesicht und schrei sie mit all deiner Wut an! Wehr dich mit der ganzen Kraft deines starken, rebellischen Herzens, wenn die Erinnerung dich unter ihren Stiefeln zerquetschen will!«
Ich habe angefangen zu schreien und stoppe mich, atme tief durch.
»Mir ist ein Name für mich eingefallen«, sagt sie leise.
»Und der wäre?«
»Phönix. Wie der Vogel, der aus seiner eigenen Asche neu geboren wird.«
»Okay, Phönix. Das passt. Aber was hältst du davon, wenn wir ihn für Freunde abkürzen? Wie wär’s mit Nixi?« Das klingt wenigstens ein bisschen nach Mädchen.
»Wenn du meinst, dann Nixi für euch«, erwidert sie immer noch viel zu leise.
Ich hoffe, sie schafft es. Aber selbst wenn, wird ihr Weg hart und steinig werden.
Nachdem ich Nixi mit mehr Paracetamol versorgt habe, entschuldige ich mich, um Eier aus dem Hühnerstall zu holen und zu versuchen, der Kuh ein bisschen Milch abzuringen. Aber um ehrlich zu sein, muss ich unbedingt raus und Abstand gewinnen. Das war alles zu viel für mich. Meine eigenen Erinnerungen lassen mich schon eine Weile die Kiefer aufeinanderpressen. Ich hab mich eisern zusammengerissen, um nicht zu heulen oder mich zu übergeben. Für Nixi wollte ich stark sein. Aber nun habe ich das Gefühl, mich selbst nicht mehr zu spüren. Obwohl ich nicht renne, flüchte ich aus der guten Stube und schließe die Tür hinter mir. Jetzt möchte ich nur noch schnell durch die Küche nach draußen in den Hof stürmen, um da meine Fassung wiederzuerlangen. Doch Marc fängt mich mit seiner Hand an meinem Arm in der Küche ab.
Da die Tür von der Küche zur guten Stube vorhin ein Stück offen stand, hat er sicher jedes Wort mitgehört, als er den Ofen angefeuert und Wasser aufgesetzt hat.
»Komm her«, flüstert er und zieht mich näher an sich.
»Nicht jetzt«, protestiere ich, denn ich spüre schon, wie mich ein Schwall Tränen überwältigen will.
Aber Marc hält mich weiter fest.
»Doch genau jetzt, Jessy. Lass es raus.«
»Ich kann nicht«, sage ich mit abgewandtem Blick und blinzle stur gegen die Tränen an.
»Doch, bei mir schon.«
Er schließt mich in seine starken Arme.
Als er auch noch über meinen Rücken streichelt und meinen Haaransatz küsst, kann ich die Flut nicht mehr aufhalten. Ich heule Rotz und Wasser, aber ganz leise, damit Nixi mich nicht hört.
Nach einer Weile geht es mir tatsächlich besser.
»Ich danke dir, Marc.« Mal wieder.
So oft war er schon für mich da! Immer im richtigen Augenblick. Er hat es echt drauf.
Als ich mich von ihm löse, um in den Stall zu gehen, hält er mich am Unterarm kurz zurück.
»Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst, Jessy. Deine Vergangenheit steht oft zwischen uns und ich will wenigstens wissen, womit ich es zu tun habe.«
Abrupt wende ich den Blick zu Boden.
»Irgendwann, Marc, irgendwann.«
Das ist ihm wohl nicht genug und er will nachhaken, doch ich reiße mich los und flüchte, diesmal schnellen Schrittes, nach draußen.
Kapitel 3
Die Hühner rauslassen, ihnen Körner hinwerfen und ihre Eier einsammeln, klappt ganz gut. Aber dann sitze ich auf diesem wackligen Melkhocker, und versuche, wieder und wieder Milch aus Elsas Euter zu bekommen. Berta hat mir das erklärt und vorgeführt. Bei ihr sah das spielend leicht aus! Doch die alte Bauersfrau hatte natürlich Jahrzehnte Übung.
Ich gebe mir Mühe, wirklich!
Probiere alles Mögliche und quäle dabei nicht nur mich, sondern auch die Kuh. Elsa wird immer unruhiger, was mir die Arbeit selbstverständlich noch schwerer macht. Schließlich gebe ich mit Tränen in den Augen auf. Ich sehe in den Melkeimer. Es ist gerade mal der Boden bedeckt, vielleicht ein halber Liter. Berta hat gesagt, eine Kuh könnte sterben, wenn man die Milch nicht rausbekommt. Aber was soll ich denn tun?
Ich binde das arme Tier los. »Komm, jetzt geht’s erst mal raus in die Sonne und an die frische Luft«, sage ich mit schlechtem Gewissen und führe sie zunächst in den gepflasterten Innenhof.
Dort pumpe ich mit der Handpumpe Grundwasser in den steinernen Trog, damit sie trinken kann – und Cäsar auch. Diesen irischen Wolfshund, den Marc gestern aufgesammelt hat, habe ich in mein Herz geschlossen und ich glaube, er mich ebenso. Als ich sein struppiges Fell kraule und mit ihm rede, merke ich, dass wir es beide genießen.
Kurz darauf öffne ich die zwei Haken des riesigen, hölzernen Tors und schiebe es zur Seite. Dann führe ich Elsa ein paar Häuser weiter, zu einem Bungalow mit eingezäuntem Garten. Ich weiß, dass der ehemalige Besitzer, den die Vogelgrippe dahingerafft hat, extrem pingelig mit seinem Rasen war. Wehe, unser Ball landete mal bei ihm! Jetzt ist es eine Wiese.
»So, Elsa. Das war früher der makelloseste Rasen, den ich kannte. Friss dich satt und lass ruhig ein paar große Kuhfladen zurück!«
Diese heimliche Schadenfreude bringt mich zum Schmunzeln und ich gehe mit Cäsar zurück, der wie ein Bodyguard an meiner Seite bleibt.
Bald darauf sitze ich mit Nixi am Tisch in Bertas gemütlicher Wohnküche mit den französischen Landhausmöbeln.
Ich schaue auf den Tisch und bin für einen Moment glücklich. Freue mich in dieser völlig veränderten Welt nämlich über kleine, normale Dinge. Dinge, die für mich früher völlig selbstverständlich und keinen Gedanken wert waren wie dieser gedeckte Tisch zum Beispiel. Ich bin happy über das frische, saubere Wasser in dem wunderschönen Porzellankrug, das hübsche Lavendelmotiv auf dem Service, Bertas selbst gemachte Marmelade und das Silberbesteck, über dessen schönes Ornament mein Zeigefinger gerade fährt. Und außerdem bin ich unglaublich froh, nicht mehr allein zu sein, auch das ist ein Schatz, den ich nie recht zu würdigen wusste.
Marc hat den antiken Holzherd, der gut in ein Bauernmuseum passen würde, angefeuert und inzwischen Kaffee für uns zubereitet. Als Nixi mir eine Tasse einschenkt, greife ich sie mit beiden Händen, schließe die Augen und atme den herrlichen Duft ein. Danke!, dringt es tief aus meiner Seele, bevor ich die Augen wieder öffne.
Von meiner Ausbeute aus dem Hühnerstall hat Marc Rühreier gemacht, die er uns gerade von der Pfanne auf die Teller schiebt. Dazu gibt es die letzten Scheiben von Bertas Brot.
»Ich weiß, das Brot ist schon etwas hart«, entschuldige ich mich bei Nixi und scherze: »Aber der Bäcker hat einfach das Handtuch geworfen, weil’s keinen Strom mehr für seinen Backofen gab.«
In Wahrheit bin ich natürlich selig, überhaupt echtes Brot essen zu dürfen. Knäckebrot war seit Langem das höchste der Gefühle. Über einem Lagerfeuer oder mit einem Campingkocher bekommt man Brot nämlich nicht gebacken – im wahrsten Sinne des Wortes. Und Bäcker sind sprichwörtlich ausgestorben wie die meisten Menschen. Marc ist Elektriker, welche Ironie in einer Zeit, wo es weder Strom, noch intakte Elektronik mehr gibt! Und ich bin Bürokauffrau. Unsere Berufe sind also völlig nutzlos in dieser veränderten Welt. Ehrlich: Frisches Brot war für mich früher selbstverständlich, heutzutage ist es himmlischer Genuss.
»Tja, Nixi«, versuche ich mich weiter in Humor. »Du kennst nicht zufällig einen Bäcker? Bei uns ist ’ne Stelle frei.«
»Die Benutzung des mittelalterlichen Brotbackofens vor dem Dorf wird nicht in Rechnung gestellt. Da kann man an frischer Luft arbeiten. Und Brennholz würden wir frei Haus liefern«, ergänzt Marc grinsend.
»Und für den Anfang hätten wir sogar noch eine Brotbackmischung zu bieten.« Eines meiner wenigen Nahrungsmittel, die unsere zweimalige Flucht überstanden hat.
Nixi sieht mich für einen Moment verdutzt an und ich denke schon, dass mein Scherz schlecht bei ihr angekommen ist. Aber dann zeigt sich bei ihr ein kleines Lächeln trotz ihrer aufgesprungenen Lippe.
»Ich bin Bäckerin.«
Marc und mir fällt fast die Kinnlade zu Boden.
»Im Ernst?«
»Der Gesellenbrief hängt zu Hause.«
Marc pfeift anerkennend.
Sofort sehe ich frisches, weiches Brot vor meinem inneren Auge, meine, den Duft von warmen Brötchen zu riechen. Das Wasser läuft mir im Mund zusammen.
»Könntest du denn mit einem mittelalterlichen Brotbackofen überhaupt zurechtkommen?«
»Ich weiß nicht«, erklärt sie nachdenklich und ist gleich ganz in der Materie. »Das Problem wird vermutlich, die richtige Temperatur über einen bestimmten Zeitraum zu halten. Aber ich würde es gern versuchen. Was ist schon ein Leben ohne frisches Brot?«
»Du wärst mein Held!«
»Mit dem Bein kann sie aber nicht draußen rumhantieren. Sie ist vorhin auch nur mit meiner Hilfe hier an den Tisch gekommen«, gibt Marc zu bedenken. »Wir müssten das erst gipsen.«
»Aber sitzen kriege ich hin!«, protestiert sie. »Und wenn ihr mir Holz und Wasser bringt sowie eine Schüssel und die Zutaten auf den Tisch stellt, versuche ich heute mein Bestes, um hier in der Küche aus der Brotbackmischung Brötchen herzustellen. Entweder backe ich die auf eurem vorsintflutlichen Holzherd in einer Pfanne mit Deckel drüber auf oder im Backofenteil dieses antiken Stückes.«
Ich spüre, dass Nixi versucht, sich als nützlich für uns zu erweisen, damit wir nicht bereuen, sie hier aufgenommen zu haben. Früher hätte ich jemand mit Beinbruch ausgeschimpft und darauf bestanden, dass man mit gebrochenem Knochen auf der Couch bleibt, aber die Zeiten haben sich leider geändert.
»Das wäre prima, Nixi! Du sagst mir, was du brauchst, und ich bringe dir alles an den Tisch. Und an den Herd stellen wir dir einfach einen Stuhl.«
Marc wirft mir einen ernsten Blick zu und ermahnt Nixi dann: »Aber übernimm dich nicht! Du hast ’ne Menge hinter dir.«
»Ich will nicht darüber reden, vor allem nicht daran denken müssen und Arbeit hilft mir sicher dabei«, erwidert sie stur und ballt ihre Fäuste, deren Knöchel durch ihre Abwehr aufgeschürft wurden.
»Falls du noch mehr Arbeit möchtest, schreib Karten für unsere Luftballons und lass sie steigen.«
Sie schaut mich an, als ob ich irre wäre. Ihr Gesichtsausdruck ist zum Schießen!
Marc grinst breit und zeigt mit dem Daumen auf mich: »Ja, die verrückten Ideen kommen definitiv von ihr.«
Seinen Kommentar ignorierend, erkläre ich ihr in aller Sachlichkeit die Einzelheiten meiner Idee, gasgefüllte Ballons steigen zu lassen …
»… Es gibt schließlich keine Post, kein Internet und kein Telefon. Und auf der Karte sollte auch so was stehen wie: Wenn ihr bereit seid, fleißig zu arbeiten, dann kommt nach Espoir und wir bringen uns gemeinsam durch den Winter. Wir brauchen nämlich keine Faulenzer, die sich nur durchfüttern lassen wollen.«
Kaum ausgesprochen, wird mir klar, dass Nixi das vielleicht persönlich nimmt.
Bevor ich allerdings Gelegenheit habe, darauf zu reagieren, rückt Marc mit seinen Zweifeln heraus: »Dieser Schuss kann aber auch nach hinten losgehen, falls eine Karte den Hellhounds in die Hände fällt. Das ist ein Risiko.«
Ich will den Einwand nicht hören, habe es so satt, ständig an das Damoklesschwert über uns denken. Ich halte diese immerwährende Angst kaum noch aus!
»Diese Gefahr droht uns doch schon die ganze Zeit, Marc! An jedem einzelnen Tag! Außerdem hast gerade du vor Kurzem noch argumentiert, dass unsere Stärke auch in der Einwohnerzahl liegen würde. Trotz der hohen Mauern hätten wir drei keine Chance, einem dauerhaften Angriff von Hellhounds standzuhalten.«
»Wow, sie hört mal auf mich.«
Aber es scheint ihm nicht zu gefallen. Kopfschüttelnd stößt er die Luft aus, lehnt sich im Stuhl zurück und fährt sich durch die Haare.
»Stärke durch Überzahl – das ist leider eine Tatsache. Und die riesigen Felder mit Weizen, Hafer und Mais um das Dorf von Hand abzuernten, Heu für das Vieh zu machen und nächstes Jahr alles neu zu bewirtschaften, ist eine Herkulesaufgabe. Die Maschinen sind ja da«, überlegt er weiter. »Womöglich würde ich es mit einem Mechaniker fertigbringen, den Schaden durch die EMP-Wellen zu beheben. Wenn wir wenigstens einen der uralten Traktoren wieder in Gang bringen könnten! Die haben nicht viel Elektronik. Aber das Wichtigste zuerst: Ich muss heute dringend Munition und Waffen besorgen. Wir haben nur noch Patronen für die Schrotflinte.«
Ich fahre abrupt vom Stuhl hoch.
»Aber die Hellhounds sind noch in der Nähe!«
Er seufzt. »Es muss aber sein, Jessy.«
Und schon jetzt habe ich eine Scheißangst um ihn!
»Dann komme ich mit!«
Bevor wir losfuhren, mussten Marc und ich noch eine schwere Aufgabe erledigen: Wir haben Bertas Leiche draußen vor dem Dorf verbrannt und ich habe dabei die ganze Zeit geheult.