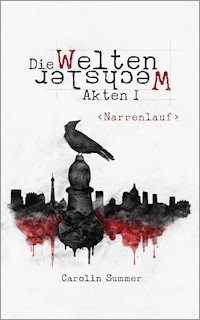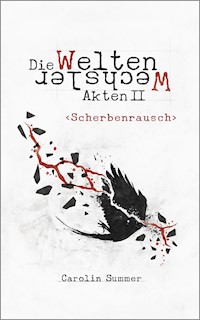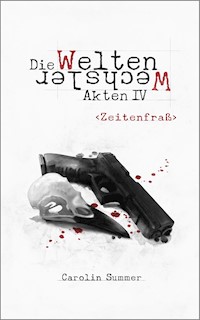
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Geheimnisse sind die Schatten der Seele.« Paris, 04. Dezember Glückwunsch, Weltrettungsszenario abgehakt. Übrig bleibt ein Haufen Probleme. Die Quittung für sämtliche Fehltritte, die ich mir geleistet habe, damit eure Realität nicht auseinanderbricht. Jetzt läuft mir die Zeit davon, während ich verzweifelt versuche, das Desaster halbwegs wieder geradezubiegen. Also legen wir uns zwischen jeder Menge Pech und Drama mit der paranormalen Mafia an. Eine aussichtslose Vampirjagd ohne Rückendeckung von Gris. Mit nichts weiter als einer alten Akte und ein paar halbgaren Indizien in der Hand. Ja, ich weiß, klingt absolut lebensmüde. Ist mir egal. Jordi lässt sich sowieso nicht davon abhalten. Immerhin geht es um seine Familie. Und ich rede es ihm garantiert nicht aus. Im Gegenteil. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist: »Du bist nicht allein.« Vanjar Belaquar
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DIE WELTENWECHSLER AKTEN
ZEITENFRAß
Carolin Summer
Band IV
Urban-Fantasy-Krimi
Content Notes Tod/Mord, Suizid, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, explizit: häusliche Gewalt, Missbrauch, Sexismus, Abusus, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Alkoholkrankheit, Selbstjustiz, RassismusDas Figurenglossar befindet sich am Ende des Buches.
IMPRESSUM
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt und jegliche Verwertung ohne Zustimmung der Autorin daher unzulässig. Insbesondere gilt dies für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Dazu zählt ebenfalls die Erstellung von RPG-Foren, Fan-Fictions etc. Die in der Geschichte enthaltenen, fiktiv-physikalischen Erläuterungen erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit und sollten mit einem nachsichtigen Augenzwinkern betrachtet werden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. INSPIRATION UND OVATION [QUELLENANGABE]: In »Ascheseelen« wird ein Auszug aus Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra zitiert. Quellen: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra Reclam Universal-Bibliothek 1994, S. 151 Dritte Auflage: 2023 Erste Auflage 2021 Copyright 2021 Selina Carolin Summer c/o Fam. Töpler, Mozartstr. 8, 66399 Mandelbachtal Lektorat: Nina Hasse Korrektorat: Florian Zimmer Cover und Satz: Selina Carolin Summer Bildmaterial: Deviantart: frankandcarystock Textur: Sascha Duensing ISBN Taschenbuch: 978-3-347-37021-0 ISBN Hardcover: 978-3-347-37022-7 Erschienen bei Tredition
für die kleinen Geschwister & besten Freunde
Passt auf euch auf.
Ein Buch für alle und keinen
»Zu jeder Seele gehört eine andere Welt.«
Friedrich Nietzsche
# allein
Das ist unmöglich.
Mit rasendem Herz stand sie vor dem halbleeren Bücherregal. Inmitten von Kartons, Koffern und Wäschekörben. Sie sollte packen. Ein altes Leben aus ihrem räumen. Doch statt weiter Schubladen zu durchstöbern und die Vergangenheit zwischen Wände aus Pappe zu sperren, presste sie das Notizbuch an sich. Knisternde Seiten, gefüllt mit Zeilen aus schwarzer Tinte. In der krakeligen Handschrift, die sie so gut kannte.
»Unmöglich.«
Erneut schlug sie das Buch auf. Die letzten beschriebenen Seiten, jede mit einem Brief versehen. Keine Einbildung. Die Worte standen wirklich dort.
Ohne ihr Heiligtum wegzulegen, suchte sie nach dem Handy. Es dauerte eine Weile, bis sie es im Durcheinander auf dem Küchentisch entdeckte – und noch länger, sich den Weg durch das Chaos aus Haufen und Kisten dorthin zu bahnen. Während sie auf das Freizeichen wartete, lehnte sie sich gegen das zerkratzte Holz. Eine Ewigkeit verging, bis er endlich abhob.
»Was gibt’s?«
»Wo bist du?«
»In der Stadt.«
»Können wir uns treffen?«
Die Antwort blieb aus.
»Bitte. Es ist wirklich wichtig.«
»Square Barye, in einer Dreiviertelstunde?«
# erster Part
[SCHULD]
# erstes Kapitel
[Mittwochabend, 14. Mai 2008, Rue Pierre Semard]
Die Stille im Büro drückte auf die Nerven. Pferchte hastig ausufernde Gedanken zusammen, an denen mein schlechtes Gewissen klebte wie weichgekauter Karamell. Darüber zu lange geschwiegen zu haben. Beichten zu müssen. Angestachelt vom Geräusch umgeblätterter Seiten.
Wahrscheinlich wäre eine Erklärung bitter nötig gewesen. Stattdessen lehnte ich neben dem leeren Wodkaglas am Schreibtisch und beobachtete Jordi. Ein Haufen Frust auf lindgrünen Sofapolstern. Die weißen Sneaker lagen so verloren unter dem Tisch, wie sich seine Fassung zwischen den gelesenen Wortfetzen jener zerfledderten Akte verteilte. Sämtliche Infos, die über die Jahre von Michelo del Ferana an Jean Denulier geflossen waren, vom Ende der Achtziger bis zu Tag X.
Jener Abend, an dem der Auftragskiller samt Frau und Tochter spurlos verschwunden war. Ein Racheakt der paranormalen Mafia. Für Michelo stand Menschenhandel zur Blutbeschaffung im großen Stil nicht auf der Liste vertretbarer Illegalitäten, also machte er seinen Auftraggebern hinterrücks einen Strich durch die Rechnung. Als Informant für Jean, während er weiterhin seinem fragwürdigen Job nachging. Es funktionierte, sogar eine geraume Weile. Michelos Spionage blieb unentdeckt, Jean Denulier gab seine Quelle nie preis. Natürlich ging das nicht ewig gut. Sie fanden ihren Verräter, wenn auch Jahre nach der Verurteilung diverser verantwortlicher Blutsauger. Und natürlich statuierten sie ein Exempel.
Übrig blieben ein Haus voller Blut und das Leben seines Sohnes, der hunderte Kilometer entfernt auf Weltreise umhergondelte – und jetzt mit der Ansammlung schriftlich zusammengetragener Fakten über seine Familie vor mir auf dem Sofa hockte.
»Mierda, seit wann hast du den Kram?«
Als ob du das nicht genau weißt.
»Dezember.«
Als er die Akte damals von meinem Schreibtisch fischte, hatte ich gerade noch so dazwischenfunken können.
Mit kritischer Miene widmete er sich wieder den Papieren. Den hellen, kaum verknitterten Seiten am Ende. Ermittlungsergebnisse. Darunter auch der Kram, den er kurz nach dem Verschwinden seiner Eltern mit Jeans Hilfe zusammengetragen hatte. Doch das war längst nicht alles. Es gab Berichte der unwissenden Behörden, entsprechende Beeinflussungen von unserer Seite und jede Menge Zeug von Jeans Solo-Ermittlungstouren. Übersät mit meinen Notizen. Letztendlich war es nicht viel, was an Ergebnissen dabei herumkam. Die paranormale Mafia ließ sich ebenso wenig in die Karten schauen wie ihr menschliches Pendant.
Der Großteil des Balzac-Clans war damals untergetaucht. Verhindert hatte das den Anschlag auf Familie del Ferana nicht. Wir wussten, was Sache war – und konnten nichts davon beweisen. Sämtliche Spuren blieben kalt. Sie verloren sich in Belgien, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland. Die meisten von Jean persönlich bis zum Ende verfolgt. Wohlgemerkt nachdem er dafür gesorgt hatte, dass niemand Jordi aufzustöbern vermochte. Wenn er seinen alten Freund schon nicht retten konnte, dann wenigstens sein überlebendes Kind. Und diesen Job verstand er ausgezeichnet. Die Wochen, die sein Schützling bei ihm in dem kleinen Ort nahe Reims verbrachte, genügten, ihn auf gewissem Abstand zu den Mafiakreisen zu halten. Schnell genug, dass keine Infos über seinen Aufenthaltsort die Runde machten. Vor allem hielt Denulier Jordi so von Fehltritten bei eigenen Nachforschungen ab. Ihm die zu verbieten, hätte ohnehin nichts gebracht, das war dem ehemaligen Ermittler von vornherein klar. Also spielte er schützende Hand und sicherer Hafen zugleich und machte es Jordi ziemlich leicht, ihm zu vertrauen. Dem Gerechtigkeitskämpfer und alten Freund seines Vaters, der nicht darauf aus war, ihn von all dem fernzuhalten, sondern neues Wissen und Details lieferte. Wenn man dem Wolf eines nicht vorwerfen konnte, dann dass er die Aussichtslosigkeit der Situation schöngeredet hätte. Jordi kannte die Erfolgsaussichten, auch ohne Einsicht in die Originaldokumente. Die Taktik ging auf. Gut genug, dass er irgendwann kapitulierte und das Weite suchte, Richtung Japan. Was daraus letztlich geworden war, wussten wir beide zur Genüge.
Team Beta. Die größte Sicherheit, die der Wolf auf Dauer zu bieten hatte. In der Hoffnung, dass Jordi über die Ungewissheit hinwegkam und mit der hässlichen Seite des Schicksals seinen Frieden schloss. Bis vor Kurzem hatte es damit auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Immerhin hielten sich die Überreste des Clans seit der Verhaftungswelle weitestgehend von Paris fern. Im Hexenkessel paranormaler Kriminalität mischten sie nicht mehr mit. Hier besaß Gris den Heimvorteil – zumindest gingen alle davon aus. Bis vor sechs Wochen.
Ich war das alles unzählige Male durchgegangen - und ausgerechnet dort auf eine Spur gestoßen, wo ich sie niemals vermutet hätte: während eines illegalen Undercovereinsatzes, in einem Notizbuch voller alter Magie. Ein fragwürdiger Einstellungstest in einer zwielichtigen Bar in Montmartre.
Jordi ließ die Akte wieder sinken. »Du hast das alles überprüft?«
»Inoffiziell, aber ja.«
»Das ganze Zeug, das Jean mir vorenthalten hat, um mir weiszumachen, dass es sich nicht lohnt, in den Richtungen weiterzusuchen? Jede verdammte Notiz, jeden verfluchten Anhaltspunkt?« So sehr er seine Stimme zur Ruhe zwang, aus seinen Augen war eindeutig das Gegenteil zu lesen.
»Sicher.« Mein Privatvergnügen. Nur weil unsere alte Garde beschloss, die Sache auf sich beruhen zu lassen, nahm ich den Dreck noch lange nicht hin. Die vernünftigste Lösung? Scheiß auf Vernunft. »Du hättest genau das Gleiche getan. Was hast du erwartet?«
»Dass du wenigstens einmal die Fresse aufbekommst, vielleicht? Aber nein!« Da ertrank die sonst so unerschütterliche Gelassenheit in einem Ozean aus Vorwürfen. »Schon wieder so eine beschissene Solotour mit deiner verfluchten Geheimniskrämerei. Obwohl du mir dein Wort darauf gegeben hast.«
Kein Geschwindel, wenn es um diese Welt ging. Keine Alleingänge. Nicht bei Ermittlungen, vor allem nicht bei denen, die ihn persönlich betrafen.
»Hier geht es verdammte Scheiße nochmal um meine Familie, cabrón!«
Ich bediente mich ein weiteres Mal am Wodka, direkt aus der Flasche. Er hatte ja recht. »Soll ich mir ein paar Rechtfertigungen aus den Fingern ziehen?«
Diplomatie? Fehlanzeige.
Der Ton, den er von sich gab, lag irgendwo zwischen missbilligendem Schnauben und Lachen. »Spar’s dir.«
Ich hob nur die Schultern. Wortlosigkeit, für die er mich genauso verfluchte wie für jede falsche Bemerkung.
»Ich kann gut damit leben, dass es mir egal zu sein hat, was du in anderen Universen treibst. Zumindest solange es kein Himmelfahrtskommando ist, das dich mit neunundneunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit den Hals kostet.« Den Ordner noch in der Hand stand er auf. »Ich habe mir sogar mal geschworen, den bornierten Menschenscheiß bleiben zu lassen und dir da keinen Strick draus zu drehen. Weil dieses Team die beste Perspektive ist, die ich habe. Die einzige. Nachdem ich bei Jean aufgeschlagen bin und endlich registriert hatte, was in Spanien gelaufen ist, war es die einzig akzeptable Lösung, der unwissenden Gesellschaft den Rücken zu kehren. Um Himmels willen niemand Unbeteiligtes in diese Scheiße reinzuziehen, niemanden mit meinem Dreck zu belasten. Mein Leben hat eine Hundertachtziggradwende ins absolute Chaos vollführt, also habe ich sämtliche Brücken abgebrochen. Zu Hause lag eh alles in Trümmern und in England? Zwischen Jurastudenten, Forschungsarbeiten und Polo-Karrieren? Dort habe ich nichts mehr verloren. Für diese Leute bin ich irgendwo auf Weltreise versackt. Klassischer Fall von eingeschlafenem Kontakt. Nachrichten von Freunden mit sporadischen Floskeln abtun oder angeblich vergessen zu antworten. Obwohl wir uns seit Jahren kennen. In der Versenkung verschwinden, zurücklassen, enttäuschen. Dir brauche ich garantiert nicht zu erzählen, wie das ist, oder? Ich lasse mich darüber nicht aus, genauso wenig wie du. Das Gruselige ist, dass mich ausgerechnet das über Wasser hält: hier nicht allein zu sein mit meinen Problemen. Ich will nicht wissen, wo ich ohne Gris versackt wäre. Ohne Jean. Ohne dich. Du brauchst nicht in meinen Gedanken zu stöbern, um zu verstehen, wie es mir geht. Weder beim Familiendrama noch mit der Einsamkeit. Du bist der Einzige, der nicht mit Phrasen und aufbauend gemeintem, aber absolut überflüssigem Optimismus ankam. Oder mir ein sicheres Leben andrehen wollte. Die Zeit heilt keine Wunden. Aber ganz ehrlich: Was das angeht«, er wedelte mit den Papieren, »habe ich dir deutlich mehr Loyalität zugetraut.«
Beide Hände um die Flasche gekrampft, sortierte ich meine Konter von der Zunge. Schlechter Zeitpunkt für Grundsatzdiskussionen. Sollte er gehen. Auch wenn ich ihm gerade einiges an den Kopf werfen mochte. Nichts davon hätte es besser gemacht, geschweige denn, als Entschuldigung getaugt.
In der Tür drehte er sich noch einmal um. »Weißt du was? Dominique hat Recht. Gerade bin ich nicht mehr der gerettete Freund. Ich bin derjenige, der belogen wird.«
Krachend landete die Schnapsflasche auf dem Schreibtisch.
So schnell wie ich verschwand und vor ihm wieder auftauchte, gelang es Jordi nicht auszuweichen. Weder meinem Griff nach der Akte noch dem Hieb magisch geleiteter Energie, der ihn rücklings mit der Tür kollidieren ließ. Heftig genug, dass sie mitsamt meinem Partner gegen die Flurwand krachte und ausreichend Lärm veranstaltete, um für geöffnete Bürotüren und neugierige Blicke unserer Kollegen zu sorgen. Das war so klar.
»Manchmal ist schweigen loyaler als reden«, zischte ich. »Oder zu lügen. Meinetwegen nehme ich beides in Kauf, wenn es dir den Horror erspart, vergeblich irgendwelchen alten Hinweisen nachzurennen, die keinen verdammten Schritt weiterführen. Das kenne ich nämlich auch zur Genüge: ständig mit leeren Händen dazustehen, immer und immer wieder bei null rauszukommen, egal was du anstellst. Nur weil du die Hoffnung hast, doch noch irgendetwas zu erreichen. Aber vergeblich zu hoffen, bringt nichts als Verzweiflung. Und die irgendwann den Wahnsinn.«
Hustend rappelte Jordi sich auf. Die spanische Schimpftirade, die er dabei vor sich hingrollte, war alles andere als jugendfrei. Ich ignorierte das Gefluche genauso wie unsere Zuschauer und schlug übertrieben theatralisch den Ordner auf. Drama stand ohnehin gerade weit oben auf der Tagesordnung.
»Ein leeres Bankschließfach in der Schweiz. Geschmierte, aber unwissende Buchmacher in Belgien. Ein verkommenes Anwesen in Luxemburg …«
»Gib das gefälligst her!«
Ungerührt suchte ich eine Karteikarte aus dem Papierchaos, an die mit zwei Büroklammern ein Foto geheftet hing. Darauf war das aufgequollene Notizbuch im Leineneinband zu sehen, für das Leonard im Brunnenschacht unter der Stadt sein Leben gelassen hatte.
»Wenn du einen Grund willst, wirklich sauer zu sein, dann bitte: Das hier ist der Anhaltspunkt, dank dem du den Kram überhaupt erst zu Gesicht bekommst. Auf der ersten Seite dieser vermaledeiten magischen Sammlung stand nämlich ein Name.«
Jordis Miene legte einen Turbostart von kritisch über irritiert zu fassungslos in unter einer Sekunde hin, als er die Notiz entgegennahm.
Jacomo Balzac – 1454.
»Balzac?« Wenn Blicke töten könnten, wäre ich auf der Stelle umgekippt. »Beim Officium sitzt seit Wochen eine potentielle Verbündete dieses Blutsauger-Clans in Haft und du hast das die ganze Zeit gewusst?«
Mit ausladender Du-hast-es-erfasst-Geste sparte ich mir die verbale Antwort. Seit der Razzia im Belladonna befand sich die Geschäftsführerin in Gewahrsam. Nach ihren beiden Cousins und Caesar wurde weiter gefahndet.
»Wie bist du da rangekommen?«
»Die Reaktion auf das Buch war mein Eignungstest im Belladonna.«
»Sie hat dir das gezeigt? Wie leichtsinnig ist das bitte?«
»Einkalkuliertes Risiko. Es gab nur drei Varianten: dass mir der Name nichts sagt, dass er der Wink mit dem Zaunpfahl ist, um mich als zukünftigen Privatmagier in Mafiageschäfte involvieren zu können, oder dass sie mich gleich aus dem Weg räumen müssen.«
»Dreist. Wie lange lief der Mist so? Seit Luna in die Sache reingezogen wurde?«
Zur passenden Untermalung schwang die Tür Richtung Eingangshalle auf. Quietschend und auf gewisse Weise ebenso anklagend wie Jordis Blick. Luanna. Ausgerechnet. Noch in schwarzer Trauerrobe, einen Stapel Papiere und Beileidskarten im Arm. Als ob wir nicht schon genug Zuschauer hatten. Flüchtig schauten wir beide zu ihr hinüber und bereuten gleichermaßen, dass sie diesen Streit mitanhören musste.
»Kurz vorher.«
Ein Schlag ins Gesicht. Wortwörtlich. In Form von Jordis Faust, die mich zielsicher unterhalb der Nase traf. Der Schmerz zog hinauf in die Schläfen. Grell und beißend, dass mir Hören und Sehen verging. Dieses Mal landete ich an der Wand, vornübergebeugt, eine Hand vor den Mund gepresst. Es dauerte, bis ich die roten Tropfen registrierte, die auf dem Dielenboden glänzten. Dunkel und zäh zog das Blut Fäden von meinen Fingern abwärts, dem von Dämonen unübersehbar ähnlicher als dem der Menschen. Mit dem Ärmel wischte ich mir übers Gesicht.
Scheiße.
Das unterdrückte Stöhnen war nicht halb so artikuliert wie der zugehörige Gedanke, was aber auch egal war. In Luannas Protest ging es ohnehin unter.
»Sonst geht’s euch aber noch ganz gut?«
Dazu mischten sich ähnlich gelagerte Beschwerden von Mai und Amélie in das Stimmengewirr von Nic, Hélène und einigen anderen. Nur der unterschwellige mentale Kanon bildete eine weitestgehend einheitliche Meinung:
Geschieht dir recht.
Ja, wahrscheinlich.
»Aufhören!«, befahl Luanna.
Jordi rieb sich die schmerzenden Knöchel und sah eher aus, als ob er gerne noch einen Schlag hinterhergesetzt hätte. Ich konnte getrost darauf verzichten.
»Hättest du nicht wenigstens aufs Auge zielen können?«
»Ich fand meinen Schlag eigentlich ganz gut.«
Ohne weiteren Kommentar reichte ich ihm die Unterlagen zurück.
Rote Flecken auf weißer Waschbeckenkeramik und das Pochen an der Wohnungstür, das ich am liebsten überhören wollte. Ich drehte das Wasser auf, spülte erst das Blut davon und dann die Tablette herunter, die auf der Ablage unter dem Spiegel darauf wartete, gegen meine Kopfschmerzen ankämpfen zu dürfen. Immerhin hatte er mir nicht die Nase gebrochen.
Wieder klopfte es, lauter dieses Mal.
Das fleckige Handtuch landete im Wäschekorb. Ein letzter Blick in den Spiegel genügte, um weitere Mühe um Ordnung als überflüssig zu deklarieren. Genau wie Luannas Worte, als ich ihr endlich öffnete.
»Gott, du siehst schlimm aus.« Vermutlich meinte sie nicht nur die aufgeplatzte Lippe.
Mit einer resignierenden Geste bat ich sie herein. »Tee?«
Zweifelnd begutachtete sie die Kanne, hob den Deckel an und fühlte nach der Temperatur. »Kommt drauf an, wie lange das Zeug schon zieht.«
»Fünf Minuten. Zweitaufguss.« Ich beförderte das Sieb in eine Emailletasse, auf der ein eingeprägter Teebeutel ›Tea Time‹ verkündete.
»Klingt genießbar.«
Also schenkte ich uns Tee ein, während sie es sich auf dem Sofa gemütlich machte.
»Du hättest ihm das nicht verschweigen dürfen.«
»Ach was.« Ich drückte ihr eine der Tassen in die Hand. »Ich habe es schlicht nicht fertiggebracht, ihm einen Haufen papiergewordene Enttäuschung vor die Füße zu klatschen und unnötig neu-alte Hoffnungen zu schüren, während wir versuchen, dem Weltuntergang zuvorzukommen. So leichtsinnig, das in der U-Haft beim Officium rauszuposaunen, war ich auch nicht. Sie hätten den Fall an sich gerissen und wir uns sämtliche Ermittlungen an den Hut stecken können. Mal davon abgesehen, dass jeder Zeitpunkt dafür der falsche ist.«
Einen Moment lang studierte sie die Tiefen des Assam, dann zog sie mich neben sich auf die Couch.
»Ich würde dir keinen Schritt weit mehr trauen, wenn ich mir nicht immer noch einreden könnte, dass du gute Gründe für solchen Scheiß hast.«
»Da bist du nicht die Einzige.«
Sie rammte mir den Ellbogen so fest in die Seite, dass mir Tee auf die Socken spritzte. »Du kannst so furchtbar sein!«
»Danke.«
»Weißt du, was das Schlimmste ist? Genau wegen sowas frage ich mich jetzt, was du mir alles verschwiegen hast. Dabei will ich dir gar nicht misstrauen.«
Ich stellte die Tasse weg. »Frag bitte nicht.« – ›Nicht ausgerechnet heute.‹
Noch so einen Streit ertrug ich schlichtweg nicht.
»Erzählst du es mir, wenn ich dich irgendwann anders darum bitte?«
Nein.
Als ob es nicht vollkommen gleichgültig war, ob ich sie verlor, weil ich ihr die Wahrheit vorenthielt oder weil ich ihr beichtete, dass ich für den Tod ihres Vaters verantwortlich war.
»Ja.« Kaum dass ich die gewünschte Antwort gab, bereute ich sie. Der Tag war für die Tonne. Müde rutschte ich tiefer in die Polster und schloss die Augen. Ende der Diskussion. Zumindest, wenn es nach mir ging. Was nicht bedeutete, dass sie das Gespräch für beendet erklärte.
»Ist die Chefin wirklich der einzige Anhaltspunkt zur Familie del Ferana?«
Chefin. Dass sie Mademoiselle Balzac noch immer so betitelte, ließ mir sämtliche Haare zu Berge stehen.
»Der einzige neue.«
Auch wenn ich mir von einem Verhör nicht viel versprach. Die Hierarchie unter Vampiren folgt einem komplexen System unterschiedlichster Positionen und Grade. Dass die Geschäftsführung des Belladonna nach wie vor ohne jeglichen Schutz der Familie ausgerechnet in Paris ihrem Business nachgingen, zeugte nicht vom höchsten Rang. Niemand gab auf sie acht oder scherte sich um ihren Erfolg. Auf mich wirkte das Belladonna eher wie ein Überbleibsel des Familienimperiums, von dem der Rest vorzugsweise die Finger ließ.
»Wäre sie den Balzacs irgendwas wert, säße sie längst nicht mehr allein beim Officium. Wenn überhaupt ist sie ein Wegweiser. Aber in diesen Kreisen stochert man nicht offiziell als Ermittler herum. Es hat nicht umsonst einen Informanten aus ihren eigenen Reihen gebraucht, um sie auffliegen zu lassen.«
»Also noch ein Undercover-Einsatz?«
Dank ihrer entsetzten Stimmlage öffnete ich die Augen doch wieder. »Eher unser Privatvergnügen. Henry hat mir die Akte nur überlassen, weil ich ihm klargemacht habe, dass ich sie mir sonst selbst hole. Dieser Fall ist von Gris längst als Cold Case abgestempelt.«
Genau wie vom Officium.
Nachdenklich neigte sie den Kopf zur Seite. Sie wusste, dass ich die Finger nicht von der Sache lassen würde, ebenso wenig wie Jordi.
»Ich verstehe, dass er es herausfinden muss. Und du darfst ihn das nicht allein durchziehen lassen, hörst du?«
»Hab ich nicht vor.«
Zufrieden nippte sie an ihrem Tee - und verzog das Gesicht. »Das waren definitiv mehr als fünf Minuten.«
# zweites Kapitel
[Gerade so hell. Also Donnerstag, 15. Mai 2008]
Nervtötendes Vibrieren riss mich aus dem undefinierbaren Zustand zwischen Dösen und Schlafen.
Handy.
Aber wo?
Und vor allem wer?
Ich brauchte zwei Anläufe, um den Apparat aus der Hosentasche zu angeln.
Eingehender Anruf: Hendrik Svenson titelte das Display. Niemand, den ich erwartet hatte. Verschlafen schob ich Luna eine Decke unter, um mein zum Kopfkissen degradiertes Knie zu befreien, und stand auf.
»Was gibt’s, großer böser Wolf?«
Das Schnaufen in der Leitung ließ deutlich vernehmen, was er von der Betitelung hielt. »Hier werden deine schwarzmagischen Griffel gebraucht.«
Das klang unschön. »Wieso?«
»Carole hatte ’nen Rückfall.«
Shit.
»Wo seid ihr?«
»Beim Rudel.«
»Bitte?« Ich stolperte fast über meine eigenen Füße.
»War am nächsten. Ich wusst’ nicht, wohin sonst.«
Na bravo.
»Bin quasi unterwegs.«
Dreck und Kies spritzten gegen die geparkten Geländewagen, als ich die Kawasaki am Ende der Zufahrt zum Stehen brachte. Hinter dem verwilderten Park lag die Villa im Frühnebel.
Was heute das Pariser Rudel sein Eigen nannte, hatte Anfang der Sechziger noch Richard Weam höchstpersönlich gehört. Für einen Spottpreis erwarb der Organisationsgründer das riesige, von Wald und Wasser umgebene Gelände mit dem baufälligen Gebäude unweit vom wahrscheinlich reichsten Vorort der Metropole. Boulogne-Billancourt grenzt hinter dem Périph ans sechzehnte Arrondissement und liegt in einer Seineschleife, direkt an einem der Pariser Waldgebiete. Der ideale Ort für Stadtwölfe. Umringt von einer meterhohen Hecke samt Elektrozaun und bewacht von jeder Menge Kameras. Betreten des Geländes nur mit ausdrücklicher Erlaubnis und unter Beobachtung möglich. Auch wenn gewisse Ecken des Bois de Boulogne ein Hauptverdienstplatz für die verschiedensten Varianten der Prostitution darstellt, verirrte sich selten jemand hierher.
Das Empfangskomitee wartete bereits. Ein junger Kerl mit Dreitagebart und Rollkragenpullover hockte auf der Motorhaube einer G-Klasse.
»Im Haupthaus«, verkündete er, als ich den Helm im Topcase verstaute.
Ich nickte nur und eilte die Freitreppe nach oben. Wie lange war es her, dass ich hier gewesen war? Zwölf, dreizehn Jahre? Zeiten, in denen Jean noch zum Rudel gehörte und mich seinen Azubi schimpfte. Verändert hatte sich das Anwesen seither kaum. Ein typischer Prunkbau vom Ende des vorletzten Jahrhunderts mit sichtbaren Klinkersteinen, mehrteiligen Fenstern und zu vielen Kaminen auf dem Schieferdach. Mystisch von Efeu überwuchert und im Inneren mit einem seltsamen Mix aus Neo-Landhausstil und überladener Jagdschlossromantik ausgestattet.
Abhandengekommen war nur das Gefühl, einen sicheren Hafen zu betreten. Stattdessen begrüßte mich ein aufgerissenes Maul in Form einer doppelflügeligen Tür, hinter der Marmorsäulen die Eingangshalle füllten. Die passende Assoziation zu dem finsteren Gedanken, der durch den mentalen Äther grollte:
›Als graue Krähe schleicht der Tod ins Haus.‹
Auf der Schwelle hielt ich inne – und widerstand dem Drang, diverse Zauber heraufzubeschwören. Vor den Stufen zu den oberen Stockwerken hockte eine schwarze Wölfin. Riesig, mit angelegten Ohren und gelben Augen, die mich strafend fixierten. Die Rudel-Beta. Wir kannten uns und sie ahnte, dass ich ihre Gedanken las.
›Du bist hier nicht willkommen, Belaquar.‹
Kein Wunder, in Anbetracht des Desasters um die beiden Metrowölfe und dem verdammten Angriff auf der Petit Ceinture. Trotz Mathias’ geschönter Beurteilung und Hendriks Schicksal. Nichts davon machte den Tod ihrer Rudelmitglieder ungeschehen, weder den von Noahs Opfern noch der auf den Schienen. Und ich war derjenige, der diese Einsätze in den Sand gesetzt hatte.
Den Blick gesenkt, trat ich an ihr vorbei. Wenn auch ohne Zögern. Keine Machtspielchen. Keine Diskussion.
›Im Salon.‹
Hinter den Säulen und Türspalten blitzte im Halbdunkel ein halbes Dutzend Augenpaare auf. Stumme Beobachter, die meinen Weg auf die andere Seite verfolgten und meine Befürchtungen schürten. Wie schlimm war die Lage, dass sie mich trotz allem passieren ließen? Zum Eingang des weitläufigen Zimmers voller Bücherregale und gemütlicher Ledersessel. Wo es nach Zigarren roch und man nächtelang vor dem Kamin über die unsinnige Politik der unwissenden Gesellschaft philosophieren konnte.
›Hilf der Kleinen‹, knurrte es hinter mir.
Ich nickte. Genau deshalb war ich hier.
Obwohl Bleiglas und Holz nicht wirklich etwas gegen Werwölfe auszurichten vermögen, lehnte ich mich nach dem Eintreten aufatmend gegen die Tür.
»Gut, dass du da bist!«
Ganz neue Töne.
Thomas Faure trat mir mit ausgebreiteten Armen entgegen. Groß und schlaksig wie sein Sohn, auch wenn das ernste Gesicht mehr Falten zierte als das von Nicolai. Halb erschöpft, halb resignierend wies er zur anderen Seite des Raums. Dorthin, wo Carole zwischen beiseitegeschobenen Sesseln am Boden lag. Neben ihr knieten Hendrik und Marcel, der Hausherr in persona. Der alte Wolf hatte die grauen Haare zu einem wirren Zopf gebunden und die blutigen Hemdärmel hochgekrempelt. Beide atmeten schwer, Hände und Arme von Schrammen übersät, die in Anbetracht ihrer übersteigerten Wundheilungsfähigkeiten nicht besonders alt sein konnten.
Hendrik richtete sich auf. »Sie hat angerufen. Vom Festnetz in ihrer Wohnung. Total verwirrt, ich soll sie holen. Im Auto hatt’ sie dann den ersten Krampfanfall.«
Die Lippen der Wandlerin schienen blau vor Kälte, obwohl ihr die Haare im verschwitzten Gesicht klebten. Da halfen auch die Wolldecken nicht, in die sie gewickelt war. Ich streckte die Hand aus, um ihre Temperatur zu fühlen, doch Marcel hielt mich zurück.
»Vorsicht. Sie hält die Gestalt nicht. Das ist keine normale Wandlung. Nicht mal für eine Gestaltwechslerin. Es kommt schubweise und beschränkt sich nicht auf eine Form.« Wenn sogar er in Bedenken verfiel, war es noch schlimmer, als ich annahm.
»Habt ihr Mathias informiert?«
Hendrik schüttelte den Kopf. »Sie hasst es auf der Krankenstation und hat so sehr drum gekämpft, ein paar Tage heimzudürfen. Wenn er sie so sieht …« Er zog die Decke zur Seite. Der Anblick ließ mich scharf die Luft zwischen den Zähnen hervorpressen.
»Scheiße.«
*
»Wie lange wollt ihr euch aus dem Weg gehen?«
Jordi ignorierte Luanna und schob die Stapel mit den Zetteln 1988 bis 2000 auf dem Küchentisch beiseite. Dann nahm er sich die nächste Hälfte vor. Nachdem er Ewigkeiten wachlag, hatte er schließlich kapituliert. Jetzt saß er seit Stunden hier, glich Daten ab und notierte Stichpunkte. Auf Gesellschaft konnte er gut und gerne verzichten, aber Luna ließ sich nicht beirren.
»Hast du etwas rausgefunden?«
»Ja.« Und das machte diesen verdammten Streit nur schlimmer.
»Was?«
»Dass Van recht hat.«
»Bitte?«
»Es ist der Horror. Seit ich die verdammte Akte habe, ist da diese irrationale Hoffnung, dass irgendwo doch etwas zu finden sein muss. Irgendein winziger Hinweis. Eine Lücke im Teppich loser Fäden. Aber Fehlanzeige.«
Da war rein gar nichts.
Vergeblich zu hoffen, bringt nichts als Verzweiflung. Und die irgendwann den Wahnsinn.
Die Worte des Wanderers gingen ihm nicht aus dem Kopf. Sie skizzierten ein schemenhaftes Bild, in dem Vanjars Familiengeschichte frappierende Ähnlichkeit mit seiner eigenen besaß. Zumindest war es das, was Jordi sich aus diversen Bemerkungen und den Begegnungen mit Elli zusammenreimte. Nicht zuletzt dank eines Namens. Das zentrale Puzzleteil, das so viel verband, obwohl er keine Ahnung hatte, wie sie aussah. Sie. Louisa. Vanjars verlorene kleine Schwester. Seit dem Mittag in Croix-Rouge hatte er nicht gewagt, ihn noch einmal nach ihr zu fragen. Weil das zu den Dingen gehörte, über die er nicht reden mochte. So wie Jordi selbst nicht gerne von Marie sprach. Zu viele Parallelen.
Seufzend ließ er sich im Korbstuhl nach hinten fallen.
»Was hast du jetzt vor?«, fragte Luanna.
»Keine Ahnung. Die einzige brauchbare Spur sitzt wegen Bluthandel beim Officium in Haft und schweigt wie ein Grab.«
Das O.I. würde ihm garantiert nicht die Art von Verhör gestatten, die sie zum Plaudern brachte – falls sie ihn überhaupt mit ihr reden ließen. Ein Ding der Unmöglichkeit.
»Frag Van?«
»Der kann mir mit seiner Blasiertheit gerade sowas von gestohlen bleiben.«
»Das ist kein Nein.«
»Aber auch kein Ja.«
»Ihr solltet reden.«
Jordi verdrehte die Augen.
»Dringend«, präzisierte sie.
»Sag das dem verbitterten Zyniker, nicht mir. Außerdem: Hast du eine Ahnung, wo er sich rumtreibt? Nein? Ich auch nicht.«
So viel dazu.
*
Fleckiger Pelz im Wechsel mit braunen Federn bedeckten Caroles Arme bis zu den verkürzten Fingern. Teils Pfoten, teils Vogelkrallen, in verkrampfter Haltung, da die zu kurzen Sehnen es nicht anders zuließen. Der Rücken rund und die verdrehten Beine viel zu dürr. Zwischen den Wandlungen gefangen, wie ich es bei noch keinem Gestaltwechsler gesehen hatte.
Ein Blick auf die krummen Nägel reichte, um die dunklen Verfärbungen zu erkennen, die das Sapientia hinterließ. Der unregelmäßig hervorgestoßene Atem roch deutlich nach Bittermandel.
»Hatte sie irgendwas bei sich?«
Hendrik zog ein Pipettenfläschchen aus der Tasche. Der letzte Tropfen darin wirkte eher bordeaux- als purpurfarben.
»Überdosis?«, fragte Marcel. »Oder gepanschter Stoff?«
Vermutlich beides, aber ich zog es vor, mich nicht darüber auszulassen.
»Kannst du ihr helfen?«
»Ich hoffe.«
»Wie?«
»Energie zu Masse transferieren«, erwiderte ich. »Im Idealfall genug davon, um den Körper vollständig zu regenerieren.«
»In ihre vorrangige Gestalt?« Im Gegensatz zu ihnen nicht die tierische Form, sondern die humanoide. »Willst du sie magisch darin festsetzen?«
»So zumindest der Plan. Habt ihr Kreide oder sowas im Haus?«
Abgesehen von Hendrik gingen die Wölfe auf Abstand, sobald ich die ersten Worte der Formel aufs Parkett kritzelte. Obwohl die Kohle mehr Spuren auf meinen Fingern hinterließ als auf dem Boden, registrierten sie die Magie. Die gleiche Wandlungshemmung, die Schnitzelchen auf der Krankenstation damals blockiert hatte.
»Willst du bleiben?«, fragte ich.
Hendrik zögerte. »Auf uns wirkt’s auch, oder?«
»Ja.« Der Zwang, die Gestalt zu wechseln – und die quälende Gewissheit, es nicht zu können. »Wird nicht gerade angenehm.«
Nervös leckte er sich über die Lippen. Unsicherheit, die in seinem Kopf tobte, aber keinen verbalen Ausdruck fand. Er traute den Reaktionen seines Wolfsnaturells also noch immer nicht.
»Geh, ich passe schon auf sie auf.«
»Nein. Ich lass sie nicht allein. Nicht mit dir.«
»Na dann.« Nachdrücklich platzierte ich den schwarzen Brocken in der verbliebenen Kreislücke. »Halt sie fest.«
Während er sich über der Wandlerin positionierte, um ihre Beine notfalls mit dem eigenen Gewicht zu fixieren, zog ich die Jacke aus und schob sie ihr als zusätzliches Polster unter den Kopf.
Inzwischen zogen sich Fell und Federn den Hals hinauf bis zu den Wangen. Ihr fehlte die Kraft entgegenzuwirken. Sachte strich ich ihr die Haare aus dem Gesicht und tastete an den heißen Schläfen nach dem Puls.
»Es kommt alles in Ordnung.« Dieses Mal würde ich mein Versprechen halten. Egal, was gleich passierte.
»Wann war der letzte –« Ich kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Für einen Sekundenbruchteil spannte sie sämtliche Muskeln an.
Ich sah zu Hendrik auf. »Bereit?«
Für mehr als ein Nicken reichte es nicht. Dann riss Carole die Augen auf. Ihr Körper zuckte, bäumte sich auf, die Wirbelsäule durchgebogen. Begleitet von einem markerschütternden Schrei.
*
»Bonjour chérie. Was kann ich für dich tun?«
Luanna verdrehte die Augen. Das war so typisch.
»Ist Van bei dir?«
Das Auflachen aus dem Lautsprecher klang überdreht und künstlich. Ganz so, wie Mireille sich mit Vorliebe präsentierte.
»Nein. Leider«, setzte sie nach einer unnötig in die Länge gezogenen Pause hinterher.
»Mist.«
»Ich hoffe, er hat einen guten Grund, dich ausgerechnet heute allein zu lassen.«
Heute. Am Tag nach der Beerdigung ihres Vaters, den sie eigentlich mit ihrem Bruder verbringen sollte. Doch Maxime hatte sich gestern mit einer knappen Umarmung vor dem Friedhof verabschiedet. »Kommst du klar, Schwesterchen?« Als ob sie das Sorgenkind wäre!
»Bestimmt«, entgegnete sie automatisch. Die Antwort galt nicht nur Maxi in ihren Gedanken, sondern genauso Mireille. Nicht einmal ihre Mutter war da gewesen. Weil sie nicht wollte? Weil sie nicht dazu in der Lage war?
Eine ganze Reihe an Vollmachten hatte sie immerhin unterschrieben. Tante Silly hatte sie ihr mitgebracht – zusammen mit einem Haufen schlechter Nachrichten. Geschlossene Psychiatrie, medikamentöse Einstellung, Therapieverweigerung … und das waren nicht einmal die hässlichsten Anmerkungen. Es hatte sie ein hübsches Stück Überredungskunst gekostet, Silly klarzumachen, dass sie und Maxi zurechtkamen. Dass sie nicht bleiben musste. Wenn sie ihren Job in Marseilles behalten wollte, funktionierte das ohnehin nicht. Unter einem Haufen Versprechungen war ihre Tante schließlich in den Zug gestiegen. Eines davon war, dass sie ihrer Mutter gemeinsam eine bessere Welt vorspielen würden. Ein anderes, dass Maxi nicht zu lange die Schule schwänzte. Luanna wusste nicht recht, was schwerer einzuhalten sein würde.
»Soll ich dich abholen?«, fragte Mireille.
Skeptisch neigte Jordi den Kopf zur Seite, als versuchte er, sich irgendeine gehässige Bemerkung zu verkneifen.
»Nein, schon in Ordnung.«
»Okay?«
So viel Sorge wie in diesen vier Buchstaben mitschwang, hätte sie fast glauben können mit einer völlig anderen Person zu sprechen.
»Wirklich. Der taucht schon wieder auf. Und ich bin nicht allein.«
*
Im Leuchten der Magieströme verzerrte sich Caroles Gesicht zum Kopf der Hyäne. Nicht gut. Weder dass ich die Energie tatsächlich visuell registrierte noch dass die Wandlung fortschritt. Ein Gestaltengemisch aus Vogel und Hyäne. Formgewordene Panik samt gefletschten Zähne und aufgerissenen Augen.
Hendrik legte eine respektable Reaktionsgeschwindigkeit an den Tag. Er lehnte sich nach hinten, fing ihre Tritte ab und verhinderte gleichzeitig, dass sie sich und ihn verletzen konnte. Allerdings verschaffte er ihr damit die Chance, einen Arm aus seinem Schraubstockgriff zu lösen. Mir hingegen gelang es nicht, rechtzeitig auszuweichen. Eine Kralle schrammte durch mein Gesicht, knapp unterm linken Auge vorbei. Dazu bohrten sich ihre Fänge in meine Hand. Die Welt explodierte in Schmerz und Funkenregen. Der Beweis für den sich schlagartig entladenden Zauber, der Carole eigentlich genau davor bewahren sollte. Glühende Spiralen schraubten sich in den krampfenden Körper und ließen ihn erbeben. Zusammengesetzt aus Blutzauber und Beeinflussung. Nicht um gegen das Sapientia anzukämpfen, sondern um die Wirkung der Essenz in neue Bahnen zu lenken.
Der Schub verschaffte Hendrik immerhin die Gelegenheit, ihren freien Arm zu packen. Und mein Plan ging auf: So schnell sich der Schmerz des Bisses steigerte, so zügig wichen Pelz und Federn und ihre Gliedmaßen gewannen die gewöhnliche Form und Größe zurück. Mein Kopf quittierte die Erleichterung darüber mit grellen Blitzen. Dabei durfte ich den Zeitpunkt nicht verpassen, diesen verdammten Kreis zu schließen. Nur ein paar Sekunden, zwei, drei, vier …
Wie von Geisterhand bewegt, zog das Kohlestück das letzte Zeichen aufs Parkett. Die Krämpfe verebbten und Hendrik sank aufstöhnend mit Carole zur Seite.
Im Gegensatz zu ihm registrierte ich die Folgen der Wandlungshemmung kaum. Dafür schmerzte mein Arm zu stark. Kraftreserven ausgebrannt.
# drittes Kapitel
[Donnerstag. Immer noch.]
Das Klicken schleichender Pfoten mischte sich mit Pizzaduft und einer Reihe halbgarer Erinnerungen, in denen ein verbeulter Erste-Hilfe-Kasten, eine Flasche sündhaft teureren Whiskys und das Salonsofa tragende Rollen spielten. Alkoholgeschwängerte Wattegedanken, die von einer deftigen Portion Schmerzen zugunsten eines astreinen Panikmoments verdrängt wurden.
»Carole!«
Eine kalte Wolfsnase berührte die Finger meiner Rechten, die in mehrere Lagen Verbandsmaterial gehüllt war. Mein Kopf fühlte sich schwammig an, die Augen brannten. Zu wenig Schlaf, zu viele Schmerzmittel und ein grässlicher Kater.
Mich aufzusetzen, stellte meinen Kreislauf hart auf die Probe. Jede Bewegung vom Blick dunkler Wolfsaugen verfolgt. Ein gebeugter Rüde im grauen Pelz. Übersät von Narben, gezeichnet von unzähligen Revierkämpfen. Der Alpha, dem jeder hier gehorchte.
›Es geht ihr gut. Sie hat dich ganz schön zugerichtet.‹
»Ich werd’s überleben.« Ich klang grauenvoll. »Wo ist sie?«
›Draußen. Mit Hendrik.‹
Ich machte Anstalten aufzustehen, doch Marcel baute sich drohend vor mir auf. ›Wenn du dieses Haus verlässt, betrittst du es so schnell nicht wieder.‹
»Berufsrisiko.«
›Du weißt, was sie dir nachsagen.‹
Sie?
»Du etwa nicht?«
Schnaubend wandte er sich um und trottete zur Tür. ›Nein. Ich schiebe niemandem die Schuld zu, nur weil es leichter zu ertragen ist, wenn man jemanden verurteilen kann. Und das ist das Einzige, was dir hier den Hals rettet, Vanjar.‹
Zu gütig.
Ich ließ ihn stehen. Statt den Weg durch die Haustür wählte ich die direkte Variante - jene, die die Terrassentür überging und mich in Hörweite eines Gesprächs brachte, das garantiert nicht für meine Ohren bestimmt war.
»Ich kann nicht zurück, Hendrik! Ich ertrage das nicht. Ihr verdammtes Mitleid. Das Flüstern hinter meinem Rücken. Gerade du müsstest das doch verstehen.«
Die letzte Silbe ging in einem Schlucken unter. Der Schwede folgte ihrem Blick. Zu mir, mit dem geschwollenen Cut im Gesicht und der verbundenen Hand, über die ich lieber den Pulloverärmel zog.
»Nein!« Hektisch stemmte sie sich auf die Krücken, um mir entgegenzulaufen. »Das - ich wollte nicht, ich meine …«
Bevor sie sich um Kopf und Kragen redete, winkte ich ab. Wovon sie sich allerdings nicht beeindrucken ließ.
»Es tut mir so leid! Ich weiß, ich hätte nichts nehmen dürfen. Aber …« Kurz blickte sie zur Seite und holte Luft. »Zwei Wochen in diesem beschissenen Krankenzimmer. In dieser unnützen Gestalt. Ich dachte, ich drehe durch. Ich hab es nicht mehr ausgehalten gestern, verstehst du?«
Gefangen zu sein. An einem Ort, in einer einzigen Gestalt. Und ob ich sie verstand. Besser, als sie ahnte.
»Schon okay.«
War es nicht und sie wusste das so gut wie wir.
»Vogelseele nannte Oma mich immer. Weil ich den Himmel brauche. Weil ich nicht leben kann, ohne zu fliegen.«
Hendrik legte ihr seine Pranke auf den Rücken. Obwohl er keine gefiederte Gestalt besaß, kannte er das Gefühl, in einer anderen Form aus dem eigenen Leben zu fliehen, inzwischen so gut wie jeder Wandler. Und er war ihm genauso verfallen wie wir, auch wenn er das ums Verrecken nicht zugeben mochte. Weder er noch ich würden sie verpfeifen.
Aus der Innentasche meiner Jacke kramte ich das leere Pipettenfläschchen, dann einen fast bis zum Rand befüllten Zwilling. Meine Notfallration. Seit der Dimensionsspalt nicht mehr existierte und weder Hirngespinste noch schwarzes Nasenbluten mich heimsuchten, hatte ich sie nicht mehr angerührt – und trug die Ampulle dennoch ständig mit mir herum. Weil es guttat, sie ihn Reichweite zu wissen. Kurz wog ich das Ding in der Hand, dann warf ich es Hendrik zu.
»Maximal vier Tropfen. Unter deiner Aufsicht.«
Wieder in La Défense aufzutauchen fühlte sich ein wenig danach an, das Universum zu wechseln. Zwischen Nobeleinrichtung und Glasfronten zwölf Stockwerke über dem Boden wirkte das Geschehen in der alten Villa wie der Blick in eine Parallelwelt.
Mireilles Miene verfinsterte sich, als sie den Schnitt in meinem Gesicht sah. Flüchtig berührte sie die geschwollene Haut, dann wickelte sie den Verband an meiner Hand ab.
»Was ist passiert?«
»Ein Gefallen unter Kollegen.«
»Ex-Kollegen«, korrigierte sie. »Du riechst nach Wolf. Hendrik?«
Ich nickte und wäre fast zurückgewichen, als sie ihre Hand sanft auf meine legte. Um die Heilung brauchte ich nicht zu bitten – wie bei allem anderen.
»Das ist kein Wolfsbiss.«
Das ging sie einen Scheiß an. Nichts zu sagen reichte, ihr genau das klarzumachen. Mit gespieltem Seufzen rückte sie näher und zog mich an sich. Ihr ganzer Körper schien die Wärme auszustrahlen, mit der sich die Zauber ausbreiteten. Intensive Wellen, die den Schmerz vertrieben und das Gedankenchaos betäubten, bis es zu einer rauschenden Dauerschleife verkam.
Dieser irrsinnige Haufen Scheiße, den ich zu verantworten hatte. Angefangen bei dem Metrowolf, der dank meiner Fehlentscheidung elendig verreckt war. Danach hatte das Desaster seinen Lauf genommen. Caroles und Sébastiens ruinierte Leben bis hin zu dem Wolf, der den Kampf auf den Schienen nicht überstand. Auch wenn ich nicht zu sagen wusste, ob die Furora-Überdosis schuld war oder meine Offensive, die ihn in den Tunnel gezerrt hatte. Hendrik rettete das nicht. Oder Leo. Unzählige auf die eine oder andere Weise zerstörte Leben. Genau wie das von Luanna, das aktuell den Bach hinunterging, weil ihr Vater sich dank meines Fluchs zu Tode gesoffen hatte. Nichts davon ließ sich geradebiegen. Die einzige Chance, etwas in Ordnung zu bringen, hatte ich gestern glorreich versemmelt – und mir dabei eine blutige Lippe eingehandelt.
Das alles hätte mir hier vielleicht eine Weile egal sein können – wäre dieser verdammte Tag nicht genau so ausgegangen, wie er anfing: mit einem klingelnden Telefon.
Fluchend und ohne das Gespräch entgegenzunehmen beförderte ich das Handy auf den Nachttisch und ließ mich zurück in die Kissen fallen. Ich hätte das Teil ausgeschaltet lassen sollen.
Skeptisch nahm Mireille den Apparat zur Hand.
»Du solltest rangehen.«
Sollte ich. Tat ich aber nicht.
Sie hielt mir das Telefon vor die Nase. Eingehender Anruf: Luanna Salomon.
»Wenn du nicht mit ihr redest, werde ich es tun.«
Ich griff nach dem Drecksding und drückte den grünen Hörer.
»Weltuntergang oder Damoklesschwert?«
»Beides«, presste sie hervor. »Maxi wurde verhaftet.«
Scheiße.
»Irgendein Drogendeal. Auch noch in Pigalle. Er war wohl als Kurier unterwegs. Sie haben ihn ins Kommissariat gebracht. Rue de Clignancourt. Mehr weiß ich nicht.«
»Bist du schon dort?«
»In zehn Minuten. Wir fahren grade los. Kannst du –?«
»Bis gleich.«
Mehrere Beamte standen vor dem pseudo-modernen Betonklotz mit seinen fünf Stockwerken Wache. Direkt vor dem runden Glasbau, der an eine eingefasste Konservenbüchse erinnerte. Dort parkte auch ein Einsatzbus, an der Straße standen weitere Dienstwagen. Pylone und Gitter zwischen akkurat gestutzten Bäumen hielten zivile Parker vom Gehweg fern und bildeten einen geregelten Zugang zur Station.
Auf einer dieser Absperrungen machte ich es mir bequem. Unweit von zwei rauchenden Streifenpolizisten, die dank einer Dissimulatio keinerlei Notiz von mir nahmen. Die ältere Kollegin bot dem jungen Uniformträger eine Schachtel Kaugummi an, aus der er sich dankend bediente.
»Das sind doch noch Kinder«, sagte er zwischen den Nikotinzügen.
Sie nickte traurig. »Wenn du das Leben als Laufbursche für Drogendealer oder Späher auf den Dächern in den Banlieues Kindheit nennen willst, ja. Aber die werden schneller erwachsen, als gut für sie ist.«
»Und kaum kommen sie mal aus ihrem siffigen Vorstadt-Ghetto raus, landen sie bei uns.«
»Die wurden garantiert nicht zum ersten Mal erwischt. Hier vielleicht, aber nicht generell. Wenn es nach dem Gesetz geht, könnten sie morgen früh schon beim Haftrichter sitzen. Sie sind älter als dreizehn. Lange gefackelt wird da nicht mehr.«
»Und das findest du richtig?«
»Nein. Aber die Regierung.«
»Ich würde sie lieber ordentlich zusammenstauchen und laufen lassen.«
»Ich auch. Aber nicht bei der Menge. Und dann auch noch Tabletten. Ging ja nicht nur um ein bisschen Cannabis. Das Einzige, was sie jetzt vielleicht rettet, ist zu reden.«
»Was sie nicht tun werden. Die verraten sich nicht gegenseitig. In den Vierteln herrscht Solidarität.«
Die beiden setzten ihren Weg fort. Auf der anderen Straßenseite zog derweil ein metallicgrauer Clio halsbrecherisch in eine frei gewordene Parklücke.
»Mademoiselle Salomon?« Die Polizistin, die ich vorhin beim Rauchen belauscht hatte, streckte den Kopf aus einer Bürotür in den Wartebereich, wo wir auf unbequemen Stühlen die Zeit absaßen. »Commissaire Levert möchte Sie sprechen.«
Jordi machte Anstalten ebenfalls aufzustehen, doch die Beamtin bat ihn mit einer Geste zu warten. »Nur Angehörige, bitte.« Sie lächelte müde. »Es ist bloß eine Tür weiter.«
Luanna sank ein Stück in sich zusammen.
›Wir können von hier aus zuhören‹, ließ ich sie wissen.
»Okay.«
Sobald sich die Tür hinter den beiden Frauen schloss, ließ Jordi sich mit genervtem Grummeln mir gegenüber auf einen der Stühle fallen. Die Beine so weit in den Gang gestreckt, dass er mir dabei gegen die Zehen trat. »Wieso zur Hölle lassen wir uns das gefallen?«
Ich bedeutete ihm still zu sein und machte es mir im Schneidersitz bequem. »Willst du zuhören?«
Es dauerte, bis er begriff. »Seit wann fragst du, ob ich mit deinem Telepathenscheiß einverstanden bin?«
›Ich interpretiere das mal als Ja.‹
*
Der Eindruck, den Commissaire Levert und ihr Büro hervorriefen, glich dem Klischee der überarbeiteten Beamtin, die neben Familie und Haushalt einen anspruchsvollen Job managte. Sie sah verbraucht aus, müde, mit unordentlichem Zopf, aber tadelloser Garderobe. Das Make-up verwischt, der Mascara mehr Faltenschatten als Wimpernbetonung. Im Chaos auf ihrem Schreibtisch standen Familienbilder und ein halb geleerter Joghurtbecher, das Sideboard krönten ein Fahrradhelm und Handschuhe.
»Meine Kollegin hat ihre Daten bereits aufgenommen. Also kommen wir gleich zum Wesentlichen. Sie haben aktuell die temporäre Vormundschaft für Maxime inne?«
»Ja.« Dieses Gespräch war jetzt schon anstrengend, mittlerweile war ihr richtig schlecht. »Unser Vater wurde gestern beerdigt. Mama befindet sich derzeit in einer stationären Therapie.«
»Mein Beileid.«
Wie sie diese Floskel hasste. Sie brachte es nicht fertig, sich dafür zu bedanken. Wenn die Beamtin schon auf ein Vier-Augen-Gespräch bestand, konnte sie gefälligst zur Sache kommen. »Bitte, erklären Sie mir, was los ist?«
»Maxime und zwei weitere Jungs waren als Kuriere in ein Drogengeschäft verwickelt. Es handelt sich um verschiedene Sorten synthetischer Rauschmittel in Tablettenform. Eine beträchtliche Menge. Über die Details darf ich Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in Kenntnis setzen, aber klar ist, dass es sich nicht um ein Bagatellvergehen handelt. Können Sie mir dazu etwas sagen?«
Das ging schnell. Ehrlich gesagt war Luanna nicht sicher, ob Madame Levert von sich aus so gesprächig war.
»Tut mir leid, nein. Ich vermute, Sie haben die Akte des Jugendamts eingesehen. Sie kennen unsere Geschichte, wissen, dass ich Arbeit habe und mit allen Mitteln versuche, aus den Banlieues rauszukommen. Ich gebe, was ich kann, um mich und meinen kleinen Bruder aus der Scheiße zu ziehen. Und wir wissen beide, dass ich auf ganzer Linie versage. Hier zu sitzen, ist der beste Beweis. Was glauben Sie, wie es mir damit geht? Bestehen Sie wirklich darauf, diese Farce von einem Gespräch zu führen?«
Perplex schob die Kommissarin die Papiere zurecht. Mit jenem glasig-abschweifenden Blick, den Luanna von den Jugendamtsangestellten kannte. So war das also. Vanjar beeinflusste sie von da draußen. Pfuschte ihr im Kopf herum, um das Gespräch in Bahnen zu lenken, die ihr zumindest entgegenkamen.
»Was ich möchte, ist die Sache so glimpflich wie möglich für die Jungs ausgehen zu lassen. Sie haben genug Scherereien. Aber so einfach wird das leider nicht. Die Beweislast ist eindeutig.«
Hoffnungslos. Sie verwendete das Wort nicht, dabei stand es ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Maxime hatte Mist gebaut, so schlimm wie noch nie in seinem Leben. Selbst wenn Gris ihn da rausboxte, wie lange würde es dauern, bis es wieder so weit war? Verdammter Dickkopf!
»Darf ich mit ihm sprechen?«
Gerade brachte sie beim besten Willen nicht die Geduld für ausschweifende Höflichkeiten auf.
»Darum möchte ich Sie sogar bitten. Die Jungs waren zu dritt. Einer konnte flüchten, der andere ist beim Sprung über ein Geländer gestürzt und muss derzeit medizinisch behandelt werden. Maxime hat bisher kein Wort gesagt. Dabei wäre das ein Ausweg für ihn. Wenn er Informationen zum Netzwerk preisgibt und kooperiert, könnte sich das positiv auf sein Strafmaß auswirken.«
»Verstehe.« So gefasst sie klang, so sehr tobte es in ihr. »Ich versuche gerne, Ihnen zu helfen, aber versprechen kann ich nichts.«
»Warten Sie bitte einen Moment draußen.«
*
»Das wird er nicht tun!« Luanna brachte nicht die Ruhe auf, sich wieder hinzusetzen. Stattdessen trat sie Pfade im Flur und drehte eine Haarsträhne zwischen den Fingern umher. »Er verrät seine Freunde nicht.«
»Eigentlich«, hängte Jordi an.
Luanna starrte ihn fassungslos an, dann fuhr sie zu mir herum. »Nein, du darfst ihn nicht beeinflussen! Wenn er plaudert, bringen sie ihn um!«
»Es sei denn, er ist nicht der Einzige, dem im Kopf rumgepfuscht wird«, hielt Jordi stur dagegen. »Zumindest theoretisch.«
Ganz sicher nicht.
»Praktisch fehlt mir dazu jegliche Handhabe. Gedächtnismanipulationen von Unwissenden werden nur bei Konflikten mit der paranormalen Gesellschaft autorisiert. Die Sache mit dem Jugendamt war mehr als grenzwertig. Bei einem Verbrechen herumzupfuschen, ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.«
»Seit wann hältst du dich bitte an irgendwelche Regeln?«, blaffte Jordi mich an.
»Mache ich nicht. Ich habe nur nicht vor, mich erwischen zu lassen. Wenn auffliegt, wie viel wir mitmischen, werden sämtliche Beeinflussungen annulliert. Dann landet Maxi nicht nur im Knast, sondern der Kram mit der Vormundschaft hat sich genauso erledigt.«
Durchatmend strich Luanna sich die Haare mit beiden Händen aus dem Gesicht, als könnte sie so auch ihre Gedanken zurechtrücken. Konsequenzen abwägen, Szenarien durchdenken.
»Nein«, sagte sie schließlich. »Er ist selbst für diesen Mist verantwortlich, also wird er selbst entscheiden.« So sehr sie es zu vermeiden versuchte, ihre Stimme klang nach erstickten Tränen. »Was aus unserer Familie geworden ist, ist nicht seine Schuld. Dass er als Drogenkurier für diese Arschlöcher springt, schon.«
Die unschönste Variante also.
»Schaut mich nicht so an. Ich lasse ihn nicht allein und ich lehne keine Hilfe ab. Aber ich erwarte nicht, dass ihr ihn da ungeschoren rausholt. Das ist ein Teil meines unwissenden Lebens. Ihr und Gris nicht.«
Die Bürotür flog auf und die Kommissarin wuselte heraus, ein schnurloses Telefon zwischen Ohr und Schulter eingeklemmt. »Es ist mir egal, wie lange sie im Haus ist! Ich erwarte eine Rückmeldung. Heute!« Mit einer Geste bat sie uns, ihr zu folgen. Auf dem Weg zum Treppenhaus steckte sie das Telefon ein. »Entschuldigen Sie. Wir haben einen Raum vorbereitet. Sie unterhalten sich unter vier Augen. Wir hören von der anderen Seite zu und erstellen einen Audiomitschnitt.«
Luna nickte und hielt noch vor dem Treppenaufgang inne. »Ihr müsst nicht auf mich warten. Ich habe nicht zum ersten Mal mit sowas zu schaffen.«
Offensichtlich sprach meine Miene genauso Bände wie die von Jordi. Kam nicht infrage.
»Gleich gegenüber ist ein italienisches Bistro«, schlug Madame Levert vor. »Hier im Haus gibt es auch eine Cafeteria.«
Jordi machte bereits auf dem Absatz kehrt. »Wir finden schon was. Ruf an, wenn du fertig bist.«
Im Erdgeschoss blinkte uns erwartungsvoll ein Kaffeeautomat entgegen. In schweigendem Einvernehmen stiefelten wir darauf zu.
Jordi wählte einen Café Crème mit extra Milchschaum, nur um mit einem Blick in seinen Geldbeutel fluchend festzustellen, dass sein Kleingeld nicht reichte. Kommentarlos übernahm ich die Bezahlung und zog das Schokoladenpendant mit Karamellsirup. Ausgestattet mit Einwegbechern suchten wir uns eine Bank im überdachten Innenhof.
Eine Weile saßen wir schweigend in diesem zu opulent geratenen Wintergarten zwischen Inseln aus Plastikgrün, pflegeleichten Palmen und bunten Werken einer dem Impressionismus verfallenen Künstlergruppe, denen die zweifelhafte Ehre zuteilwurde, erschöpfte Polizeibeamte in ihrer Pause zu erfreuen. Lokalausstellung für Studentenfrischlinge.
»Können wir gar nichts tun?«, fragte er schließlich.
»Außer mit einem guten Anwalt, Geld und Unterstützung im bürokratischen Labyrinth aushelfen? Ich fürchte nicht.«
»¡Qué mierda!«
Das fasste die Situation ziemlich gut zusammen – und sorgte dafür, dass wir uns wieder anschwiegen. Kommunikative Unfähigkeit auf höchstem Niveau. Und natürlich schweiften seine Gedanken zügig von Luna und ihrem Bruder zu seiner Schwester - und damit unwillkürlich zu Mademoiselle Balzac.
»Raus aus meinem Kopf.«
»Lo siento.«
»Du entschuldigst dich?«
Das war wohl angebracht. Und zwar nicht nur für das verhasste Kopfgestöber.
# viertes Kapitel
Der Raum mit den grauen Wänden wirkte drückend, obwohl nur ein Tisch und zwei Stühle darin standen. Vielleicht lag es an der niedrigen Decke. Oder daran, dass das, was sich Fenster schimpfte, lediglich aus schmutzigen Glasbausteinen bestand.
Die Polizistin, die sie zu Commissaire Levert gebracht hatte, bat sie mit einem mitleidigen Lächeln herein. Ob sie selbst Kinder hatte?
»Ich bin gleich hier im Gang. Nur falls was sein sollte.«
Dann schloss sie nahezu geräuschlos die Tür. Vor einer Wand mit Einwegspiegel saß Maxime.
Ein zusammengesunkenes Häufchen Elend und Trotz. Er trug weder Handschellen noch hatte man ihm Gürtel oder Schnürsenkel abgenommen. Seine Jeans war an den Knien aufgerissen, die Schuhe verschrammt. Wie erschöpft er aussah. Starrte müde zu Boden, um niemandem, der hereinkam, in die Augen sehen zu müssen. Hektisch wippte er mit dem Fuß, wie er es immer tat, wenn er angespannt war.
»Hallo.«
Überrascht hob er den Kopf. »Lulu!«
Der Stuhl kippte beinahe um, als er auf sie zustürmte. Einen Augenblick hielten sie einander einfach fest.
»Es tut mir so leid«, schniefte er schließlich.
*
»Wie viel Dreck kann eigentlich noch kommen?« Jordis Becher landete im nächsten Papierkorb, der sich scheppernd bedankte. »Wir löffeln das Unglück doch gerade mit dem Klappspaten, oder?«
»Hm. Scheint ansteckend zu sein.«
»Allerdings. Vielleicht hat Jean recht und es gibt wirklich einen Beta-Fluch. Ein ganz persönlicher Pecheimer für jeden im Team.«
War es jetzt schon so weit, dass irrwitziger Aberglaube infrage kam?
»Schau mich nicht so an. Ist doch wahr. Erst Lunas Vater, dann ihr Bruder, quasi jeder, der mit uns zusammenarbeitet von Carole bis Hendrik. Bei dir fang ich gar nicht erst an aufzuzählen. Und ich? Egal was ich mache, mir rutscht der letzte Faden ständig durch die Finger. Ich meine, eine Kronzeugin des Officium. Da gibt es quasi keine Chance ranzukommen.«
»Doch.«
»Ja, klar. So viel zum Thema regelkonform.«
»Ist es. Absolut.«
Ihm war deutlich anzusehen, dass er eigentlich nicht fragen wollte – es aber nicht fertigbrachte, sich den rettenden Strohhalm entgehen zu lassen.
»Wie zur Hölle willst du das anstellen?«
Kurz schien der Abgrund zu schwinden, der sich mit dieser verdammten Akte zwischen uns aufgetan hatte. Fragte sich nur, ob der nächste Satz als Kitt taugte oder alles nur schlimmer machte.
»Ein Teil meiner Abmachung mit Julius steht noch offen.«
»Und das heißt?«
»Uneingeschränkte Befragungsrechte im Belladonna-Fall.«
Sein Blick war Gold wert. Jeder Lemur wäre neidisch geworden. »Ich weiß gerade nicht, ob ich dich dafür umarmen oder dir noch eine in die Fresse schlagen soll.«
*
»Ich wusste nicht, was in dem Paket war. Klar, Zeug zum Verticken, aber nicht wie viel. Oder was es wert ist. Wir sollten den Kram an zwei Metrostationen abliefern. Blanche und Stalingrad.«
Wieso war er so leichtsinnig gewesen, sich darauf einzulassen? Das stank doch förmlich nach Ärger.
»An wen?«
»Typen mit rot-blauen Basecaps, auf denen eine Dreiundneunzig aufgestickt ist. Ich kenn keine Namen.«
Dreiundneunzig. Die ersten beiden Ziffern der Postleitzahlen, die den Block kennzeichneten, aus dem sie stammten. Dort prangte die Zahl überall, auf Wände gesprüht, in Türen und Geländer gekratzt.
»Maxi, sie werden mich nach den Jungs fragen.«
»Ja und? Du brauchst gar nichts zu sagen. Die Bullen wissen doch genau, wer da alles mit drinhängt. Die wussten, wo wir waren! Voll das abgekartete Spiel.«
Irgendwer hatte also gepetzt. Und drei Kinder in diese Hölle geschickt.
»Haben sie deshalb euch genommen? Weil sie geahnt haben, dass was schiefgehen könnte?«
Er ging auf Abstand, jenen missmutigen Blick aufgesetzt, den er immer zur Schau trug, wenn ihr Vater anfing, mit leeren Flaschen zu hantieren.
»So ein Quatsch! Die Jungs lassen uns nicht ins offene Messer laufen! Wir sind Brüder. Da hintergeht man sich nicht! Das war eine Chance, verstehst du? Endlich mal mehr machen, als auf der Straße rumzuhängen. Ein scheiß Vertrauensbeweis. Außerdem bringt Pakete liefern Geld. Deshalb hab ich’s überhaupt erst gemacht!«
Das konnte nicht sein Ernst sein! »So ein Müll! Wenn du Geld für irgendwas brauchst, warum sagst du dann nicht Bescheid?«
Sie hätte es ihm gegeben, ohne zu zögern. Und das wusste er ganz genau. So war es früher schon gewesen, wenn sie ihr Taschengeld für gebratene Maiskolben ausgab, damit sie nicht hungrig ins Bett gingen.
»Weil das nicht fair ist. Ich lasse meine Schwester doch nicht für mich schuften! Ich bin nicht wie Paps. Du zahlst schon die Miete. Mach lieber endlich deinen Führerschein.«
»Du Spinner!« Die Hand vor den Mund gepresst, versuchte sie, gegen den Kloß im Hals anzukämpfen. Für den Moment war sie nicht mehr wütend, sondern entsetzt. »Das scheiß Geld ist doch völlig egal, wenn du dafür nicht in den Knast wanderst! Was soll denn werden, wenn sie dich wirklich wegen Drogenhandel einbuchten? Hast du darüber mal eine Minute nachgedacht?«
»Pfff. Von den Jungs haben das auch fast alle durch. Die Stadt will uns nicht. Falsche Ecke, falsche Herkunft. Hast du vergessen, wie’s läuft? Wir kommen aus den Banlieues. Nur weil du Glück hattest, kriegt nicht jeder bei den Reichen einen Job und einen Kerl ab.«
Sie wollte widersprechen, dabei stimmte, was er sagte. Genau genommen hatte sie nicht nur einen ›Kerl‹, sondern gleich zwei. Wenn auch nicht so, wie Maxi sich das vorstellte.
»Dann mach die verdammte Schule fertig und ich seh zu, dass wir dir Arbeit besorgen. Nur so kommst du raus. Glaubst du mit Vorstrafen und ohne Abschluss wird das leichter?«
»Fuck, du redest daher wie die Streetworker.«
»Weil -« Sie brachte den Satz nicht zu Ende. Was sie da von sich gab, war absoluter Mist. Es war sinnlos, darüber zu streiten. Sie konnte die Zeit nicht zurückdrehen. Keine Magie des Universums vermochte das. Maxime wollte nicht in ihrer Welt leben und sie hatte ihn dort gelassen, wo er sich zuhause fühlte, um ihn nicht in ein Leben zu zwängen, das er nicht akzeptieren konnte. Um ihn nicht zu verlieren. Jetzt bekamen sie die Quittung dafür.
»Sie geben mir die Schuld, weißt du. Ich hätte auf dich aufpassen müssen. Mich darum kümmern, dass du keine Scheiße baust. Aber ich habe dir eben nicht reingeredet. Damit du nicht wegläufst wie bei Mama und Paps. Weil ich dich lieb habe und auch nicht so sein will wie sie. Das Problem ist, dass es das nicht besser gemacht hat. Und jetzt ist doch alles schrecklich. Weil ich dir nicht helfen kann, obwohl das alles ist, was ich gerade will.«
»Die Gesetze sind Hühnerscheiße. Das ist doch unfair!«
»Ja. Aber wir können sie nicht ändern. Verdammt, Maxi, ich hab Angst um dich.«
Er schaute zur Seite, damit sie nicht sah, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. »Ich hab auch Angst.«
*
In Begleitung von Commissaire Levert kam Luanna den Gang entlang auf uns zu. Unter mitleidigem Lächeln zog die Beamtin eine Visitenkarte aus der Tasche.
»Falls Ihnen noch etwas einfällt, Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie uns an.«
Luanna nahm die Karte zwar entgegen, bedankte sich jedoch nicht.
»Lasst uns bitte gehen.«
Sobald sich die Tür zum Treppenhaus schloss, löste sich ihre Anspannung in einer Fluch- und Schimpftirade auf, die Maxime genauso einschloss wie Frankreichs Strafrecht und ihren Vater.
»Dieser Säufer ist doch an allem schuld! Wäre er noch am Leben, hätte Maxi nie versucht Geld für die Miete aufzutreiben! Dieser egoistische Wichser! Wie kann man nur so verflucht verantwortungslos sein?«
Innerlich zuckte ich zusammen. Verflucht war genau das richtige Wort dafür.
»Sie haben mich nach Maxis Kumpels gefragt. Nicht ein Name war dabei, den sie noch nicht auf ihrer Liste hatten. Morgen muss ich nochmal herkommen, um die Aussage zu unterschreiben.«
»Wann?«
»Vormittags. Aber das mache ich allein.« Kaum war der Ausgang in Sicht, holte sie das Zigarettenpäckchen hervor. »Er bleibt in Untersuchungshaft, bis die anderen beiden verhört wurden. Danach entscheidet ein Haftrichter.«
Ehe sie dazu kam, nach ihrem Feuerzeug zu suchen, entzündete sich die Kippe von selbst, was mir einen erstaunten Seitenblick einhandelte.
»Ähm, danke.«
»Geschenkt.« Gerade war ich es leid, über die vermaledeiten Glimmstängel zu diskutieren. Genüsslich inhalierte sie den Rauch und hakte sich zwischen uns unter. »Dass ihr für mich da seid, meine ich.«
Jordis »Natürlich« kam zeitgleich mit meinem »Immer«.
Jordi stellte den Motor des Clio ab und zog den Schlüssel. »Gerade hätte ich nichts gegen einen Drink einzuwenden.«
Der erwartete Protest von der Rückbank blieb aus. Gleichzeitig schauten wir in den Spiegel. Luanna döste, vollkommen erledigt, den Kopf ans Fenster gelehnt.
»Oben stehen diverse Flaschen zur Auswahl«, schlug ich vor.
»Ist das ein Friedensangebot?«
»Wenn du willst.«
Zum ersten Mal seit gestern schwand der Schatten gänzlich von seiner Miene.
»Für jedes Glas fünf Antworten.«
»Drei.«
»Bis wir betrunken genug sind, einfach einzupennen. Und von den Erinnerungen, die morgen noch übrig sind, lässt du gefälligst deine Telepathenfinger.«
Vermutlich war es dann ohnehin zu spät, sie zu löschen.
»Das ist ein mieser Deal.«
So zufrieden hatte ich ihn lange nicht grinsen sehen. »Sí.«
**
»Glaubst du, dass etwas im Gange ist?« Die Frage drang heute bereits zum zweiten Mal aus der Freisprechanlage. Carina hatte sie ebenfalls gestellt.
»Deine Schwester wollte das Gleiche wissen. Die Angelegenheit in Paris lässt Spielraum für Spekulationen und ich möchte, dass wir in Frankreich weiterhin die Ohren offenhalten. Vor allem bei denen, die mit Michelo del Ferana sympathisiert haben. Überwacht seine alten Kontakte.«
Baptiste gab ein unwirsches Grummeln von sich. »Del Ferana ist tot, Vater. Niemand sympathisiert mehr mit ihm.«
Das war sicherlich die Ansicht der meisten. »Seine Kinder leben noch. Das ist Grund genug, nicht nachlässig zu werden.«
Ende der Diskussion.
Einen Moment blieb es still auf der anderen Seite der Leitung. Dabei wusste er ganz genau, worüber, nein, an wen Baptiste dachte.
»Wie geht es ihr?«
»Ihre Erinnerungen vergehen«, erwiderte Baptiste. »Sie fragt nicht mehr nach ihnen. Nur nach ihrem Bruder ruft sie noch im Schlaf.«
»Du weißt, dass das vielleicht nie aufhören wird. Das ist kein Kriterium für den Verlauf ihrer Wandlung. Die Hauptsache ist jetzt, dass sie regelmäßig trinkt.«
Er hatte genug Änderungen erlebt, in denen die Übergangsphasen Monate in Anspruch genommen hatten. Insbesondere bei Kindern.
»Nicht viel, aber ja. Manchmal frage ich mich, ob sie nicht doch zu jung ist.«
»Das wird sich erst mit der Zeit herausstellen. Bei dir wusste ich es auch nicht.«
Hauptsache, er wurde nicht nachlässig. Das galt nicht nur für die Begleitung dieser Wandlung.