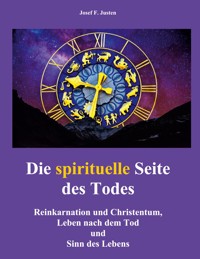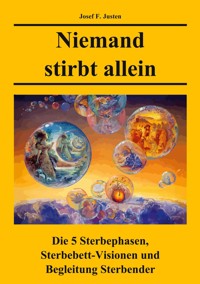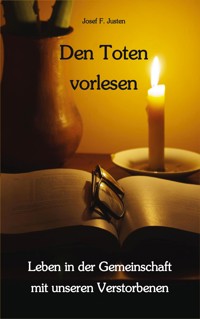Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Leben der wohl meisten Menschen geschehen immer wieder Dinge, die sie sich nicht erklären können, die bisweilen sogar völlig unerfindlich und höchst merkwürdig sind. Das, was einem da widerfährt, kann sehr unangenehm, aber auch äußerst erfreulich sein. Im Normalfall versucht man erst gar nicht, der Sache auf den Grund zu gehen. Man nimmt es hin und glaubt, dass es sich eben um zufällige Ereignisse oder Begebenheiten handele, für die es keine erkennbaren Ursachen gäbe. Zu diesen unerklärlichen Dingen kann es auch gehören, dass man sich manchmal für etwas sehr stark engagiert, ohne genau zu wissen, warum man es tut. Bis vor etwa drei Jahren war das bei mir nicht anders. Auch ich habe das, was mir nicht erklärbar schien, nicht weiter hinterfragt. Insbesondere hätte ich es damals niemals für möglich gehalten, dass die wahren Ursachen für bestimmte Geschehnisse in einem früheren Erdenleben liegen können. Ja, ich war sogar davon überzeugt, dass die Idee der Reinkarnation, von der ich natürlich schon einmal gehört hatte, nur etwas für Spinner und Phantasten wäre. Da sich meine Einstellung zu dieser Thematik vor drei Jahren radikal geändert hat, ist es vermutlich ganz gut, wenn ich mit meiner Erzählung im Jahre 2018, also vor drei Jahren, beginne. Ich war zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt. In dieses Jahr fiel der Tag, ab dem sich mein Leben langsam von Grund auf zu verändern begann. Ich wachte allmählich auf und fing an, mein Leben mehr und mehr zu verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Sitzung
Sitzung
Sitzung
Sitzung
Sitzung
Sitzung
Sitzung
Im Leben der wohl meisten Menschen geschehen immer wieder Dinge, die sie sich nicht erklären können, die bisweilen sogar völlig unerfindlich und höchst merkwürdig sind. Das, was einem da widerfährt, kann sehr unangenehm, aber auch äußerst erfreulich sein. Im Normalfall versucht man erst gar nicht, der Sache auf den Grund zu gehen. Man nimmt es hin und glaubt, dass es sich eben um zufällige Ereignisse oder Begebenheiten handele, für die es keine erkennbaren Ursachen gäbe.
Zu diesen unerklärlichen Dingen kann es auch gehören, dass man sich manchmal für etwas sehr stark engagiert, ohne genau zu wissen, warum man es tut.
Bis vor etwa drei Jahren war das bei mir nicht anders. Auch ich habe das, was mir nicht erklärbar schien, nicht weiter hinterfragt. Insbesondere hätte ich es damals niemals für möglich gehalten, dass die wahren Ursachen für bestimmte Geschehnisse in einem früheren Erdenleben liegen können. Ja, ich war sogar davon überzeugt, dass die Idee der Reinkarnation, von der ich natürlich schon einmal gehört hatte, nur etwas für Spinner und Phantasten wäre.
Da sich meine Einstellung zu dieser Thematik vor drei Jahren radikal geändert hat, ist es vermutlich ganz gut, wenn ich mit meiner Erzählung im Jahre 2018, also vor drei Jahren, beginne. Ich war zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt. In dieses Jahr fiel der Tag, ab dem sich mein Leben langsam von Grund auf zu verändern begann.
Ich wachte allmählich auf und fing an, mein Leben und den Sinn desselben mehr und mehr zu verstehen.
Seitdem unsere beiden Kinder aus dem Haus waren, nutzten mein Mann Gerd und ich nahezu jedes Wochenende, um etwas gemeinsam zu unternehmen. Meistens fuhren wir in die nahe gelegenen Berge oder an einen der vielen oberbayerischen Seen. Manchmal gingen wir ins Theater oder besuchten eines der zahlreichen Münchener Museen. Hin und wieder fuhren wir zum Sightseeing in eine andere Stadt.
So war es auch an einem Sonntag im besagten Jahre 2018, an dem wir nach Nürnberg fuhren, um die alte Nürnberger Burg zu besichtigen. Ich war zwar schon einige Male in der fränkischen Metropole, aber die Burg kannte ich noch nicht.
Als wir anschließend in einem Café saßen, traute ich meinen Augen nicht. Ein paar Meter weiter saß eine Dame allein an einem Tisch, die mir gleich sehr bekannt vorkam. Es dauerte aber eine Weile, bis ich mir sicher war, dass es sich wirklich um meine alte Jugendfreundin handelte. Ja, tatsächlich, die Dame war keine andere als meine ehemals beste Freundin Gabi. In jungen Jahren waren Gabi, die in all den Jahren in der Schule immer neben mir saß, und ich unzertrennlich. Als wir achtzehn Jahre waren, zogen ihre Eltern mit ihr nach Norddeutschland. Uns trennten nun fast 700 Kilometer. Nie zuvor war ich so traurig wie an dem Tag, an dem wir uns verabschiedeten. Selbstverständlich versprachen wir uns, miteinander in Kontakt zu bleiben. Und – wie das so häufig der Fall ist – wurde der Kontakt letztlich immer seltener. Anfangs telefonierten wir noch mindestens einmal pro Woche, nach einem Jahr höchstens noch einmal im Monat, nach zwei Jahren nur noch, wenn einer von uns Geburtstag hatte, und schließlich gar nicht mehr. Seit über zwanzig Jahren hatten wir nichts mehr voneinander gehört.
Obwohl ich etwas nervös war, stand ich unverzüglich auf und ging mit stark pochendem Herz auf sie zu. »Ob sie mich wohl erkennt?«, dachte ich. Gabi erkannte mich sofort. Wir nahmen uns in die Arme und drückten uns minutenlang.
Noch ahnte ich nicht, wie entscheidend und wegweisend diese unverhoffte und scheinbar zufällige Begegnung mit Gabi für mein weiteres Leben werden sollte...
Dann bat ich Gabi, sich doch an unseren Tisch zu setzen, wo ich sie mit meinem Mann bekannt machte. Es waren über dreißig Jahre vergangen, seit wir uns das letzte Mal persönlich begegnet sind.
Da Gerd und ich noch eine Verabredung mit einem befreundeten Ehepaar, das in Nürnberg wohnt, hatten, waren wir ein wenig in Eile, so dass Gabi und ich kaum Gelegenheit hatten, miteinander zu plaudern. Sie sagte mir noch, dass sie seit vielen Jahren in Fürth wohnte und lud mich für den nächsten Samstag zu sich nach Hause ein.
Bevor ich von meinem Besuch bei meiner Freundin erzählen möchte, muss ich Ihnen noch von ein paar wichtigen Begebenheiten aus meinem Leben berichten, ohne die vieles von dem, was ich noch zu schildern habe, nicht verständlich werden könnte. Wir müssen also einen kleinen Zeitsprung machen.
Was meine übliche Biografie anbelangt, kann ich mich kurz fassen.
Also, ich wurde im Jahre 1967 in München geboren. Ich war das jüngste Kind meiner Eltern, Mujo und Helga Sarailic, die zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Söhne hatten. Jens war damals vier, Jan zwei Jahre alt. Die Eltern meines Vaters stammten aus Serbien. Sie wanderten in den 1930er-Jahren nach Deutschland aus und siedelten sich in Bochum an, wo mein Großvater auf einer der vielen Zechen, die es in jener Zeit im Ruhrgebiet gab, Arbeit fand. Mein Vater zog 1960 nach München, wo er eine renommierte Buchhandlung übernahm. Dort lernte er auch meine Mutter kennen.
Meine Eltern waren streng katholisch, so dass ich selbstverständlich unverzüglich getauft wurde, und zwar auf den Namen Johanna.
Ebenso selbstverständlich war es für meine Eltern, dass sie ihre Kinder auf ein Gymnasium schickten.
Aus meiner Schulzeit gibt es von einer Ausnahme abgesehen, auf die ich später noch zu sprechen kommen möchte, nichts Besonderes zu erwähnen. Im Gegensatz zu meinen hochbegabten Brüdern war ich eine bestenfalls mittelmäßige Schülerin. Alle drei machten wir Abitur – erstaunlicherweise auch ich. Jan ist heute ein sehr gefragter Neurologe mit eigener Praxis in Ingolstadt. Jens ist katholischer Priester, und als solcher war er natürlich der ganze Stolz unserer Eltern. Für mich kam es nie in Frage zu studieren.
Im Herbst 1987 lernte ich meinen heutigen Mann, den sieben Jahre älteren Immobilienmakler Gerd Holtkamp kennen. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich im zweiten Ausbildungsjahr zur Erzieherin. Auch wenn es abgedroschen klingen mag – es war Liebe auf den ersten Blick! So heirateten wir auch bereits gut ein Jahr später. Meine Ausbildung zur Erzieherin habe ich noch abgeschlossen. Anschließend war ich aber beruflich nicht mehr tätig – weder in diesem noch in einem anderen Beruf.
Auch wenn sowohl Gerd als auch ich mit Religion und insbesondere mit dem Katholizismus nicht viel verbinden konnten, ließen wir uns unseren Eltern und meinem Bruder Jens zuliebe kirchlich trauen. Selbstverständlich war es Jens, der die Zeremonie durchführte.
Bis zum heutigen Tag verstehe ich mich mit meinem Mann blendend. Jeder ist stets für den anderen da und unterstützt ihn auf allen Ebenen. Ich könnte mir keinen besseren Partner fürs Leben vorstellen.
Gerd und ich bezogen ein schmuckes Einfamilienhaus in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von München. Im Jahr darauf kam unsere Tochter Andrea und vier Jahre später unser Sohn Christian zur Welt. Die Geburt unseres Sohnes erlebten meine Eltern leider nicht mehr. Beide waren im Jahr zuvor gestorben.
Andrea lebt seit einigen Jahren mit ihrem Lebensgefährten in Florida. Was sie dort genau macht, weiß ich nicht wirklich. Unser Verhältnis ist nicht gerade das beste. Christian studiert in Tübingen Medizin. Mit ihm verstehen wir uns sehr gut. Mindestens einmal im Monat kommt er übers Wochenende zu uns. Auch einen großen Teil seiner Semesterferien verbringt er in seinem Elternhaus.
Nachdem ich in groben Zügen meine Biografie skizziert habe, muss ich nun noch ein paar besondere Ereignisse aus meinem Leben schildern, die sich im späteren Verlauf meiner Erzählung als sehr wichtig erweisen werden. Es sind solche Ereignisse bzw. Begebenheiten, die zu denen gehören, die man sich nicht so recht erklären kann, für die es keinen ersichtlichen Grund zu geben scheint.
Seit meiner Kindheit leide ich an etwas, für das es im Grunde keinen präzisen medizinischen Fachausdruck gibt. In unregelmäßigen Abständen – manchmal sogar mehrmals in der Woche – bekomme ich plötzlich panische Angst und das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Diese Panikattacken mit Atemnot könnte man vielleicht mit asthmatischen Anfällen vergleichen. Die Anfälle, die meistens nur wenige Minuten bis maximal eine halbe Stunde dauern, sind ganz fürchterlich und bisweilen mit Todesängsten verbunden. Wenn sie vorüber sind, erhole ich mich im Normalfall recht schnell.
An meinen ersten Anfall kann ich mich noch besonders gut erinnern. Ich war damals acht Jahre alt. Mit meiner Schulklasse ging ich zum Schwimmunterricht in eine öffentliche Schwimmhalle in München. Wie das so üblich ist, mussten wir alle zunächst unter die Dusche, bevor wir ins Schwimmbecken durften. Während wir dann in dieser großen Gemeinschaftsdusche standen und das Wasser aus den Duschköpfen lief, wurde mir plötzlich ganz schummrig. Wenige Sekunden später bekam ich panische Angst und rang nach Luft. Ich sank zu Boden und glaubte sterben zu müssen. Der eilig herbeigerufene Sportlehrer alarmierte einen Notarzt. Als dieser nach etwa fünfzehn Minuten eintraf, ging es mir bereits wieder einigermaßen gut.
Meine Eltern waren sehr besorgt und schickten mich zu unserem Hausarzt sowie zu zwei Fachärzten. Eine wirkliche Ursache konnte jedoch keiner finden. Organisch war alles in bester Ordnung. Also war klar, dass es psychische Ursachen geben müsste. Aber auch der Psychotherapeut, zu dem meine Eltern mich schleppten, konnte mir nicht helfen. Jedenfalls ließen meine Eltern mich für das gesamte Schuljahr vom Schwimmunterricht befreien.
Schon bald stellte sich heraus, dass die Attacken auch an anderen Orten und bei anderen Gelegenheiten auftraten. Als ich vierzehn Jahre alt war, begann ich, Protokoll über meine Anfälle zu führen. Ich notierte genauestens, in welchen Situationen es zu einer Attacke kam, wie lange sie anhielt und vieles mehr.
Allerdings gab mir diese gewissenhafte Buchführung auch keine wirklichen Aufschlüsse. Immerhin wurde mir dadurch gewahr, dass diese Anfälle vermehrt auftraten, wenn ich mit mehreren Leuten in einem engen Raum zusammen war. Besonders oft kam es zu einer Attacke, wenn ich mich – so wie bei meinem ersten Anfall – im Schwimmbad in einer Gemeinschaftsdusche befand. Das führte schließlich dazu, dass ich von da an für lange, lange Zeit kein öffentliches Schwimmbad mehr aufgesucht habe.
Wie auch immer – ich lernte recht schnell, mit diesem Problem einigermaßen zu leben, obwohl die Angst vor einer neuen Attacke ständig mitschwang. Im Laufe der Jahre kam es in diesem Kontext einige Male zu Erlebnissen, die nicht gerade erfreulich waren. So erwischte mich einmal eine Attacke, als ich beim Einkaufen in einem Supermarkt war. Ich setzte mich auf den Boden und rang nach Luft. Sofort eilte eine andere Kundin herbei und fragte, was mit mir sei und ob sie etwas für mich tun könne. Da es mir während eines Anfalls meistens nicht möglich ist, vernünftig zu sprechen, konnte ich ihr nicht sagen, dass sie sich keine Sorgen machen müsse und dass in ein paar Minuten alles wieder gut sei. Ehe ich mich versah, befand ich mich in einem Rettungswagen, der mich mit Blaulicht ins nächstgelegene Krankenhaus karren wollte. Es kostete mich einige Mühe, den Leuten klarzumachen, dass ich ihrer Hilfe nicht bedurfte.
Wie bereits angedeutet war ich keine gute Schülerin. Insbesondere Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer machten mir sehr zu schaffen. Zum einen fehlte es wohl an der Begabung, zum anderen am Interesse.
Auf Anordnung meiner Eltern gaben mir meine Brüder hin und wieder Nachhilfeunterricht. Dieses Unterfangen gaben sie eines Tages mit der Bemerkung, bei mir sei Hopfen und Malz verloren, auf. Mein Klassenlehrer erteilte meinen Eltern den Rat, mich lieber auf eine Real- oder sogar auf die Hauptschule zu schicken, weil ich für das Gymnasium nicht begabt genug sei. Das alles nagte natürlich gewaltig an meinem Selbstwertgefühl. Die zumindest vermeintliche intellektuelle Überlegenheit meiner Brüder vermittelte mir den Eindruck, weniger wert zu sein als sie. Meine Eltern ließen mich allerdings auf dem Gymnasium, was mir eigentlich gar nicht recht war.
Doch dann, als ich fünfzehn Jahre alt war und soeben die siebte Klasse wiederholen musste, wendete sich das Blatt. Wir bekamen einen neuen Mathematiklehrer, der uns auch in Physik unterrichtete.
Dieser Lehrer – er hieß Wolfgang Cords – war so ganz anders als alle anderen Pädagogen dieser Schule. Er war noch verhältnismäßig jung und verstand es, die Themen, die er zu vermitteln hatte, seinen Schülern schmackhaft zu machen. Insbesondere mich zog die Art, wie er seinen Unterricht gestaltete, ganz in ihren Bann. Zum ersten Mal machte es mir Freude, mich mit der Mathematik und Physik zu befassen.
Dennoch war es nicht so, dass ich gleich gute Noten erzielte. Aber immerhin waren es nicht nur Fünfer und Sechser. Herr Cords mochte mich auch sehr und war sehr bestrebt, alles zu tun, damit ich jeweils das Klassenziel erreichen konnte. So machte er mir immer wieder Mut und erteilte mir sogar des Öfteren privaten Nachhilfeunterricht, wofür er kein Entgelt haben wollte. Besonders schätzte ich an Herrn Cords, dass er im krassen Gegensatz zu meinen Brüdern eine Engelsgeduld mit mir hatte und nicht gleich aufgab, wenn ich etwas auch beim zweiten Erklärungsversuch noch nicht verstand. Ich glaube, ich war sogar ein wenig verliebt in ihn.
In den folgenden Jahren hatte ich immer den Eindruck, dass er sich mindestens genauso über meine ordentlichen und zum Teil sogar guten Noten freute wie ich. Auf dem Abiturzeugnis habe ich im Fach Mathematik sogar eine Eins stehen. Das haben nicht einmal meine hochbegabten Brüder geschafft!
Heute kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass ich ohne ihn niemals das Abitur geschafft und kein so gutes Selbstwertgefühl hätte.
Ein paar Jahre später hatte ich das Bedürfnis, ihm für sein großes Engagement zu danken. Aber er unterrichtete nicht mehr an der Schule, und es konnte mir leider keiner sagen, wo er jetzt lebte.
Alles, was ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, fand viel später statt. Ich war schon verheiratet.
Auf dem Nachbargrundstück stand ein kleines, schon etwas heruntergekommenes Haus, in dem seit vielen Jahren das Ehepaar Eichler wohnte. Die Eichlers waren gewiss schon über sechzig Jahre alt. Es waren recht freundliche Leute, zu denen wir allerdings nur einen eher losen Kontakt hatten. Man traf sich hin und wieder am Gartenzaun oder beim Einkaufen. Da die Eichlers kein Auto hatten, fuhren mein Mann oder ich sie manchmal in die Stadt, wenn sie viel zu besorgen hatten.
Eines Tages – es war im Jahre 2003 – bekamen sie ›Nachwuchs‹. Wie wir etwas später erfahren haben, war es ihr Enkelsohn Franz Eichler. Seine Eltern waren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Franz hatte den Unfall ohne körperliche Schäden überlebt. Nun übernahmen die Großeltern die Aufgabe, den elfjährigen Franz aufzuziehen.
Es dauerte ein paar Wochen, bis ich Franz, der von seinen Großeltern nicht »Franzi« – wie es in Bayern eigentlich üblich ist –, sondern »Fränzchen« genannt wurde, kennenlernte. Er stand in der Nähe unserer Garageneinfahrt und versuchte sich an einem Hula-Hoop-Reifen. Ich war ein wenig überrascht, da ich einen solchen Reifen, den ich noch bestens aus meiner Kinderzeit kannte, schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Ich ging auf ihn zu und sagte: »Das klappt ja schon prima! Ich habe das früher auch geliebt.« So kamen wir erstmals ins Gespräch.
Schon bald wurde offensichtlich, dass Fränzchen anders als meine etwa gleichaltrigen und auch die meisten anderen Kinder war. Er war extrem schüchtern, anfangs auch recht scheu und etwas verhaltensauffällig, was sicherlich daran lag, dass er verständlicherweise noch sehr an dem Trauma des tragischen Unfalls zu leiden hatte. Ja, er war schon ein etwas merkwürdiger Junge. Aber viel merkwürdiger war, dass ich mich irgendwie zu ihm hingezogen fühlte. Er war mir gleich sehr vertraut, wie wenn ich ihn schon seit vielen Jahren kennen würde. Auch Fränzchen fasste recht schnell Vertrauen zu mir.
Um es kurz zu machen – Fränzchen wurde für mich schon bald so etwas wie ein neues Familienmitglied. Auch mein Mann und unsere Kinder kamen gut mit ihm aus. Seinen Großeltern war es durchaus recht, dass wir uns ein wenig um ihn kümmerten. Mehrmals in der Woche aß er mit uns gemeinsam zu Mittag. Wenn wir mit unseren Kindern einen Ausflug machten oder den Zoo besuchten, nahmen wir Fränzchen nahezu immer mit. Da er nicht gerade ein sehr heller Kopf war, fiel es ihm schwer, den Lehrstoff, der ihm auf der Hauptschule vermittelt wurde, aufzunehmen. So nahm ich mir viel Zeit, um mit ihm zu lernen. Meine Kinder waren manchmal ein wenig eifersüchtig, weil ich mich nach ihrem Empfinden mehr mit Fränzchen als mit ihnen beschäftigte. Insbesondere Andrea kam mit meinem Engagement für den Nachbarsjungen nicht immer klar.
Alles, was ich für meinen »Zögling« getan habe, habe ich niemals aus einem lästigen Pflichtgefühl heraus oder wegen der viel zitierten »Christenpflicht« gemacht. Es war mir vielmehr immer ein Bedürfnis und geradezu eine Freude, für ihn da zu sein und ihn fördern zu dürfen. Es war für mich eine Herzensangelegenheit, Fränzchen eine gute Ersatzmutter zu sein. Ich konnte gar nicht anders...
Kurz vor dem Schulabschluss wurde Fränzchen schwer krank. Er klagte schon seit Wochen über starke Übelkeit und Bauchweh. Häufig musste er sich übergeben.
Auf Bitte seiner Großeltern konsultierte ich gemeinsam mit ihnen und Fränzchen einen Arzt. Schon die Anamnese ließ Schlimmstes befürchten. Eine Magenspiegelung, die wenige Tage später erfolgte, bestätigte den Verdacht: Fränzchen hatte Magenkrebs. Der Arzt nahm kein Blatt vor den Mund und sagte: »Da ist nichts mehr zu machen. Der Krebs ist schon recht fortgeschritten und hat höchstwahrscheinlich bereits gestreut. Eine Operation macht leider keinen Sinn mehr.« Die Eichlers und ich waren todtraurig und den Tränen nahe. Fränzchen, der alles mitbekommen hatte, schien die Diagnose recht gelassen aufzunehmen. Auf meine Frage, wie viel Zeit ihm noch bleibe, antwortete der Arzt: »Das kann kein Mensch ganz genau sagen. Da aber seine körperliche Konstitution nicht die beste ist, sind es vermutlich nur noch wenige Wochen, bestenfalls ein paar Monate.«
Auf Wunsch seiner Großeltern sollte Fränzchen bei ihnen zu Hause gepflegt werden und nicht im Krankenhaus oder einem Hospiz sterben. Auch ich fand die Idee sehr gut.