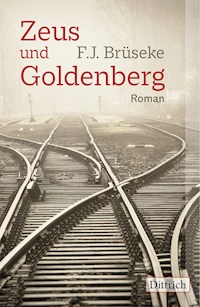
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft. Hamm, im Jahr 1936. Hier, am östlichen Rand des Ruhrgebiets, treffen sich Zeus, ein junger Kommunist, und Goldenberg, ein ungläubiger Jude. Ein Pfarrer hat die beiden in seiner Gemeinde aufgenommen und hält sie versteckt, getarnt als Küster und Bibliothekar. Das geht so lange gut, bis der Pfarrer ins Visier der Nazis gerät. Zeus verhilft Goldenberg zur Flucht und muss bald selbst das Land verlassen. Für die Freunde beginnt eine gefährliche Odyssee. Goldenberg verschlägt es nach Paris, während Zeus unmittelbar an die Front gerät. Der Autor erzählt die spannende Geschichte zweier ungleicher Männer, deren Schicksale in den Kriegswirren miteinander verknüpft werden, und deren Freundschaft auch die Nachkriegsjahre noch überdauert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Josef Brüseke
Zeus und Goldenberg
Roman
© Dittrich Verlag ist ein Imprint
der Velbrück GmbH, Weilerswist-Metternich 2021
ISBN 978-3-947373-57-4eISBN 978-3-947373-62-8
Satz: Gaja Busch, Berlin
Cover: Helmi Schwarz-Seibt, Leverkusen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog
Zeus
Goldenberg
Zeus
Goldenberg
Zeus
Goldenberg
Zeus
Goldenberg
Zeus
Goldenberg
Zeus
Epilog
Prolog
Wir nannten ihn Zeus. Alle nannten ihn Zeus. Von Schülergeneration zu Schülergeneration wurde der Name weitergereicht. Warum er so hieß? Das wusste niemand. Vielleicht, weil er Respekt einflößte wie kein anderer unter den Lehrern. Viele hatten sogar Angst vor ihm. Ich nicht, obwohl mir Latein nicht gerade lag. Vielleicht hieß er auch Zeus, weil er Rom und seine antiken Götter so vor uns darstellte, als ob er einer von ihnen wäre. Im Gegenzug nannte er uns Kulturbanausen.
Erst als wir in die Oberstufe kamen, hatten wir bei ihm auch Geschichte. Es war in dieser Zeit, genauer gesagt in der Oberprima, als ich Gelegenheit hatte, Zeus auch privat kennenzulernen – ein Privileg, das, soviel ich weiß, weder vor mir noch nach mir je ein Schüler genießen durfte.
Ich kam zu dieser Ehre, weil ich als einziger unserer Klasse für die Jahresarbeit ein Thema ausgewählt hatte, das ihn zu interessieren schien: »Der geistige Widerstand gegen Hitler«. So hatte ich meinen Vorschlag formuliert, doch er hatte ihn gleich bei unserem ersten diesbezüglichen Gespräch, das noch im Klassenzimmer stattfand, geändert. Von nun an hieß mein Thema: »Der kommunistische Widerstand gegen Hitler«, von dem ich zugegebenermaßen keinen blassen Schimmer hatte. Eben deshalb ließ sich Zeus auf eine Reihe von Gesprächen mit mir ein, die bald auch außerhalb der Klasse, in einem eigens für Elterngespräche eingerichteten Zimmerchen stattfanden.
Später dann lud mich Zeus in seine Privatwohnung in der Zeppelinstraße ein. Sie war in der Nähe des Kurparks im Ostteil der Stadt gelegen, und wollte, so empfand ich es, so gar nicht zu den Industrieanlagen, dem gigantischen Rangierbahnhof und den weiter westlich von Hamm gelegenen Zechen passen. Eine Tasse Kaffee nach der anderen trinkend erklärte er mir die Welt, indem er mir von seinem Leben erzählte. Aber ich will den Dingen nicht vorgreifen.
Zeus hatte eine Methode. Mochten seine Schüler anfangs noch verständnislos aus der Wäsche gucken – auch dies sagte er häufig: »Kulturbanausen, die verständnislos aus der Wäsche gucken« – so wandelte sich das, wenn er diese Methode anwandte. Er brauchte in der Regel zwei Unterrichtsstunden, dann wurde auch dem Letzten klar, dass mit ihm nicht zu spaßen war – nicht mit ihm und nicht mit der Geschichte.
»Er kommt!«, rief der an der Tür postierte Klassenbeste. Alle stürzten auf ihre Plätze, um dem olympischen Donnerwetter zu entgehen. Immer verspäteten sich zwei oder drei, sei es aus Unachtsamkeit oder weil der pubertäre Widerstandsgeist sie dazu verleitete, Zeus auf die Probe zu stellen.
Dieser schien jedoch weder die hinter ihren Stühlen stehende Schülerschaft, noch den absichtlich über den Fuß eines Mitschülers stolpernden Klassenclown zu sehen. Sein Blick ging über unsere Köpfe hinweg und musste wohl irgendwo hinter uns an der Wand Großes erspäht haben. Er fixierte so eindringlich das Nichts hinter uns, dass jegliches Geräusch erlosch und wir zu einer unbedeutenden Formation Halbwüchsiger wurden. Als selbst Peter, der Clown, regungslos auf seinem Platz stand, senkte Zeus seinen Blick und ließ eine Stimme erschallen, die endgültig ankündigte, wer hier das Sagen hatte.
»Meine Herr’n! Setzen Sie sich!«
Er sagte tatsächlich »meine Herr’n!« und zwar unter Auslassung des letzten »e«. Es knallte, es schnarrte und wir, gerade einmal sechzehn oder siebzehn Jahre alt, fühlten uns aus der untersten aller Kasten in den Rang von vollwertigen Männern erhoben. Er siezte uns.
»Sie machen sich ja keine Vorstellung …« Wir machten uns keine und wir hatten auch keine, wie auch. Die Peloponnes kannten wir nur aus dem Erdkundeunterricht und Athen, davon hatten wir einige Dias gesehen und das war es dann. Aber es ging nicht um Athen, sondern um Sparta.
»Sie machen sich ja gar keine Vorstellung!«
Jetzt begann eine wahrhafte Theateraufführung. Zeus lief in der Klasse hin und her. Bald mimte er, ein spartanischer Kämpfer zu sein, um kurz darauf einen athenensischen Heerführer zu verkörpern. Steile Felsenpfade ging es hinauf, um in schwindelnder Höhe einen Blick in die Schlucht zu wagen, wo, ganz unten, die Verfolger in endloser Kette aufmarschierten. Die Athener waren in der Überzahl, aber der spartanische Mannesmut und die wohldurchdachte Kriegslist trotzten der höheren Zivilisation. Bald stürzten Steine auf das überlegene Heer hinab und die spartanischen Helden entkamen, nicht ohne bis an die Grenzen der Kraft gehende Tagesmärsche zurückgelegt zu haben. Zeus war sichtbar ermüdet.
»Merken Sie sich das! Merken Sie sich das!«, und er entschwand, ohne uns eines weiteren Blickes zu würdigen.
In der nächsten Stunde gab es Blutsuppe. Zeus forderte uns auf, uns da hineinzuversetzen: nämlich in die Situation der gerade sieben Jahre alt gewordenen Knaben, die unter Aufsicht ihrer dreißigjährigen Mentoren, alte Männer für die damalige Zeit, wie er bekräftigte, Blutsuppe schlürften.
Zeus trank vor unseren Augen aus der hohlen Hand diese ekelerregende Suppe. Das Blut lief ihm den Unterarm hinab, aber es machte ihm nichts.
»Es ist alles Gewohnheit! Der Mensch gewöhnt sich an alles!«
Schulenburg, der Sensibelste unter uns, wurde Opfer der Didaktik des Sich-Hinein-Versetzens und lief würgend, sich die Hand vor den Mund haltend aus der Klasse.
Wenn ich heute, wohl schon älter als Zeus damals, an Situationen wie diese zurückdenke, kann ich nicht umhin, ihn wie eine schwergewichtige Kreatur wahrzunehmen, die, von der Brandung an den Strand geworfen, sich noch verzweifelt und in Aufbietung aller Kräfte gegen sein unvermeidliches Schicksal sträubt. Sein trauriges Los war es, nicht von uns verstanden zu werden. Vielleicht mag der eine oder andere aus meiner damaligen Klasse, so wie ich es heute tue, sich an ihn erinnern und vielleicht sogar einiges zum Besten geben, was an Merkwürdigem in der Erinnerung hängen geblieben ist. Vielleicht lacht man, vielleicht kramen andere ebenfalls Geschichten über skurrile Lehrergestalten hervor, aber damit wird nur weiterhin ignoriert, was ich damals deutlich vor mir sah: Zeus litt.
Es mag also nicht nur das Interesse an der Verbesserung meiner Jahresarbeit gewesen sein, das Zeus bewog, mit mir zu reden und mich dann später in seine Wohnung einzuladen. Er musste gespürt haben, dass ich in ihm nicht nur einen gefürchteten Oberstudienrat sah, sondern angesichts des Eindrucks, den seine Unterrichtsstunden bei mir hinterließen, zu denken begann.
Wie viele junge Menschen der in diesen nun weit zurückliegenden Jahren war auch ich links.
»Links ist da, wo der Daumen rechts ist!«, sagte Zeus und hatte wieder einmal die Lacher auf seiner Seite. Sie lachten dieses Mal durchaus auch über mich, denn ich hatte, als wir die Geschichte Osteuropas durchnahmen, die Ideen der Oktoberrevolution verteidigt. Nun gut, ich wusste recht wenig von den Ereignissen in Russland am Ende des Ersten Weltkrieges, hatte aber Auszüge aus der Autobiografie von Trotzki gelesen und fand die Forderung nach Frieden und Land, mit der die Bolschewiki die Soldaten und hungernde Bauern auf ihre Seite brachten, sehr sympathisch.
»Revolution«, keuchte Zeus, »das war doch keine Revolution! Das war ein Putsch! Ein vom deutschen Generalstab angezettelter Putsch!«
Und er erzählte, wie Lenin nach langen Jahren im Schweizer Exil von den Deutschen in einen verplombten Zug gesetzt und unbehelligt bis hinter die feindlichen Linien gebracht worden war. Ich staunte und die Klasse griente, hatte es Zeus doch seinem Lieblingsschüler gerade so richtig gegeben.
»Der Zar war doch schon erledigt. Es gab eine provisorische Regierung unter Kerenski. Hätten sie die regieren lassen, wer weiß, vielleicht wäre den Russen vieles erspart geblieben. Die Zarenfamilie wäre jedenfalls nicht ermordet worden. Selbst die Kinder des Zaren haben sie erschossen. Schöne Revolution!«
Zeus brabbelte noch einiges vor sich hin, was ich nicht verstehen konnte, schloss seine Aktentasche und verließ die Klasse.
Für mich lag Zeus wieder einmal falsch. Wer gegen die Russische Revolution war, konnte nur ein Reaktionär sein. Und das mit der Zarenfamilie? Die Zaren waren ja selbst grausam gewesen, hatten Trotzki in die Verbannung geschickt und Lenins Bruder exekutiert. So einfach war das damals für mich.
Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Zeus mir vor der gesamten Klasse widersprach. Ich ließ mich aber keineswegs einschüchtern wie die meisten meiner Mitschüler, sondern bereitete mich auf zu erwartende Herausforderungen vor, indem ich las. Statt einiger Auszüge, las ich Trotzkis Biografie ganz. Sogar Marx nahm ich mir vor, den Zeus nur streifte, so, als ob seine Gegenwart ihm lästig wäre.
»Ideen! Ideen! Marx hatte auch nur Ideen!«
So wurde ich zwar regelmäßig in meine Schranken verwiesen, gab aber nicht auf und konnte mir der Aufmerksamkeit meines mir haushoch überlegenen Widersachers gewiss sein.
Manchmal schien es mir, als spräche Zeus nicht mit mir, wenn er wieder einmal meinen Idealismus, wie er es nannte, kritisierte. Er schien mit irgendjemandem zu kämpfen, den er sehr gut kannte.
Heute weiß ich, dass er selbst es war, den er in meinen törichten Einwürfen vor sich wiederauferstehen sah.
Zeus
Er war ein Jude. Zeus wusste es, weil der Pfarrer es ihm gesagt hatte. Er konnte sicher sein, dass er ihn nicht verriet, denn er wusste, dass Zeus Kommunist war.
Zeus war auf ihn gestoßen, als er sich einmal wieder in der Woche ein oder zwei Bücher in der Bibliothek der Pfarrei auslieh. Dort saß Goldenberg hinter einer Art Tresen an einem hohen Pult, das die Bücherregale vom Eingangsbereich trennte. Alles war eng, nicht wie heute in den Öffentlichen Büchereien. Da, wo Zeus stand, konnte er seinen Angstschweiß riechen, der sich unter den muffigen Geruch der Bücher mischte.
Er sah gar nicht aus wie ein Jude. Zumindest sah er nicht so aus, wie sie ihm Juden beschrieben hatten. Er selbst kannte bis dahin keine Juden. Im Viertel waren alle katholisch und bis zur Synagoge an der Martin-Luther Straße kam er selten und wenn, war dort niemand zu sehen. Er kannte also nur einen Juden und das war dieser: Goldenberg.
Goldenberg sprach ihn an, weil er wohl der Einzige war, der regelmäßig Bücher auslieh, und Goldenberg wissen wollte, warum. Wahrheitsgemäß verwies Zeus ihn auf seine Arbeitslosigkeit, was er mit nickendem Kopf quittierte.
Beim nächsten Mal, als er einen fürchterlich dicken Band von Charles Dickens zurückgab, wollte Goldenberg wissen, ob er auch den ganzen Wälzer gelesen habe. Eine Woche wäre ja fast zu kurz für so viele Seiten. Mit gewissem Stolz konnte er von komplett vollzogener Lektüre berichten, was Goldenberg mit einem: »Sehr schön, sehr schön!« belohnte.
Wenn er nicht las, machte er sich in den zur Pfarrei gehörenden Gebäuden nützlich. Er war seit seinem achten Lebensjahr zuerst Messdiener und dann Obermessdiener gewesen, bis er schließlich zum Lektor aufgestiegen war und kurze Ausschnitte aus den Paulusbriefen oder anderen gerade anstehenden Texten während des Gottesdienstes vortrug.
»Hättet ihr aber die Liebe nicht …« Besonders dieser Paulus, der einst ein Saulus gewesen war, hatte es ihm angetan. Er mochte ihn. Doch sei es, dass er ihn zu ernst genommen hatte oder dass jugendlicher Leichtsinn ihn dazu verleitete: Er wurde beim Versuch, das Liebesgebot und die Idee der Brüderlichkeit umzusetzen, zum Kommunisten.
Der Pfarrer wusste um seinen Werdegang und hatte ihm wohl aus Nächstenliebe oder Barmherzigkeit trotz seines jugendlichen Alters die Stelle als Küster angeboten, als er von seinem Rauswurf bei der WDI, der Westfälischen Drahtindustrie, erfuhr. Zeus war noch keine zwanzig Jahre alt und zu Tode erschrocken, als die Gestapo die Mitglieder der Betriebszelle der KPD verhaftete. Es waren alles gestandene Männer, die noch am 1. Mai 1933 in der Augustastraße die rote Fahne gehisst hatten – übrigens nicht nur eine, die ganze Straße war beflaggt.
Er kam ungeschoren davon, zum einen, weil alle Verhafteten aussagten, dass er nicht zu ihnen gehöre, zum anderen, weil die Betriebsleitung das Angebot gemacht hatte, ihn, den jungen Schnösel, zur Bestrafung zu entlassen.
Die Einladung des Pfarrers tat dann ihr Übriges, denn mit den Schwarzen, wie man die Katholiken damals nannte, legten sich die Nazis nicht gerne an. Es war 1936, das Jahr der Olympiade, und für einige Monate beschränkte sich die Gestapo auf das Notwendigste. Den Rest des kommunistischen Widerstands zu zerschlagen, gehörte dazu, den Angriff auf die katholische Kirche plante man für später.
So wurde er nach zweimonatiger Arbeitslosigkeit Küster, was sich, wie sich bald herausstellte, lediglich als Halbtagsjob erwies. Er zupfte Unkraut, wechselte die Kerzen, fegte den Kirchplatz und stellte pünktlich fünfzehn Minuten vor jeder Messe die Glockenanlage an. Der Pfarrer war mit seiner Arbeit zufrieden, übertraf sie doch den Einsatz seines kurz zuvor verstorbenen gebrechlichen Vorgängers um ein Vielfaches. Ihm blieb Zeit zu lesen, viel Zeit. So traf er regelmäßig Goldenberg, der seine Bücher zurücknahm und von Mal zu Mal gesprächiger wurde. Der Pfarrer hätte von ihm erzählt, sagte jener eines Tages.
»So, so, Sie waren also Kommunist.«
»Bin ich noch!«, fuhr es Zeus heraus, worauf Goldenberg erschrocken einen Blick zur Tür warf.
In der Tat war Zeus ziemlich unvorsichtig.
Wahrscheinlich war er deshalb auch nie vollständig in alle Aktionen der Betriebszelle eingeweiht worden. Ein katholischer Idealist wäre er, hatte einmal der Zellenleiter zu ihm gesagt und ihn zur Schulung geschickt, die während der Mittagspause im hinteren Teil des Drahtzugs stattfand. Fünfzehn Minuten erklärte ein erfahrener Genosse das Kommunistische Manifest oder jemand von auswärts erörterte die neuesten Weisungen der Komintern, der Kommunistischen Internationale.
Obwohl er brav seine Mittagspause opferte, nahmen sie ihn nie mit, wenn es um konkrete Aktionen ging. Diese beschränkten sich im Wesentlichen darauf, vorher einstimmig beschlossene und mit den Weisungen aus Moskau übereinstimmende Parolen nachts an Fabrikmauern zu pinseln. Auch wurden Flugblätter aus durchfahrenden Güterzügen auf die Bahnsteige geworfen, die danach von Bahnbeamten hastig aufgesammelt wurden. Trotz der Harmlosigkeit dieser Aktionen waren sie für die Genossen ungemein gefährlich. Die Gestapo wartete nur darauf, dass die Kommunisten aus ihren Löchern kamen, und schon wurden wieder einige verhaftet. Im Jahre 1936 waren sie nur noch ein paar Mann, die im Untergrund mehr an das eigene Überleben denken mussten als an die Weltrevolution.
Für den jungen Zeus war das Schicksal seiner Genossen eine Art Märtyrertum, ein Zeugnisablegen für die gute Sache, die eines Tages trotz alledem siegen würde. Sein Glaube war unerschütterlich.
Goldenberg war derweil dazu übergegangen, ihm Bücher zu empfehlen.
Auf seiner Büchertheke hatte Goldenberg stets die letzte Ausgabe von »Mein Kampf«, die er manchmal an das linke und dann an das rechte Ende schob, stets in Begleitung eines Neuen Testaments, das ebenfalls regelmäßig die Stellung wechselte, mal lag es obenauf und mal unter dem von beiden Männern verachteten Machwerk. Denn Goldenberg war klug: Im Falle eines überraschenden Besuchs war er gewappnet, um sowohl bei den Katholiken als auch bei den Nationalsozialisten einen guten ersten Eindruck zu machen.
Manchmal ertappte er Goldenberg mit erröteten Wangen, sichtlich konzentriert bei der Lektüre eines abgegriffenen Buches, das er jedes Mal verschwinden ließ, wenn Zeus die Tür aufmachte. Als nach einigen Monaten das Eis zwischen beiden gebrochen war und Goldenberg seine Lektüre jetzt ungeniert auf dem Pult liegen ließ, traute sich Zeus nachzufragen. Der Autor war ihm unbekannt: Heidegger. Ja, den Namen hatte er schon einmal gehört, irgendjemand aus der Betriebszelle hatte ihn verächtlich einen Naziphilosophen genannt, aber das war es dann.
Goldenberg wiegte mit dem Kopf, wie immer, wenn er versuchte abzuschätzen, welche Wirkung seine Worte haben würden.
»Dazu bist du mit deinen zwanzig Jahren noch zu jung. Das ist Philosophie.«
Eine Zeit lang ließ sich Zeus hinhalten. Zwar hatte er jetzt schon die Stufe erklommen, die ihm die Lektüre umfangreicher und durchaus nicht leicht zu bewältigender Romane möglich machte. Aber wie immer, wenn man einem neugierigen Menschen etwas vorenthielt, wurde der Reiz des Verbotenen schließlich stärker als die zögerliche Didaktik Goldenbergs.
Doch dieser rückte nicht mit dem Buch heraus. Den Titel hatte er jetzt wohl schon erhascht, aber Goldenberg, der vielleicht fünfzehn Jahre älter als Zeus sein mochte, blieb eisern.
»Erst musst du in deinen Ansichten gefestigter sein«, sah er sich jetzt schon gezwungen zu sagen, wenn Zeus wieder einmal darauf bestand, »Sein und Zeit« auszuleihen.
Es war, als hätte die Geschichte im Sommer 1936 eine Pause gemacht. Die Angst vor der Verfolgung war nicht gewichen, aber auf die reduziert, die sie unmittelbar betraf: Kommunisten, Sozialdemokraten, jüdische Familien, Homosexuelle, Roma und Sinti und andere, die den Mund nicht halten konnten. Unter der Bevölkerung war sogar so etwas wie Erleichterung zu spüren, denn die Arbeitslosenzahlen waren zurückgegangen und das in der Weimarer Zeit politisch zerrissene Deutschland schien zu einer zwar erzwungenen, aber doch spürbaren Einheit wiedergefunden zu haben.
Der nationalsozialistische Körperkult fand im Berliner Olympia-Stadion eine Bühne, die nicht nur Ariern eine Gelegenheit zur Zurschaustellung bot, aber die deutschen Kameras und Zuschauer konzentrierten sich auf diejenigen mit blauen Augen und makelloser weißer Haut. Zeus hörte im Volksempfänger von den Resultaten und konnte nicht umhin, für seine, die deutschen Athleten, die Daumen zu drücken. Von Medaille zu Medaille stieg das Selbstbewusstsein der Deutschen. Dieser Erfolg vertrieb in diesen Tagen das Gefühl, auf der Verliererseite zu stehen, ein Gefühl, das nach dem verlorenen Krieg nach so langer Zeit immer noch allgegenwärtig war.
Goldenberg bemerkte, wie in der Seele des jungen Zeus der Hass auf die bürgerliche Klasse und der internationalistische Idealismus langsam Konkurrenz bekamen. Deutsch sein, unbeschwert deutsch sein, das war eine Verlockung, der schon viele ehemalige Wähler von SPD und KPD erlegen waren. Zudem war allein die Tatsache, dass die Olympischen Spiele dieses Mal in Deutschland stattfanden, eine Aufwertung des Hitler-Regimes. Man war wieder wer, und was selbst Ausländer anerkannten, konnte so schlecht nicht sein.
Zeus ging in diesem Sommer, wenn seine Freistunden es erlaubten, häufig am Kanal spazieren. Die motorisierten Lastkähne brachten rohen Draht für die Weiterverarbeitung in die örtlichen Fabriken, Schotter für den Straßenbau und sogar riesige Baumstämme mit mehr als einem Meter Durchmesser, die schon einen langen Weg über den Atlantik hinter sich hatten.
Krupp stellte in Essen reihenweise neue Arbeitskräfte ein. Die Hochöfen kochten den Stahl, den die deutsche Aufrüstung nachfragte, und brauchten dazu Koks, aus Kohle gemacht, die neu abgeteufte Zechen aus der Tiefe holten. Auch Zeus hatte bei Krupp angefragt, ob es nicht Arbeit für ihn gebe, aber er stand auf der schwarzen Liste und musste froh sein, dass der Pfarrer von seiner Untreue nichts mitbekommen hatte.
So setzte er sich auf einen Poller am Rande des Treidelpfads, der beiderseits den Kanal begleitete, und las – wenn nicht in einem der von Goldenberg empfohlenen Romane, so in der mitgebrachten Zeitung vom Vortage, die ihm der Pfarrer überlassen hatte. Fernsehen gab es noch nicht, außer in einigen wenigen Sälen, die versuchsweise Direktübertragungen der Olympischen Spiele machten, aber auch dies nur in Auszügen. Die Wochenschau lief zwar vor den Filmen im Roxy und im Kristallpalast, aber ins Kino zu gehen, dafür hatte Zeus kein Geld. Auch gefielen ihm die rührseligen Schnulzen nicht, die im Angebot waren. Zumindest redete er sich das ein, um nicht das Fehlen eines Luxus zu verspüren, den er sich ohnehin nicht leisten konnte.
Gern hätte sich Zeus von der Begeisterung mitreißen lassen, mit der die Reporter aus Berlin berichteten. Eine deutsche Goldmedaille nach der anderen! Schon am ersten Tag waren es drei und es sollten insgesamt dreiunddreißig werden! Damit lag die deutsche Mannschaft vor allen anderen und machte die vier Goldmedaillen des Jesse Owens, eines schwarzen US-Amerikaners, vergessen.
Die dreitausend Journalisten, die aus aller Herren Länder angereist waren, berichteten von den Wettkämpfen im neu erbauten Olympiastadion und konnten aus Deutschland nur Gutes melden. Einige Schönheitsfehler wurden entweder nicht bemerkt oder, schließlich war es ein sportliches Ereignis und kein politisches, bewusst ausgeklammert.
Die Berliner Zigeuner, die Sinti und Roma, waren einige Tage vor den Spielen in Marzahn zusammengetrieben worden. Wie sollte man über etwas berichten, was man nicht sah? Zwar hatte es in den USA, eines der wichtigsten Zielländer für aus Deutschland Geflüchtete, einige Proteste gegen Hitler gegeben, aber dieser hatte versprochen, dass auch Juden an den Wettbewerben teilnehmen könnten, und das war es dann, denn das IOC zog vor, ihm zu glauben.
Nur zwei Länder nahmen nicht an den Spielen teil: die Sowjetunion Stalins, mit der Vorbereitung der Moskauer Schauprozesse beschäftigt, und das im Bürgerkrieg liegende Spanien, wo die Truppen Francos in Barcelona eine ohnehin unbedeutende Gegenolympiade verhindern konnten. Während alle Welt nach Berlin sah, machte sich Hitlers Legion Condor auf den Weg. Guernica sollte später ein Begriff für die deutsche Militärhilfe an die spanischen Gesinnungsgenossen werden, später, als Picassos berühmtes Gemälde tausendfach reproduziert wurde.
Doch Goebbels Choreographie im Stadion, das Hitler schon zu eng wurde, ging auf. Der Hitlergruß, tatsächlich bekannt seit den Tagen der Antike, wurde von den ins Stadion einziehenden Mannschaften Frankreichs, Kanadas und Mexikos übernommen. Auch auf den Rängen flogen die Arme hoch: Heil! Heil! Es war ein Fest!
Alle vorherigen Olympischen Spiele waren dilettantisch im Vergleich zu denen von 1936. Erstmals beeindruckend in Berlin inszeniert, wurden die Spiele mit dem Fackellauf und dem Entzünden der olympischen Flamme eröffnet. Zwar hatten Kommunisten geplant, diese Flamme irgendwo zwischen der Peloponnes und Berlin auszulöschen, aber selbst dazu fehlte ihnen mittlerweile die Kraft.
Zeus wusste von alledem recht wenig, woher auch? Seine Verbindungen zur Partei waren vollständig abgebrochen und er war auf die Informationen angewiesen, die er der Lokalzeitung des Pfarrers entnahm oder die Goldenberg ihm flüsternd zusteckte. Fast niemand sonst redete noch mit ihm. Doch er hielt Augen und Ohren offen und stellte zu seinem Bedauern fest, dass selbst ehemalige Arbeitskollegen, die immer die KPD oder SPD gewählt hatten, begannen, anerkennend über die neuen Zeiten zu reden.
Als die Olympischen Spiele schließlich mit dem Lichterdom beendet wurden, kehrte der Alltag zurück. Lichterdom, das war ein fast christlicher Name für eine profane Inszenierung. Weitreichende Scheinwerfer, die das Stadion umsäumten, wurden parallel in den Himmel gerichtet und schließlich simultan in einem Punkt hoch über den Köpfen gebündelt. Ein heiliger Schauer erfasste die andächtig nach oben blickenden Massen. Sie wussten nicht, wie sollten sie es auch, dass dieselben Scheinwerfer nur wenige Jahre später denselben Himmel Berlins nach todbringenden Bombern absuchen würden.
Der Sommer ging seinem Ende zu. Zeus hatte es aufgegeben, nach Arbeit zu suchen. Es war besser, so dachte er, niemanden daran zu erinnern, dass er wegen Kontakten zu kommunistischen Umstürzlern entlassen worden war.
»Vergessen«, sagte Goldenberg, »sie müssen uns vergessen.«
Zeus gruselte es, wenn er ihn so reden hörte. Aber noch mehr grauste ihm davor, so zu enden wie seine Kollegen aus der Betriebszelle. Alle waren nach langwierigen Verhören in Dortmund, wo eine Gestapozentrale war, vom Oberlandesgericht Hamm wegen Hochverrats verurteilt und dann abtransportiert worden. Wohin? Man munkelte Namen, die niemand bis dahin gehört hatte: Oranienburg, wo lag das?
Goldenberg wusste immer ein wenig mehr. Er erzählte von Lagern, in denen Hitlergegner zusammengepfercht worden seien. »Konzentriert«, sagte er, »sie haben sie in Lagern konzentriert.« Es war das erste Mal, dass Zeus das Wort Konzentrationslager hörte.
Die fast optimistisch zu nennende Stimmung, die den jungen Zeus während der Olympischen Spiele erfasst hatte, wich unter dem Eindruck der eintreffenden schlechten Nachrichten zunehmend einem Gefühl der Niedergeschlagenheit. Wie lange würde der Pfarrer ihn noch decken können? Keine Messe ließ er aus, nicht die tägliche Frühmesse und nicht die drei sonntäglichen, um sieben, um neun und um elf Uhr morgens. Er tat dies, weil er jedes Mal inbrünstig betete, dass »dieser Kelch an ihm vorüberginge«, denn zu Herbstanfang hatten die Ehefrauen seiner früheren Genossen die Bescheinigung erhalten, dass ihre wegen Hochverrats verurteilten Männer aus gesundheitlichen Gründen in der Haft verstorben seien. Durch diese Urteile in Angst und Schrecken versetzt, wollte er dem Pfarrer demonstrieren, dass es einen besseren Katholiken und arbeitsameren Küster als ihn nicht gab.
Goldenberg, so schien es Zeus, war im Laufe der letzten Monate immer mehr in sich zusammengesackt. Der Geruch von Schweiß, der die ganze Bibliothek durchwaberte und den er schon fast nicht mehr wahrnahm, vermischte sich mit dem Geruch von Eukalyptusbonbons, die Goldenberg nun ohne Unterlass lutschte. Doch eine dritte Geruchsnote wurde mit der Zeit immer stärker: Alkohol, Zeus war sich jetzt ganz sicher, es war Alkohol.
Manchmal meinte er sogar, ein verändertes Verhalten an Goldenberg feststellen zu können. Immer dann, wenn die Alkoholfahne besonders intensiv durch die Regale zog, war dieser besonders redselig. Goldenberg erhob sich dann sogar von seinem hochbeinigen Schemel hinter der Theke und machte, je nach Gewichtigkeit des Themas, ausholende Armbewegungen. Nie jedoch kam er hinter seinem Pult hervor oder öffnete die kleine Holzschranke, die den Publikumsbereich von der eigentlichen Bibliothek trennte, von der Zeus immer nur die erste Regalwand sehen konnte.
Umso überraschter war Zeus, als Goldenberg ihn eines Tages einlud, auch den verdeckten, weiter hinten gelegenen Teil der Bibliothek zu besichtigen.
»Komm ruhig«, sagte Goldenberg, »ich beiße nicht.«
Hinter der ersten, der vorderen Regalwand war nur mehr eine zweite. Zeus war verblüfft. Er konnte nicht umhin, diese Gemeindebibliothek als eine optische Täuschung zu empfinden. Stets hatte er die vorne ausgestellten Bücher lediglich für das Eingangstor zum unendlichen Universum von Titeln und Autoren gehalten. Die Enttäuschung, die sich in ihm ausbreitete, sagte ihm, dass er bald auch das letzte dieser Bücher gelesen haben würde. Und was dann?
Doch Goldenberg wollte ihm etwas anderes zeigen. Hinter der zweiten, der letzten Regalwand war ein vielleicht zwei Meter breiter Abstand gelassen worden, wohl, um irgendwann noch ein weiteres Regal aufnehmen zu können. Auf dem Boden lag eine Matratze. Über den Stuhl hinten in der Ecke waren einige Kleidungsstücke gelegt, daneben stand ein Koffer. Hier also wohnte Goldenberg.
»Eine Toilette habe ich auch.« Er wies auf eine schmale Tür zur Linken. »Aber das weiß keiner, nur der Pfarrer.«
Zeus überkam ob dieser unerwarteten Einführung in die Privatsphäre des Bibliothekars das Gefühl, auch etwas Persönliches preisgeben zu müssen, um das Gleichgewicht in ihrer bis dahin doch recht förmlichen Beziehung wiederherzustellen.
»Ich wohne auch alleine«, sagte Zeus, »deshalb lese ich meistens, wenn ich zu Hause bin.« Er fürchtete, dass Goldenberg auch die Toilettentür öffnen würde, um ihn auch noch in die letzten Geheimnisse seines Privatlebens einzuweihen. So drehte er sich rasch um und stand bald wieder hinter der Holzschranke, wie es sich für ein normales, lediglich an Bücherausleihe interessiertes Gemeindemitglied ziemte.
Doch Goldenberg hatte noch mehr zu zeigen. Er kramte irgendwo hinter der Bücherwand herum und kam dann mit verschwitztem Kopf hervor, triumphierend einen Kasten hochhaltend.
»Ein VE 301.« Fast hätte sich Goldenberg in dem Draht verheddert, der in dem Apparat steckte.
»Meine Antenne. Nachts kriege ich manchmal sogar
England.«
Goldenberg stellte den Volksempfänger auf die Theke.
»Weißt du, warum das Ding diese Nummer hat, 301?«
Zeus dachte an eine Seriennummer oder Ähnliches, aber Goldenberg beantwortete die an Zeus gestellte Frage selbst.
»Zur Erinnerung an den 30.1.1933. Mehr brauche ich dir ja nicht zu sagen.«
Es war schon kurios, wie ein Radio, ein mechanisches, technisches Ding, in die Politik verwickelt wurde. Der Tag der Machtergreifung Hitlers war fest in die Technikgeschichte eingraviert. Und aus dem Volksempfänger wurde die Abkürzung VE. Die Nazis hatten es mit Abkürzungen. Sie kürzten alles ab. SA, SS, GESTAPO, alles, was sie erfanden, kürzten sie ab. Nullachtfünfzehn, ging Zeus durch den Kopf. Das war ein Ausdruck, der im Ruhrgebiet verwendet wurde, wenn es um die ungefähre Wiederholung ging, um Vorgestanztes.
»Was bedeutet 08/15?«
»08/15 ist schon älter. Das war ein Maschinengewehr im Ersten Weltkrieg.«
Goldenberg hatte seinen VE 301 schon wieder unter dem Arm und machte sich daran, ihn hinter der Bücherwand zu verstauen.
»Und mein Buch?«
Fast hätte der angetrunkene Bibliothekar vergessen, weshalb Zeus wieder einmal die Tür zur Gemeindebibliothek geöffnet hatte.
»Hier«, sagte Goldenberg und schob ihm die Buddenbrooks zu. Zeus zögerte.
»Haben sie den nicht verboten? Den Autor, meine ich.«
»Verboten, verbrannt und vertrieben …«, sagte Goldenberg.
»Ich stecke ihn in einen Schutzumschlag. Hier!« Und er reichte Zeus die Buddenbrooks in einer braunen, aus Wachstuch angefertigten Hülle.
Doch Zeus zögerte. Der Alkohol schien Goldenbergs Scharfsinn geschwächt zu haben. Die heutige Offenherzigkeit kam wohl auch daher und war entschuldbar, vielleicht sogar sympathisch. Aber Zeus war auf der Hut. Seine bloße Vergangenheit in der Betriebszelle der KPD war schon eine gefährliche Hypothek, mit der sie ihn jederzeit behelligen konnten. Und er konnte es nicht riskieren, mit einem missliebigen Autor erwischt zu werden. Langsam schob er das Buch zurück.
»Danke. Vielleicht ein anderes Mal.«
Heute verließ er ohne eine neue Lektüre die Bibliothek. Er begann, sich um Goldenberg Sorgen zu machen.
Die nächsten Monate verstrichen, ohne dass Zeus zur Ruhe kam. Ruhe nicht in einem körperlichen Sinne, denn seine Arbeit nahm ihn weiterhin nicht sonderlich in Anspruch. Aber die Ereignisse, die in den Sommermonaten noch ganz von den Olympischen Spielen bestimmt waren, nahmen eine durchaus unerfreuliche Richtung. Wie der jetzt anbrechende November die vom Münsterland aus dem Nordwesten heranwehenden Nebel über die Niederungen der Lippe verteilte, so breitete sich in seiner Seele eine Stimmung aus, die ihn frösteln ließ.
Der Pfarrer hatte ihn zu sich gerufen. Der Kontakt mit ihm war durchaus nichts Ungewöhnliches, denn sie sahen sich täglich in der Sakristei, wo Zeus vor und nach jeder Messe dem Seelsorger beim An- und Ablegen der Messgewänder behilflich war. Doch dieses Mal hatte er ihm vom Fenster des direkt am Kirchenvorplatz gelegenen Pfarrhauses ein Zeichen gegeben, das ihn zum Eintreten aufforderte. Zeus säuberte umständlich seine Schuhsohlen auf der im Eingang liegenden Fußmatte und trat erst ein, als er ein energisches: »Na, dann komm schon!«, vernahm.
Der Pfarrer saß in einer Rauchwolke, die an Dichtigkeit den Novembernebeln in Nichts nachstand.
»Setz dich doch!« Der Pfarrer hatte ihn immer geduzt. Dies tat er mit allen Gemeindemitgliedern, unter denen er sich wegen seines volkstümlichen Stils größter Beliebtheit erfreute.





























