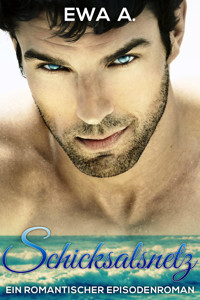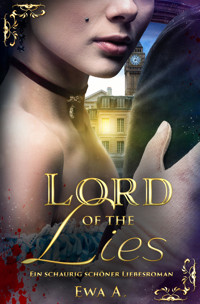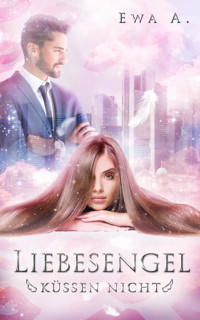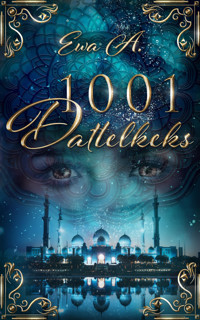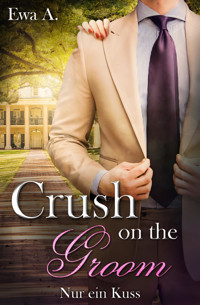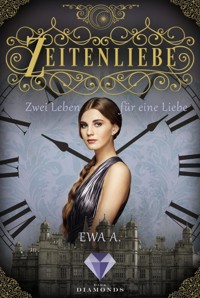3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- 80er Jahre Mystery Romance - ** Eine Liebe im Irrgarten düsterer Geheimnisse ** Kein Geld. Kein Dach über dem Kopf. Diese Umstände zwingen die frisch geschiedene Vivien mit ihrer Tochter in ihr altes Leben zurück. Dort erwartet sie aber nicht nur ihre Mutter, die sie mit Hass überschüttet, sondern auch der unverschämte, aber leider auch attraktive Lennhart, der sich rührend um die ältere Frau kümmert. Obwohl er Vivien mit vehementer Abneigung begegnet, knistert die Luft zwischen ihnen vom ersten Moment an. Doch mit dem Einzug in das düstere Haus ihrer Mutter brechen auch Viviens alte Phobien und Alpträume wieder auf. Als diese von Mal zu Mal schlimmer werden und sie auch im Wachzustand von fürchterlichen Visionen heimgesucht wird, beginnt Vivien an ihrem Verstand zu zweifeln. Allmählich keimt ein schrecklicher Verdacht in ihr auf, weshalb ihre Mutter sie nicht lieben kann. Und ausgerechnet der Mann, der für sie nur Spott übrig hat, ahnt, was in ihr vorgeht. *************************** Lesealterempfehlung: 16+ Enthält blutige, verstörende und erotische Szenen sowie derbe sexuelle Sprache - Leseprobe – »Was wollen Sie? Und wer zum Teufel sind Sie überhaupt?«, fragte er barsch. Zugleich versperrte er uns den Eingang, indem er sich in legerer Haltung gegen den Türrahmen lehnte und die Hand nicht von der Klinke nahm. Seine dunkelbraunen Augen glitzerten grimmig und aus reinem Trotz richtete ich mich zur vollen Größe auf. »Ich bin Vivien Vanderblant und will zu meiner Mutter.« In all dem Hochmut, zu dem ich fähig war, hob ich eine meiner Augenbrauen an und ließ meinen Blick abschätzend über seine Gestalt gleiten. »Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Der Gärtner?« In einem hämischen Lächeln entblößte er seine beachtlich weißen Zähne. »Sieht der Garten etwa danach aus, als ob ein Gärtner ihn pflegen würde?« Anscheinend erwartete er keine Antwort, denn mit einem Kopfschütteln verschränkte er die Arme vor der Brust und fuhr in seiner Rede fort. »Sie sind also Sophies Tochter, Vivien?« Abermals wanderte sein Blick über meine Kleider. Doch diesmal verriet auch die Tonlage seiner tiefen Stimme, dass er sich bereits ein Urteil über mich gebildet hatte, welches alles andere als freundlich ausfiel. »Das erklärt natürlich einiges.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Zimt und Sandelholz
von
Ewa A.
Impressum
Text: Copyright by 2020 Ewa A.
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Copyright ©
Renee Rott,
Dream Design - Cover and Art
unter Verwendung von Bildmaterial
von stock.adobe.com
Korrektorat: Rune L. Green
https://runelgreen-lektor.de/
Verlag: E. Altas
Bundesstraße 6
79423 Heitersheim [email protected]
https://www.facebook.com/EwaA.Autorin
Die Geschichte sowie die Personen und die Orte in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit Begebenheiten, Orten, lebenden oder toten Personen sind in keiner Weise beabsichtigt und wären purer Zufall.
1. Blaue Augen
November 1982
Nichts ist mehr wie zuvor. Meine Welt hat sich verändert. Auf einen Schlag. Wegen einer paar Worte.
Unnatürlich laut hallt das Summen der flimmernden Neonröhren von den gefliesten Wänden wider und dröhnt in meinen Ohren fort. Der aufdringliche Chlorgeruch liegt mir beißend in der Nase. Kalte Schweißperlen treten auf meine heiße Stirn. Ich beuge mich über das Waschbecken, an dessen Rand ich mich krampfhaft festhalte. Schwankend ringe ich nach Atem, doch der Raum beginnt, sich um mich zu drehen. Glühende Übelkeit dehnt sich in meinem Körper aus, setzt ihn in Brand. In skurriler Deutlichkeit beobachte ich, wie sich in Zeitlupe ein Tropfen vom Wasserhahn löst, auf der weißen Keramik aufschlägt und in tausend kleine zerplatzt. Ich drehe das Wasser auf, fühle das kalte Metall des Hahns unter meinen Fingern, danach das kühle Nass, in das ich für einen Moment mein Gesicht tauche. Aber selbst das hilft nicht. Zitternd verharre ich auf der Stelle.
Nichts kann mir helfen. Nichts kann ich an dem Vergangenen ändern. Keine Tat zurückholen, ungeschehen machen.
Voller Angst blicke ich auf, in den Spiegel, und versinke in dem eisigen Blau meiner Augen. Den Augen eines Mörders.
Es ist an der Zeit, dass die Welt es endlich erfährt.
2. Verlorenes Zuhause
4 Wochen zuvor
Es war keiner dieser goldenen Herbsttage, die man im Oktober sehnsüchtig erwartet, weil sie Erinnerungen an einen unbeschwerten Sommer schenken. Vielmehr war es einer dieser trostlosen, an denen sich nur allmählich die feuchtschweren Nebelschwaden des Morgens auflösten und die trübe Nachmittagssonne hinter dem grauen Wolkenvorhang erahnen ließen. Wir fuhren in unserer alten Schrottlaube die enge Straße in dem kleinen, abgeschieden gelegenen Dorf entlang. Als ich vermutete, dass wir demnächst das Ziel unserer Reise erreichen würden, drosselte ich das Tempo. Bald kam das Grundstück in Sicht, dessen hohe Bäume schon von Weitem auszumachen waren. Vieles hatte sich verändert. Zwar stand noch der schmiedeeiserne Zaun, aber das Gebäude war nicht mehr wie einst von dieser Stelle aus zur Gänze zu sehen. Im Gegensatz zu früher verbarg es sich nun hinter den kahlen Laubbäumen. Während ich den Blinker betätigte und auf die Einfahrt zusteuerte, stöhnte meine Tochter neben mir auf dem Beifahrersitz laut auf.
»Oh Gott, Mama«, fuhr sie mich an und zog die Kopfhörer ihres Walkmans von den Ohren. Die munteren Klänge von Come on Eileen der Dexy’s Midnight Runners schallten leise ins Autoinnere und standen im krassen Widerspruch zu meiner Gefühlslage.
»Sag mir jetzt bitte nicht, dass das da ab heute unser Zuhause sein soll?« Joan warf mir aus ihren grünen Mandelaugen einen vorwurfsvollen Blick zu.
Obwohl es mir das Herz zusammenzog und ich meiner sechzehnjährigen Tochter gerne etwas anderes gesagt hätte, erstickte ich kurz und schmerzlos ihren letzten Hoffnungsschimmer. »Doch.«
Ihr Gesichtsausdruck nahm an Frustration zu. Schweigend legte sie die Kopfhörer auf ihren Schoß nieder und machte die Musik aus.
Verwundert stellte ich fest, dass die Flügel des Gartentores, die einst einen imposanten Empfang bereitet hatten, vergessen vor sich hin rosteten.
Wie konnte das sein? Meine Mutter war von jeher darauf bedacht gewesen, das Anwesen in Schuss zu halten. Seltsam.
Das Tor stand offen, sodass ich langsam in die gekieselte Auffahrt einbiegen konnte. Irritiert bemerkte ich, dass der Garten, der ehemals einer gepflegten Parkanlage geglichen hatte, stark verwildert war. Die Buchsbäume mussten schon jahrelang nicht mehr gestutzt worden sein, denn ihre frühere akkurate Form gehörte der Geschichte an. Unerbittlicher Efeu hatte sie im Würgegriff und drohte sie, unter einer Flut von Schlingen und Blättern zu ersticken. Den armen zartgliedrigen Zierpflanzen erging es genauso, wie es mir einst ergangen war.
Erinnerungen an die penibel geformten Kegel stiegen in mir auf, die den damaligen englischen Rasen geziert hatten. Im Stillen fragte ich mich, was passiert war, dass meine Mutter von der strikten Pflege ihres Hab und Guts abgelassen hatte. Kein einziges Unkraut oder Moos hatte sie in jener Zeit auf dem satten Grün geduldet. Doch nun war es eine verwahrloste Wiese, voll von verblühten Disteln, wüsten Brombeersträuchern und wild wuchernden Hagebutten.
Unter den hohen Linden konnte ich, inmitten des Gestrüpps, den halb verrosteten Eisenpavillon ausmachen, in dem ich als Kind gern gespielt hatte. Ein beklemmendes Gefühl erfasste mich und ich ließ meinen Blick dem Haus entgegenschweifen, das langsam näherkam.
Das früher strahlende Weiß der Fassadenfarbe war nur noch ein düsteres Grau. Die langen Fensterläden waren morsch und so sehr beschädigt, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen konnten. Ihre zerfallenen Reste baumelten teilweise nur noch an einem Scharnier. Die Verwahrlosung des Anwesens konnte nichts Gutes verheißen.
Freude brachte ich mit diesen Gemäuern ohnehin nicht in Verbindung. Schmerz, Einsamkeit, Wut und Leid waren die Gefühle, die ich beim Anblick meines ehemaligen Heims empfand und daran hatte sich nichts geändert.
Eine dunkle Furcht befiel mich und ließ mir die Nackenhaare stehen. Es schien, als trage das Haus nun endlich das Unheilvolle zur Schau, welches seit jeher in ihm gärte und mich verfolgte.
So sehr der Zahn der Zeit auch an ihm genagt hatte, ich hätte es immer wieder erkannt. Niemals war dieses Gebäude in meinen Erinnerungen verblasst. Nicht, dass ich es in all den vergangenen Jahren nicht versucht hätte, es zu vergessen. Nach wie vor fand es den Weg in meine ruhelosen Träume. Oder zumindest Teile von ihm.
Allein der Gedanke an diese Träume, in denen ich den langen, dunklen Flur des Obergeschosses entlangeile, der einfach kein Ende nehmen will, ließ einen Schauder meinen Rücken hinunterlaufen.
Ich fuhr den Wagen vor das Garagentor, dessen taubengrauer Lack bereits großflächig abgeblättert war, und schaltete den Motor mit einem Seufzen aus.
»Glaub mir, Joan, wenn wir eine andere Wahl hätten … Aber die haben wir nicht und mir fällt es mindestens genauso schwer wie dir, deiner Großmutter gegenüberzutreten.«
Verzweifelt umklammerte ich das Steuerrad und schloss in stummer Resignation meine Lider. Ich wusste, was mir bevorstand. Sie würde mir das Gefühl geben, versagt zu haben und damit nicht hinter dem Berg halten. Sie - meine Mutter, Sophie Vanderblant, Witwe des angesehenen, leider viel zu früh verstorbenen, Bankdirektors Jakob Vanderblant. Süße Wehmut befiel mich, als mir mein Vater in den Sinn kam. Er war der einzige Elternteil, mit dem ich meine wenigen, glücklichen Kindheitserinnerungen in Verbindung brachte.
Joan streichelte sacht meinen Rücken und rettete mich vor meinen düsteren Gedanken. »Komm schon Mama, so schlimm wird es nicht werden. Es ist ja nur vorübergehend, das schaffen wir auch noch.«
Ich öffnete wieder die Augen. Die tröstenden Wörter taten gut, denn diesmal würde ich hier nicht alleine sein. Mit einem gequälten Lächeln wandte ich mich meiner Tochter zu.
»Du hast Recht... wir werden uns so schnell wie möglich ein neues Leben aufbauen.« Ich holte tief Luft. »Nun, was wirst du zu deiner Großmutter sagen, die du noch nie gesehen hast?«
Joan zeigte mir ein freches Grinsen und glich dadurch noch mehr dieser Frau, vor deren Begegnung wir uns gegenseitig Mut zusprachen.
»Hallo Großmutter natürlich. Was bleibt mir sonst übrig?«
Wir stiegen aus und hievten unsere Existenz, die in vier Koffer und zwei Reisetaschen Platz gefunden hatte, aus dem Kofferraum. Ein flaues Gefühl im Magen, das mich mahnte, jemand beobachte uns, ließ mich über die Schulter zum Fenster neben dem Hauseingang schauen. Doch ich konnte niemanden dahinter entdecken. Wir schleppten unser Gepäck vor die Eingangstür und nach kurzem Zögern betätigte ich die Klingel. Mein Herz pochte und meine Handinnenflächen wurden feucht. Fahrig strich ich über den hellen Stoff meines schmalgeschnittenen Rocks und zog den Saum meines Blazers glatt. Aufatmend blickte ich zu Joan, die ihre toupierte Mähne noch mehr in erwünschte Unordnung brachte. Im selben Moment ging die Tür meines ehemaligen Zuhauses auf, doch zu meiner Überraschung, stand ich nicht meiner Mutter gegenüber, sondern einem großgewachsenen, wildfremden Mann.
Seine kräftigen Augenbrauen zogen sich mürrisch zusammen, indessen er mich unverhohlen musterte. Sekundenlang starrten wir uns gegenseitig stumm an. Trotz seines dichten dunklen Bartes waren seine markanten Gesichtszüge nicht zu übersehen, allerdings ebenso sein Unwille. Offensichtlich gefiel ihm nicht, was er sah. Wahrscheinlich gab er sich mit solchen Leuten wie mir ungern ab, denn unterschiedlicher hätte unser jeweiliger Kleidungsstil nicht sein können. Vermutlich stempelte er mich in dem teuren Designerkostüm, mit den elegant frisierten Wellen und den hohen Pfennigabsätzen als verzogenes, arrogantes Püppchen ab. Zugegebenermaßen steckte auch ich ihn gedanklich bereits, aufgrund seiner Erscheinung, in die Schublade der fanatisch müsliliebenden Naturschützer. Ich schätzte, dass er in etwa meinem Alter gleichkam, was bedeutete, dass er die Dreißig knapp überschritten haben musste. Allerdings schien ihn dies keineswegs davon abzuhalten, seine schwarzen Haare außergewöhnlich lang zu tragen und sie zu einem unachtsamen Pferdeschwanz im Nacken zusammenzubinden. Dies entsprach weder der momentanen Frisurenmode noch dem Anblick der Männer, in deren Umfeld ich mich die letzten Jahre bewegt hatte. Mein Exmann, Paul, wäre vermutlich auch nie auf die Idee gekommen, ein Jeanshemd, das voller Flecken und halb zerrissen war, außerhalb seiner Hose herumflattern zu lassen. Letztere sah an dem Fremden keinen Deut besser aus als sein Hemd und gab mir, dank zwei riesiger Löcher, noch einen unerwünschten Blick auf ein Paar beharrte Männerknie frei. Es war wahrlich ein Wunder, dass er keine Sandalen trug, sondern Turnschuhe, die entgegen meiner Erwartungen seine Füße vollständig verhüllten.
Wie kam es, dass solch ein abgerissener Typ im Haus meiner Mutter herumlungerte?
Ich wollte gerade den Mund aufmachen, als der Mann mir zuvorkam.
»Was wollen Sie? Und wer zum Teufel sind Sie überhaupt?«, fragte er barsch. Zugleich versperrte er uns den Eingang, indem er sich in legerer Haltung gegen den Türrahmen lehnte und die Hand nicht von der Klinke nahm.
Seine dunkelbraunen Augen glitzerten grimmig und aus reinem Trotz richtete ich mich zur vollen Größe auf.
»Ich bin Vivien Vanderblant und will zu meiner Mutter.« In all dem Hochmut, zu dem ich fähig war, hob ich eine meiner Augenbrauen an und ließ meinen Blick abschätzend über seine Gestalt gleiten. »Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Der Gärtner?«
In einem hämischen Lächeln entblößte er seine beachtlich weißen Zähne. »Sieht der Garten etwa danach aus, als ob ein Gärtner ihn pflegen würde?« Anscheinend erwartete er keine Antwort, denn mit einem Kopfschütteln verschränkte er die Arme vor der Brust und fuhr in seiner Rede fort. »Sie sind also Sophies Tochter, Vivien?« Abermals wanderte sein Blick über meine Kleider. Doch diesmal verriet auch die Tonlage seiner tiefen Stimme, dass er sich bereits ein Urteil über mich gebildet hatte, welches alles andere als freundlich ausfiel. »Das erklärt natürlich einiges.«
Nach dieser Unverschämtheit zog ich scharf die Luft ein und schüttelte meine braunen Wellen in einer erhabenen Geste über die Schultern. »Dürfte ich jetzt bitte meine Mutter sprechen, sie erwartet uns.«
Ein unechtes Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. »Klar.«
Mit einem Kopfnicken deutete er ins Hausinnere und stieß gleichzeitig die Tür weiter auf, damit wir eintreten konnten. Tatenlos wartete er, bis Joan und ich unsere Koffer über die Schwelle gewuchtet hatten und verschloss dann die Haustür.
»Von mir aus könnt ihr euer Gepäck hier in der Diele stehen lassen. Dann braucht ihr es nicht allzu weit schleppen, wenn ihr gleich wieder verschwinden wollt.«
Joan und ich wechselten vielsagende Blicke. Auch sie war irritiert und fragte sich wahrscheinlich, wohin uns das alles führen sollte. Der große Fremde kehrte uns den Rücken zu und ließ uns einfach stehen. Offenbar ging er davon aus, dass wir ihm folgen würden. Noch während er den Flur entlangschritt, begann er, zu rufen: »Hey, Sophie, es ist tatsächlich deine Tochter. Du hattest recht, sie scheint ziemlich auf dich angewiesen zu sein.«
Verbissen schluckte ich die Wut hinunter, die in mir brodelte. Das Traurige war, dass ich das nicht zum ersten Mal zwischen diesen Wänden tat. Zu gut konnte ich mich an das ohnmächtige Gefühl erinnern, welches mich letztlich von hier fortgetrieben hatte. Und doch war ich wieder hier gelandet. Herzlich willkommen Zuhause, dachte ich zynisch.
Zögerlich schritten Joan und ich dem Unbekannten nach, der uns in seiner unhöflichen Art sogar seinen Namen verschwiegen hatte. Er führte uns den Gang entlang, direkt zur Wohnstube. Wenn man sechzehn Jahre in einem Haus gewohnt hatte, vergaß man dessen Raumaufteilung nicht so schnell. Besonders, wenn die Ausstattung und das Mobiliar noch genauso aussahen wie früher. Der Marmorboden schimmerte nach wie vor in dem sandfarbenen Beige, während es dieselben barocken Konsolen und Spiegel der Vergangenheit waren, die den Gang säumten. Dieser Umstand beflügelte mein Gedächtnis und ich konnte schon die gepolsterte Eckbank der Wohnstube vor mir sehen, auf der wir unsere täglichen Mahlzeiten eingenommen hatten. In diesem Raum hatte meine Mutter die Nachmittage mit Handarbeit oder Lesen verbracht, wenn sie nicht eine ihrer illustren Teegesellschaften im gegenüberliegenden Salon abhielt, der um einiges nobler eingerichtet war. In der gewöhnlichen Stube hingen keine großen, beeindruckenden Familienporträts der väterlichen Vanderblants oder mütterlichen Hohenröcks. Kein goldener, dreiarmiger Kerzenhalter würde hier auf einer Tafel zu finden sein. Lediglich ein kleines Stillleben zierte die Wände, welche von einer Tapete mit zartem Blumenmuster überzogen waren. Statt des Kandelabers dekorierte in der Stube eine Vase mit einem Strauß Strohblumen den kleinen Tisch, da war ich mir sicher. Sogar der Geruch, der im Haus in jeder Ecke waberte, war nach all den Jahren der gleiche. Es war eine Mischung aus der Holzmöbelpolitur und dem Parfüm meiner Mutter, einem süßen Veilchenduft. Der Knoten in meinem Magen wurde fester und dann war es soweit.
Der Fremde hatte die Stubentür aufgestoßen und war zur Seite getreten. Ich fand mich meiner Mutter von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
Entsetzt hielt ich die Luft an. Denn diese alte, in sich zusammengesunkene Frau, die da vor mir in einem Sessel saß, hatte nur entfernt Ähnlichkeit mit meiner drakonischen Mutter, vor der ich in jungen Jahren geflüchtet war.
3. Tiefgekühlte Gefühle
»Wie ich sehe, bist du genauso geschockt von meinem Anblick, wie ich von deinem. Allerdings hatte ich einen Schlaganfall und was ist deine Ausrede?« Die spröde Stimme meiner Mutter zerschnitt die Stille.
Altbekannter Hass sprühte mir aus ihren Augen entgegen, die trotz der Falten, die sie umsäumten, nichts von ihrer Lebhaftigkeit eingebüßt hatten. Ihr linkes Lid schien mir ein wenig schlaffer als das rechte, wie auch der Mundwinkel auf dieser Seite. Die einst vollen Lippen hatten ihre Fülle verloren und ließen ihren Mund verbissen wirken. Vermutlich kniff sie in diesem Moment ihre Lippen wirklich zusammen. Denn ich hatte keinen Zweifel daran, dass sie es ernst meinte. Das war keine scherzende Bemerkung gewesen, um das Eis zu brechen, wie es vielleicht andere Eltern getan hätten. Nein, meine Mutter verfügte über keinerlei Arten von Humor.
Hatte ich soeben noch gedacht, sie sei gebrechlich und zahm geworden, wurde ich nun eines Besseren belehrt. Die rüde Begrüßung - wenn man sie so nennen wollte - traf mich unerwartet hart. Wie eh und je wusste meine Mutter genau mit ihrer spitzen Zunge zu verletzen. Die Beleidigung hätte mir vielleicht weniger zugesetzt, wenn der Fremde und meine Tochter nicht Zeugen gewesen wären.
Zitternd sog ich die Luft ein und schimpfte mich im Stillen ein dummes Huhn. Wieso hatte ich erwartet, dass sie mich mit offenen Armen oder einem freundlichen Satz empfangen würde? Unser letztes Telefonat, in dem ich sie um Hilfe gebeten, vielmehr angebettelt hatte, hätte mir doch eine Warnung sein müssen.
Ich ging auf sie zu und versuchte mich an einem Lächeln, das mir nicht ganz glücken wollte. »Hallo, Mutter.«
Unentschlossen blieb ich vor ihr stehen. Ihr zur Begrüßung lediglich die Hand zu reichen, erschien mir in diesem Moment unangebracht. Denn trotz ihres kaltherzigen Empfangs war sie noch immer meine Mutter, die ich nach siebzehn Jahren zum ersten Mal wiedersah. Einem Impuls folgend, beugte ich mich zu ihr hinab, umarmte und küsste sie geschwind auf die Wange. Ich hatte Angst, sie würde sich dagegen wehren, da sie noch nie ein Freund von körperlicher Nähe oder Zuneigungsbezeugungen gewesen war.
»Schön, dich wiederzusehen«, murmelte ich.
Es war ein Schock, festzustellen, dass ihre Schultern und ihr Gesicht sich wirklich so mager und zerbrechlich anfühlten, wie sie aussahen.
Ich ging vor ihr in die Hocke und betrachtete sie wehmütig. »Warum hast du nie etwas gesagt? Hätte ich gewusst, dass du ...«
»Hätte ich auch nicht gewollt, dass du zurückkommst«, fiel mir meine Mutter ins Wort.
Der Unbekannte trat neben ihren Sessel. »Vielleicht hätten Sie sich bei Sophie öfter melden sollen, als einmal in zehn Jahren?! Dann hätten Sie schon vor fünf Jahren erfahren, dass Ihre Mutter einen Schlaganfall erlitten hat.«
Ungläubig starrte ich den bärtigen Mann an. Natürlich könnte ich ihm erklären, dass ich mehr als einmal bei meiner Mutter angerufen hatte. Immer wieder hatte ich den Kontakt zu ihr gesucht und genauso oft einen Korb von ihr bekommen. Aber auf keinen Fall wollte ich mich vor diesem ungehobelten Flegel rechtfertigen. Deswegen schnauzte ich ihn mit verhaltener Wut an: »Wer sind Sie eigentlich? Und woher nehmen Sie sich das Recht, sich einzumischen? Und was treiben Sie überhaupt im Haus meiner Mutter?«
Es war jedoch nicht der Fremde, der mir antwortete, sondern meine Mutter. Ihr Kopf wurde krebsrot und ein Beben erfasste ihren schmächtigen Körper. »Was fällt dir ein?! Du kommst in mein Haus und beschimpfst meine Freunde? Du wirst dich auf der Stelle bei Lenn entschuldigen. Er ist ein gern gesehener Gast hier und im Gegensatz zu dir war er mir die letzten Jahre eine wertvolle Stütze. Was ich von dir noch nie behaupten konnte!«
Meine Mutter explodierte regelrecht und ich zog befangen den Kopf ein.
»Sophie, bitte reg dich nicht auf. Du weißt, es tut dir nicht gut.« Der gute Lenn legte seine Hand tröstend auf ihre Schulter und warf mir anklagende Blicke zu, während er weitersprach. »Sieh es als Fortschritt an. Immerhin beginnt deine Tochter, sich endlich Sorgen um dich zu machen.«
Als ich dann noch mitansehen musste, wie meine Mutter seine Finger liebevoll drückte, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, verschlug es mir vollends die Sprache. Was hatte diese vertrauliche Geste zwischen den beiden zu bedeuten? War dieser Mann-aus-den-Bergen-Verschnitt womöglich ihr Liebhaber? Diese Vorstellung war mir jedoch so zuwider, dass ich sie sofort abschüttelte. Dennoch blieb der Hauch eines Verdachtes zurück, der leise Erbschleicher flüsterte.
Pikiert erhob ich mich aus der Hocke und besann mich darauf, sowohl Haltung als auch einen bestimmenden Ton zu wahren.
»Ich werde mich bei ihm nicht entschuldigen, Mutter. Denn er besaß weder Anstand noch Höflichkeit, meine Frage zu beantworten und mir seinen Namen zu nennen. Im Übrigen bin ich kein Teenager mehr, den du zurechtweisen musst.«
Grimmig schüttelte meine Mutter den Kopf. »Herrgott, Vivien, dann benimm dich auch so. Glaubst du, ich lass Wildfremde in meinem Haus herumschleichen? Also wirklich, ich dachte, du wärst klüger.«
Der Freund oder Liebhaber meiner Mutter, was immer er auch war, hob seine buschigen Augenbrauen an. Die Situation amüsierte ihn wohl. »Für meine Freunde bin ich Lenn. Also können Sie mich Lennhart nennen.« Sein Timbre wurde noch einen Tick rauer, als er sich nun an mich wandte.
Dieser erneuten Unhöflichkeit begegnete ich mit einem falschen Grinsen. »Nett, aber nein, danke. Ich bevorzuge es, Ihren Nachnamen zu benutzen. Und Sie dürfen mich mit Frau Vanderblant ansprechen, Herr ...?« Ich kräuselte die Stirn, während ich auf die Entgegnung seines Familiennamens wartete.
»Karlson«, kam es nach einem Zögern von ihm.
Meine Mutter musterte mich indessen aufmerksam. »Du hast wieder deinen Mädchennamen angenommen?«
»Ja«, bestätigt ich wortkarg ihre Frage. Denn sicherlich würde ich ihr vor diesem Lennhart nicht offenbaren, dass dies durch Pauls verfluchten Ehevertrag, im Falle einer Scheidung, geregelt worden war. Wie vieles andere auch, was mich letztlich nahezu komplett mittellos aus unserer Ehe entlassen hatte. Als ich ihn vor sieben Jahren kennengelernt hatte, war ich nicht gerade vermögend gewesen. Ich hatte mich einfach nur glücklich geschätzt, dass ein vornehmer Anwalt mich, eine mittellose Kellnerin mit Kind, genug liebte, um mich zu heiraten und mit Joan und mir eine Familie zu gründen. Ich hatte damals nicht eine Sekunde gezögert, den Vertrag zu unterschreiben. Blind hatte ich Paul und auf die Liebe vertraut. Wieder einmal. Und genau das war mein Fehler, den meine Mutter mir noch früh genug vorwerfen würde. Ja, sie würde es genießen, mir breit und lang zu predigen, dass sie von jeher im Recht gewesen sei. Zu allem Übel würde dies sie in ihrer Überzeugung bestärken, dass ihre damaligen Handlungen legitim waren. Doch das waren sie nicht. Keine Einzige davon. Niemals würde ich meinen vermeintlich größten Fehler bereuen, dessen Resultat schweigend hinter mir stand und den ich über alles liebte.
Mit einem stolzen Lächeln griff ich nach der Hand meiner Tochter, zwinkerte ihr aufmunternd zu und zog sie an meine Seite.
»Mutter, darf ich dir deine Enkeltochter vorstellen: Joan.«
Während Joan schüchtern dem Blick meiner Mutter begegnete, konnte man auf deren Gesicht Neugier entdecken, was mich überraschte.
Vorsichtig näherte sich Joan der Frau, die ihre Existenz bis zu diesem Zeitpunkt immer ignoriert hatte.
Zaghaft streckte Joan ihr die Hand entgegen. »Hallo, Großmutter.«
Der Kopf meiner Mutter wankte einen Moment unentschlossen zwischen einem Nicken und Verneinen. Ich hielt den Atem an, aber zu meiner Erleichterung erwiderte sie die Geste und hielt Joans Hand länger als nötig.
»Hm, da scheint mal jemand nicht den Vanderblants ähnlichzusehen.«
Es war nur ein Satz, der dennoch einen Widerstreit an Emotionen in mir auslöste. Denn indirekt eröffnete meine Mutter wieder einmal, dass ich mit meinem Vater mehr Ähnlichkeiten teilte als mit ihr. Obwohl ich dies immer als Kompliment gewertet hatte, weil ich meinen Vater liebte und er ein wundervoller Mensch gewesen war, flößte es mir ein bedrückendes Gefühl ein. Möglicherweise hing es damit zusammen, dass sie es nie ertragen hatte, an ihren geliebten Gatten erinnert zu werden. Stets hatte sie mich gemahnt, meinen Vater oder auch nur irgendetwas, was mit ihm in Verbindung stand, in ihrer Gegenwart zu erwähnen. Seinen Tod hatte sie nie verkraftet, geschweige denn verarbeitet. Vermutlich würde sie selbst jetzt noch nicht, nach all den Jahren, seine Räumlichkeiten betreten. Bestimmt ruhten sie verschlossen, wie eh und je in diesem Haus. Jäh wurde mir klar, dass sie dieses Haus in einen Schrein umfunktioniert hatte.
»Aber was ist denn um Himmels willen das für ein Name? Joan? Wie kommt man denn auf so eine Idee?« Meine Mutter riss mich aus den trüben Gedanken. Abwertend schüttelte sie den Kopf.
Doch ehe ich reagieren konnte, kam aus einer Ecke Beistand, woher ich ihn nicht erwartet hatte.
»Also ich finde Joan ganz cool«, meldete sich Lennhart Karlson zu Wort.
Dies zauberte Joan ein Lächeln aufs Gesicht. Mit einem Anflug von Stolz reckte sie ihr Kinn. »Den hat Mama ausgewählt, weil er einer berühmten Sängerin gehört. Ihre Lieder sind nicht nur schön, sondern fordern zu Gleichberechtigung und Frieden auf.«
Während meine Mutter genervt aufstöhnte und die Augen verdrehte, zog ein Schmunzeln über das Gesicht des Mannes, den ich vielleicht doch noch eines Tages mit Vornamen ansprechen würde.
»Ach, wirklich?«, fragte er spöttisch. »Nach der Folksängerin Joan Baez?« Erneut wanderte sein Blick über mich hinweg, doch diesmal lag nicht nur Ablehnung darin, sondern auch etwas, das wie Verwunderung erahnen ließ.
»Ja!«, sagte Joan.
Meine Mutter brummte argwöhnisch vor sich hin. »Oh, ja, bestimmt, das passt. Vivien war nämlich schon immer eins dieser schamlosen, Sex-besessenen ...«
»Mutter«, unterbrach ich sie empört.
»Was?«, ereiferte sie sich unschuldig. »Joan ist doch der beste Beweis für dein lasterhaftes Leben.«
Während mir die Augen aus den Höhlen quollen, warf Lennhart Karlson den Kopf in den Nacken und lachte lauthals. Deutlich und schnell verlor er wieder an Sympathie.
»Oh, Sophie, du bist dein Gewicht in Gold wert. Aber ehrlich gesagt, kann ich das wirklich nicht glauben. Schau dir deine Tochter mal an.«
»Glaub es, glaub es ruhig, mein Junge. Es ist die Wahrheit. Lass dich von ihrer feinen Aufmachung bloß nicht täuschen«, beharrte meine Mutter energisch auf ihre Bloßstellungen.
Kopfschüttelnd holte ich tief Luft und zog Joan mit mir in den Flur. »Wenn du nichts dagegen hast, Mutter, bringen Joan und ich unser Gepäck in mein altes Zimmer.«
Hastig, um ihr nicht die Gelegenheit eines Neins zu geben, ließ ich das Paar stehen und hoffte, das Peinlichste überstanden zu haben.
4. Fremdes Angesicht
Gemeinsam mit Joan schleifte ich unsere Koffer die Treppe ins Obergeschoss hinauf. Und mit jeder Stufe, die ich mich dem Flur näherte, der zu meinem Zimmer führte und mich seit Jahren in meinen Träumen verfolgte, nahm das Unbehagen zu. Kaum hatte ich das dämmrige Treppenhaus betreten, überzog eine Gänsehaut meinen Rücken.
Es war ein kleiner Schock, als ich feststellte, dass der finstere Korridor meiner Albträume ein exaktes Ebenbild der Wirklichkeit war. An viele Dinge aus meiner Kindheit konnte ich mich nur noch vage erinnern. So sehr ich es auch versuchte, sie mir deutlicher ins Gedächtnis zu rufen, so blieben sie doch stets nur schemenhaft. Selbst das geliebte Gesicht meines Vaters, den ich mit fünf Jahren zum letzten Mal gesehen hatte, war in meinem Geiste verblasst. Aber dieser Gang, der nun vor mir lag, hatte sich für die Ewigkeit in mein Gehirn eingebrannt.
Sogar jetzt, an diesem trüben Herbstnachmittag, erstreckte er sich im Halbdunkel genauso vor mir, wie ein endloser Pfad, der ins Nichts führte. Das wenige Tageslicht drang zum einzigen Fenster herein, das am linken Ende des Flurs lag, neben meinem alten Kinderzimmer. Rechter Hand dagegen herrschte Düsterkeit. Da weder die Tür des Badezimmers noch die des Schlafzimmers meiner Eltern geöffnet war, konnte man keine drei Schritte weitersehen. Ich setzte meinen Fuß auf den dicken Teppich, der jeden Laut verschluckte und glaubte im selben Moment, einen kalten Windhauch aus dem Dunkeln zu spüren. Ich stockte abrupt in meiner Bewegung.
»Wo entlang, Mama? Nach rechts oder links?«, fragte Joan ungeduldig und vertrieb damit die finstere Sinnestäuschung.
Mit einem erzwungenen Grinsen deutete ich in Richtung des kleinen Fensters. »Nach links. Auf der linken Seite ist mein altes Kinderzimmer und auf der rechten war früher ein kleiner Raum, in dem meine Mutter die Wäsche bügelte.«
»Was liegt auf der anderen Seite des Gangs?«
»Geradeaus findest du die Toilette, rechts davon das Badezimmer und gegenüber diesem das Schlafzimmer deiner Großeltern.«
Wir gingen den Flur entlang und Joan warf nochmals einen Blick zurück in die Dunkelheit. »Das muss ja riesig sein. Es belegt fast die ganze Seite des Hauses, oder?«
»Na ja, das Bügelzimmer beansprucht zwar einen kleinen Teil«, erwiderte ich. »Aber du hast Recht, es ist verhältnismäßig groß. Wahrscheinlich liegt es an dem begehbaren Wandschrank, den meine Eltern sich einbauen ließen.«
Bilder von dem besagten Raum zuckten durch meine Hirnwindungen. Unscharf und doch konnte ich die Silhouette meines Vaters erfassen. Groß und breitschultrig sah ich in ihn zwischen den Regalfächern und Kleiderstangen stehen. Melancholie befiel mich, denn jede Kleinigkeit schien mich an ihn zu erinnern.
Joan öffnete die Tür meines ehemaligen Zimmers und mit einem Schlag fühlte ich mich wieder als der Teenager von sechzehn Jahren. Es war, als hätte meine damalige Flucht diesem Raum alles Leben entzogen, ihn in ein zeitloses Vakuum verwandelt. Der Lauf der Welt, gar der Zeit, war an diesem Ort aufgehalten worden.
Auf meinem breiten Himmelbett lag die mir vertraute Steppdecke, als hätte ich sie erst vor wenigen Stunden über den Kissen ausgebreitet. Zugegeben, die Farben hatten in ihrer Leuchtkraft nachgelassen, doch noch immer war das zarte Ringelblumenmuster gut zu erkennen. Selbst die orangefarbenen Volantvorhänge, die das Himmelbett und die Fenster zierten, waren in tadellosem Zustand. Kein Riss, kein loser Faden zeigte sich an ihnen. Allein der Staub, der sich in den Falten des Stoffes angesammelt hatte, verbreitete den unverkennbaren Geruch von Vergänglichkeit.
Mein Schreibtisch und die Regale, gefüllt mit Büchern und Nippes, waren ebenfalls so belassen worden.
Der Zustand des Zimmers war jedoch kein Anzeichen für eine Sehnsucht nach mir, die meine Mutter hegte. Oh nein, das wusste ich. Es war lediglich Bequemlichkeit und noch Schlimmeres: Gleichgültigkeit, die sie bewogen hatte, alles so liegenzulassen. Es war ihr egal, was mit meinem Zimmer und meinen Sachen geschah. Hätte sie diesen Raum für etwas Bestimmtes nutzen wollen, hätte sie gewiss nicht einen Moment gezögert, ihn leerzuräumen und die Möbel der Müllabfuhr zu übergeben.
Aber ich wollte mich nicht darüber beklagen, sondern war letztlich dankbar dafür, für die kommenden Nächte ein genügend breites Bett für Joan und mich zu haben.
»Du hattest ein Himmelbett? Geil!«, freute sich meine Tochter und ließ ihre Koffer und Taschen fallen.
Guter Dinge stellte auch ich das Gepäck ab und öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Ich raufte die Tagesdecke vom Bett und schüttelte sie kräftig außerhalb des Fensters aus. Feine Staubwölkchen stoben in einer feuchten Herbstbrise davon. Die Kissen erfuhren die gleiche Prozedur wie die Decke und nach dem ich die Matratze abgeklopft hatte, glaubte ich, den stickigen Geruch einigermaßen vertrieben zu haben.
Joan hatte in der Zwischenzeit in den Schränken herumgestöbert und herausgefunden, dass diese lediglich Bettwäsche, aber keinerlei Kleidung enthielten. Ich vermutete, dass meine alten Kleider bei einem Wohltätigkeitsverein gelandet waren. An sich würde dies für meine Mutter sprechen, wenn ich nicht wüsste, wie skrupellos sie es verfolgte, sich in der Öffentlichkeit im besten Licht darzustellen. Das, was fremde Leute über sie oder die Familie dachten, war ihr schon früher wichtiger als alles andere gewesen. Wichtiger als ihre Tochter. Bittere Wut erwachte in mir und wirbelte schmerzende Erinnerungen aus den Tiefen empor.
In aller Deutlichkeit konnte ich sie wieder vor meinem Bett stehen sehen. An jenem Morgen, als ich von einem schmerzhaften Ruck an meiner Kopfhaut erwachte. Niemals könnte ich den Ausdruck auf ihrem Gesicht vergessen. Mit einer Mischung aus Zorn und Befriedung hatte sie sich über mich gebeugt. Erst auf den zweiten Blick hatte ich dann die Schere in ihrer rechten Hand entdeckt und das Büschel brauner Haare in ihrer linken. Es hatte einen Moment gedauert, bis mein müder Verstand erkannte, dass es meine Haare waren, die sie in ihrer Faust hielt. Mit einem lauten Heulen hatte ich mich im Bett aufgesetzt, doch sie verzog ihren Mund voller Abscheu.
»Das wird dir hoffentlich eine Lehre sein. Ich werde es dir noch austreiben, in der Gegend herumzuhuren. Sollte mir noch einmal zu Ohren kommen, wie du den Männern hinterherjagst, rasiere ich dir den Schädel kahl. Das schwöre ich dir!«, hatte sie mich angegiftet.
All mein Weinen nützte jedoch nichts, meine langen Wellen waren abgeschnitten. Die unterschiedlich kurzen Strähnen, die traurig von meinem Kopf herunterbaumelten, bedeckten nicht mal mehr meine Ohren.
Für sie war der Besuch einer Abschlussfeier in der Schule Hurerei gewesen, Tanzen ein Männerhinterherjagen. Und für mich war jener Morgen letztlich der Grund, weshalb ich mich entschloss, davonzulaufen.
Joans Seufzen holte mich in die Gegenwart zurück. »Na ja, immerhin besser als unter einer Brücke zu schlafen, oder?« Sie ließ sich auf das Bett plumpsen und beobachtete mich dabei, wie ich die Koffer öffnete. »Glaubst du, dieser Herr Karlson ist mehr als ein Freund für Großmutter?«
Belustigend stierte ich sie an. »Du meinst doch nicht etwa ...?«
Meine Tochter kicherte verschmitzt: »Doch. Vielleicht ist er ihr junger Stecher. Schließlich können sich auch ältere Frauen einen jüngeren Geliebten zulegen.«
Obwohl ich noch vor ein paar Minuten die gleichen Vermutungen angestellt hatte, musste ich mir dennoch eingestehen, dass dies für meine Mutter nie in Frage kommen würde. Abwegig schüttelte ich den Kopf. »Nein, sie würde niemals etwas tun, was ihrem Ruf schaden könnte.«
»Also, ihr verwilderter Garten ist auch nicht gerade das beste Aushängeschild.«
Ich stimmte ihr nachdenklich zu. »Ja, wohl wahr. Aber da jeder im Ort von ihrem Schlaganfall weiß, der sie körperlich einschränkt, scheint der verwahrloste Zustand des Anwesens für sie kein Problem zu sein. Anscheinend kann sie sich es auch nicht leisten, jemanden für die Gartenarbeit anzuheuern.«
Jäh kam mir eine Idee. »Vielleicht sollten wir ihr anbieten, den Garten wieder auf Vordermann zu bringen? Was meinst du?«
Die Begeisterung meiner Tochter, sich durch die meterhohe Wiese zu wühlen, hielt sich augenscheinlich in Grenzen. Sie zog eine unwillige Schnute. »Wenn es sein muss.«
Ich grinste verständnisvoll. »Ich weiß, dass das hier alles ganz fürchterlich für dich sein muss. Aber ich denke, wenn wir uns ihr gegenüber ein bisschen erkenntlich zeigen, für die Unterbringung, wird sie uns nicht völlig wie Aussätzige behandeln.«
Zögernd nickte Joan. »Na gut.« Sie holte tief Luft, bevor sie weitersprach. »Sie ist wirklich ein alter Giftzahn. Ich kann verstehen, warum du vor ihr davongerannt bist.« Traurigkeit machte sich plötzlich auf ihrem zarten Gesicht breit. »Sie hätte dich gezwungen, mich abzutreiben, nicht wahr?«
Betroffen hielt ich mit dem Auspacken inne, stand auf und ging zu ihr hinüber, um sie in eine Umarmung zu ziehen.
»Nein!«, sagte ich fest und nahm ihr Gesicht zärtlich in meine Hände. »Niemals hätte ich auf irgendeine Weise zugelassen, dass sie dich mir wegnimmt. Du bist das Wundervollste, was mir je im Leben geschenkt wurde, Joan. Dein leiblicher Vater mag ein Volltrottel gewesen sein, weil er mich schwanger vor die Tür setzte, aber du bist das Beste, was er vollbracht hat.« Ihre grünen Augen glänzten feucht und ich lächelte sanft. »Und er war gar kein so schlechter Sänger.«
Mit zittriger Stimme fragte sie halb weinend: »Besser als Paul?«
»Ja!«, entgegnete ich in einem Lachen. »Viel besser, aber das ist keine Kunst. Denn dein Stiefvater hatte eine schreckliche Stimme.«
Auch Joan lachte nun wieder und in Gedanken an Paul verdrehte sie die Augen. »Leider sah er das anders, wenn er unter der Dusche stand und lautstark seine Arien schmetterte.« Verlegen entfernte sie meine Hände von ihren Wangen, ließ sie jedoch nicht los. »Aber er war mir ein guter Vater. Zumindest bis er die Scheidung einreichte.«
»Ja, das war er«, nickte ich niedergeschlagen. »Es tut mir leid, Joan.«
Empört schaute sie zu mir auf. »Nein, Mama!«
Schluckend kämpfte ich gegen die Tränen an, die mir aus Augen quellen wollten. Ich durfte jetzt nicht schwach werden, ich musste stark bleiben, für uns beide.
»Doch«, murmelte ich. »Ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht und du musstest immer darunter leiden. Es tut mir so leid.«
Vehement schüttelte Joan den Kopf. »Mama, nein! Sag doch sowas nicht. Ich hatte immer ein schönes Leben. Und das hier ist ... ein Abenteuer, das wir gemeinsam bestehen. Wir werden wieder glücklich werden. Mach dir keine Sorgen.«
»Ja«, hauchte ich und atmete durch. Verstohlen wischte ich meine Augenwinkel trocken. Eine erbärmliche Mutter war ich, die auf den Zuspruch ihrer Tochter angewiesen war. Stattdessen sollte es doch andersherum sein. Mit dem Vorsatz, keine Schwäche mehr zuzulassen, straffte ich die Schultern.
»Komm, bringen wir unsere Kosmetiktaschen ins Bad. Dann vertrödeln wir morgen früh keine Zeit damit. Schließlich solltest du an deinem ersten Schultag pünktlich sein.«
Maulend erhob sich Joan und folgte mir mit bedrückter Miene in den finsteren Flur.
»Sieh es von der Seite: neue Schule, neues Glück und ... neue Jungs.« Ich wollte sie aufmuntern und vielleicht auch mich selbst beruhigen. Denn erneut hatte mich das Unwohlsein eingefangen. Das kleine Fenster im Rücken, ruhte der schmale, lange Gang in Schwärze nun vor uns. Mir war, als lauere in der Dunkelheit etwas auf mich, als wolle mich eine unbekannte Gefahr verschlingen. Die Furcht war auf einmal da. Stark. Nicht zu ignorieren. Ich zwang mich zum Weitergehen, denn ich wusste, dass an der Wand neben dem Treppenaufgang ein Lichtschalter wartete. Mit klopfendem Herzen schritt ich voran und streckte schon von weitem meine Hand aus, um den Drehschalter so bald wie möglich ertasten zu können. Ich fand ihn schließlich und mit einem leisen Knacksen erhellte eine Deckenleuchte den Flur.
Hier säumten keine Möbel den Gang, der rot-schwarz gemusterte Teppich war die einzige Zierde.
Mit Joan im Schlepptau, strebte ich auf das Ende zu, wo das Badezimmer lag. Schon immer hatte ich die geschwungene Messingtürklinke bewundert, die sich in meine Hand schmiegte. Ich öffnete die Türe und als ich das grün-weiße Fliesenmuster sah, erfasste mich schlagartig ein Schwindel. Ich taumelte benommen und konnte mich gerade noch an der Tür festhalten. Zugleich presste es mir die Luft aus den Lungen und ich glaubte, zu ersticken. Panik erfasste mich und die gefliesten Wände begannen, sich um mich zu drehen. Mein letzter Gedanke war, dass ich das Bewusstsein verlieren würde und im nächsten Moment verschlang mich die Schwärze.
5. Gefangenes Herz
»Sie kommt wieder zu sich.«
Eine Männerstimme drang durch das nebelhafte Nichts zu mir. Ich wollte meine Lider aufschlagen, aber sie waren so schwer. Ein unerwarteter Schmerz schoss durch meinen Hinterkopf und ich stöhnte gepeinigt auf.
Erneut sprach der Mann. »Geh bitte zu Sophie und sag ihr, ich brauche ein Glas Wasser.«
Nach einem Moment entfernten sich Schritte und mir gelang es, die Augen zu öffnen.
Ich fand Lennhart Karlsons bärtiges Gesicht vor meiner Nase. Seine Brauen hatten sich zusammengezogenen, während sein Blick grimmig über mich hinwegschweifte. Irgendwie glaubte ich, Sorge in ihm zu erkennen. Die satte Farbe seiner Augen erinnerte mich an geschmolzene, dunkle Schokolade.
»Wie geht es Ihnen? Alles okay?«
»Ich denke schon. Mein Kopf tut nur ein bisschen weh«, sagte ich und wollte vorsichtig die Stelle abtasten, die schmerzte.
Doch Lennhart brummte. »Lassen Sie mich nachschauen!«
Sanft hob er meinen Kopf an und rückte dabei noch näher an mich heran, sodass mein Gesicht fast seine Schultern berührte. Ein Duft stieg mir in die Nase. Er war ganz angenehm. Unbewusst atmete ich tiefer ein. Es war ein pfeffriges Aroma, das zugleich etwas Zitronenartiges an sich hatte. Sehr sinnlich. Oh Gott, wie kam ich denn darauf? Lennhart Karlson und sinnlich?!
Schweigend hielt ich still und spürte, wie seine Finger behutsam unter meine Haare fuhren und sanft über meine Kopfhaut glitten. Bis ein stechender Schmerz mich zusammenzucken ließ.
»Aah, verdammt«, zischte ich.
»Tut mir leid«, nuschelte er. »Fester ging es nicht. Aber immerhin sehe ich kein Blut. Scheint nur eine Beule zu werden.« Er ließ meinen Kopf wieder auf das Kissen zurücksinken. »Sie hatten Glück, dass Joan Ihren Sturz abgefangen hat. Wäre sie nicht gewesen, hätten Sie Schlimmeres davongetragen.«
»Ja«, murmelte ich und wich Lennharts durchdringenden Augen aus.
Endlich richtete er sich auf und gab mir damit Raum zum Atmen.
»Wenn die Schmerzen bleiben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Mit einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen.«
Noch immer seinen Blick meidend, nickte ich, hielt vor Schmerz jedoch kurz die Luft an.
»Weshalb sind Sie zusammengebrochen?«, fragte Lennhart. »Haben Sie es etwa mit Ihrer Diät übertrieben, um besser in ihren schmalen Haute-Couture-Rock hineinzupassen?« Seine Stimme triefte vor Hohn.
Wütend schaute ich ihn an und musste feststellen, dass er sich königlich amüsierte. Der verfilzte Kerl genoss es, mich zu verärgern.
»Nein!«, empörte ich mich. »Ich halte keine Diät. Ich habe heute Morgen ...« Betreten verstummte ich, denn mir wurde klar, dass ich seit dem Brötchen zum Frühstück tatsächlich nichts mehr gegessen hatte. Während Joan bei einem Zwischenstopp in einer Bäckerei eine Brezel vertilgt hatte, war ich mit einer Tasse Kaffee zufrieden gewesen. War mein Zusammenbruch wirklich auf eine Unterzuckerung zurückzuführen? Ich hatte doch schon oft eine Mahlzeit übersprungen, warum sollte ich deswegen auf einmal umkippen? Vielleicht war dieser kleine Ohnmachtsanfall nur eine Folge der Aufregungen der letzten Tage gewesen. Allerdings erklärte es nicht, weshalb ich den Eindruck hatte, zu ersticken.
Indessen ich grübelte, grinste Lennhart selbstgefällig. »Ja, das dachte ich mir.«