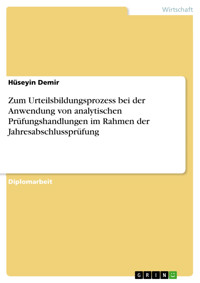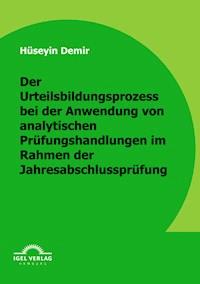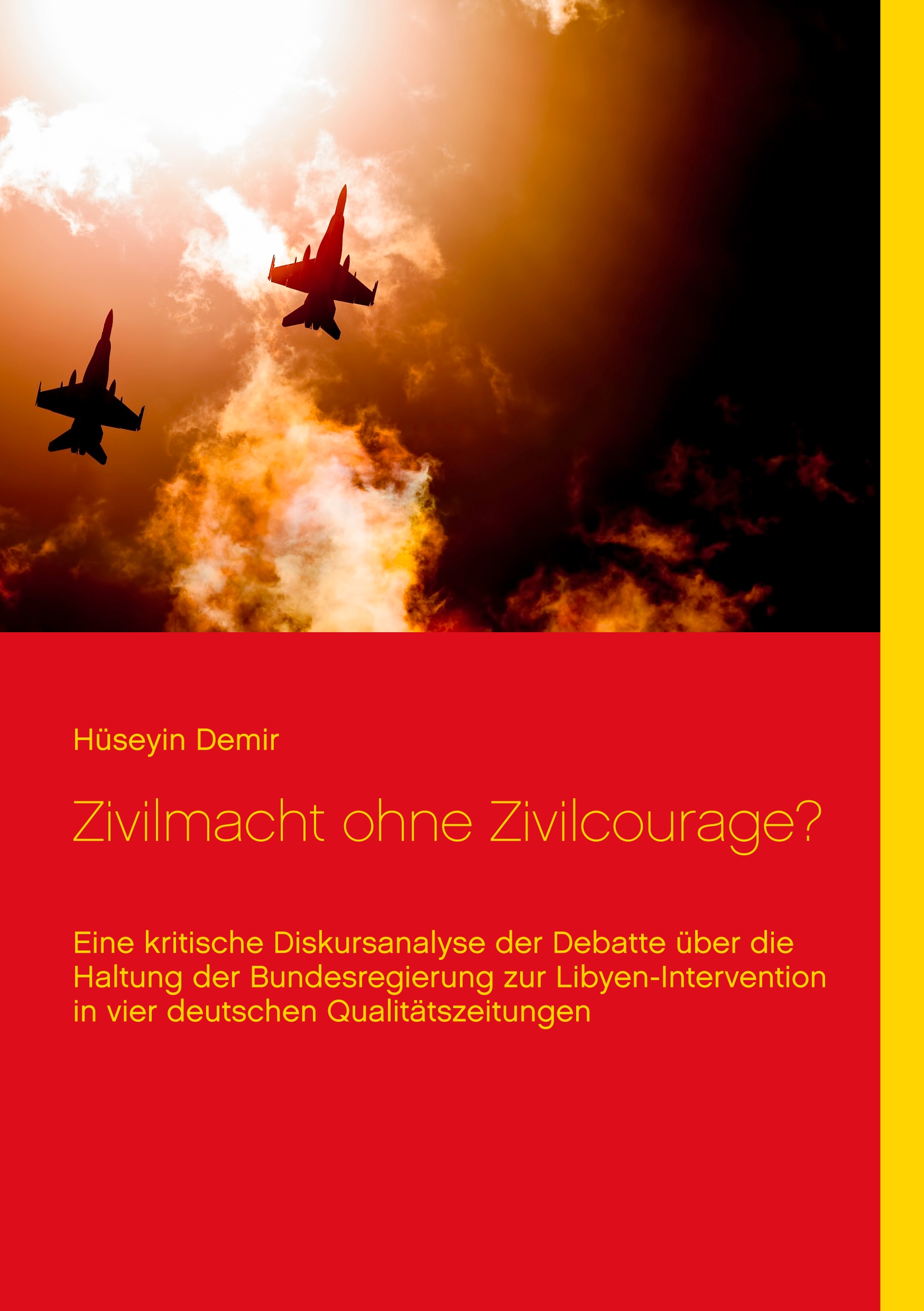
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gegen Ende des Jahres 2010 und zu Beginn des Jahres 2011 bewegte der sogenannte 'Arabische Frühling' die Menschen in Deutschland und der Welt.Nach langen Zeiträume mit suppressiven Regierungen entstanden wie aus dem Nichts Protestbewegungen und Unruhen, die von den jeweiligen Bürgern und Bürgerinnen ausgingen und zum Teil im Umsturz der Regierungen endeten. Auch in Libyen zeigten sich deutliche Hinweise auf eine Revolution, die vom seit geraumer Zeit unzufriedenen Volk ausging, sich jedoch schwerwiegenderen Grenzen als in Tunesien oder Ägypten gegenüber sah. Im Zuge dieser politischen Entwicklungen wurde auch in der deutschen Außenpolitik über eine mögliche Militärintervention in Libyen nachgedacht, die aufgrund historischer und bündnispolitischer Merkmale jedoch auf erhebliche Skepsis stieß und sehr umstritten war. Hüseyin Demir wendet sich dieser spannenden und immer wieder im Falle der Diskussion um Interventionen auftretenden Problematik zu und untersucht anhand der 'kritischen Diskursanalyse' nach Jäger die Medienberichterstattung in vier deutschen Qualitätszeitungen auf implizite Argumentationsstrukturen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Thema und Problemstellung
1.2 Struktur der Untersuchung
2 Diskursiver Kontext
2.1 Arabischer Frühling
2.2 Revolution in Libyen
2.3 Völkerrechtlicher Hintergrund des NATO-Einsatzes
2.3.1 Das Prinzip der Schutzverantwortung
2.3.2 UN-Resolution 1973
2.4 Deutsche Außenpolitik
2.4.1 Deutsche Außenpolitik nach der Wiedervereinigung
2.4.2 Geschichte deutscher Out-of-Area-Einsätze
2.4.3 Zur Debatte über die deutsche Haltung zur Libyen-Intervention
3 Methodologie und Methodik
3.1 Diskurstheorie
3.2 Kritische Diskursanalyse (KDA)
3.2.1 Diskursbegriff und -struktur nach Jäger
3.2.2 Anwendung der Kritischen Diskursanalyse
3.2.3 Kritische Anmerkungen zur KDA
3.3 Anwendung der Kritischen Diskursanalyse in dieser Arbeit
3.3.1 Methodisches Vorgehen
3.3.2 Datenbasis
3.3.3 Sampling
4 Analyse
4.1 Kommentaranalyse der Tageszeitung „die tageszeitung“ (TAZ)
4.1.1 Sinneinheiten
4.1.2 Sprachlich-rhetorische Komponenten
4.1.3 Inhaltlich-ideologische Komponenten
4.1.4 Zusammenfassende Interpretation der TAZ
4.2 Kommentaranalyse der Tageszeitung „Süddeutsche Zeitung“ (SZ)
4.2.1 Sinneinheiten
4.2.2 Sprachlich-rhetorische Komponenten
4.2.3 Inhaltlich-ideologische Komponenten
4.2.4 Zusammenfassende Interpretation der SZ
4.3 Kommentaranalyse der Tageszeitung „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ)
4.3.1 Sinneinheiten
4.3.2 Sprachlich-rhetorische Komponenten
4.3.3 Inhaltlich-ideologische Komponenten
4.3.4 Zusammenfassende Interpretation der FAZ
4.4 Kommentaranalyse der Tageszeitung „Die Welt“ (WELT)
4.4.1 Sinneinheiten
4.4.2 Sprachlich-rhetorische Komponenten
4.4.3 Inhaltlich-ideologische Komponenten
4.4.4 Zusammenfassende Interpretation der WELT
5 Untersuchungsergebnis
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
„Die Amerikaner schätzen Deutschland als wirtschaftlichen Koloss, haben es aber als strategischen Partner abgeschrieben, dito die Briten. Welche Ironie! Die Deutschen haben sich nach 1945 geschworen, nie wieder allein zu sein. In der strategischen Arena schreitet die Selbst-isolierung voran.“ (Josef Joffe, Die ZEIT 07. November 2013)
1.1 Thema und Problemstellung
Die deutsche Haltung im Rahmen außenpolitischer Entscheidungsprozesse im Verhältnis zu derjenigen der Bündnispartner wird fortwährend von Diskussionen begleitet, wobei zwischen den Beteiligten Uneinigkeit bezüglich des außenpolitischen Rollenkonzepts1 der Bundesregierung herrscht. Während die eine Seite Zurückhaltung anmahnt, befürchtet die andere, die Hacke (2012) durch das Wortspiel im Titel dieser Untersuchung und Josef Joffe mit obigem Zitat vertritt, die Abwendung von den westlichen Bündnispartnern. Da eine eindeutige Festlegung der Haltung der Bundesregierung in außenpolitischen Fragen nicht absehbar scheint, sind auch in Zukunft intensive Debatten über das außenpolitische Rollenkonzept Deutschlands zu erwarten.
Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Basis der von Jäger (2004) entwickelten Untersuchungsmethode der Kritischen Diskursanalyse (KDA) untersucht, wie die Haltung der Bundesregierung zur Libyen-Intervention in der Anfangsphase des Einsatzes in vier verschiedenen deutschen Tageszeitungen dargestellt wird. Dafür gilt es die Diskurspositionen 2 der Tageszeitungen in der Debatte über die Libyen-Intervention und insbesondere zur Haltung der Bundesregierung herauszuarbeiten. Die jeweilige Positionierung lässt sich anhand der Verflechtungen von Repräsentationen3 in einem Diskursfragment ermitteln, wobei die Offenlegung der durch die jeweilige Zeitung bevorzugtenArgumentationsstrategieneine zentrale Rolle spielt (Kap. 4.1 bis4.4). Darauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt versucht, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Darstellungen herauszuarbeiten und diese vergleichend bzw. kontrastierend zu übergreifenden Diskurspositionen zusammenzufassen (Kap. 5.). Das Forschungsdesign lässt sich dementsprechend als das einer qualitativen, synchronen Untersuchung einer außenpolitischen Debatte bestimmen, die als Fallstudie im Rahmen einer vertikalen Analyse des deutschen Diskurses über militärische Auslandseinsätze dient.
Debatten über Militäreinsätze außerhalb des NATO-Bündnisgebiets (Out-of-area) sind in Deutschland aufgrund der turbulenten Geschichte stets ein sehr brisantes Thema (vgl. Katsioulis 2011: 1). Ein weiterer Faktor für die intensiven Debatten anlässlich der deutschen Beteiligung an Out-of-Area-Einsätzen ist die historische Neuheit dieser Frage, da sie erst durch die gestiegene außenpolitische Verantwortung nach der Wiedervereinigung aufkommt, weshalb es kein eindeutiges Prinzip gibt, nach dem außenpolitische Entscheidungsträger urteilen können, sondern jedes Mal eine Einzelfallentscheidung getroffen wird. Zudem lassen sich insbesondere die für oder gegen eine Entscheidung hervorgebrachten Argumente nicht generalisieren, weshalb jede dieser Entscheidungen, wie auch Pillath (2008: 96) ausführt, eine Einzelfalluntersuchung nach sich ziehen muss.
Politische Debatten erfüllen in demokratischen Gesellschaften eine wichtige Funktion, indem sie politische Diskussionen formen, politische Ereignisse erklären, politische Entscheidungen und Handlungen rechtfertigen oder hinterfragen, historische Erfahrungen (re-) interpretieren und Identitäten (re-) konstruieren (vgl. Nadoll 2000: 12). Durch die Diskursanalyse kann herausgearbeitet werden, wie eine Gesellschaft politische Entscheidungen beeinflusst und begrenzt, so dass Entscheidungsträger nur bestimmte Optionen für angemessen halten oder als vertretbar präsentieren (vgl. Nadoll 2000: 8, Westlind 1996: 116). Damit erfüllen Diskurse eine doppelte Funktion: Zum einen beschränken sie den potentiellen Widerstand der Gesellschaft gegen eine bestimmte außenpolitische Handlung und gleichzeitig begrenzen sie das staatliche Handeln.
Die Handlungsempfehlungen, die verschiedene Diskursträger4 aussprechen, können auf demselben Identitätselement basieren. Ein Identitätselement soll nach Stahl/Harnisch als
„‘letztgültiges Argument‘ in Diskursen über Außenpolitik verstanden werden, das einen Bezug zum Eigenen aufweist, z. B. Deutschland in Europa oder Deutschland als Teil des Westens. Durch ein Identitätselement wird ein Bezug zum eigenen Land hergestellt, der keiner weiteren Begründung bedarf, sondern als konsensualer Ausgangspunkt von Argumentationsketten fungiert.“ (2009: 41; Herv. im Original)
Die nationale Identität einer Gesellschaft gilt daher nicht als konstant und einheitlich umrissen, sondern als „Ansammlung von ‚Identitätselementen‘“ (ebd.; Herv. i. O.). Mit Bezug zum Zweiten Weltkrieg und die daraus folgende „deutsche Verantwortung“ kann bspw. zum einen die Zurückhaltung in militärischen Interventionen begründet werden, andererseits aber eine besondere Verpflichtung zum Eingreifen (vgl. Schwab-Trapp 2002: 349, Hacke 2003: 512).
In außenpolitischen Debatten können sich daher verschiedene diskursive Lager bilden, die ähnliche Identitätselemente und Argumentationsmuster verwenden, aber gegensätzliche Handlungsempfehlungen aussprechen. Im Falle innenpolitischer Fragen sind diese Lager häufig deckungsgleich mit den Parteien. In außenpolitischen Debatten zeigt sich jedoch, dass die Positionierungen häufig quer zu Parteigrenzen verlaufen (vgl. Gabel/Scheve 2007: 38). Daher wird als Diskursträger, statt der Parteien, das Konzept der „Diskursformation“ (Foucault 1989: 13) eingeführt, durch das sich Vertreter verschiedener Parteien ihrer außenpolitischen Orientierung entsprechend einordnen lassen. Diskursformationen (im Folgenden DF) umfassen verschiedene, identitätsgeprägte und daher handlungsleitende und rechtfertigende Argumentationsmuster, die von einer Gruppe von Diskursträgern genutzt werden (Nadoll 2003: 176). Der Vorteil des DF-Begriffs liegt darin, dass sich der Diskurs nach seinen Hauptargumenten strukturieren lässt und nicht nach Hauptakteuren (vgl. Stahl 2011: 7). Wichtig im Rahmen dieser Arbeit ist, dass sich die innergesellschaftliche Umstrittenheit einer außenpolitischen Handlung mit diesem Konzept präziser abbilden lässt.
Trotz der erläuterten Zielsetzung, kann eine Diskursanalyse nicht den Anspruch erheben, außenpolitische Entscheidungen kausal und analytisch zu „erklären“. Es soll auch nicht Ziel dieser Arbeit sein, von verschiedenen Rechtfertigungen und Begründungen auf unterschiedliche Motive zu schließen. Vielmehr besteht das Ziel der Diskursanalyse darin, gesellschaftliche Debatten und öffentliche Auseinandersetzungen abzubilden und ihre diskursiven Verschränkungen herauszuarbeiten. Daneben gilt es herauszufinden, welche Begründungen, Legitimierungen und Rechtfertigungen sich wie und in welcher Verschränkung durchsetzen, wobei dies Rückschlüsse auf die Konsistenz der Legitimationen und die grundsätzliche Ausrichtung der deutschen Außenpolitik erlaubt.
1.2 Struktur der Untersuchung
Im folgenden Kapitel (2.) wird der diskursive Kontext des Untersuchungsgegenstands dargestellt, um die diskursive Einordnung der Diskursfragmente (Kap. 4) zu ermöglichen. Die Herausstellung des Kontexts ist dreigeteilt in die Darstellung der libyschen Revolution – ihrer Ursachen, ihres chronologischen Ablaufs und der internationalen Reaktion –, des völkerrechtlichen Hintergrunds des Einsatzes sowie einen Überblick über die Geschichte deutscher Out-of-Area-Einsätze und die in ihr eingebettete Debatte über die Haltung der Bundesregierung zur Libyen-Intervention. In Kapitel 3 wird die Kritische Diskursanalyse nach Jäger (2004), eine Untersuchungsmethode der qualitativen Sozialforschung, vorgestellt und ihre Einbettung in die Diskurstheorie erörtert sowie das Design der vorliegenden Studie erläutert. Nach der Analyse jeweils eines nach bestimmten inhaltlich-semantischen und formalen Kriterien ausgewählten typischen Kommentars aus jeder der vier deutschen Qualitätszeitungen (Kap. 4), werden im anschließenden Kapitel 5 die Ergebnisse zu Diskursformationen mit ihren jeweiligen verwendeten Argumentationsstrategien und Repräsentationen zusammengefasst. Abschließend (Kap. 6) folgt eine kurze Rekapitulation der Forschungsergebnisse. Daneben wird an diesem Punkt aufgezeigt, welche Anschlussmöglichkeiten diese Studie für weitere Forschungsvorhaben bietet
1 Zum Begriff des außenpolitischen Rollenkonzepts siehe Walker (1987).
2 Die Definition des dieser Arbeit zugrunde liegenden Diskursverständnisses und des verwendeten begrifflichen Instrumentariums (Diskurs, Diskursposition, Diskursfragment, Diskursstrang) erfolgt in Kapitel 3 (v.a. 3.2.1).
3 Unter Repräsentation wird dabei der Prozess verstanden, „durch den die Mitglieder einer Kultur sowohl sprachliche als auch weitere Zeichensysteme dazu benutzen, Bedeutungen zu produzieren“ (Hepp 2010: 36).
4 Aus Gründen der Vereinfachung wird ausschließlich die männliche Form verwendet. Personen weiblichen wie männlichen Geschlechts sind darin gleichermaßen eingeschlossen.
2 Diskursiver Kontext
2.1 Arabischer Frühling
Über Jahrzehnte hinweg waren in Nordafrika repressive und korrupte Regime an der Macht, deren Stabilität von Herrscherfamilien abhängig war, die ihre Macht mit allen Mitteln für lange Zeit sicherten. Der Prozess, in dessen Verlauf drei der autoritärsten Diktatoren der Region – Zine el-Abidin Ben Ali in Tunesien, Hosni Mubarak in Ägypten und Muammar al-Gaddafi in Libyen – in Folge gesellschaftlicher Protestbewegungen ihre Herrschaft verloren, wurde in der deutschen und internationalen Presse als „Arabischer Frühling“ oder „Arabische Revolution“ bezeichnet.
Für viele Beobachter überraschend, begann der Zerfall der autoritären Herrschaftssysteme in den arabischen Ländern am 17. Dezember 2010. An diesem Tag wurde die Welt Zeuge der Selbstverbrennung des tunesischen Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi im Rahmen einer Protestaktion gegen berufliche und soziale Perspektivlosigkeit sowie Korruption in der Kleinstadt Sidi Bouzid. Die in der Folge lokal aufflammenden Unruhen weiteten sich schnell über die neue Kommunikationstechnik (Web 2.0, Mobiltelefone) zur landesweiten Solidarisierung, spontanen Volksaufständen und am Ende zur Revolution aus (vgl. Werenfels 2011, Mattes 2013).
Die gewaltfreie Revolution in Tunesien wurde in den Medien, insbesondere den Sozialen Medien, intensiv verfolgt und kommentiert (vgl. El Difraoui 2011). Schultz und Peters bewerteten die friedliche Revolution als „Vorbild für Millionen von Arabern, die seit Jahrzehnten unter ihren korrupten Herrschern leiden“ (2011) und auch für viele Historiker gelten die Ereignisse als „historische Zäsur“ (Asseburg 2011: 7ff.).
Ermutigt durch den Erfolg der beiden Protestbewegungen kommt es ab dem ersten Quartal des Jahres 2011 in den meisten arabischen Ländern zu Protesten, die die Mittel, Forderungen und zum Teil sogar die Parolen5 der erfolgreichen Revolutionen in Tunesien und Ägypten aufgreifen (vgl. Khalidi 2011, Rosiny 2011: 2f.). Die Ursachen für die Aufstände und die Forderungen an die Herrschenden, klingen dabei über alle Protestbewegungen hinweg ähnlich, auch wenn sich die Auslöser der Proteste sowie ihre Intensität je nach Land unterscheiden 6 (vgl. Perthes 2011: 7, Werenfels/Asseburg 2011: 1f.). Das Spektrum der landesspezifischen Zielsetzung der Protestierenden reicht dementsprechend von der Abschaffung konfessioneller oder ethnischer Diskriminierung bis hin zur bedingungslosen Absetzung des Regimes (vgl. Ben-Jelloun 2011, Perthes 2011: 7).
2.2 Revolution in Libyen
Nach Beginn der Aufstände in den Nachbarländern gilt Libyen lange Zeit als Hort der Stabilität. Kurz nach dem Sturz Mubaraks in Ägypten am 17. Februar 2011 kommt der Arabische Frühling jedoch auch in Libyen an, wo sich von Anfang an abzeichnet, dass der Umbruch gewaltsamer verlaufen würde. Einer der wichtigsten Gründe für das schnelle Entgleiten der Proteste in Libyen in einen Bürgerkrieg ist nach Lacher (2013: 69-71) die durch Gaddafi vorangetriebene Schwächung staatlicher Institutionen, vor allem der Armee, und das Verbot von Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen zugunsten seines Clans bzw. seiner informellen Unterstützer.
Allerdings lässt sich der libysche Aufstand nach Beobachtern nicht allein als Reaktion auf die einschneidenden Ereignisse in den Nachbarländern sehen. Vielmehr nutzten die Protestierenden die Gelegenheit, ihrem seit Jahrzehnten angestauten Unmut über die verkrusteten Strukturen und das auf Unterdrückung, Stammesloyalitäten und Instabilität gegründete Herrschaftssystem Gaddafis Ausdruck zu verleihen und seinen Abtritt zu fordern (vgl. AI 2011a). Daneben jährte sich an diesem Datum die brutale Niederschlagung öffentlicher Proteste in Bengasi im Jahr 2006 zum fünften Mal (vgl. Nordhausen/Schmid 2011, AI 2011a). Als weiteren wichtigen Faktor benennt Amnesty International (2011a) das Massaker im Abu-Salim-Gefängnis im Jahre 1996, bei dem Wachen innerhalb von zwei Tagen hunderte Insassen – vor allem oppositionelle Aktivisten – hinrichteten, die gegen schlechte Lebensbedingungen demonstriert hatten (vgl. Human Rights Watch 2006). Seitdem gelten ihre in Bengasi angesiedelten Angehörigen, die als Abu-Salim-Familien bekannt sind, und ihre Anwälte als lautstärkste Gegner des Gaddafi-Regimes (vgl. Nordhausen/Schmid 2011: 93). Die Festnahme des Anwalts Fathi Tarbel am 15. Februar 2011 bzw. die öffentliche Protestaktion gegen diese gilt in der Folge als Beginn der libyschen Revolution (vgl. AI 2011a):
„We, the Abu Salim families, ignited the revolution […]. The Libyan people were ready to rise up because of the injustice they experienced in their lives but they needed a cause. So calling for the release of people […] became the justification for their protest.” (Oakes 2011: 224-225)
Den Kern der Aufständischen bilden auch in Libyen junge Menschen, die jedoch deutlich schlechter ausgebildet sind, als ihre Altersgenossen in Tunesien und Ägypten und über einen eingeschränkteren Zugang zum Internet und seinen Vernetzungsmöglichkeiten verfügen, weshalb die Protestaktionen zu Beginn weniger organisiert verlaufen als in den Nachbarländern (vgl. Lacher 2011).
Chronologie und Internationale Reaktion
Am 17. Februar 2011 finden sich trotz gekappter Internet- und Telefonleitungen in verschiedenen Städten Libyens tausende Menschen zum über Facebook ausgerufenen „Tag des Zorns“ zusammen, um zu protestieren (vgl. Schmid/Nordhausen 2011: 93). Der Protest beginnt in Bengasi und der weiter östlich gelegenen Stadt al-Bayda unter großen Anspannungen, verläuft jedoch zunächst als relativ koordinierte, friedliche Demonstration und ähnelt damit den Revolutionen in Tunesien und Ägypten. Die libyschen Sicherheitskräfte reagieren mit brutalem Waffeneinsatz, weshalb bis zu 24 Protestierende getötet und viele mehr verletzt werden (vgl. AI 2011a). Angesichts dieser Gewalt laufen in Bengasi ganze Armeeeinheiten zur Opposition über (vgl. Schmid/ Nordhausen 2011: 93). Schon am 20. Februar steht Bengasi faktisch nicht mehr unter der Führung des libyschen Diktators. Am selben Tag hält der zweitälteste Sohn Gaddafis, der bis dahin als besonnen gilt, eine Rede, in der er die Aufständischen als kriminell und drogenabhängig verunglimpft und bedroht: „Flüsse voller Blut werden fließen“ (Schmid/Nordhausen 2011: 93).
In Folge der brutalen Reaktion Gaddafis offenbaren sich die Bruchlinien innerhalb des Regimes, die den großen Einfluss von Clans und Stämmen zutage treten lassen. Auf der einen Seite stehen die Stämme des Nordostens, allen voran die Abu-Salim-Familien in und um Bengasi, denen sich wichtige Diplomaten und militärische Führungskräfte anschließen, um den Widerstand organisieren zu helfen. Auf der anderen Seite kämpfen dagegen Angehörige aus Gaddafis eigenem Stamm und verbündeter Clans (vgl. Lacher 2013: 67-74).
In Tripolis gilt die Lage bis zum 21. Februar 2011 als eher ruhig. An diesem Tag sammeln sich Demonstranten auf dem zentralen Grünen Platz (der symbolisch für Gaddafis Macht steht), wo Sicherheitskräfte das Feuer auf die Demonstrierenden eröffnen (vgl. AI 2011b: 16). Zeugen berichten, dass sich schwer bewaffnete Einheiten der Armee und afrikanische Söldner in massiver Zahl in der Stadt befinden, die aus Lastwagen heraus unterschiedslos auf jeden feuern (vgl. AI 2011b: 16, Hackensberger 2011).
Zu Beginn des Aufstands veröffentlichen die EU-Außenminister eine gemeinsame Erklärung, die vorsichtig formuliert und abwartend klingt. Besonders Italien, Malta und Zypern fürchten massive Flüchtlingsströme und sind daher an Stabilität in Libyen interessiert. Die Stimmung in Deutschland unterscheidet sich jedoch davon. Staatsminister Hoyer sieht die Ereignisse als „Chance für die Freiheit“ (Busse/Sattar 2011), während Außenminister Westerwelle Sanktionen fordert (ebd.). Peter Wittig, der deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen (VN), wird in der Folge von Westerwelle zum Aufgreifen der libyschen Krise im Sicherheitsrat7 aufgefordert (vgl. ebd.).
Am 22. Februar spricht Gaddafi selbst über das Fernsehen zum libyschen Volk und dementiert gleichzeitig Gerüchte, er sei bereits geflohen. Er bezeichnet die Demonstranten als Ungeziefer, bietet die „Option Tiananmen“ an und gibt irrationale Erklärungen für die Demonstrationen ab (vgl. Schmid/Nordhausen 2011: 94). In der Folge schließt er mit der Ankündigung „I will fight on to the last drop of my blood“ (Fahim/Kirkpatrick 2011) jeden Kompromiss aus. Am selben Tag schließen sich Justizminister Abdel Jalil und Innenminister Abdel Fateh Junes angesichts der brutalen Niederschlagung der Proteste den Aufständischen an. Am 23 Februar ist bereits der gesamte libysche Osten in der Hand der Rebellen. Das Ende der Herrschaft Gaddafis scheint zu diesem Zeitpunkt nah – amtierende Minister, Diplomaten und ganze Einheiten der Streitkräfte sind übergelaufen und auch im Westen des Landes, im gaddafifreundlichen Tripolitanien, konnten die Aufständischen einige Städte erobern (vgl. Nordhausen/Schmid 2011: 96). Gaddafi zweifelt die Existenz von Demonstrationen derweil an, indem er meint, „there are ‘no demonstrations at all in the streets’ and that ‘all my people are with me, they love me’“ (Bowen 2011; Herv. i. O.).
Am 26. Februar verabschiedet der Sicherheitsrat die Resolution 1970, mit der er seiner Sorge angesichts der dramatischen Entwicklung Ausdruck verleiht und die Gewalt in Libyen verurteilt (siehe Punkt 2.3.2). Am 28. Februar entschließt sich die EU, ihre Bürger aus der Region zu evakuieren, und einigt sich auf erste Sanktionen – ein Waffenembargo und Einreiseverbot hoher libyscher Regimeanhänger (EU-Ratsbeschluss v. 28.02.2011). Thema ist zu dieser Zeit auch die Errichtung einer Flugverbotszone, wobei unklar ist, wer sie durchsetzen könnte. Die Bundesregierung präferiert weiterhin Sanktionen, die verhindern, „dass frisches Geld in die Hände von Herrn Gaddafi kommt“ (Ross et al. 2011).
Am 10. März ist Frankreich das erste Land, das den Nationalen Übergangsrat in Bengasi „als einzige Vertretung Libyens“ (Marquart/Pauli 2011) anerkennt. Zusätzlich bereiten Frankreich und Großbritannien einen Resolutionsentwurf für die Flugverbotszone vor. Neben der Zustimmung des Sicherheitsrats ist jedoch auch die der Arabischen Liga Voraussetzung für deren Durchsetzung. Zu diesem Zeitpunkt, an dem die Gewalt in Libyen zunimmt und die Einnahme Bengasis durch Gaddafis Einheiten droht, zeigt sich die USA einer Flugverbotszone gegenüber noch skeptisch (vgl. Birnbaum et al. 2011). Am 12. März richtet sich die Arabische Liga (AL) mit einer präzedenzlosen Anfrage zur Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen an die UN, womit ein Einsatz für viele wahrscheinlicher wird (vgl. Reißmann 2011).
Der libysche Aufstand droht aufgrund der mangelnden strukturellen und strategischen Organisation im Chaos zu versinken, weshalb es zu Versorgungsengpässen und zum Stocken der Eroberungen kommt. Unterstützt von Kampfjets und schwerem Geschütz gelingt es Gaddafis Truppen die Aufständischen zurückzudrängen und einige Städte zurückzuerobern – bis die Truppen des Regimes am 17. März 2011 vor Bengasi stehen. Gaddafi hält zu diesem Zeitpunkt erneut eine Rede, in der er ankündigt jede Straße, jedes einzelne Haus und jeden Raum in Bengasi zu durchsuchen und jeden, der mit einer Waffe angetroffen wird, als Feind der Regierung zu betrachten (vgl. AI 2011b: 16). Dies wird international und auch in Bengasi als Ankündigung eines Massakers interpretiert, dessen Glaubwürdigkeit durch vergangene Ereignisse, wie das Abu-Salim-Massaker oder die Niederschlagung der Proteste im Jahre 2006, unterstrichen wird (vgl. Schmid/Nordhausen 2011: 96). Eine hundertprozentige Sicherheit, dass es zu einem Massaker gekommen wäre, konnte nicht gegeben sein. Durch die kompromisslose Haltung des Gaddafi-Regimes gilt ein friedlicher Widerstand jedoch als aussichtslos und die Aufstände entwickeln sich für beide Seiten zu einem Kampf auf Leben und Tod (vgl. Lynch 2012: 56).
An diesem Punkt wird eine schnelle Entscheidung der internationalen Gemeinschaft notwendig, wie mit der Gefahr eines Massakers umzugehen sei. Die US-Regierung ändert kurz vor der Sicherheitsrats-Sitzung am 17. März ihre skeptische Haltung und stimmt dem Resolutionsentwurf von Frankreich, Libanon und Großbritannien zu, womit am selben Tag die Resolution 1973 (VN 2011a, s.a. Kap. 2.3.2) verabschiedet wird. Durch die Resolution ermächtigt der Sicherheitsrat den Einsatz „aller notwendigen Maßnahmen“ (ebd.), die zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung erforderlich sind. Frankreich fordert am entschiedensten eine Intervention, allen voran der Publizist und Philosoph Bernhard-Henri Lévy, der von seinen Gegnern als „Resolutionsführer“ (Schmid/Nordhausen 2011: 104) bezeichnet wird, da er Sarkozy zum Einsatz für eine UN-Resolution gedrängt habe (vgl. ebd.). Sarkozy wird zudem unterstellt, vor allem aus innenpolitischer Motivation heraus zu handeln (vgl. ebd.: 97). Deutschland zählt zu den fünf Nationen, die sich im Sicherheitsrat enthalten haben, wobei der Bundesregierung ebenfalls die Fokussierung auf innenpolitische Motive unterstellt wird, da zu diesem Zeitpunkt Landtagswahlen in Baden-Württemberg anstehen (ebd). Im Anschluss an diese Entscheidung der Bundesregierung entwickelt sich eine heftige Debatte über ihre Angemessenheit und ihre Folgen, die unter Punkt 2.4.3 ausgeführt wird. Zwei Tage nach dem Beschluss beginnt eine „Koalition der Willigen“ (Busse 2011), angeführt von Frankreich, Großbritannien und den USA, mit der Durchsetzung der Flugverbotszone und Luftangriffen auf die Truppen Gaddafis, wobei der Einsatz mit Zustimmung der Arabischen Liga erfolgt. Die USA und Großbritannien möchten die Führung schnellstmöglich an die NATO übertragen, wobei sie zunächst noch Frankreich umstimmen müssen, welches wegen des schlechten Rufes der NATO in arabischen Ländern besorgt ist. Daher wird die Einrichtung einer Libyen-Kontaktgruppe favorisiert und Ende März auch realisiert. Das wichtigste Ziel der in London von 40 Ländern und regionalen Organisationen gegründeten Gruppe soll die Koordinierung des weiteren Vorgehen ins Libyen sein (vgl. Stahl 2011: 19f.).
Einigkeit besteht in der Gruppe von Anfang an darüber, dass der Wandel und damit die Opposition unterstützt werden muss. Auf der Konferenz fordert auch Westerwelle ausdrücklich den Abtritt Gaddafis und stellt klar, dass die deutsche Enthaltung im Sicherheitsrat nicht mit Neutralität gleichzusetzen sei und verknüpft dies mit dem Hinweis, dass sich Deutschland an humanitärer Hilfe und dem Wiederaufbau beteiligen werde (vgl. Leithäuser 2011, Greiner et al. 2011).
Am 31. März geht das Kommando des Libyen-Einsatzes an die NATO über. Ausdrückliches Ziel der Operation „Unified Protector“ sei nach Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen der Schutz der libyschen Zivilbevölkerung (vgl. Kock/König 2011). Für die vom deutschen Außenminister angebotene humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau besteht zu diesem Zeitpunkt keine Nachfrage (vgl. Stahl 2011: 20). Derweil kritisiert der französische Außenminister Alain Juppé das zögerliche Verhalten der NATO (vgl. Reimann 2011). Am 13. April fordert die Kontaktgruppe einstimmig den Rücktritt Gaddafis (vgl. Kock/König 2011).
Der entscheidende Faktor für den Sieg der libyschen Opposition gegen die Truppen Gaddafis war in der Folge, so Lacher (2011), die Unterstützung durch die NATO-Intervention auf der Grundlage der Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrats. Durch das Zurückdrängen der Einheiten des Regimes mit der Unterstützung der NATO und umstrittene (illegale) Waffenlieferungen von an der Intervention beteiligten Nationen, gelang es der Opposition zunächst, die verlorenen Städte zurückzuerobern und nach einer mehrmonatigen Pattsituation schließlich am 21. August die Gewalt über Tripolis zu erlangen (vgl. Lacher 2011, CSS 2011: 3).
Westerwelle sieht dies als Anlass, den Erfolg zu einem großen Teil der deutschen Sanktionspolitik zuzuschreiben:
„Jeder hat auf seine Art und Weise einen Beitrag geleistet, dass die Zeit des Regimes von Oberst Gadhafi vorbei ist. Wir Deutsche mit unseren politischen Prioritäten, mit unserer gezielten Sanktionspolitik. Das wird auch international sehr geschätzt.“ (Lau/Ulrich 2011)
Er gibt zwar zu, dass der Hauptantrieb der Freiheitswille des libyschen Volkes gewesen sei. Unerwähnt bleiben dabei jedoch über 20.000 Luftwaffeneinsätze der NATO und Waffen- und Beratungsleistungen Frankreichs und Großbritanniens, die maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatten (vgl. Lau 2011, Stahl 2011: 21f.).
2.3 Völkerrechtlicher Hintergrund des NATO-Einsatzes
2.3.1 Das Prinzip der Schutzverantwortung
In diesem Abschnitt soll es angesichts des Verhältnisses zwischen internationalen Beziehungen und dem Völkerrecht um die Erläuterung der Resolution und ihrer juristischen Implikationen gehen sowie um Details der entscheidenden Abstimmung.
Das Prinzip der Schutzverantwortung (Responsibility to Protect/R2P), auf dessen Grundlage die Resolution 1973 verabschiedet wurde, basiert auf einer Erklärung aller Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2005, in der sie sich normativ zu ihrer Pflicht zum Schutz der Zivilbevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschheit bekennen (vgl. VN 2005 Ziff. 138-140). Dabei lässt sie sich als Reaktion auf den Völkermord bzw. ethnische Säuberungen in Ruanda und während der Balkankriege in den 90er Jahren einordnen. Um derartige Verbrechen zu vermeiden, seien die Vereinten Nationen daher in Kooperation mit internationalen Organisationen dazu verpflichtet,
„rechtzeitig und entschieden, kollektive Maßnahmen über den Sicherheitsrat im Einklang mit der Charta, namentlich Kapitel VII, zu ergreifen, falls friedliche Mittel sich als unzureichend erweisen und die nationalen Behörden offenkundig dabei versagen, ihre Bevölkerung […] zu schützen“ (VN 2005 Ziff. 139).
Damit gilt die R2P als eine Weiterentwicklung des Konzepts humanitäre Intervention, das von Varwick als „Anwendung von Waffengewalt zum Schutze der Bevölkerung eines Staates vor schweren Menschenrechtsverletzungen“ (2009: 4) definiert wird. Deutlich wird damit eine Entwicklung vom Interventionsverbot (Art. 2, Abs. 3, 4, 7 der UN-Charta) zum Interventionsgebot (VN 2005 Ziff. 138-140, vgl. ICISS 2001: 29-37).
Als zwingende Voraussetzung für einen Einsatz auf der Grundlage der R2P gilt, dass von dem betreffenden Land eine akute Gefahr für die internationale Sicherheit ausgeht oder massive Menschenrechtsverletzungen verübt werden (vgl. Varwick 2009: 9, ICISS 2001: 31-34) Mit der Ausweitung der Schutzverantwortung der internationalen Staatengemeinschaft geht gleichzeitig die zunehmende Einschränkung staatlicher Souveränität in humanitären Fragen und der innerstaatlichen Gewaltanwendung einher (vgl. Varwick 2009: 5f., CSS 2011: 1, ICISS 2001: 7f.). Die lange umstrittene Frage, ob die staatliche Souveränität oder die internationale Schutzverantwortung Priorität habe, wurde im Rahmen des Somalia-Einsatzes der VN (1992-93) geklärt. Seitdem erkennt der Weltsicherheitsrat schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen als rechtmäßigen Grund für Interventionen zu humanitären Schutzzwecken an (vgl. Varwick 2009: 5f.). Die Durchsetzung von Menschenrechten mit militärischen Mitteln soll jedoch „Ausnahmeinstrument“ (Varwick 2009: 2, vgl. ICISS 2001: 31f.) bleiben, wobei in der operativen Umsetzung häufig die Gefahren der Selektivität und eines potentiellen (Macht-) Missbrauchs hervortreten (vgl. Varwick 2009: 13).
2.3.2 UN-Resolution 1973
Bereits am 26. Februar 2011 verabschiedete der Sicherheitsrat die Resolution 1970 (VN 2011b: 1-7), mit der die Mitgliedsländer ihrer Sorge über die Gewalt in Libyen Ausdruck verliehen und sie verurteilten. Durch die Verurteilung der Gewalt und die Aufforderung der libyschen Verantwortlichen, die Sicherheit ihrer Bürger zu sichern, wurde bereits durch diese Resolution der Bezug zur Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft hergestellt (vgl. ebd.:1f.) Die Resolution 1970 (ebd.: 2-7) umfasste folgende Maßnahmen: 1. Übersendung der Verantwortlichen zum Internationalen Strafgerichtshof (ICC), 2. Waffenembargo (Verbot der direkten oder indirekten Unterstützung mit Waffen, Waffenteilen oder Munition), 3. Einfrieren von Bankkonten Gaddafis, seiner Familienmitglieder und hoher libyscher Funktionäre, 4. Humanitäre Hilfe. In der Folge ebnete sie den Weg zur Resolution 1973, über die am 17. März abgestimmt wurde. Die mit zehn Stimmen und fünf Enthaltungen angenommen Resolution umfasst folgende zentrale Maßnahmen (vgl. folgend VN 2011a):
Verurteilung der systematischen Verletzung von Menschenrechte, wie willkürlicher Inhaftierung und Massenhinrichtungen
Forderung nach sofortiger Waffenruhe
Verurteilung der Gewalt und Einschüchterung der libyschen Behörden gegen Journalisten.
Ermächtigung der Mitgliedsstaaten „alle notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung zu schützen
Ermächtigung zur Durchsetzung der Ziele durch Waffengewalt und zur Durchsetzung einer Flugverbotszone
Der Einsatz von Bodentruppen auf libyschem Gebiet bleibt jedoch weiterhin ausgeschlossen. Neben den USA, Großbritannien und Frankreich stimmten auch Kolumbien, Nigeria, Gabun, Südafrika, Bosnien-Herzegowina, Portugal und der Libanon für die Resolution 1973, während sich die sogenannten BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) und Deutschland enthielten, wobei die Argumente für die Enthaltung sehr unterschiedlich ausfielen (vgl. VN 2011a).
Erstaunt sind Experten im Rahmen der aufkommenden Debatte zum einen über die ungewöhnliche Breite des UNO-Mandats, und zweitens darüber, wie schnell sich die Koalition der Willigen auf einen militärischen Einsatz einigen konnte (vgl. CSS 2011: 1). Ein wichtiges Thema im Rahmen der Libyen-Debatte ist die Rechtmäßigkeit der Resolution 1973, wobei Kritiker ihre Vagheit und die Erlaubnis, „alle notwendigen Maßnahmen“ zum Schutz der libyschen Bevölkerung zu ergreifen, hinterfragen. Angenommen wird, dass viele westliche Staaten ihrem heimlichen Wunsch nach der Absetzung Gaddafis folgten, der jedoch nicht legitimiert sei (vgl. Schmid/Nordhausen 2011: 97, Merkel 2011a). Völkerrechtswissenschaftler vom Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht kommen jedoch nach eingehender Analyse der Resolution 1973 zu dem Ergebnis: „Die Resolution 1973 (2011) ist rechtmäßig, auch wenn zuzugeben ist, dass sich der Sicherheitsrat mit der Regelung in Ziffer 4 einen ‚Bärendienst‘ erwiesen hat.“ (Brunner/Frau 2011; Herv. i. O.) Mit mit dem Begriff „Bärendienst“ unter Ziffer 4 wird darauf Bezug genommen, dass sich der Sicherheitsrat einen recht weiten Handlungsspielraum zum Schutz der libyschen Bevölkerung eingeräumt habe. Es seien einzig „Besatzungstruppen“ (ebd.) verboten, dagegen sei bspw. der „Einsatz von Spezialtruppen zur Markierung von Bodenzielen […] ohne Weiteres von der Resolution gedeckt“ (ebd.).
In den UN-Debatten, die zu der Resolution 1973 führen, ist es den beteiligten Staaten besonders wichtig zu vermeiden, dass die Intervention wie ein Eingriff des Westens in gesellschaftliche Prozesse im arabischen Raum wirkt. Dahinter steht die Sorge, Gaddafi könnte eben diesen Vorwurf des westlichen Kreuzzugs für seine Propaganda nutzen (vgl. Schiltz 2011), wobei er dies in Ansätzen seit Beginn der Diskussionen um eine Intervention tut. Deshalb setzt man einer Intervention unbedingt die regionale Unterstützung durch die Nachbarn Libyens8 voraus.
Am 12. März richtete sich die Arabische Liga mit der Bitte um eine „no-fly zone on Libyan military aviation, and to establish safe areas in places exposed to shelling as a precautionary measure that allows the protection of the Libyan people and foreign nationals residing in the Libyan Arab Jama-hiriya” (VN 2011a) an die Vereinten Nationen. Eine derartige Anfrage ist historisch einzigartig und durch ihre legitimatorische Kraft ein wichtiges Argument für eine westliche Intervention (vgl. Müller 2011: 4). Angesichts der Zustimmung der AL entschieden sich China und Russland, ihr häufig gegen die Interessen des Westens eingesetztes Vetorecht bei der Abstammung im Sicherheitsrat nicht zu nutzen (vgl. ebd.: 5).
Offensichtlich war in dieser Zeit der Debatten über eine Intervention die deutliche Zurückhaltung der Afrikanischen Union, wobei dennoch der Ausdruck von tiefer Beunruhigung über die Gewalt in Libyen erfolgte. Sie präferierte jedoch eine friedliche, diplomatische Lösung und lehnte eine militärische Intervention ab (vgl. Dembinski/Mumford 2012: 3ff.). Von verschiedenen Beteiligten wurden weitere Alternativen vorgeschlagen, die aus verschiedenen Gründen nicht viel Anklang fanden. Vielversprechende Vorschläge waren bspw. der Friedensplan der Arabischen Liga in Kooperation mit dem venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez (vgl. Weiß/Das Gulpa 2011), den die libysche Regierung sogar akzeptiert habe, oder der Friedensplan der türkischen Regierung, auf den beide Seiten des libyschen Bürgerkriegs mit „positiven Signalen“ (Güsten 2011, Galaktionow/König 2011) reagierten. In der türkischen Zeitung Hürriyet war in der Folge zu lesen: „Frankreich bombardierte eine Lösung“ (Demir 2011). Frankreich steht hier im Vordergrund, da in vielen Medien die Ansicht vorherrscht, Paris habe seine westlichen Verbündeten zum Eingreifen gedrängt (vgl. Reinbold 2013, Sauerbrey 2011). Die Ignorierung mehr oder weniger vielversprechender nicht-militärischer Alternativen durch den Westen führt in der Folge immer wieder zu der Frage, welchen Interessen und Zielen die Intervention dient (vgl. Naumann 2011, CSS 2011: 2, Henken 2011).
Die Bereitschaft zu intervenieren war bei einigen westlichen Ländern sehr früh gegeben, wobei aber die Erlangung von international anerkannter politischer und rechtlicher Legitimität abgewartet wurde. Im politischen Sinne bestand im Westen Einstimmigkeit über die Notwendigkeit des Eingriffs und regionaler Unterstützung. Rechtlich war eine Vorschrift nötig, die die Intervention legalisierte, wobei dies in diesem Falle die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen abgesegnete Resolution 1973 auf der Grundlage von Kapitel VII der VN-Satzung war.
2.4 Deutsche Außenpolitik
„Deutschland ist dem Dienst für den Frieden in der Welt verpflichtet; […]. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie; wir schützen unsere Bürger, ihr Leben und ihre Unversehrtheit mit den zu Gebote stehenden rechtsstaatlichen Mitteln. Deutschland steht in dieser Welt in festen Bündnissen und Partnerschaften; deutsche Sonderwege sind grundsätzlich keine Alternative deutscher Außenpolitik. Es ist Aufgabe jeder politischen Führung, diese drei Prinzipien in der konkreten geschichtlichen Wirklichkeit immer wieder neu zur Geltung zu bringen. Das gehört mit zu den schwersten Aufgaben.“ (Angela Merkel, Regierungserklärung zur Situation in Afghanistan am 08.09.2009, zit. n. Hesse 2009: 3)
Nach der bedingungslosen Kapitulation im Jahr 1945 musste die deutsche Außenpolitik bei null beginnen. In der Folgezeit von 1949 bis 1989 sah sich das geteilte Deutschland vor der Herausforderung sich den wechselhaften Bedingungen zwischen den beiden Parteien des Kalten Krieges, den Westmächten unter Führung der USA und der Sowjetunion, anzupassen (vgl. Maull 2006: 2f.). Dieser Zeitraum lässt sich im Falle der BRD in drei Phasen unterteilen, in denen jeweils wichtige Weichen für die Zukunft der deutschen Außenpolitik gestellt wurden: 1) Adenauer-Ära: Westbindung, Verständigung mit Frankreich, Wiederbewaffnung, erste Schritte zur Wiedererlangung staatlicher Souveränität. 2) Brandt-Ära: Aussöhnung, Entspannung, Ost-Annäherung. 3) Kohl-Ära: Vertiefung der europäischen Integration und Deutsche Einheit (vgl. Hesse 2009: 3, Fröhlich 2001: 109-285).