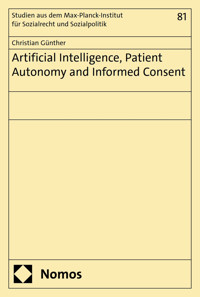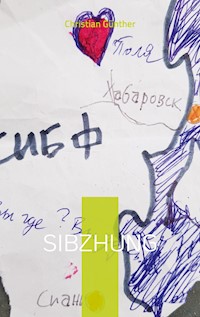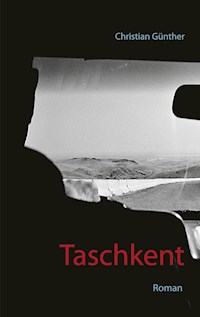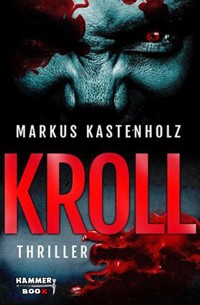Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Zombie Zone Germany
- Sprache: Deutsch
Unsere Städte wurden Höllen. Sie kamen über Nacht. Ihr Hunger war unstillbar. Sie fielen wie Heuschreckenschwärme über die Lebenden her. Zerrissen sie, fraßen, machten aus ihnen etwas Entsetzliches. In den Straßen herrscht verwestes Fleisch. Zwischen zerschossenen Häusern und Bombenkratern gibt es kaum noch sichere Verstecke. In Deutschland ist der Tod zu einer seltenen Gnade geworden. Hohe Stahlbetonwände sichern die Grenzen. Jagdflieger und Kampfhubschrauber dröhnen darüber. Es wird auf alles geschossen, was sich (noch) bewegt. Deutschland wurde isoliert - steht unter Quarantäne. Die wenigen Überlebenden haben sich zu Gruppen zusammengeschlossen, oder agieren auf eigene, verzweifelte Faust. Gefangen unter Feinden. Im eigenen Land. Doch ist der Mensch noch des Menschen Freund, wenn die Nahrung knapp wird und ein Pfad aus kaltem Blut in eine Zukunft ohne Hoffnung führt? Die Auftakt-Anthologie zu Deutschlands größter Zombie-Reihe mit 21 Kurzgeschichten von Alin Rys, Britta Ahrens, Carolin Gmyrek, Christian Günther, Daniel Huster, Eberhart Leucht, Fabian Dombrowski, Felix Kreutzmann, Heike Schrapper, Jan Christoph Prüfer, Joshua Lorenz, Kerstin Zegay, Lisbeth Duller, Chris Dante, Marina Heidrich, Markus Cremer, Nora Wanis, Sandra Longerich, Sebastian Braß, Tom Karg und Vincent Voss
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2015 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
Herausgeber der Reihe: Torsten Exter
Lektorat: Tamara Fehn und Jasmin Krüger Korrekturen: Heike Schrapper Umschlaggestaltung: Christian Günther
© lindrik - Fotolia.com
Alle Rechte vorbehalten
ISBN – 978-3-944729-732
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
Sie kommen
Torsten Exter
Es war ein ungemütlicher März, als wir uns trafen. Ein Jahr zuvor war er wärmer gewesen. Angenehm. Ich bin gerne zwischen Halle 2 und Halle 4 gewesen, habe die Sonne genossen, ein mitgebrachtes, zerdrücktes Käsebrötchen gegessen. Starken, guten Kaffee vom kleinen Stand mit dem dreirädrigen Wagen getrunken. Die Verkäufer dort waren immer nett gewesen. Selbst am Sonntag.
Auch in diesem kühlen März 2013 war ich Stammgast bei dem Kaffeewagen. Von Messebeginn bis zu ihrem Ende. Leipzig. Halle 2, meine Heimat. Lieb gewonnen mittlerweile. Unser Mutterschiff im Wirrwarr aus Menschen und Kostümen, seltsamen Gestalten und Männern, die von Bodyguards flankiert wurden.
Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den Mann getroffen habe. Habe ich ihn gesucht, so wie wir alle in Leipzig waren und wieder sein werden, um etwas zu suchen? Hatte er mich gefunden, zwischen Perry Rhodan und dem kleinen Kabuff, dem kurz darauf meine »Krieger« entwachsen waren?
Ich weiß es nicht mehr. Zu kalt war dieser März, zu klamm die Erinnerungen an ihn. Ich glaube, ich habe das Wort an ihn gerichtet. Oh, ich bin nicht gut in diesen Sachen. Eher ein Zuhörer als ein eleganter Redner, obwohl ich meine meisten Tage mit stundenlangem Reden verbringe.
Wir redeten und hörten uns zu. Draußen war es kalt, drinnen laut. Die Luft merkwürdig. Wenn ich heute an dieses Wochenende im März zurückdenke, glaube ich, dass wir damals bereits eine Vorahnung hatten. Der Mann und ich. Wir erinnerten uns an den anderen Mann, der einsam aus einem Krankenhaus kam und in eine einsame Stadt sah. 28 Tage zu spät, um das Grauen des Ausbruchs miterlebt zu haben. Und wir ahnten, dass auch uns 28 Tage bevorstanden. Doch noch waren wir zu naiv und unwissend, um zu erkennen, wann sie ihren tödlichen Countdown beginnen würden.
Wir standen da und sprachen. Saßen später und tranken Eierlikör aus kleinen Plastikbechern. Ich glaube, eine Buchbloggerin platzte an diesem Abend, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war es nur ein Traum.
Wie machen wir es genau?, fragten wir uns und planten. Was im kalten März 2013 einen Anfang genommen hatte, trat uns 2014 als etwas längst konkret Gewordenes entgegen. Ich denke, wir beide konnten es damals schon riechen. Diesen ranzigen Duft, der uns bald überall in Deutschland entgegenwehen würde. Stinkende Ausdünstungen. Körper, vom Regen aufgeweicht. Besudelte Städte. Straßen, mit einem klebrigen Belag aus geronnenem Blut und zertretenen Innereien. Magensäfte, die an Häuserwänden klebten. Rattenfeste auf Leichenbergen, Fliegenschwärme, die in Kinderwagen tanzten. Warme Verwesungsdämpfe.
Doch im März 2013 gestanden wir es uns noch nicht ein. Im März war es kalt und über das, was sich draußen anbahnte, bewahrte man Schweigen.
Der Mann hatte schon seit Langem versucht etwas zu hinterlassen und dieses auch geschafft. Gedanken zu Geschichten. Raum für Geschichten. Irgendwo in der Vergangenheit hatten sich unsere Wege bereits gekreuzt. Unmerklich. Ein kurzes Registrieren des anderen. Doch Ende 2012 / Anfang 2013 entstand etwas anderes. Neues. Die Elben nannten es Sonnenaufgang und wir auch. Amrûn.
Als im kalten März 2013 die ersten Worte von Angesicht zu Angesicht ausgetauscht wurden, kurz bevor wir mit Wolfgang Hohlbein anstießen und Sekt schlürften, hatten wir noch ein vergleichsweise gutes Gefühl. Wir dachten über unsere Idee nach und sie erschien mir wie ein Luftballon, den der Wind in die Höhe trieb. In den Sonnenaufgang, hinter dem das Dunkel des Kommenden ein noch kaum sichtbarer Albtraum war.
Doch im März 2014 wussten wir mehr, als uns lieb war. Wir hatten zu fragen begonnen und erste Antworten erhalten. Es gab Pläne, Skizzen. Wir suchten Hoffnung im kalten Apparat des Militärischen und ich bin mir sicher, dass nicht nur ich auch an Gott gedacht habe. Was wir fanden, was sich vor unseren Augen offenbarte, war die Gewalt. Sie schälte sich aus dem Leib des Landes, gebar sich durch die Kruste der Landmasse. Natürlich hatte es sie schon zuvor gegeben. Überall. Aber hier bei uns war sie kleiner gewesen. Leiser. Oft etwas Fremdes und darüber waren wir froh. Als wir sie jetzt sahen, im nahenden Morgen, war sie gigantisch und allgegenwärtig. Sie war tief und dunkel. Schlug um sich. War in uns gedrungen, in den ersten Atemzug am Morgen und den Letzten vor den grauen Träumen der Nacht.
Als unsere Rufe im Juni 2014 beantwortet wurden, war es für mich ein Gefühl, als halte mir jemand eine geladene Waffe in den Mund. Diese Erwartung, dass es doch endlich passieren würde. Der befreiende Knall, der Geschmack von Rauch auf der Zunge. Erlösung aus langem Warten.
Was ich fand, war die Bestätigung meiner schlimmsten Befürchtungen. Die Stacheldrähte waren wahr geworden. Die Schießanlagen und Kampfhubschrauber. Angelegte Gewehre. Mütter, die ihre Kinder in die Schusslinie zerrten, weil dahinter, irgendwo dahinter, Hoffnung auf Leben lag. Mauern. Minenfelder. Granatenkrater. Die Städte brannten und starben. Wurden Höllen.
Tartaros. Das Einzige, was er zu wissen scheint: Mensch wird von Mensch umgeben.
B3ZwW11.
Die faule Schlampe in ihrer zerrissenen Reizwäsche. Der Mann im Hundekäfig und seine Frau davor. Francis, die zu viel gesehen hatte und nicht mehr sprach. Das unleserliche Manuskript, toten Händen entglitten. Blut, das in ein Dorf führte und die Masse Witterung aufnehmen ließ. Begrabene Körper unter einem Baukran. Alpha entfernte sich vom Dom in südlicher Richtung. Ein Messer am Kopf des kleinen Mädchens. Menschenjagd hinter zerstörten Schaufenstern. Dornen, an denen der Darm des Straßenfegers hing. Affenpisse. Blutige Flora. Eine angekettete Mutter und ihre Kinder. Röcheln im Wald und aus der Tiefe des Glaubens. Der Durchgeknallte. Die Totgetrampelten. Axtnächte. Schlachthäuser, Menschenfleisch, Finger, die im Erdreich scharrten. Die Brücke und die Marodeure. Wimmern. Krieg in den Vororten. Natürliche Auslese. In den Hörsälen fressen sie.
Die Zone.
Deutschland.
2020 beginnt es.
Es ist nah. So schrecklich nah.
Zwei weitere Männer seien an dieser Stelle erwähnt, da ihnen mein Dank gebührt. Der eine aus der Nähe von Hamburg, der andere im beschaulichen Buxtehude.
Über den Mann bei Hamburg wird viel geredet. Geschichten kursieren. Er soll bereits lange vor uns gesehen haben, wie sie fressen und Neue schaffen, die fressen werden. Er hat eine analytische Kälte, die mir oft widerlich vorkommt. Aber sie hat es ihm erlaubt, jenes zu sehen und zu schildern, was sich vom Menschen nährt und ihn zu etwas anderem macht. Auch wenn unser Weg in die Abgründe nicht einfach war, hat er doch die Wurzel entstehen lassen, die die widerliche Saat erst gebären konnte.
Vielen Dank, Vincent Voss.
Über den Mann aus Buxtehude heißt es, dass er aus Rost lesen könne und seine Visionen keine Farben hätten, die dem gesunden Menschen gefallen würden. Er weiß, was Punk bedeutet und vielleicht ist dies ein Grund, warum sich unsere Wege irgendwann zwangsläufig kreuzen mussten. Auch er hatte es mit mir nicht immer einfach. (»Dem Herrn Exter ist die Schrift nicht dreckig genug.«)
Er hat Großartiges geleistet.
Danke, Christian Günther.
Jasmin und Tara, viel Arbeit und Mühe. Manchmal erschienen sie mir, wie die Grand Dames im Hintergrund. An anderen Tagen, wie ein fleißiges Uhrwerk, auf das stets Verlass war.
Ich danke euch.
Für uns ist die Zeit abgelaufen. Zwei Jahre nach den ersten Gedanken. Achtundzwanzig Tage später. Regenwasser füllt die tiefen Spuren der Panzer und die Krater ihrer Geschosse. Ein Teddybär liegt vor einer ausgebrannten Tankstelle. Wir gehen weiter, gehen tiefer. Der Mann steht am Horizont. Sieht die Dinge, die uns entgegenkriechen. Ich sehe sie auch. Fürchte sie, erfreue mich an ihnen. Dieses Buch ist erst der Anfang. Ein Luftballon aus rissiger Haut. Fettige Haarsträhnen und ungleiche, zuckende Augen. Wir haben ihn fliegen lassen. Zu dir. Eine Warnung, ein Versprechen.
Es wird noch viel schlimmer.
Torsten Exter
Blutspuren
Christian Günther
2021
Beckdorf, Niedersachsen
David hockte mit seinem Hund auf dem Damm und wartete, dass die Jäger zurückkehrten. Der Herbst färbte den Himmel grau und übersäte den Boden mit Laub. In der Ferne konnte David bereits die ersten Trecker erkennen, die sich auf der schmalen Asphaltstraße zwischen den Feldern näherten. Der alte Dammann mit seinem Claas vorneweg, auf dem Hänger hockten seine Söhne und suchten die Umgebung ab. Es kam Leben in David. Er sprang auf, griff sich Gewehr und Fernglas und stellte sich hinter die Absperrung aus gestapelten Waschbetonplatten. Die hatten einmal auf Meyers Hof als Terrasse gedient, doch nun bildeten sie eine stabile Wand, hinter der bequem zwei Menschen stehend Platz fanden. Auch Jonny, sein Mischlingshund, erhob sich mit wedelnder Rute, als David aus seiner Starre erwachte. David hielt sich das Fernglas vor die Augen und suchte die Felder ab, während die Trecker sich näherten. Sein Platz auf dem alten Bahndamm, der nördlich am Dorf entlangführte, bot ihm einen guten Blick auf die Wiesen, Äcker und kleinen Gehölze; ein leeres Niemandsland. Teile der Felder wurden noch bewirtschaftet, doch viele lagen brach und wurden langsam von Gestrüpp überwuchert. Rehe und Hasen fühlten sich auf den Flächen heimisch, unbehelligt von Jägern – außer, wenn der alte Dammann die Fleischvorräte des Dorfes auffüllen wollte.
Der beißende Geruch, der aus dem Graben am Fuße des Bahndamms aufstieg, kitzelte David in der Nase. Er musste niesen. Sie hatten alles, was sie an Pflanzenschutzmitteln, Dünger und sonstiger Chemie im Dorf finden konnten, in einem flachen Graben rund um die Schutzwälle verteilt, um so die Maden zu töten, die womöglich durch die Erde eindringen wollten. Ob das irgendeinen Nutzen hatte, wusste niemand, doch immerhin war das Dorf in der letzten Zeit von Infektionen verschont geblieben.
Die Traktoren bogen jetzt um die letzte Kurve, wo die Alleebäume schon abgeholzt worden waren. David konnte im ersten Anhänger einige tote Rehe erkennen. Die Dammann-Brüder hockten daneben, blickten weiter stoisch umher, beachteten ihn gar nicht.
David verließ jetzt seinen Posten und löste die Flaschenzüge, um das breite Tor zu öffnen, das die Durchfahrt im Bahndamm sicherte. Knirschend schob sich die schwere Konstruktion aus Blechplatten, Holz und Garagentoren über den Asphalt der Straße, die durch die Schneise im Damm ins Dorf führte. Früher hatte hier einmal eine Bahnbrücke die Straße gekreuzt, doch die war schon demontiert gewesen, als David geboren wurde.
Jenseits der Felder war die nächste Ortschaft fünf Kilometer entfernt – Wiegersen war vor einigen Monaten schon gefallen, kurz bevor sie hier den Wall verstärkt hatten. Eine streunende Horde hatte das Dorf nachts heimgesucht. Sie waren in Häuser und Scheunen eingedrungen und hatten die Bewohner gnadenlos angegriffen. Die meisten waren ihnen zum Opfer gefallen und fanden sich jetzt wahrscheinlich in den Reihen der Untoten wieder, während nur wenige sich in den Wald hatten flüchten können. Diese Überlebenden waren später hierher nach Beckdorf gekommen, doch Dammann hatte sie abgewiesen, so wie er es mit allen Neuankömmlingen tat, um die Gefahr zu minimieren, dass sie Maden einschleppten. Die Zombies waren derweil weitergezogen, in Richtung Revenahe, nach Harsefeld wahrscheinlich. Verschwunden in den Birkenwäldern der Moore.
Jedenfalls hatten sie Beckdorf in Ruhe gelassen.
Die Jäger durchquerten das Tor und David schloss es hinter ihnen wieder. Der alte Dammann winkte ihm kurz dankend zu, sonst schenkte ihm niemand Beachtung.
Jonny stand die ganze Zeit schwanzwedelnd neben David und hoffte auf ein bisschen Aufmerksamkeit. Genau wie ich, dachte David, den es nervte, dass die Leute im Dorf kaum noch sprachen.
Sicher, der Schock saß tief. Am Anfang, als David die ersten Berichte der Untoten im Fernsehen mit großer Spannung verfolgt hatte, war er sogar heimlich davon begeistert gewesen. Wie in den Videospielen! Er hatte sich ausgemalt, wie er sich ausrüsten würde, überlegt, welche Waffen er sich besorgen könnte. Als dann wirklich die ersten Zombies in der Gegend auftauchten, war das gar nicht mehr so spannend gewesen. Zuerst hatten Polizei und Bundeswehr noch Einsätze gegen die Untoten geführt, doch irgendwann waren sie einfach fortgeblieben. Und die freiwillige Feuerwehr konnte nicht viel ausrichten. Als der erste Feuerwehrmann von einem gebissen wurde, fing man panisch an, das Dorf zu befestigen. Weitere fielen den Zombies zum Opfer und kehrten dann auf deren Seite zurück.
Als die Lage sich irgendwann beruhigt hatte, die Horden der Untoten weitergezogen waren, standen die meisten Häuser leer. Der alte Dammann hatte das Kommando übernommen, harte Regeln erlassen und die Leichen verbrannt.
Seitdem war Ruhe eingekehrt.
David hockte sich neben Jonny und kraulte ihn hinter den Ohren. Der revanchierte sich, schleckte seine Hand. »Das gefällt dir, was?« David hob einen Stock auf und warf ihn den Damm entlang. »Los, hol ihn!«, befahl er Jonny, doch der war längst unterwegs, schnappte sich den Stock und schleppte ihn zurück.
David warf ihn ein weiteres Mal und Jonny rannte los. Der Junge war gern hier oben Wache halten. Alle anderen fanden es langweilig, die ganze Zeit auf die Felder zu starren, deshalb war das hier sein fester Platz geworden. Ganz selten hatte er mal einen Untoten gesehen, der durch die Felder gestrichen war, und Alarm geschlagen. Dammann und seine Leute waren dann hinterher und hatten die Wandelnden erledigt, die sich dem Ort näherten. Manche waren auch einfach weitergezogen, hirnlos, immer geradeaus. So verwest, dass sie kaum noch vorwärts kamen, aber irgendein innerer Antrieb hielt sie in Bewegung. Sie alle wimmelten von Maden.
»Jonny?« David hatte wieder den Stock geworfen und Jonny war ihm in ein Gebüsch am Hang des Dammes gefolgt.
»Jonny? Komm her!« Wie als Antwort erklang ein Bellen, dann raste ein aufgeschreckter Hase aus dem Gebüsch, Jonny hinterher. David rief wieder nach ihm, doch Jonny beachtete ihn nicht, sondern jagte dem Tier nach. Aufs Feld, wo der Hase Haken schlug, um ihn abzuhängen. David wartete ab, ob der Hund seine Jagd irgendwann aufgeben würde, doch Jonny legte eine erstaunliche Ausdauer an den Tag. Verflucht. David griff sich das Gewehr, das er zum Spielen beiseite gestellt hatte, rutschte den Hang hinab und rannte aufs Feld. Der Hase war inzwischen über einen Graben hinweggesetzt, Jonny hatte den Sprung verpatzt, war im Wasser gelandet. Der Vorsprung des Langohrs wuchs weiter an, und als er schließlich die Straße überquerte, gab Jonny auf. David war hoffnungslos weit abgeschlagen, wurde aber nicht müde, seinen Hund zu rufen. Doch der blieb jetzt auf der Straße stehen und schnüffelte an der Fahrbahn.
Keuchend erreichte David ihn, und Jonny machte auch keine Anstalten weiterzulaufen. Stattdessen stand er mit eingekniffener Rute da und beobachtete etwas zwischen den Bäumen, die die Straße begrenzten. David stockte der Atem – ein Untoter! Er hockte an einem Gebüsch, halb von einem Baum verborgen. Rührte sich nicht, stieß nur schwache Geräusche aus, die wie der rasselnde Atem eines Geistes klangen. Jonny knurrte. David griff ihn am Halsband und zerrte ihn weg. Der Hund stemmte sich zuerst dagegen, fügte sich dann aber und folgte David. Der ging rückwärts, ließ den Untoten nicht aus den Augen. Jonny bellte wieder, zog jetzt in die andere Richtung. David wandte sich um und wäre fast über einen weiteren Körper gestolpert, der gerade auf die Straße kroch und mit dem Gesicht den Boden untersuchte. Blutflecken! Die Jäger waren schlampig gewesen, sie hatten Blut von ihren Wagen tropfen lassen. David zog Jonny zur Seite, zwischen den Bäumen hindurch. Der Untote blieb bei seiner Blutspur und leckte gierig am Asphalt mit dem Stummel einer nicht mehr vorhandenen Zunge. Maden fielen ihm aus Rachen und einer leeren Augenhöhle. Er trug einen dunklen Anzug, war jedoch komplett mit Schlamm und Erde verkrustet. Sein Kopf wirkte klein, weil ein Teil bereits fehlte, Haare hatte er nur noch wenige Büschel. Stattdessen wimmelten auch hier weiße Maden über seinen Schädel, gruben in Haut und Fleisch herum. So nah hatte David noch keinen der Untoten gesehen, er konnte sogar den entsetzlichen Gestank riechen, den der verwesende Körper von sich gab. Auch Jonny schien verwirrt, er winselte jetzt und zog David fort von der Straße.
Als sie sich wieder dem Bahndamm näherten, sah David zwei Männer mit Gewehren dort oben stehen. Einer hielt dazu noch ein Fernglas in der Hand. Davids Fernglas, Opas Fernglas. Es war der alte Dammann.
»Bleib wo du bist!« Das war die Stimme von seinem Sohn, der neben ihm stand.
»Was ist los?« David beschattete seine Augen mit der Hand, um die beiden Männer besser zu erkennen, doch die Sonne blendete plötzlich stark – endlich einmal waren die Wolken aufgerissen.
»Wir haben dein Geschrei gehört – als wolltest du die ganze Welt heranlocken.«
»Der Hund hat einen Hasen aufgestöbert. Ich musste ihn wieder einfangen.«
»Du hättest den Köter laufen lassen müssen. Kennst doch die Regeln.«
»Und jetzt?«
Eine kurze Pause, dann ergriff der Alte das Wort. »Wir haben auch gesehen, dass ihr an der Straße wart. Ihr habt Untote getroffen. Haben sie dich angegriffen?«
»Nein, haben sie nicht. Von denen ist kaum noch was übrig. Ihr könnt sie ja kaltmachen, ich führe euch hin.«
Schweigen.
»Außerdem habt ihr sie erst angelockt.«
»Was meinst du?«
»Da ist Blut auf der Straße. Von euren Wagen. Das hat sie hergeführt.«
Der Alte warf seinem Sohn einen verärgerten Blick zu. Doch dann wandte er sich wieder an David. Die Wolken kehrten zurück, aus dem schwarzen Scherenschnitt wurde ein bösartiges Gesicht. David erkannte, dass er einen Fehler begangen hatte. Er hatte den Anführer beschuldigt. Hatte ihm gezeigt, dass er etwas wusste, was Dammann womöglich in seiner Position schwächen konnte, sollten es die übrigen Leute im Ort erfahren. Wenn jetzt ein Angriff folgen würde, wäre Dammann Schuld daran. Zumindest reimte sich David das zusammen. Wahrscheinlich war es vollkommener Unsinn, dass ein paar Blutspuren plötzlich Horden von Zombies anlocken würden. Doch Dammann schien das Gleiche zu denken wie er. Die Menschen waren wie ein Rudel Tiere geworden, und Dammann gebärdete sich als Leitwolf. Jeder, der seine Stellung bedrohte, wurde verstoßen.
»Verschwinde«, sagte der Alte, so leise, dass David zuerst dachte, er hätte ihn falsch verstanden. »Los, hau ab.«
Die wollten ihn wirklich aus dem Dorf ausschließen?
»Aber – das ist doch Wahnsinn! Ich habe nichts Falsches getan, nur den Hund geholt. Und der ist wichtig für uns! Er kann uns warnen.«
»Wie können wir sicher sein, dass die Untoten dich nicht infiziert haben? Es ist zu spät für dich.« Beide hoben jetzt ihre Gewehre, zielten auf ihn. Nein – der Sohn zielte auf Jonny.
»Gebt mir wenigstens etwas zu essen ab!«
»Ist sowieso zu wenig da!«
»Und was ist mit Opa? Ich muss mich doch um ihn kümmern.«
»Um den kümmern wir uns schon«, sagte der alte Dammann. Es klang wie eine Drohung.
Später hockte David zwischen Tannen und dachte an Opa. Die Sonne ging am Horizont allmählich unter. Er hatte sich einen provisorischen Schlafplatz gebaut, aus Ästen und einer alten Plane, die er unterwegs gefunden hatte. Er war nicht weit entfernt vom Dorf, von seinem Platz aus konnte er bis zum Bahndamm spähen. Jonny lag neben ihm, spendete Wärme. Dennoch – der Boden war hart und uneben, und David sorgte sich um seinen Opa. Außerdem spähte er immer wieder zur Straße hinüber, dorthin, wo Jonny die zwei halb zerfallenen Untoten aufgespürt hatte. Dort bewegte sich nichts. Laub raschelte, der Wind schien stärker zu werden. Aber es war nicht der Wind, und es war auch kein Laub, was die Geräusche verursachte. David lauschte, und auch Jonny hatte den Kopf gehoben, die Ohren gespitzt. Sicherheitshalber hielt David sein Halsband fest umklammert.
Das Rascheln wurde zu einem Schaben, dazu ein Krächzen, ein Murmeln. Schlurfende Schritte auf dem Asphalt. Im Matsch der Felder. David schluckte. Er sah sie gegen den glühenden Horizont. Wie ein Wald aus Menschen, der sich auf Beckdorf zu bewegte. Bestimmt mehr als hundert. Instinktiv wollte David aufspringen, um das Dorf zu warnen, aber das wäre sicher nicht nötig – dieser Ansturm war nicht zu übersehen. Was hatte sie nur hergelockt? David überlegte, loszurennen, über den Damm und heim zu Opa. Ob der es rechtzeitig in den Keller schaffte? Davids Puls raste, unwillkürlich krallte er sich in Jonnys Fell.
Schon hörte er erste Schüsse peitschen, Rufe wehten herüber. Rennende Schemen auf dem Damm. Mündungsfeuer. Die Zombies waren schon verdammt nah am Dorf – warum hatte niemand sie früher gesehen?
David sah die wandelnden Toten den Bahndamm erklimmen. Dunkle Schemen, die erstaunlich schnell waren. Die vorderen fielen, wurden von den Nachfolgenden überrannt. Es dauerte nicht lange, da überwanden die ersten den Wall. Die Schützen oben zogen sich zurück oder fielen. Die Schüsse wurden seltener.
Beckdorf war gefallen.
Es brannte die ganze Nacht. David wagte sich nicht aus seiner Deckung. Er hörte die unwirklichen Schreie, gelegentlich aufheulende Motoren, vereinzelte Schüsse. Irgendwann kehrte Ruhe ein. Der Himmel färbte sich schon wieder grau, als David genug Mut und Entschlossenheit gesammelt hatte, um sich auf den Weg zu machen. Jonny hatte neben ihm gelegen, mit eingeklemmtem Schwanz, zitternd. Doch als sich sein Herrchen rührte, stand er sofort an seiner Seite. Zögerlich überquerten sie das Feld, auf den Bahndamm zu. Fast wirkte alles unverändert. Die Toten waren, wenn jemand sie vom Damm hinuntergeschossen hatte, wieder aufgestanden und weitergegangen. Vorsichtig kletterten sie hoch zur alten Bahnstrecke, wichen dabei allen Maden aus, die sich am Boden wanden. David zerrte seinen Hund ein ums andere Mal von dem tödlichen Gewimmel am Boden fort, wenn der es neugierig beschnupperte.
Jenseits des Damms jedoch hatte sich alles verändert: Viele Häuser waren niedergebrannt, Scheiben zerschlagen. Tote Körper fanden sich auch hier nur wenige. Wie ein Schwarm Heuschrecken waren die Untoten über den Ort hergefallen, hatten getötet, was sie finden konnten und waren dann weitergezogen. Die neuen Toten waren mit ihnen gegangen oder würden ihnen bald folgen.
Dammanns Volvo war fort.
Gespenstische Stille hing zwischen den Häusern. David wollte nach seinem Opa sehen, doch er zögerte. Angst kroch lähmend durch seinen Körper. Ihm war elend zumute, als er durch das verwüstete Dorf ging, er war hungrig und müde. Jonny trottete neben ihm her, schnüffelte hier und da, doch er schien ebenso erschöpft wie sein Herrchen.
Als David sah, dass Opas Haus nicht ausgebrannt war, atmete er auf. Der ganze Straßenzug schien einigermaßen unbeschadet davongekommen zu sein. Er ging auf die Haustür zu, schob Barrikaden und Zaunteile beiseite. Die Befestigungen hatte er selbst gebaut, genau wie den Schutzraum im Keller.
Im Flur war es still. Nach dem Chaos draußen wirkte das ordentlich aufgeräumte Haus wie ein fremdartiger Ort. Die Kellertür stand offen – hatte Opa es nicht rechtzeitig nach unten geschafft? David entschied sich gegen den Keller und ging ins Wohnzimmer. Die Terrassentür stand offen. Dort im Garten saß sein Opa. Einen schrecklichen Moment lang war David überzeugt, dass er tot war, doch dann drehte Opa sich zu ihm um.
»Junge, wo bist du gewesen?«
David rannte zu ihm. Jonny sprang dem alten Mann an den Beinen hoch. Sie umarmten sich. Opa weinte.
***
8 Monate später
Er vermisste das Handballspielen. Die Sporthalle war zwischenzeitlich zum Rot-Kreuz-Notlager umfunktioniert worden, inzwischen war dort nur noch ein Gerippe zu finden, Stahlbeton, bedeckt von verkohlten Kunststoffplanen. Außerdem war niemand mehr da, mit dem er hätte spielen können.
David schleppte Holz ins Haus, schlug die Tür mit der Hacke ins Schloss. Der Flur roch wie immer, leicht muffig und – nach Opa eben. Schon seit er klein war, roch es hier so.
David spähte durch einen Spalt in der Wohnzimmertür. Opa saß in seinem Sessel und war in eine alte Zeitung vertieft. Er ging weiter in die Küche, stapelte die Scheite sorgfältig neben dem Kachelofen. Dann öffnete er die Klappe zur Feuerkammer und schob zwei Holzstücke hinein. Flammen loderten auf über der Glut, leckten gierig am neuen Futter.
***
»Alles Arschlöcher!« Vollmer regte sich auf, als er den Tankstellenshop durchforstete. Komplett leergeräumt, saubere Arbeit. Aber warum hatten die Pisser danach alles kaputtgeschlagen? So musste er über Regaltrümmer steigen, um sich umzusehen. Da – hinter dem Tresen, ein Karton Jägermeister war zwischen zwei Brettern eingeklemmt. Er zerrte den Karton hervor, die kleinen Fläschchen darin klimperten. Er riss die Pappe auf, klaubte einen Flachmann heraus und goss sich den Schnaps auf ex in den Hals. Zufrieden schmatzend verließ er den Trümmerhaufen, blaue Kunststoffsplitter knirschten unter seinen Stiefeln. Die Zapfsäulen waren natürlich lange trocken. Er musste raus aufs Land – diese dämlichen Bauern hatten alle ihren eigenen Dieseltank im Garten stehen. Noch einen Jägermeister, dann stellte er den Rest in ein Regalfach hinten im Wohnmobil. Er ließ sich auf den weichen Fahrersitz fallen, zündete sich eine Kippe an und wischte mit dem Ärmel über die triefende Nase. Scheiß Schnupfen, hatte er früher nie. Aber was sollte es, er hatte immer geraucht, gesoffen und auch mit Koks gespielt – trotzdem: Er lebte noch, während die anderen alle verreckt waren. Nun ja, fast alle, aber die restlichen Mongos, die Vollmer über den Weg liefen, die würde er auch noch weghauen. Vollmer hatte keinen Bock auf Gesellschaft, er fühlte sich wohl so, ganz allein mit allem, was er brauchte. Ohne Bullen, ohne Vermieter, Anwälte oder andere Abzocker.
Man hatte ihm im Jugendknast »mangelnde Sozialkompetenz« bescheinigt, damals in Hahnöfersand, nachdem er einen Haufen Weicheier verdroschen hatte. Ein paar blutige Nasen nur und einem hat es den Schädel geknackt, bloß weil er zu dämlich zum Hinfallen war. Hatten sie natürlich Vollmer angehängt. Vollmer, du bist asozial. Was empfindest du, wenn du anderen Schmerzen zufügst? Denkst du an die Folgen? Bereust du, was du angerichtet hast? Scheiße, nein. Wenn er jetzt eine von diesen Psychotanten von damals in die Finger kriegen würde...
»Alles Arschlöcher«, murmelte er, als er den Motor startete und an der falschen Seite vom Hof der Tankstelle fuhr, immer auf der Gegenfahrbahn.
***
»Hallo Opa!« David stellte den Teller auf den Couchtisch und setzte sich auf das Sofa.
Sein Großvater blickte auf. »Hallo Junge. Na, was hast du heute geschafft?«
»Ich habe Holz besorgt. Und ich war nochmal in der Tankstelle, Batterien suchen. War aber nichts mehr da.«
Opa hustete. »Und wie ist das Wetter? Mach doch bitte mal die Jalousie hoch.«
»Klar.«
Sein Opa mochte das Wohnzimmer lieber abgedunkelt, abgeschottet von der Außenwelt. Er ging schon lange nicht mehr nach draußen. Er hatte resigniert, saß hier und las den ganzen Tag. Aber manchmal fehlte ihm das Tageslicht doch. David ging zum Fenster und zog den Rollladen hoch. Draußen wucherte Efeu ins Blickfeld, tastete sich schon in Richtung Scheibe vor. Dahinter war der verwilderte Vorgarten zu sehen, jenseits der Straße die ausgebrannten Häuser gegenüber. Darüber der trübe Himmel, ein schmaler Streifen in orange-rosa zeugte noch von der gerade untergehenden Sonne.
Tiefe Schatten lagen zwischen den Sträuchern und Ruinen.
Opa sah lange hinaus, seine Miene unbewegt. Dann nickte er und bedeutete David so, den Rollladen wieder zu schließen.
Dann entzündete David einige Kerzen und schob den Teller zu Opa. »Dein Essen.«
Sein Großvater beugte sich vor, nahm den Löffel mit zittriger Hand und aß die Erbsensuppe. David hatte erst gestern zwei ganze Paletten mit Eintopf-Dosen im Keller von Dammanns Hof gefunden.
»Schmeckt’s dir?«
Opa nickte. »Weißt du, mein Junge, es gibt Zeiten, in denen ist jede warme Mahlzeit ein Fest.«
David lächelte schwach, räumte dann den leeren Teller fort, brachte seinem Opa noch die Bettdecke, mit der er sich auf dem Sofa ausruhen konnte.
Dann bekam der Hund sein Futter, bevor er David nach oben folgte. David verzog sich von Zeit zu Zeit gern in sein altes Zimmer, kuschelte sich unter die Decke und sah sich auf dem DVD-Player Filme an. Opa hatte ihm gezeigt, wie er ihn an eine Autobatterie anschließen konnte. Was für Filme war eigentlich egal, Hauptsache, es kamen Menschen darin vor. Tagsüber, wenn er zu tun hatte, wog die Einsamkeit nicht schwer, aber abends, wenn es dunkel war, gewann sie an Gewicht. Er liebte seinen Opa, doch der wurde immer älter und schwächer. So mühsam es auch war, ihn zu versorgen, David fürchtete sich vor dem Tag, an dem sein Opa nicht mehr da war.
***
Vollmer wechselte fluchend das Rad seines Lieferwagens. Ein Reifenplatzer auf der Autobahn – früher wäre das eine brenzlige Situation gewesen. Aber heute ... Die Autobahn zerfiel ungenutzt, Unkraut brach durch den rissigen Asphalt. Er konnte mitten auf der Fahrbahn hocken, niemand würde hupend herangerast kommen. Er hätte nicht gedacht, dass die Straßen so schnell auseinanderbröseln würden.
Schweiß trat ihm auf die Stirn, als er den Wagenheber an der entsprechenden Stelle am Unterboden ansetzte und das Fahrzeug hochpumpte, dann die festgerosteten Radmuttern löste und den Ersatzreifen aus dem Heck wuchtete. Natürlich musste er dazu erst einmal jede Menge Kartons und Tüten beiseiteschaffen – sein Wagen war prall gefüllt. Argwöhnisch blickte er sich immer wieder um. Er blieb vorsichtig, erblickte jedoch nichts als verwilderte Weiden, umgestürzte Stacheldrahtzäune, vereinzelte Bäume und Buschreihen, die Feldwege markierten. Ein Stück weiter die Fahrbahn hinab stand ein Wegweiser – nächste Ausfahrt Hollenstedt. Was auch immer das für ein Kaff sein mochte, er brauchte Sprit, irgendein verrottender Bauernhof würde sich schon finden. Die Käffer hier bestanden meist aus nichts anderem als alten Höfen und geschniegelten Neubaugebieten.
Die Neubauten machten Vollmer immer besonders wütend. Er hatte die Leute früher beneidet, die sich hier ihre schicken Häuschen hingesetzt hatten, mit ihren beschissenen SUVs und braven Kindern. Und jetzt? Jetzt war nur er noch hier, konnte durch die Häuser ziehen, sich nehmen, was ihm gefiel, und wenn er besonders düsterer Stimmung war, einfach die Drecksvillen anzünden. Während die Besitzer entweder in irgendeinem der medizinischen Auffangzentren dem Tode entgegen röchelten oder untot durch die Gegend wankten. Vollmer war es eins, solange sie ihn in Ruhe ließen.
Er packte seine Sachen wieder ein, fuhr den Wagen die Ausfahrt jenseits des Schildes hinauf und stellte ihn auf dem Hof einer Autobahnmeisterei ab, der – von dichten Bäumen und Büschen umwuchert – nur von der Einfahrt aus einsehbar war.
Als er sich gerade an einem Gebüsch erleichterte, hörte er Motorengeräusche. Ein Wagen näherte sich. Vollmer rannte zum Wohnmobil, griff sich sein Gewehr und legte sich in der Nähe der Einfahrt auf die Lauer.
Ein Geländewagen kam die Autobahn entlang, raste mit hoher Geschwindigkeit über die Ausfahrt, dicht an Vollmer vorbei und verschwand dann im nächsten Ort.
***
David drehte den Fernseher leise. Hatte er ein Motorengeräusch gehört? Sofort war auch Jonny hellwach, spitzte die Ohren und sah sein Herrchen erwartungsvoll an.
David wickelte sich aus den Decken, stieß dabei die Colaflasche um, die er am Abend bei »Stirb langsam« ausgetrunken hatte.
Das Motorengeräusch war wieder verstummt, ganz nah beim Haus. Schritte auf der Zufahrt, schon rannte Jonny aufgeregt die Treppe hinab und bellte aus Leibeskräften. David überlief ein kalter Schauer. Hastig zog er sich an und folgte dem Hund. Er warf einen kurzen Blick auf das Gewehr, das neben seinem Bett an der Wand lehnte. Kurzentschlossen griff er es sich und rannte dann die Treppe hinab. Jemand fingerte am Türschloss herum, dann rammte etwas Schweres dagegen. Unter ständigem Bellen brach ein Stück aus der Tür. Dahinter war eine Gestalt zu erkennen, nur schemenhaft im schwachen Licht der Morgendämmerung. Jonny knurrte.
»Hau ab!«, rief David. Ihm war es egal, wer dort sein mochte; wer so in sein Haus eindrang, konnte nichts Gutes im Schilde führen.
Er bekam keine Antwort, doch die Gestalt verschwand wieder.
David ging zum vernagelten Fenster – hier unten im Erdgeschoss hatte er alles verbarrikadiert, nur das Wohnzimmerfenster war lediglich vom Rollo geschützt.
Opa! Er hastete ins Wohnzimmer. Tatsächlich hörte er dort, wie sich jemand am Rollladen zu schaffen machte. Opa regte sich, richtete sich langsam auf. »Was ist los?«, fragte er schlaftrunken.
»Sei still. Ein Einbrecher. Komm mit, ich bringe dich nach oben.«
Opa nickte. »Pass nur auf, Junge. Hast du das Gewehr? Mach keinen Unsinn. Gib ihm was er will, vielleicht verschwindet er«, redete der Großvater auf seinen Enkel ein. Doch David wusste, dass sein Opa selbst nicht glaubte, was er da sagte. Er hatte einfach nur Angst.
»Schon gut, ich pass auf. Schaffst du es selbst die Treppe hoch?«, fragte David, als sie im Flur standen.
Etwas Schweres wurde gegen den Rollladen geworfen. Eine raue Stimme brüllte Unverständliches.
Opa nickte.
»Ich glaube, es ist nur einer«, behauptete David, um seinen Großvater zu beruhigen, der langsam, Stufe für Stufe, die Treppe erklomm.
Wieder donnerte es am Wohnzimmerfenster. David spähte durch die Tür – der Rollladen war zerbrochen, hinter der Scheibe war die Dunkelheit der Nacht zu sehen. Dann ein berstendes Geräusch – tausend Splitter flogen durch das Wohnzimmer, ein großer Stein schlug mehrere Zinnbecher aus einem Regal.
»Verpiss dich!«, schrie David.
Der Typ von draußen kam angerannt, wie ein Tier sprang er durch die Reste der Scheibe, rollte sich über den Esstisch, schlug gegen zwei Stühle, von denen einer zerbrach. David griff nach dem Gewehr, legte an. Der Kerl rappelte sich auf, sah sich um, erkannte David im Türrahmen. David schoss, der Kerl taumelte zurück, brach zusammen. Blut lief auf den Teppich. Hätte Oma das noch erleben müssen, geschrien hätte sie, doch David schaute nur. Er schluckte, ließ das Gewehr sinken. Opa rief irgendwas von oben, der Fremde aber gab keinen Laut von sich, lag einfach da und unter ihm strömte das Blut hervor. Seine Jacke, eine Militärjacke, war zerrissen, auch voller Blut. Es war überall. David krallte sich in den Türrahmen, erbrach sich, spie Erbsensuppe und Cola auf den Teppich. Was für eine Sauerei, dachte er kurz, dachte noch tausend andere Sachen, alles drehte sich. Er sackte zusammen, weil er seine Knie nicht mehr spürte, starrte den Kerl an, der da im Wohnzimmer lag, wo zwei Minuten zuvor noch Opa geschlafen hatte. Konnte es nicht fassen und schloss die Augen. Dann rührte sich der Kerl doch noch, sprang auf, blickte verwirrt umher. David versteckte sich in der Küche. Der Typ rannte raus, stolperte aus der Haustür und krabbelte in einen dunklen Geländewagen, der dort stand. Wieder dröhnte der Motor auf, dann raste der Wagen davon. Hinterließ Stille. Dann ein Krachen, ein Bersten, gefolgt von schmerzerfüllten Schreien. Jonny kläffte wieder. Die grässlichen Schreie wollten nicht aufhören, David presste sich die Hände auf die Ohren. Nach einer endlosen Weile hatte Jonny sich heiser gebellt, die Schreie wurden schwächer und erstarben dann ganz. David merkte, dass er am ganzen Leib zitterte.
***
Die Straßen waren hier ganz in Ordnung, deshalb konnte Vollmer Gas geben. Er hatte tatsächlich einen Dieseltank gefunden – auf einem Bauernhof, genau wie er es sich gedacht hatte.
Fast wäre er in einen Jeep gerast, der mitten auf der einzigen Kreuzung in einem dieser beschissenen Dörfer stand. Am Steuer ein Kerl mit aufgeplatzter Stirn, war voll aufs Lenkrad geknallt, als er den Wagen gegen einen LKW gefahren hatte, der auf dem Seitenstreifen stand. Herrje, das schöne Auto. Sah irgendwie frisch aus, der Unfall. Das musste der Typ sein, der gestern an ihm vorbeigerast war. Tja, du Idiot, Fahren will gelernt sein.
Vollmer stieg aus und ging zu dem Wagen. Blieb auf der Hut, aber es rührte sich nichts. Er öffnete die Tür des Jeeps, sie war verkantet und gab ein lautes Kreischen von sich. Alles war voller Blut. Der Kerl war hinter dem Steuer eingeklemmt, rührte sich nicht. Vollmer überlegte, ihm sicherheitshalber in den Kopf zu schießen, aber warum sollte er unnötig Aufmerksamkeit erregen? Der Pisser kam sowieso nicht aus seinem Wagen raus. Er konnte auch keine von den beschissenen Maden entdecken, die den Untoten meist aus der Fresse rieselten, also würde der Kerl erstmal schön sitzenbleiben.
Vollmer sah sich um, ging die Straße hinab.
Das halbe Dorf war niedergebrannt, aber Vollmer hatte auch Beete gesehen. Jemand hatte hier Gemüse angepflanzt, hatte sich nett eingerichtet und hoffte, hier alles für sich haben zu können. Vollmer blickte sich neugierig um. Viele Ruinen, niedergebrannte Häuser, Autowracks. Aber die Beete, irgendwem mussten sie gehören. Er strich durch die Straßen, bis er vor einem Grundstück stehenblieb.
Dieses Haus. Vernagelte Fenster, sorgsam angerichtete Unordnung, die Plünderer täuschen sollte. Aber er war ja nicht blöd und fiel nicht auf solche billigen Tricks rein. Eigentlich hatte er kein Problem damit, wenn hier jemand wohnte, ging ihn ja nichts an. Aber trotzdem – die Welt hatte sich geändert. Vollmer fand immer weniger zu fressen auf seinen Beutezügen, er musste einfach nachsehen, ob er hier nicht seine Vorräte aufstocken konnte. Und um sicherzugehen, dass ihn nicht irgend so ein Arschloch aus dem Hinterhalt niederschoss, entschloss er sich zur rabiaten Methode. Die meisten wurden davon verschreckt und verpissten sich.
***
David wusste, dass etwas nicht stimmte, als er das Haus betrat. Die Zäune und Gitter lagen im Vorgarten, die Haustür stand offen. Nach dem Kerl vom Vorabend, den er vorhin noch auf einer Kreuzung gesehen hatte, sein Wagen zu Schrott gefahren, war er besonders nervös.
Er stellte den Karton ab, mit dem er auf Plünderungstour gewesen war, und nahm das Gewehr vom Rücken.
Jonny stürmte los.
Vollmer saß im Wohnzimmer, breitbeinig in Opas Sessel. Er pickte sich mit einem Zahnstocher im Gebiss herum, um ihn herum lagen die Reste von Plastikverpackungen – offenbar hatte er Davids Vorräte geplündert und sich an Fertigfraß und Schokoriegeln satt gegessen. Davids Großvater lag auf dem Sofa, die Augen geschlossen. Er zitterte, bemüht, sich nicht zu rühren.
Jonny stürmte vor David in das Wohnzimmer, kläffte wild auf den Eindringling ein. Vollmer sprang auf, suchte hinter seinem Stuhl Schutz. David folgte dem Hund, das Gewehr in Händen. »Jonny –still.« Der Hund gehorchte widerstrebend, knurrte aber weiter und behielt den Unbekannten im Auge.
David ließ das Gewehr sinken, besann sich dann und richtete es auf den grobschlächtigen Kerl, der in sein Wohnzimmer eingedrungen war.
»He, wen haben wir denn da?« Der Typ hatte eine seltsame Stimme, die zwischen quietschig und krächzend hin und her schwankte. »Ist Schneewittchen nach Hause gekommen?«
David blickte immer wieder zu seinem Opa hinüber, der sich kaum rührte. »Hast du Opa was getan?«
Dreckiges Lachen. »Quatsch, der ist doch schon scheintot. Dürr wie Papier, ich glaube du lässt ihn verhungern!« Vollmer amüsierte sich über seinen eigenen Witz. »Wohnst hier also mit Opi, was? Wohl Schwein gehabt. Bist den Untoten entwischt? He, wir sind schon Glückspilze, was? Los, pack das Ding weg.« Er deutete auf das Gewehr, dessen Lauf in Davids Händen zitternd auf ihn gerichtet war. »Ich bin nicht monatelang rumgekurvt, um mich dann von so einem Milchgesicht abknallen zu lassen, bloß weil du zu blöd bist und nicht aufpasst.«
David rührte sich nicht.
Vollmers Stimme wurde ärgerlich. »Los jetzt, weg damit. Mach schon, sonst hau ich dir auf die Fresse. Oder …« Vollmer schien eine Idee zu haben. »Oder ich hau ihm auf die Fresse.« Er deutete auf den alten Mann auf dem Sofa. »Ja, genau!« Vollmer kriegte sich gar nicht mehr ein.
Davids Gedanken rasten.
»Oder dem Köter!« Vollmer schrie fast, Spucke landete auf dem Couchtisch. Da regte sich Opa. Vollmer stand direkt vor ihm, wandte ihm aber den Rücken zu. Opa richtete sich auf, die karierte Decke rutschte von seiner Brust hinab. Ein glänzender Gegenstand wurde sichtbar. David erkannte einen der Pokale, die Opa in einer Vitrine aufbewahrt hatte. Vom Fußball, früher, David in der E-Jugend. Seine dürren Finger umklammerten ihn, als er den ebenso dürren Arm erhob und den Pokal auf Vollmers Kopf niedersausen ließ. Das schwere Teil rutschte am Hinterkopf des Mannes ab und fiel klappernd zu Boden. Opa sank wieder zurück auf sein Kissen, er schien seine letzte Kraft in den Schlag gelegt zu haben. Vollmer zuckte zusammen, griff sich an den Hinterkopf. Auf seinen Fingerspitzen – Blut! Er schien David augenblicklich vergessen zu haben, hob den Pokal auf und drosch ihn dem alten Mann ins Gesicht.
»Nein!« David schrie, sein Magen krampfte zusammen, ebenso sein Finger um den Abzug. Donnernd löste sich ein Schuss. Jonny jaulte auf. Vollmer ließ von Opa ab, taumelte zur Seite. Mehr Blut. Dann sackte er in sich zusammen, rutschte mit seltsam abgewinkelten Gliedmaßen zwischen Couchtisch und Sofa. Jonny stürzte auf ihn zu, verbiss sich in seinem Hosenbein.
David ließ das Gewehr fallen. Er war wie betäubt. Zuerst traute er sich nicht, dann nahm er all seinen Mut zusammen und ging zu Opa. Den schrecklichen Anblick des misshandelten Gesichts würde er niemals mehr aus seinem Gedächtnis löschen können.
Opa atmete nicht mehr. David zog die Decke hoch und legte sie ihm über das Gesicht.
Vollmer ließ er so liegen, wie er gefallen war. Unter dem Couchtisch bildete sich eine weitere große Blutlache, vermischte sich mit der ersten. Vollmers Augenlider flatterten, er murmelte etwas, was David nicht verstehen konnte. Und nicht wollte.
»Jonny, komm!«, sagte er mechanisch, dann verließ er das Wohnzimmer, um es nie wieder zu betreten.
Hunger
Lora Horst
Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie würde mein Tod sein oder ich der ihre. Obwohl, eigentlich war die zweite Möglichkeit ausgeschlossen, schließlich war sie schon tot.
Augen sind das Fenster zur Seele, heißt es. Als ich jedoch in die ihren sah, fand ich nur gähnende Leere. Und doch konnte ich mich nicht überwinden, sie zu töten.
Sie kauerte vor den Gitterstäben und wartete. Zuvor hatte sie stundenlang an ihnen gerüttelt, geknabbert und zwischendurch vor Wut aufgeheult, bis ihrem faulenden Gehirn endlich dämmerte, dass sie so nicht an mich herankommen würde.
Anni, meine Verlobte.
Es schmerzte, sie so zu sehen. Es schmerzte, zu wissen, dass ich daran schuld war. Dass ich zu langsam und zu schwach gewesen war, um sie zu beschützen.
Die klaffenden Bisswunden an ihren Armen und Beinen, das fehlende Stück Fleisch in ihrem Nacken, das den Blick freigab auf, wie ich glaubte, ihre Speiseröhre. Darin wälzten sich die schleimigen Körper der Maden. Wühlten sich tiefer und tiefer in ihr Gewebe vor.
Der Würgereiz kam augenblicklich. Säure stieg mir in den Hals und brannte. Ich schluckte sie wieder herunter. Mehr hatte ich nicht in mir, was ich hätte erbrechen können. An das getrocknete, schimmelige Futter im Napf wagte ich mich nicht heran. Seit zwei Tagen saß ich in diesem Zwinger. Seit zwei Tagen hatte ich nichts mehr zu mir genommen.
Sie waren wie ein Sturm über uns hereingebrochen. Die Toten. Als die ersten Meldungen in den Nachrichten aufgetaucht waren, hatten wir es für einen Witz gehalten. Doch dann kamen sie in Horden. Unförmiges, totes Fleisch, dem wieder Leben eingehaucht worden war. Das sich über das Land wälzte, getrieben von einem unstillbaren Hunger. Nach uns.
In den Städten war es die Hölle. Zerfressene Kadaver wandelten durch die Straßen. Manche ohne Gliedmaßen schoben sich über den harten Asphalt und leckten die letzten Tropfen Blut aus den Schlaglöchern, Ritzen und Kuhlen. Die Flüchtenden waren in Panik in alle Richtungen gelaufen. Autos blockierten Straßen und versperrten ihnen den Weg. Ihre eigene Panik hatte ihnen die Möglichkeit aufs Überleben genommen. Sie hatten es in den Nachrichten gezeigt. Aus einem Helikopter heraus hatte man sie gefilmt. Es war mir damals wie ein weit entfernter Albtraum erschienen.
Doch auch wir auf dem Land waren nicht verschont geblieben.
Zuerst kamen sie einzeln. Wir schossen sie ab oder zerschlugen ihnen, mit dem, was wir gerade zur Hand hatten, die Köpfe. Auf den Friedhöfen warteten wir auf sie, als sie sich hervorwühlten. Wir fühlten uns stark. Wir dachten, wir könnten das überstehen. Doch es wurden immer mehr. Sie kamen in Gruppen und vor zwei Tagen erreichte uns eine wahre Flut von ihnen. Sie hatten die Städte auf der Suche nach Nahrung verlassen.
Anni. Die Furcht in ihren Augen, als sie die Alarmsirenen der Feuerwehrwagen an der Dorfgrenze aufheulen hörte. Wie sie sich in meinen Armen verkrochen hatte, am ganzen Körper zitternd und bebend. Diese Augenblicke hatten sich tief in meine Erinnerung gebrannt.
Was danach geschah, war verschwommen. Sie waren plötzlich überall. Wir rannten, schlugen wild um uns. Da war Blut, Kreischen erfüllte die Luft. Ich hatte keine Ahnung, wohin mich meine Beine trugen, bis ich vor dem Hundezwinger unseres Nachbarn stand. Stahlgitter, stabil genug, um seine zwei Rottweiler im Zaum zu halten, die jedoch nirgends zu sehen waren. Ich schlüpfte hinein und wollte Anni hinter mir herziehen, als etwas an meiner Hand zog. Sie hing lasch daran, ihr Körper an unzähligen Stellen blutend. Ich brüllte, schlug und rüttelte sie. Endlich öffnete sie die Augen. Doch es war nicht mehr meine Anni.
Sie schnappte nach mir.
Ich trat sie von mir und schloss die Zwingertür.
Seitdem war ich hier, in meinem von mir selbst erwählten Gefängnis, und wartete. Wartete darauf, dass etwas geschah. Dass meine Anni wieder sie selbst wurde. Wartete darauf, dass sich eine weitere, dritte Möglichkeit auftat. Wartete darauf, dass ich die Augen aufschlug und sich alles nur als ein böser Traum erwies.
***
Als ich wieder erwachte, war es Nacht um mich herum. Ich war eingeschlafen, ohne es bemerkt zu haben. Meine Kehle fühlte sich rau an. Sie war völlig ausgetrocknet. Als ich mich räusperte und etwas Spucke zu sammeln versuchte, schoss mir der Schmerz durch den Hals. Meine Zunge lag schwer und pelzig in meinem Mund.
Ich tastete mit meiner linken Hand über den Boden, bis ich fand, was ich suchte. Die Cola-Dose, das einzige Getränk, das sich in meinem Rucksack befunden hatte.
Nachdem ich keuchend mit brennenden Lungen in der Zelle angekommen war, hatte ich sie in einem Zug geleert. Das war jetzt drei Tage her. Oder waren es schon vier? Ich bereute es jetzt jedenfalls.
Der illusorischen Hoffnung anhängend, dass sich vielleicht doch noch ein Tropfen herausschütteln ließe, setzte ich sie an meine Lippen. Vergebens.
»Verdammt!«, fluchte ich und schleuderte sie in die Dunkelheit. Sie schlug an die Wand und fiel zu Boden.
Erschrocken zuckte ich zusammen, als etwas gegen das Gitter vor mir knallte. Mein Herz raste und auch als mir klar wurde, dass es nur Anni war, die der Lärm aufgeschreckt hatte, wollte es sich nicht beruhigen.
Sie kratzte an den Gittern, scharrte am Boden und an den Wänden, dabei heftig schnaufend.
»Sei ruhig!« Der Schreck saß mir noch in den Gliedern. Warum ging sie nicht einfach weg? Die anderen Untoten waren schon längst weitergezogen. Jedenfalls hatte ich lange keine Schreie mehr gehört und die letzten Tage auch keinen mehr zu Gesicht bekommen.
Ich lehnte den Kopf gegen die Hundehütte und schloss die Augen. Mein Magen zog sich zusammen. Die ersten zwei Tage war der Hunger schlimm gewesen, inzwischen spürte ich nur eine große Leere. Krrrrr, krrrr. Der Durst war schlimmer. Und die Hitze des Tages, wenn die Sonne auf das Zwingerdach knallte. Krrrrr, krrrr. Der Zwinger lag im hinteren Teil des Nachbargartens. Von allen Seiten von Mauern umgeben, sodass kein Windhauch sich hierher verirrte. Krrr.
»Verdammt, hör endlich auf damit, du blödes Miststück!«
Sie knurrte und fauchte zurück.
Ihr Scharren und Kratzen machte mich wahnsinnig. Der süßliche Verwesungsgestank nahm mir die Luft.
Ich stützte den Kopf in die Hände und versuchte, gleichmäßig zu atmen. Als ich mich beruhigt hatte, schaute ich wieder auf. Man konnte über diese Untoten sagen, was man wollte, aber dumm waren sie nicht. Anni wusste ganz genau, wo sich der Eingang des Zwingers befand. Sie hatte sich die ganze Zeit über nicht einen Millimeter davon weg bewegt. Zu ihrer Linken stand eine Kommode, Säcke mit Hundefutter standen darin ordentlich aufgereiht. Gleich dahinter waren die Glastüren, die ins Innere des Hauses führten. Und … sie stand offen! Warum war mir das nicht früher aufgefallen?
Wenn Anni doch nur nicht da wäre …
***
»Verschwinde, verschwinde, verschwinde!«
Ich hatte nicht bemerkt, wie meine Lippen die Worte formten.
Ihre toten Augen starrten zurück in die meinen.
»Verpiss dich endlich!« Meine Stimme brach und Schmerz schoss durch meine Kehle.
Anni zuckte nicht einmal.
Ich ballte die Hände zu Fäusten und presste die Zähne zusammen. Diese blöde Schlampe! Immer machte sie mir das Leben zur Hölle. Zu dumm, sich selbst zu schützen und dann noch nicht einmal in der Lage sein, in einer Ecke zu sterben und andere in Ruhe zu lassen. Nein, sie musste als dieses, dieses – Ding! – wiederkommen!
Der Weg ins Haus war nur wenige Schritte entfernt. Dort würde ich Essen und Trinken finden und mich duschen und abkühlen können. Wenn nur sie nicht wäre!
Diese Hitze, mein Körper glühte. Das Hemd und die Jeans klebten an mir und scheuerten meine Haut bei jeder Bewegung auf.
Ich griff nach dem mit getrockneten Futterresten bedeckten Napf und schleuderte ihn ihr entgegen. Auf Höhe ihres Gesichtes klatschte er an das Gitter und fiel scheppernd zu Boden. Reste des Futters klebten in ihrem Gesicht und in ihren Haaren.
»Fahr zur Hölle.« Jedes Wort riss eine Wunde in meinen Rachen.
***
Sie war wunderschön. Die Sonnenstrahlen, die Hitze machten ihr nichts aus. Ihre Muskeln waren unter der schlaffen Haut kaum zu sehen. Ein Tacker! Das war es, was ich brauchte! Wenn ich ihre Haut ein wenig straffer spannte, wäre sie wieder ganz meine alte Anni.
Hunger.
Ein wenig Schminke. Das war es, was fehlte. Ihr fehlte das allmorgendliche Schönheitsritual im Bad! Kein Wunder, dass sie so aussah.
Schmerz.
Wo war ich? Ich sollte reingehen, ich hatte in Nachbars Garten nichts zu suchen. Sonst würde er Ares auf mich hetzen.
Schwer, mein Körper war so schwer.
Ich hörte Schluchzen. Ich weinte? Meine Wangen waren trocken.
Wer war das? Eine Gestalt hockte vor mir und streckte mir ihren Arm entgegen, soweit es die Gitter zuließen. Was tat ich hier?
Dunkelheit.
***
Zwielicht herrschte und es war merklich abgekühlt, als ich wieder zu mir kam. Ein angenehmer Geruch lag in der Luft.
Regen!
Beim Gedanken an Wasser öffnete ich den Mund, was vom Brennen der trockenen, rissigen Lippen begleitet wurde. Doch das war nichts im Vergleich zum Kopfschmerz. Mein Schädel schien von innen heraus zu platzen. Druck drohte meine Augen aus ihren Höhlen herauszupressen. Meine Sicht war verschwommen und ich hatte Schwierigkeiten, etwas zu fokussieren. Erst nach einer Weile wurde mein Blick klarer.
Wenigstens war ich wieder bei Verstand. Fieber hatte mich den letzten Tag in seinen Klauen gehabt und die letzten Tropfen Flüssigkeit als Schweiß aus mir herausgezogen.
Der Regen hatte bereits aufgehört, doch die Fliesen vor dem Zwinger waren noch nass, ebenso Anni.
Ich konnte nicht sagen, ob es Morgen oder Abend war. Oder wie lange ich hier schon saß. Fünf Tage? Ganz gleich, lange würde ich es nicht mehr machen.
Mein Körper war steif. Nur mit Mühe schaffte ich es, mich zum Sitzen aufzurichten. Meine Bewegungen hatten Anni aufhorchen lassen.
Sie stand noch genauso vor der Zwingertür wie zuvor. Scheinbar ermüdeten Untote nicht. Selbst wenn sie tagelang keine Nahrung hatten.
Ich erkannte kaum noch etwas von meiner Verlobten in ihr. Die Verwesung war unter der Hitze der Sonne schnell fortgeschritten. Jetzt hing ihre nasse Haut schlapp an ihren Knochen, in ihren Wunden hatte sich das Blut grün-schwarz verfärbt. Maden tummelten sich darin, die klebrige, warme Masse als Brutplatz für ihre Eier nutzend. Ich konnte sie weiß und glänzend zwischen den zerfallenden Muskelfasern sehen.
Unter anderen Umständen wäre mir übel geworden, doch mein Geist war durch die letzten Tage zu abgestumpft. Mit einer Gleichgültigkeit, die ich nicht erwartet hatte, musterte ich sie. Und auf einmal war alles ganz klar. Es war einfach. Ich musste sie nur töten. Im Haus befand sich Nahrung und Wasser. Medizin würde auch nicht weit sein. Ich würde wieder zu Kräften und über die Runden kommen. Ich musste sie nur töten. Und zwar jetzt, solange ich noch bei Verstand war und das Delirium mich nicht zurückforderte und damit in den Tod riss.
Nur wie? Ich trug keine Waffen bei mir und auch im Zwinger befand sich nichts, was ich hätte verwenden können. Suchend schaute ich mich um. Hinter mir befand sich ein großer Schrank. Vielleicht fand ich dort etwas? Doch um dorthin zu gelangen musste ich erst einmal an Anni vorbeikommen, und was, wenn sich nichts Nützliches im Schrank befand? Dann säße ich in der Falle. Nein, das war zu riskant.
Mein Blick ging weiter. Da! Ein Holzgriff lugte hinter der Kommode hervor. Ein Spaten? Eine Hacke? Ganz gleich, es würde für meine Zwecke reichen. Jetzt stellte sich nur noch die Frage, wie ich Anni von dort wegbekam. Wie sollte ich sie locken? Das Einzige, was sie interessierte, war ich, mein Fleisch, das sie verschlingen wollte. Ich schluckte, als mir dämmerte, was ich zu tun hatte. Die Kanten der hölzernen Hundehütte waren scharf genug für meine Zwecke. Das einzige Problem war, mich zu überwinden.