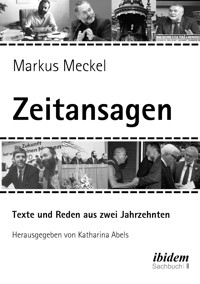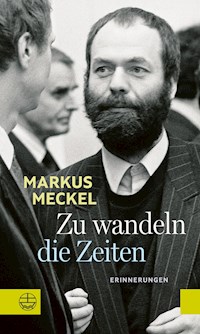
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ein Akteur der deutschen Einheit erinnert sich Markus Meckel ist bekannt als langjähriger SPD-Bundestagsabgeordneter und ein Außenpolitiker, der sich bis heute aktiv um eine europäisch orientierte Erinnerungskultur und die Aufarbeitung der Diktaturen des 20. Jahrhunderts bemüht. In besonderer Weise ist sein Name jedoch in der Öffentlichkeit mit der Oppositionsbewegung in der DDR verbunden, mit der Friedlichen Revolution von 1989 und dem Prozess der Deutschen Einheit. Mit Martin Gutzeit initiierte er die Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR und saß als ihr Vertreter am Runden Tisch. Nach der freien Wahl in der DDR führte er zeitweise die Ost-SPD und verhandelte als Außenminister die deutsche Einheit. In seinen Erinnerungen beschreibt er seinen besonderen Weg in der DDR, der ihn, den Pfarrerssohn, zum Politiker werden ließ. Markus Meckel – Akteur und Beobachter des großen Zeitenwandels – legt mit seinen "Erinnerungen" ein unersetzliches Stück Zeitgeschichtsbertrachtung vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Meckel, Jahrgang 1952, studierte Theologie in Naumburg und Berlin. Schon während seines Studiums war er konspirativ politisch aktiv. Nach dem Vikariat in Vipperow/Müritz übernahm er das dortige Pfarramt und beteiligte sich fortan daran, die verschiedenen oppositionellen Gruppen zu vernetzen. 1989 initiierte er zusammen mit Martin Gutzeit die Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP). Nach den freien Wahlen 1990 verhandelte er als DDR-Außenminister die Deutsche Einheit mit. Von 1990 bis 2009 gehörte er dem Deutschen Bundestag an. Er ist vielfältig ehrenamtlich aktiv, darunter als Ko-Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung für deutschpolnische Zusammenarbeit und als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Aufarbeitung. Von 2013 bis 2016 war er Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2020 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: FRUEHBEETGRAFIK ·Thomas Puschmann, Leipzig
Satz: Formenorm · Friederike Arndt, Leipzig
ISBN 978-3-374-06577-6
www.eva-leipzig.de
VORWORT
Nach 30 Jahren ist das Erinnern an 1989/90 viel lebendiger und differenzierter geworden als noch vor wenigen Jahren – so ist mein Eindruck. Liegt das daran, dass so viele ehemalige Akteure nun in die Jahre kommen und zurückschauen und versuchen, Bilanz zu ziehen? Oder ist es doch mehr das Erstarken der AfD im Osten Deutschlands, das die Öffentlichkeit herausfordert, sich noch einmal stärker »den Ostdeutschen«, dieser für viele im Westen immer noch schwer verstehbaren Spezies von Deutschen, zuzuwenden?
Jedenfalls heißt es in diesen Tagen oft, dass wir uns in Deutschland aus Ost und West unsere Geschichten erzählen und uns mehr als bisher gegenseitig zuhören sollen; unsere sehr verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven mitteilen. Wir Deutschen sind wohl das Volk in Europa, das sich selbst am wenigsten kennt, so unterschiedlich sind die Narrative, in denen wir unsere Geschichte zur Sprache bringen.
So erzähle auch ich in diesem Buch meine ganz persönliche Geschichte. Erinnerungen zu schreiben und öffentlich zu machen, ist jedoch auch ein Wagnis. Sowohl für den sich Erinnernden selbst, wie auch im Verhältnis zu den Menschen, die ihm nahestanden oder -stehen. Und das gilt ebenso für das eigene Bild in der Öffentlichkeit. Man setzt sich gewissermaßen aufs Spiel. Ich habe mir die Freiheit genommen, an der einen oder anderen Stelle anzudeuten, wo ich zu diesem jungen Mann, der ich war, eine gewisse Distanz gewonnen habe.
Dieses Buch ist vor allem eine politische Biografie, in der ich versuche, mein eigenes Leben in seinen zeitgeschichtlichen Kontexten nachzuvollziehen, darzustellen und in seinen vielfältigen Bezügen verständlich zu machen – soweit es sich mir eben selbst erschlossen hat. Ohne diese Beziehungen intensiver zu beleuchten und selbst zum Thema zu machen, wird deutlich, wie stark das eigene Leben von nahen Menschen beeinflusst und mitgetragen, wie sehr es von mir mitgegebenen Orientierungen geprägt wurde – und wo ich über sie hinausgegangen bin.
Die erste Hälfte meines Lebens bis zum Jahr 1989 spielte sich in einer mittlerweile seit 30 Jahren vergangenen Welt ab, nämlich der DDR. Als Diktatur schränkte sie die Freiheit erheblich ein, Repression und Lüge gehörten zu den Alltagserfahrungen. Gleichwohl konnte das Leben in der DDR sehr unterschiedlich sein. Das meine wurde in hohem Maße von der Kirche bestimmt, in die ich hineingeboren wurde. Ich habe sie trotz aller Unzulänglichkeiten und Konflikte als einen Raum der Freiheit erlebt, als einen Ort in langer Tradition stehenden selbständigen Denkens, des offenen Diskurses und selbstbestimmten Handelns.
Wahrscheinlich erschließt sich die folgende Erkenntnis besonders vom Osten her: Keiner der beiden deutschen Staaten, in die Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zerteilt war, kann ohne den Bezug auf den anderen wirklich verstanden werden. Wenn das in Westdeutschland oft bis heute aus dem Blick geraten ist, so war das für mich, durch meine Familie und die Kirche seit meiner Kindheit präsent. Die gesamte Familie meiner Eltern lebte im Westen. Meine Eltern hatten das Leben in der DDR als Aufgabe verstanden; sie hatten sich nach der Rückkehr meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft bewusst dafür entschieden, der bedrängten christlichen Gemeinde in diesem Teil Deutschlands zur Seite zu stehen. So wollte auch ich trotz aller Distanz zum herrschenden System nie weg. Hier sah ich von Jugend an die Herausforderung, für die eigenen Werte und den Glauben einzustehen, vor Ort etwas zu verändern – »zu wandeln die Zeiten!«.
Dass dies dann möglich wurde, und ich ein Teil der gewaltigen Umbrüche von 1989/90 sein durfte, war freilich lange nicht absehbar. Es ist ein Geschenk.
Die Generation meiner Eltern hatte die Erfahrungen von Krieg und Gewalt zu verarbeiten, die sie ihr Leben lang nicht losließ. Da gab es viel Schweigen, aber auch Neuanfang, Lernen und ein bewusstes Einstehen für Versöhnung.
Bis 1987/88 habe ich nicht geglaubt, dass ich jemals in einer Demokratie leben würde oder gar in einem geeinten Deutschland. So wurde das Jahr 1989 zu einer Erfahrung des Glücks nicht nur für mich, sondern zum Aufbruch für die Völker Mitteleuropas, und das Jahr 1990 zur Glücksstunde der Deutschen im 20. Jahrhundert – 45 Jahre nachdem von uns Deutschen so viel Tod und Schrecken über ganz Europa ausgegangen war.
Dies unvergessliche Jahr hat meine Generation geprägt. Doch haben wir in Deutschland darüber noch keine gemeinsame Erzählung gefunden. Deshalb schreibe ich hier meine Geschichte. Sie mag gegen manch andere öffentlich verbreitete Sichtweisen stehen und wird sicherlich nicht unwidersprochen bleiben. Doch hoffe ich, dass sie dazu beiträgt, dass auch andere ebenfalls ihre Geschichte erzählen und man darüber ins Gespräch kommt. Nur so wird es gelingen, auch das öffentliche Erinnern und Gedenken im vereinten Deutschland differenzierter werden zu lassen.
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Erster Teil: Jugend und Studienjahre in der DDR (1952–1980)
1. Kapitel: Herkunft, Kindheit, Jugend
Das Elternhaus
Pfarrfamilie und Dorfleben
Ein neues Umfeld: Missionshaus und Ökumene
Leben im Missionshaus
In der sozialistischen Schule
Kirchliche Jugendarbeit
Mauerbau und Leben im geteilten Berlin
Totale Wehrdienstverweigerung
Graues Kloster
Abitur auf Hermannswerder
2. Kapitel: Studentenzeit 1971–1980
Studentenleben in Naumburg
Landesweite Vernetzung von Theologiestudenten
Reisen nach Rumänien, Ungarn und Polen
Studium am Sprachenkonvikt Berlin
Krisen und Umbrüche
Studentengemeinde – erste Konflikte mit dem Staat
Engagiertes Studium
Zweiter Teil: Pastor in der DDR – oppositionelle politische Arbeit – Ökumene (1980–1989)
1. Kapitel: Vipperow – Vikariat, Pfarramt, Gemeindearbeit
Umzug ins Pfarrhaus
Schwieriger Wechsel auf das Land
Meine Kirchgemeinde
Vikariat und Predigerseminar
Philosophie auf dem Lande
Solidarität mit der polnischen Solidarnosc
Einstieg ins Gemeindepfarramt
Beerdigungen als missionarische Chance
Partnergemeinde Veitshöchheim
Vipperower Friedenskreis
Paulino – ein Blick über die eigenen Grenzen
Staatssicherheit
40 Jahre Kriegsende 1985
2. Kapitel: In der Opposition der 1980er-Jahre
Politische Arbeit als Teil des Lebens
Internationale Rahmenbedingungen
»Arbeitsgruppe Frieden« in Mecklenburg
Friedenswanderung alias Erstes Mobiles Friedensseminar 1982
Zweites Mobiles Friedensseminar 1983
Drittes und Viertes Mobiles Friedensseminar 1984/1985
Friedensbewegung in Ost und West
Das Delegiertentreffen der Basisgruppen »Frieden konkret«
Frieden Konkret 1984/1985
Im Visier der Stasi
Gehen oder Bleiben
Verantwortliche Bürgerschaft
Gorbatschows »Neues Denken« macht Hoffnung
Internationale Kontakte und Reisen
Fünftes und Sechstes Mobiles Friedensseminar 1986/87
Hoffnungen
Olof-Palme-Friedensmarsch – SPD-SED-Papier
Frieden konkret 1986/87
Zerschlagene Hoffnungen
Opposition auf der Suche
Abschied von Vipperow
3. Kapitel: Auf Ökumenischen Pfaden 1988/89
»Ökumenische Werkstatt«
Reisen nach Ungarn und Rumänien
Ökumenische Versammlung in der DDR
Neue Herausforderungen
Dritter Teil: Friedliche Revolution und Runder Tisch (1989/90)
1. Kapitel: Initiative zur Gründung der Sozialdemokratie in der DDR
Zwei Pastoren entscheiden, eine sozialdemokratische Partei zu gründen
Aufruf zur Gründung
Schritt in die Öffentlichkeit
Gründungsfieber
Strategische Vorbereitungen
Mitteleuropa im Aufbruch – die SED in Schockstarre
Missglückte Gründung des »Demokratischen Aufbruchs«
Gründung der SDP in Schwante
2. Kapitel: Die SDP in der Friedlichen Revolution
9. Oktober 1989 in Magdeburg
Parteiaufbau
Arbeit in der Magdeburger Region
Mauerfall
Die Rolle der Kirchen
Kontaktgruppe der demokratischen Opposition
Machtzerfall der SED im Oktober/November 1989
Erste Kontakte zur West-SPD
Für eine Einheit in Selbstbestimmung
3. Kapitel: Auf dem Weg zur freien Wahl – die Zeit des Runden Tisches
Sonderparteitag der SPD in Westberlin
Die SDP auf dem Weg zu einer anerkannten politischen Kraft
Der Zentrale Runde Tisch
Die »Regierung der Nationalen Verantwortung«
Die Ost-SPD auf dem Weg zur freien Wahl
Vierter Teil: Die demokratische DDR und der Prozess der deutschen Einheit (1990)
1. Kapitel: Die freie Wahl in der DDR – der schwierige Weg zur Koalitionsregierung
Politik als Beruf
Das Wahlergebnis am 18. März
Der Absturz Ibrahim Böhmes
Diskussion um Regierungsbeteiligung
2. Kapitel: Außenminister in der Koalitionsregierung
Start im Außenministerium
Außenminister einer Koalitionsregierung
Konflikt mit dem Ministerpräsidenten
Das Verhältnis zu Israel und die Einladung an sowjetische Juden
Entwicklungspolitisches Akzentprojekt
3. Kapitel: Die Einheit international verhandeln I
Anerkennung der polnischen Westgrenze
Auf dem Weg zu einem europäischen Sicherheitssystem
Den Osten in Europa im Blick behalten
4. Kapitel: Die Einheit international verhandeln II
»Zwei-plus-Vier-Gespräche«
Abzug der sowjetischen Truppen
Integration in die Europäische Gemeinschaft
5. Kapitel: Einigungsvertrag, Rücktritt als Außenminister und Vollzug der deutschen Einheit
Einigungsvertrag
Scheitern der Koalition und Rücktritt als Außenminister
Vollzug der Vereinigung
Ausblick
Die Einheit vollenden
Aufarbeiten der Vergangenheit
Integration der neuen Demokratien
Danksagung
Archive und Literatur
Archivquellen
Ausgewählte weiterführende Literatur
Personenregister
Endnoten
Abbildungsnachweis
ERSTER TEIL:
Jugend und Studienjahre in der DDR (1952–1980)
1. Kapitel: Herkunft, Kindheit, Jugend
Das Elternhaus
Hermersdorf war ein Mythos in unserer Familie. Es war die erste Pfarrstelle meines Vaters nach seiner Rückkehr aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft im Herbst 1949. Hier, in diesem kleinen Dorf am Rande der Märkischen Schweiz, begannen meine Eltern, Ernst-Eugen Meckel und Hedwig, geborene Schatz, Anfang 1950 ihr gemeinsames Leben. Acht Jahre vorher, am 22. Januar 1942, hatten sie in Gütersloh geheiratet. Es war eine typische Kriegsheirat. Mein Vater, Offizier der deutschen Wehrmacht an der Ostfront, hatte ihr geschrieben, sie war zu ihm nach Gütersloh gereist. Sie heirateten und verbrachten zwei gemeinsame Tage. Dann musste er zurück an die Front. Im September folgte die kirchliche Hochzeit in Berlin bei der Stadtmission in Neukölln.
Wie alle Soldaten hatte mein Vater bis zum Kriegsende nur wenig Fronturlaub. Er konnte meine Mutter also kaum sehen, ein Zusammenleben gab es damals nicht.
Am 9. Mai 1945, dem Tag nach der Kapitulation in Berlin, geriet er im Kurland in Lettland in sowjetische Gefangenschaft. Vom Vormarsch der Roten Armee auf Berlin abgeschnitten, hatte er in den letzten Wochen davor noch fürchterliche Schlachten erlebt. Er wurde in ein Lager hoch im Norden gebracht, wo er am Ladoga- und später am Onegasee an der finnisch-russischen Grenze im Wald arbeiten und Bäume fällen musste. Viele Kameraden kamen dort um. Nach zwei Jahren durfte er die erste Karte nach Hause schreiben. Doch es dauerte noch weitere zweieinhalb Jahre, bis er am 30. September 1949 nach Berlin, wo er seit 1937 lebte, zurückkehren konnte. Als er am Schlesischen Bahnhof, dem heutigen Ostbahnhof, ankam, lagen Jahre der Sehnsucht und des Hoffens hinter ihm und meiner auf ihn wartenden Mutter. Sie hatte in den Kriegsjahren in Forst an der Neiße in einem Kriegsblindenlazarett gearbeitet. Nach dem Krieg leitete sie als ausgebildete Kindergärtnerin und Hortnerin einen Kinderhort bei der Stadtmission.
Nach diesen schrecklichen Jahren des Krieges und der Gefangenschaft wurde Hermersdorf der Ort des gemeinsamen Anfangs. Obwohl wir Kinder noch ganz klein waren, als die Familie von dort wegzog – die Zeit dort blieb für die Eltern und uns ein lebenslanger Bezugsort der Familie. Zunächst bot jedoch das Pfarrhaus keinen Platz: 1945 war es mit Flüchtlingen aus dem Osten belegt worden, die auch noch Anfang 1950 darin wohnten. So fand mein Vater für die erste Nacht nur eine harte Kirchenbank und es brauchte einige Wochen, bis so viel Platz geschaffen war, dass er meine Mutter mit nach Hermersdorf holen konnte.
Ursprünglich wollte mein Vater als Missionar der Gossner-Mission nach Indien gehen. Es gibt ein Foto aus dem Jahr 1939, auf dem er neben dem Auto steht, das für diesen Dienst vorgesehen war, und dorthin eingeschifft werden sollte.
Seine erste theologische Ausbildung hatte er an seinem Heimatort, dem Wuppertaler Stadtteil Barmen, an der in pietistischer Tradition stehenden Evangelistenschule Johanneum erhalten. Dort war er zur Bekennenden Kirche gestoßen und hatte als Helfer die berühmte Barmer Synode miterlebt. Nach der Ausbildung arbeitete er bei dem missionarischen Jugendwerk CVJM (Christlicher Verein Junger Männer) in Erfurt und kam schließlich 1937 zur Berliner Stadtmission. In der Jugendgruppe in Berlin-Neukölln lernte mein Vater Hedwig Schatz aus Berlin-Britz kennen, seine spätere Frau.
Doch zunächst kam der Krieg dazwischen. Sein Vikariat bei der Bekennenden Kirche wurde durch die Einberufung zum Wehrdienst am 15. August 1939 abgebrochen. Er wurde eingezogen und machte erst einmal eine Ausbildung als Offiziersanwärter. Erst Ende 1940 wurde mein Vater zunächst nach Frankreich versetzt und schließlich – ab Juni 1941 – an die Ostfront in »Russland«, wie die Sowjetunion im Jargon genannt wurde. Als Batteriechef einer Einheit der Artillerie war er immer nah an der Front. Es ist ein Wunder, dass er das überlebt hat. Im Atlas meiner Mutter fand ich nach ihrem Tod eine Eintragung mit seiner Handschrift, teilweise mit Jahreszahlen versehen. Dort hat er ihr offensichtlich gezeigt und eingetragen, wo er im Krieg und später in der Gefangenschaft gewesen war: in Belarus, den baltischen Staaten und im Norden Russlands.
Mein Vater kam nach zehn Jahren in Krieg und Kriegsgefangenschaft als Pazifist zurück. Seinen Umgangsformen merkte man zwar den deutschen Offizier noch an, doch hatte er allem Militärischen gegenüber eine große Distanz entwickelt und die Friedensfrage war für ihn zentral geworden. Wie existentiell das war, zeigt vielleicht eine Begebenheit in den 1960er-Jahren. Einmal konnten wir Kinder ihn bei einem Betriebsausflug des Missionshauses auf einem Volksfest überreden, bei einer Schießbude für uns Blumen zu schießen. Er erbleichte, als er sah, dass er mit jedem Schuss eine Blume traf und ließ sich nie wieder auf so etwas ein. Karl Barth, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, Visser´t Hooft, Kurt Scharf und Gustav Heinemann – das waren die Männer der Kirche, denen er sich eng verbunden fühlte und deren Namen mir schon als Jugendlichem vertraut waren. Bonhoeffers Buch »Die Nachfolge« begleitete ihn in der Kriegsgefangenschaft. Über die eigene geistige Entwicklung, die eigenen Haltungen vor 1945 sowie über seine Erfahrungen in Krieg und Gefangenschaft sprach er jedoch wenig. Als Jugendlicher drückte er mir aber einmal Helmut Gollwitzers Buch »und führen wohin du nicht willst« in die Hand. Es war ein durchaus empathisches Buch über die Sowjetunion, die Erfahrungen und Auseinandersetzungen in der Gefangenschaft dort, aber eben doch sehr ehrlich und kritisch. Für den Besitz dieses Buches konnte man in der frühen DDR mehrere Jahre Gefängnishaft bekommen. In der Gefangenschaft hielt er oft Gottesdienste und sammelte Kameraden um sich zur Bibellese und zum missionarischen Gespräch. Ich habe aus dieser Zeit noch einen Abendmahlsteller und ein Kreuz aus Kupfer, die im Lager hergestellt worden waren.
Pfarrfamilie und Dorfleben
Hermersdorf war ein kleines Dorf, dessen Geschichte zum einen durch das Gut Wulkow, zum anderen durch selbständige Bauern bestimmt war. Die landwirtschaftlich geprägte Landschaft am Rande der Märkischen Schweiz – in der Nähe liegt etwa das schöne Städtchen Buckow – hatte schon vor dem Krieg Touristen aus Berlin angelockt. Im April 1945 ging die Front in einem dreimaligen Hin und Her über das Dorf hinweg, die Kirche aus dem 13. Jahrhundert ging in Flammen auf, nur die Grundmauern blieben stehen. Neben den Einheimischen war das Dorf voll von Flüchtlingen aus dem Osten. Das kirchliche Leben lag jedoch brach. Schon lange vor dem Krieg hatte es keinen Pfarrer mehr am Ort gegeben.
Eine Woche nach der Rückkehr meines Vaters war am 7. Oktober 1949 die DDR gegründet worden, im Frühjahr zuvor die Bundesrepublik. Die kirchlichen Strukturen waren jedoch weiterhin einheitlich und sollten es noch über viele Jahre bleiben. Als kirchlicher Dachverband umfasste die am 31. August 1945 in Treysa gegründete Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Landeskirchen in Ost und West. Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft hatte mein Vater zuerst ein Angebot, in ein Jugendpfarramt nach Hannover zu gehen. Die Eltern meines Vaters lebten in seiner Heimatstadt Wuppertal-Barmen, seine drei Geschwister im Rheinland und auch die Familie meiner Mutter lebte im Westen. Trotzdem entschied er sich für das Brandenburgische Hermersdorf. In der DDR gab es einen gravierenden Pfarrermangel. Viele Pfarrer waren im Krieg gefallen, viele in den Westen gegangen. Mit den Millionen Ostflüchtlingen kamen die ortsansässigen Gemeinden an den Rand des Verkraftbaren.
Mit der Entscheidung, in dieser schweren Zeit in die DDR zu gehen, stand mein Vater nicht alleine. Es gab mehr als 1000 evangelische Theologen, Vikare, Pfarrer, Diakone und Diakonissen, die in diesen Jahren dem Ruf der EKD folgten und aus Westdeutschland in die DDR zogen, um hier ihren Dienst zu tun. Nachdem das Sekretariat des Zentralkomitees der SED 1954 entschieden hatte, kirchlichem Personal wegen »westlicher Infiltration« keine Zuzugsgenehmigung mehr zu erteilen, fanden Pfarrer aus dem Westen nur noch sehr selten den Weg in die DDR.1
Die sowjetische Besatzungsmacht hatte in den ersten Jahren nach dem Krieg die evangelische Kirche zunächst mit einigem Wohlwollen behandelt. Die Bekennende Kirche wurde in ihrer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus gewissermaßen als Widerstand anerkannt und genoss durchaus Ansehen. Da die wichtigsten leitenden Positionen in den Kirchen in der SBZ und DDR zumeist mit Männern besetzt wurden, die aus der Bekennenden Kirche kamen, genehmigten die Besatzungsbehörden die Wiedererrichtung vielfältiger kirchlicher Institutionen, sowohl im diakonischen Bereich wie auch für die Ausbildung kirchlicher Mitarbeiter. Das half den evangelischen Kirchen in der DDR, ihren volkskirchlichen Charakter zu bewahren; sie hatten – im Vergleich zu den anderen evangelischen Kirchen im Ostblock – somit eine außergewöhnliche Position.
Die SED wollte nach 1949 die von den Besatzungsbehörden gewährte Rolle der Kirche wieder zurückdrängen. Spannungen und Konflikte bestimmten nunmehr verstärkt das Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Vor allem seit 1951/52 ging der SED-Staat mit aller Härte daran, seine atheistische Politik gegen Christen, Gemeinden und Kirchen durchzusetzen. Ein besonderes Augenmerk richtete sich gegen die evangelische Jugendarbeit in der DDR, die Junge Gemeinde. Dieser Kirchenkampf des Jahres 1952/53 hat tiefe Spuren in der Kirche hinterlassen. Die Gemeinden brauchten besondere seelsorgerliche und theologische Begleitung, Schutz und Stärkung. Mein Vater sah darin seine Berufung: Hier in der DDR, an dieser Stelle, wo das Christentum täglich ideologisch angefochten wurde, wollte er seinen Dienst tun; hier sah er seinen Ort und seine Zukunft. Die Entscheidung, in der DDR seinen Dienst zu tun, war eng mit seinem Glauben und mit den Erfahrungen in der Bekennenden Kirche verbunden. So soll schließlich auch meine Mutter mit den Worten »Du kennst die Russen, Du weißt, wie man mit ihnen umgeht!« zugestimmt haben.
Ihr eigener Vater war seit Januar 1945 in Polen vermisst. Das letzte Lebenszeichen kam aus Gory bei Plock, wo er an Schanzarbeiten beteiligt war, einer unsinnigen Abwehrmaßnahme gegen das Vorrücken der Roten Armee. Er kehrte nie zurück, meine Mutter hoffte noch lange Jahre auf ihn. Ihre jüngere Schwester Hanna war – wie ich vermute – zu Kriegsende vergewaltigt worden. Das war ein Tabu in der Familie und erschloss sich mir erst viel später. Es hieß immer nur, sie könne keinem Russen mehr begegnen. Sie lebte in Kassel, war lebenslang traumatisiert und kam nie wieder in den Osten. Wir Kinder haben sie nie kennengelernt.
In Hermersdorf entstand unsere große Pfarrersfamilie. Vier der fünf Kinder meiner Eltern wurden in diesen Jahren in der nahen Kleinstadt Müncheberg geboren. Mit großer Tatkraft machten sich meine Eltern gemeinsam daran, die großen Herausforderungen zu bewältigen. Beide verband ein tiefer Glauben. Ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus, das Vertrauen auf Gott, das frei macht, Halt bietet und Orientierung gibt in zentralen Fragen des Lebens, war beiden sehr wichtig. Sie begannen – wie auch später die ganze Familie – jeden Tag mit einem biblischen Wort und Gebet. Die Herrnhuter Losungen haben beide ihr Leben lang begleitet. Auch meine Mutter brachte sich als Pfarrfrau ganz in die aufbauende Gemeindearbeit ein und empfand dies als Erfüllung ihrer Hoffnung und Aufgabe. Als Kindergärtnerin ausgebildet war sie besonders in der Kinderarbeit aktiv. Sie leitete einen Mädchenkreis, gestaltete Kindergottesdienste und gab Unterricht für die Schulkinder in der Gemeinde, die sogenannte Christenlehre.
Wie mir meine Mutter später erzählte, war ihr gerade die gemeinsame Arbeit mit meinem Vater in der Gemeinde sehr wichtig. Bei seinen späteren Aufgaben war das so nicht mehr möglich – außer, dass sie für die vielen ökumenischen Gäste immer ein offenes Haus bereithielt.
Die meisten Kirchen östlich Berlins bis zur Oder waren beim Sturm der Roten Armee auf Berlin im April und Mai 1945 zerstört worden. Noch heute sieht man eine Reihe von ihnen als Ruinen, bei anderen wurde eine Notkirche gebaut. Mein Vater entschied sich früh, den nach den Wirren des Krieges und der Nachkriegszeit notwendigen Gemeindeaufbau mit dem Wiederaufbau der Kirchen des Pfarrsprengels zu verbinden. Die Hermersdorfer Kirche war bis auf die Grundmauern zerstört und musste völlig neu aufgebaut werden. In der damaligen politischen wie wirtschaftlichen Situation das notwendige Geld und Baumaterial zu bekommen, war nicht leicht. Nach den Aufräumarbeiten konnte im Frühjahr 1952 als erstes großes Fest in der geschmückten Ruine Konfirmation gefeiert werden. Zum Reformationsfest 1954 wurde schließlich die Hermersdorfer Kirche durch den Generalsuperintendenten Günter Jacob eingeweiht. Jacob war seit 1946 Generalsuperintendent der Neumark und seit 1949 zugleich Generalsuperintendent in der Niederlausitz mit Sitz in Cottbus. Er gehörte zu den profiliertesten Theologen dieser Zeit. Im Nationalsozialismus hatte er den Pfarrernotbund mitgegründet und war Teil des radikalen Flügels der Bekennenden Kirche. Wegen seiner Flugschrift »Wo stehen wir heute?« kam er mehrfach in Haft. In der SBZ und dann in der DDR erhob er furchtlos und zugleich selbstbewusst die Stimme gegen die Repression und atheistische Propaganda des Staates, aber auch gegen eine »muffige« und fromm-innerlich orientierte Kirche.
Ich erinnere mich, dass mir erzählt wurde, mein Vater hätte zu den »Jacobinern« gehört, wobei der Anklang an den radikalen Teil der Französischen Revolution nicht zu überhören war.
Zu Beginn des Jahres 1955 begann mein Vater seinen neuen Dienst, er wurde theologischer Leiter des Evangelischen Jungmännerwerkes in der DDR, dessen Dienststelle sich direkt neben der Berliner Sophienkirche in der Sophienstraße befand. Das Jungmännerwerk stand in der Tradition evangelikaler Jugendarbeit und war gewissermaßen der CVJM-Ost (da dieser selbst verboten war). Angesichts zunehmender atheistischer und antikirchlicher Propaganda verstärkte die Kirche in der christlichen Jugendarbeit ihre Anstrengungen, auf junge Menschen zuzugehen, um sie gegenüber der Ideologie und dem Druck des Staates widerständiger zu machen.
Gerade auf dem Feld der Friedenserziehung sah daher die Kirche ein wichtiges Arbeitsfeld, insbesondere wenn es um junge Männer ging. Sie waren in der neuen Arbeit meines Vaters der besondere Adressat, und zwar DDR-weit. In dieser Zeit geschah kirchliche Jugendarbeit noch vielfach nach Geschlechtern getrennt. Das »Burkhardthaus« war für die Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen zuständig, das »Jungmännerwerk« für Jungen und junge Männer. In den Jungen Gemeinden aber waren beide gemeinsam. Zu den wesentlichen Aufgaben meines Vaters gehörte ein intensiver Reisedienst: Jugendevangelisationen und Rüstzeiten – also mehrtätige Veranstaltungen und Seminare mit jungen Männern – standen im Zentrum dieser Tätigkeit. Aus Berichten in seinen Briefen geht hervor, dass zu solchen öffentlichen Veranstaltungen oft Hunderte von jungen Männern kamen – heute unvorstellbar! Als ich später selbst in der Kirche aktiv unterwegs war, sprachen mich immer wieder Pfarrer und andere Menschen an, für die mein Vater in ihrer Jugendzeit wichtig gewesen war. Er muss diese Aufgabe mit einer großen Ausstrahlung versehen und viele auf ihrem Lebensweg geprägt haben.
Ein Problem war nach diesem Dienstwechsel der Zuzug nach Berlin. Schon in den Jahren zuvor hatten die staatlichen Behörden mit der Verweigerung von Zuzugsgenehmigungen versucht, auf kirchliche Personalentscheidungen Einfluss zu nehmen. Das versuchten sie auch jetzt und verwehrten meinem Vater und der Familie den Zuzug nach Berlin. Nach langen vergeblichen Bemühungen, es doch noch durchzusetzen, zog die Familie, die bis dahin noch im Hermersdorfer Pfarrhaus gelebt hatte, 1956 nach Alt Rüdersdorf bei Berlin in ein kircheneigenes Gebäude. Aber auch dort war mein Vater selten. Wenn er nicht in Berlin war, war er in der ganzen DDR unterwegs.
Wie schon im Jahr zuvor war meine Mutter weitgehend allein mit uns vier Kindern. Nach meiner älteren Schwester Hanna und meinem jüngeren Bruder Hans-Martin war 1955 noch Ernst-Eugen geboren worden. Durch ihre Ausbildung als Kindergärtnerin war meine Mutter bestens gerüstet, unsere Kindheit vielgestaltig und glücklich zu machen. Von Alt Rüdersdorf aus zog sie gern mit uns an den Wochenenden los, jeder hatte einen selbstgenähten Rucksack auf dem Rücken. Es ging in die Wälder der Umgebung oder mit einem Motorschiff der »Weißen Flotte« auf die Gewässer der Umgebung Berlins. So war meine Mutter für uns Kinder die Hauptkontaktperson. Sie prägte unseren Alltag, war für uns da und hielt das Familienleben aufrecht.
Ein neues Umfeld: Missionshaus und Ökumene
1959 wechselte mein Vater erneut seinen Dienst und wurde Missionsinspektor der Berliner Mission. Das Missionshaus, das heute Sitz des Konsistoriums und des Bischofs ist, liegt in der Georgenkirchstraße am Berliner Königstor, unweit vom Alexanderplatz. Dorthin konnte nun auch die Familie ziehen. Hier wurde ich 1959 eingeschult. 1960 wurde hier meine jüngste Schwester Cornelia geboren.
Mein Vater war unter anderem zuständig für die jungen Partnerkirchen in Südafrika. Er sollte ihnen beim Aufbau der Organisationsstruktur und der Ausbildung ihres Personals helfen, die Kontakte nach Deutschland verstetigen und dafür angemessene Formen finden. Nach wie vor gab es in Afrika Missionare, die in diesen selbständig werdenden Kirchen arbeiteten. Mit dem Mauerbau 1961 wurde es jedoch immer schwieriger, diese überseeischen Angelegenheiten von Ostberlin aus zu leiten. Ende der 1960er-Jahre wurde dann die internationale Arbeit in den Westen Berlins verlagert. Dort entstand das »Berliner Missionswerk«. In unserem Haus blieb das »Ökumenisch-Missionarische Zentrum«, das über ökumenische Entwicklungen in den Gemeinden informierte sowie ökumenische Partnerschaften einleitete und diese betreute.
Gleichzeitig begann mein Vater 1959 als Referent für Ökumene in der Evangelischen Kirche der Union (EKU).2 Die EKU war ein Zusammenschluss verschiedener evangelischer Landeskirchen in Ost- und Westdeutschland. Sie war 1953 als Nachfolgerin der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union gegründet worden, die wiederum ein Ergebnis der Unionspolitik des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. war. Dieser hatte 1817 die lutherischen und reformierten Gemeinden Preußens »zwangsvereinigt« und diese Union, in der sich beide Konfessionen gegenseitig anerkannten, administrativ zusammengeführt. Jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, saß der Präsident der EKU im Osten Berlins, in der Auguststraße, wo mein Vater seinen zweiten Dienstsitz hatte. Bei Dienstantritt stellte mein Vater überrascht fest, dass der damalige Präsident der EKU, Franz Reinhold Hildebrand, noch einen zweiten Ökumenereferenten angestellt hatte: Ferdinand Schlingensiepen, der aus London nach Berlin zog und für die westlichen Kontakte zuständig war. Er wurde später auch ökumenischer Berater für Kurt Scharf, den Bischof von Berlin-Brandenburg. Diese intransparente Personalpolitik Hildebrandts hätte auch schief gehen können! Doch schon bald verband Ferdinand Schlingensiepen und meinen Vater eine enge Freundschaft, die auch die Familien einbezog – und auch Jahrzehnte nach dem Tod meines Vaters bis heute anhält.
Leben im Missionshaus
Das Leben im Berliner Missionshaus war für uns Kinder faszinierend. Es war ein abgeschirmter sozialer Raum. Die Kinder der im Haus lebenden Familien und der große Hof waren in den ersten Schuljahren der bevorzugte Kommunikationsrahmen. Wir bildeten Banden, bauten im Herbst Laubhütten und kämpften – wenn nötig – gemeinsam mit Stöcken gegen die Kinder der umliegenden Straßen. Die Familien Meckel, Brennecke, Pietz, Wekel und Althausen hatten viel Kontakt miteinander. Dabei spielten die Frauen eine wesentliche Rolle. Sie trafen sich reihum monatlich zum »Näh-Kreis«, bei dem die verschiedensten Produkte für den jährlich stattfindenden »Missionsbasar« hergestellt wurden; es wurde gestrickt, genäht, bestickt und gehäkelt.
Musik spielte in unserer Familie eine dominante Rolle.Schon in früher Kindheit erinnere ich mich an das Singen von Chorälen und Volksliedern, die mein Vater auf dem Harmonium oder dem Klavier begleitete. Meine Mutter lehrte uns in den ersten Berliner Jahren Blockflöte zu spielen, so dass wir recht schnell schon in mehrstimmigen Sätzen musizieren konnten. Bald kam das Klavier dazu. Meine Schwester Hanna und ich erhielten Klavierunterricht bei Fräulein Schmidt, einer älteren Dame in der Prenzlauer Allee. Mehrere Missionshauskinder gingen dorthin und von Zeit zu Zeit gab es Vorspielstunden, zu denen dann auch die Eltern kamen. 1964 suchte die Kantorei der Berliner Marienkirche Kinder für das »Oh, Lamm Gottes unschuldig« im Eingangschor der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Die drei größeren Geschwister unserer Familie ließen sich überzeugen, ebenso die der Familie Pietz, und es begann eine lange Mitgliedschaft in diesem Chor. Über die Jahre hinweg sangen wir hier regelmäßig das Weihnachtsoratorium von Bach, seine Passionen, das Brahms’sche »Deutsche Requiem« und vieles andere. Wir liebten unseren Kantor, Kirchenmusikdirektor Heinz Georg Oertel, bei dem ich schließlich auch Orgelunterricht nahm. Mit neun Jahren begann ich im Posaunenchor Trompete zu spielen. Das Blasen wurde dann besonders wichtig für mich, als der Jugenddiakon der benachbarten Advent-Gemeinde, Peter Ellert, und der damalige Berliner Stadtjugendwart Heinz Scholz Posaunenfahrten ins Brandenburgische Umland unternahmen. Seit 1965 zogen wir jedes Jahr etwa zwei Wochen lang mit dem Fahrrad durchs Brandenburger Land. Auf dem Gepäckträger und Rücken alles, was wir zum Spielen und für die Reise brauchten, fuhren wir von Ort zu Ort und gestalteten dort abends Posaunenfeierstunden und Gottesdienste. Untergebracht waren wir meist bei Gemeindemitgliedern auf den Bauernhöfen. Das war eine herrliche und unvergessliche Erfahrung. Noch heute ist der Geruch von reifem Getreide für mich mit diesen Posaunenfahrten verbunden. Vor allem in die Uckermark gingen mehrere dieser Fahrten, die Region im Norden Brandenburgs, die später für fast zwei Jahrzehnte mein Wahlkreis für den Bundestag wurde.
In der sozialistischen Schule
1959 wurde ich in Berlin eingeschult. In die nicht weit vom Missionshaus entfernte Schule gingen fast alle Kinder aus dem Haus. Die Lehrer in unserer Schule hatten sich daran gewöhnt, in jeder Klasse mindestens ein Kind aus dem Missionshaus zu haben. Insofern unterschied sich meine Erfahrung stark von der anderer christlicher Schüler, die oft allein in der Klasse waren, weder der Pionierorganisation noch der FDJ angehörten und es deshalb oft schwer hatten.
Als ich später Pastor in Vipperow an der Müritz wurde, war die Schulsituation für meinen Sohn Konrad sehr viel typischer für die DDR. Er kam Mitte der 1980er-Jahre in die Schule. Wir, seine Eltern, wollten nicht, dass er Pionier wird. Das führte dazu, dass er der erste und einzige Nichtpionier der Schule seit vielen Jahren wurde. Wir machten uns damals viele Gedanken, ob er das verkraften würde. Es gehörte für die Kinder viel innere Kraft dazu, solche Außenseiterrollen zu ertragen. Viele Unternehmungen und Spiele im Klassenverband, die unter normalen Verhältnissen eine Sache der Klassengemeinschaft gewesen wären, wurden im Rahmen der Pionierorganisationen veranstaltet. Das ging von kulturellen Veranstaltungen über Zoobesuche bis hin zur Gestaltung der Zeugnisausgabe am Jahrgangsende durch einen Offizier der Nationalen Volksarmee.
Kirchliche Jugendarbeit
In der Bartholomäusgemeinde gab es eine sogenannte Jungschargruppe, eine Jugendgruppe für Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Wir trafen uns wöchentlich. In den Ferien oder an den Wochenenden fuhren wir oft gemeinsam zu Rüstzeiten. Einmal im Jahr fand im Garten des Missionshauses ein großer Jungschartag statt, an dem viele Jungen teilnahmen. Organisiert wurde das vom Jungmännerwerk und den Landesjugendwarten Horst Reichelt und Johannes Kutschbach, der für mich zu einem väterlichen Freund wurde. 1966 nahm ich an Schulungskursen für Jugendmitarbeiter teil und gehörte mit 14 Jahren erstmalig zum Leitungskreis einer Jungscharrüstzeit. In einem weithin bekannten kirchlichen Jugendheim, in Hirschluch in Storkow/Mark, hielt ich vor 80 Jungen mit zitternden Knien meine erste Andacht.
In der Jugendarbeit des Jungmännerwerkes waren Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi und Martin Luther King hoch verehrte Persönlichkeiten und Vorbilder. Später kamen Dietrich Bonhoeffer und die jungen Widerstandskämpfer der »Weißen Rose« hinzu. Wir lebten in dem tiefen Bewusstsein, dass es von zentraler Bedeutung ist, bereit zu sein, für seinen Glauben und für seine Überzeugungen Risiken und Leid auf sich zu nehmen.
Sehr beeindruckt hat mich, als wir Jugendhelfer von Johannes Kutschbach, dem Landesjugendwart, aufgefordert wurden, Bibeln und Gesangbücher zu sammeln, damit sie in die Sowjetunion geschmuggelt werden können. Sie waren bestimmt für die Wolgadeutschen, die von Stalin nach Kasachstan verschleppt worden waren. Es wurde erzählt, dass sie dort Lieder und sogar die Bibel handschriftlich abschrieben, weil sie keine kaufen konnten. In meinen Unterlagen fand ich bei meinen Vorbereitungen für dieses Buch noch einen Brief aus Kasachstan von 1969: »Liebe Geschwister, Ich komme mit einer Bitte an euch, ich wünsche mir eine Deutsche Bibel. Mit herzlichem Gruss Ida Schiller«. Erst viel später erfuhr ich, dass mein Vater selbst solche Aktivitäten organisierte. Anfang der 1970er-Jahre bildete er eine Arbeitsgruppe von Vertretern des Gustav-Adolf-Werkes in Leipzig und der EKU, die bei Privatreisen Informationen zu evangelischen Gruppen sammeln und Kontakte herstellen sollte. Auch Baptisten arbeiteten mit. Hier wurde geheime Unterstützung organisiert. Diese Arbeit sollte völlig verdeckt geschehen, war aber durch einen Teilnehmer der Staatssicherheit bekannt.
Im Jahr 1964 wurde mir die Möglichkeit zuteil, Martin Luther King persönlich zu erleben. Er war vom Regierenden Bürgermeister Willy Brandt nach Westberlin eingeladen worden, erhielt von der Kirchlichen Hochschule in Zehlendorf einen Ehrendoktor und hielt eine große Rede auf der Waldbühne. Sein Wunsch war es jedoch, auch in den Osten der Stadt zu kommen. Die amerikanische Militäradministration war nicht begeistert von Kings Wunsch – und organisierte es, dass er im entscheidenden Augenblick seinen Pass nicht bei sich hatte. King fuhr trotzdem an die Grenze – und die überraschten Grenzpolizisten der DDR ließen ihn schließlich passieren, seine Identität mit der Kreditkarte ausweisend.
Martin Luther King predigte in der Berliner Marienkirche. Mein Vater hatte mich dorthin mitgenommen. Ich erinnere mich noch an die besondere Atmosphäre; die Kirche war völlig überfüllt. Weil der Andrang so groß war, wurde schließlich entschieden, dass Martin Luther King im Anschluss einen weiteren Gottesdienst in der nicht weit entfernten Sophienkirche hielt. Erst vor wenigen Jahren tauchte im Archiv der Staatssicherheit eine Aufnahme der damaligen Predigt von Martin Luther King in der Marienkirche auf. Es war für mich sehr bewegend, diese Predigt nach Jahrzehnten wieder, und erstmalig verstehend, zu hören. King bekräftigte – damals, in diesen heißesten Zeiten des Kalten Krieges –, dass auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder lebten und es wichtig sei, Brücken zu bauen. Eine Botschaft, die zu dieser Zeit auf beiden Seiten wenig Freude verursachte, aber bei den Hörern in beiden Kirchen Ostberlins durchaus Hoffnung machte und Trost spendete. Als Martin Luther King 1968 ermordet wurde, erschütterte uns das zutiefst.
Mauerbau und Leben im geteilten Berlin
Der Mauerbau am 13. August 1961 war für meine Eltern ein Schock und muss für sie ein tiefer Einschnitt in ihre Lebenswelt gewesen sein. Zwar hatte sich ihr Leben bis dahin schon lange weitgehend im Osten abgespielt, doch war es gleichzeitig – durch Herkunft, Kontakte und Selbstverständnis – von dem gesamtdeutschen Zusammenhang geprägt, sowohl privat wie in der kirchlichen Arbeit. Jetzt, mit dem Mauerbau, war für beide Eltern ein großer Teil ihrer Lebenswirklichkeit regelrecht amputiert worden. Das hat sie schwer getroffen.
In der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre, als in Berlin wieder Besuche von West nach Ost möglich wurden, wurde das Missionshaus in der Georgenkirchstraße und auch unsere Wohnung zu einem Ort der Begegnung zwischen Ost und West. Viele Gemeinden aus der ganzen DDR trafen sich bei uns im Haus mit ihren Partnergemeinden aus Westdeutschland, besonders zu der Zeit, als es noch schwierig war, Einreisen in die »Ostzone«, in die DDR außerhalb Berlins zu bekommen.
Als Ökumenereferent der EKU und später im entsprechenden Arbeitsbereich des »Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR« tätig, hatte mein Vater schon früh einen Schwerpunkt seiner Arbeit in den Kontakten nach Osten. Oft war er in Polen, der CSSR, Ungarn, Rumänien, Bulgarien oder der Sowjetunion. In Zusammenarbeit mit dem Leipziger Gustav-Adolf-Werk, ein Hilfswerk der Evangelischen Kirche, das sich besonders um evangelische Diasporakirchen kümmerte, und dem Lutherischen Weltbund besuchte mein Vater die protestantischen Minderheitenkirchen in diesen Ländern und suchte nach Möglichkeiten, sie zu unterstützen. Dies geschah auf vielfältige Weise, und nicht alles war »legal«. Er vermittelte Kontakte, Stipendien, Studienaufenthalte, Unterstützung beim Aufbau von Bibliotheken und vieles andere mehr. Er war der theologische Sekretär der »Sagorsk-Gespräche« zwischen den Kirchen in der DDR und der Russisch-Orthodoxen Kirche. Auf deutscher Seite gründete er den »Melanchthon-Kreis«, eine Gruppe von Theologen und Studenten, die sich dem Studium und den Kontakten mit der orthodoxen Welt des Ostens widmete.
Meine ersten Reisen in die östlichen und südöstlichen Nachbarländer machte ich mit meinem Vater. 1966 fuhr die Familie mit ihm nach Polen. Wir besuchten die kleine protestantische Kirche dort, zu der auch noch viele in Polen verbliebene Deutsche gehörten. Es war eine lange Rundreise: über Stettin, Stolp, Danzig, Warschau, Wisla in den Beskiden und Breslau zurück nach Berlin. Mich erstaunte, wie wenig in den ehemaligen deutschen Gebieten wiederaufgebaut war. Man war sich damals noch nicht sicher, ob die Grenze Bestand haben würde. Ich erinnere mich, dass ich in einem Wald bei Stolp (Slupsk) dachte: »Dies wäre alles noch deutsch, wenn es Hitler nicht gegeben hätte!« Soviel hatte ich offensichtlich damals schon verstanden, dass ich Hitler für diese Gebietsverluste die Verantwortung zuschrieb und nicht den Polen. 1968 waren wir als Familie mit dem Vater in Ungarn. Hier erinnere ich, dass mich erschütterte, dass manche Pfarrer mehr Angst vor ihrem eigenen Bischof hatten als vor den staatlichen Stellen. Die für mich wesentliche Erfahrung in der DDR, dass Kirche der gemeinsame Schutzraum gegen staatliche Einflüsse und Eingriffe ist, galt dort offensichtlich nicht.
1971 begleitete ich die Eltern nach Siebenbürgen. Sie machten dort mit Freunden meines Vaters Urlaub, erst mit Prof. István Juhász, einem ungarischen Professor für Kirchengeschichte aus Klausenburg (Cluj), und seiner Frau, später noch ein paar Tage mit Prof. Hermann Binder, dem Neutestamentler der Theologischen Hochschule in Hermannstadt (Sibiu). Über Prof. Juhasz lernte ich seinen Assistenten János Herman kennen und wir waren gemeinsam im Land unterwegs. Die Freundschaft mit ihm hält bis heute. Dieser Besuch beeindruckte mich sehr, insbesondere das Miteinanderleben der verschiedenen Ethnien in Siebenbürgen und die damit verbundenen Prägungen und Schwierigkeiten. So kehrte ich in den darauffolgenden Jahren immer wieder dorthin zurück.
Die Kommunikation zu Hause war jedoch mitnichten auf den Osten beschränkt. Auch in die westliche Welt gab es vielerlei Kontakte. Als für Südafrika zuständiger Referent der Berliner Mission brachte mein Vater immer wieder Afrikaner und Missionare von dort zu uns nach Hause. Da ging es am Abendbrottisch auch um die Apartheidpolitik. Einen dieser Missionare, Christian Fobbe, der später als Gegner der Apartheid aus Südafrika ausgewiesen wurde, hatte ich besonders ins Herz geschlossen. Per Post schickte er mir einen afrikanischen Schild und Speer, der noch heute in unserem Landhaus hängt, und zwei geschnitzte Vögel aus Horn, die in meinem Bücherregal stehen.
In seiner Funktion als Ökumenereferent der EKU war mein Vater wesentlich beteiligt am Aufbau der Partnerschaft zwischen der EKU und der »United Church of Christ« (UCC) in den USA, einer ebenfalls unierten Kirche. Ich erinnere mich an den Besuch von Pastor Harald Wilke, einem sehr eindrücklichen Mann aus der Führung dieser Kirche. Er hatte keine Arme – und bewegte sich völlig selbständig und selbstbewusst. Er aß mit uns am Tisch mit Messer und Gabel – mit den Füssen! Er erzählte von seiner Mutter, der er sehr dankbar sei, dass sie ihn eisern zur Selbständigkeit erzogen habe. Das war wie ein Lehrstück fürs Leben! Nach seiner Pensionierung engagierte sich Wilke für Menschen mit Behinderungen und gründete in den USA die Organisation »The Healing Community«. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass in den USA seit 1990 die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung verboten ist.3
Diese Internationalität, die ich ganz selbstverständlich in der heimischen Wohnung kennenlernte, war ein Reichtum, für den ich bis heute zutiefst dankbar bin. Das war etwas völlig anderes als das, was sonst in der provinziellen DDR erfahren wurde. Erst nach und nach merkte ich, in welcher privilegierten Umwelt ich groß geworden war. Auch hat mich diese Jugenderfahrung davor bewahrt, nur die eigene Schwierigkeit im Land als Maßstab zu sehen; sie war eine Schule gegen die Nabelschau. Gewiss, es war nicht leicht in der DDR. Aber die Schicksale anderer Menschen in anderen Ländern waren oft viel schwerer. So ist es mir von Kindheit an vertraut, die eigene Situation und die des eigenen Landes ins Verhältnis zu setzen mit dem, was woanders geschieht. Die eigenen Probleme werden so relativiert.
Totale Wehrdienstverweigerung
Nach der Einführung der Wehrpflicht in der DDR 1962 wurde man im Alter von 17 Jahren gemustert. In der Jugendarbeit des Jungmännerwerkes hatten wir über die Friedensfrage und den Wehrdienst intensiv diskutiert. 1964 war es den Kirchen in der DDR – als einzigem Land im sogenannten sozialistischen Lager – gelungen, dass die DDR einen waffenlosen Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee (NVA) einführte, den Dienst als »Bausoldat«.4 Nach vielen Gesprächen zu Hause und mit Johannes Kutschbach, »meinem« Landesjugendwart, kam ich zu dem Entschluss, auch selbst den Wehrdienst total zu verweigern. Um auf mögliche Diskussionen auf dem Wehrkreiskommando besser vorbereitet zu sein, schrieb ich schon vor dem Musterungstermin im März 1970 meine Begründung und gab sie schriftlich ab.5
Für den Fall der Einberufung zum Wehrdienst wurde man für die Verweigerung normalerweise zu 20 bis 24 Monate Gefängnis verurteilt. Dieser Kelch ist jedoch an mir vorübergegangen. Einberufen wurde ich nicht. 1976 wurde ich schließlich ausgemustert.
Graues Kloster
Nach dem Abschluss der achten Klasse bewarb ich mich an der 2. Erweiterten Oberschule Berlin-Mitte, um Abitur zu machen. Dies war das alte »Graue Kloster«, die einzige Schule in Ostberlin, an der noch Latein und Griechisch gelehrt wurde. Diese Sprachen brauchte ich für das Theologiestudium und wollte sie so früh wie möglich lernen. Die alte Klosterschule, neben der – heute noch als Ruine erhaltenen – Klosterkirche in Berlin Mitte, unweit des Alexanderplatzes und des Roten Rathauses gelegen, war im Krieg zerbombt worden und letztendlich in die Niederwallstraße umgezogen (ganz in der Nähe des heutigen Auswärtigen Amtes). Als 1957 Jahre fast ein ganzer Schülerjahrgang nach dem Abitur in den Westen ging, erregte das Aufmerksamkeit und Ärger bei der SED. Der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht ereiferte sich darüber im Zentralkomitee der SED. Im Gefolge wurde die Schule degradiert, der traditionsreiche Name wurde ihr 1958 aberkannt und ein großer Teil der alten Lehrer musste die Schule verlassen. Sie wurde zur ganz normalen 2. Erweiterten Oberschule Mitte, doch wurde weiter Latein und Griechisch gelehrt. Zwar gab es neben dem altsprachigen noch weitere Zweige mit anderem Profil – auch solche mit dem Schwerpunkt auf Russisch –, im Bewusstsein der meisten Lehrer und Schüler blieb jedoch die Tradition des Grauen Klosters präsent. An der Schule erhielt sich in gewisser Weise ein außergewöhnlicher Charakter. Kinder aus DDR-kritischen Familien trafen hier auf solche der Funktionseliten des Systems. Das ergab eine besondere Mischung. Als ich 1967 dort eingeschult wurde, war für alle Schüler klar: Wir sind Schüler des Grauen Klosters!
Mein neuer Klassenlehrer, Karl Jüling, sprach mich gleich persönlich an: Er, selbst Sohn eines Predigers, kenne die Probleme solcher Herkunft und wollte mir den langen und schweren Weg in diese neue Zeit ebnen und mich schulen. Meine Erinnerung ist, dass er mir helfen wollte, mich auf den komplizierten Weg zu begeben, zu einem Kommunisten zu werden. Jedenfalls aber nahm er mich in eine harte Schule. Jeden Donnerstag, zur Politinformationsstunde, die in der Verantwortung des Klassenlehrers stand und nicht des Lehrers für Staatsbürgerkunde, rief er mich auf und befragte mich zur jeweils aktuellen politischen Situation: »Markus, was sagen Sie darüber?«
Ich stand auf – und sagte offen, was ich dachte. Ungewöhnlich für den Schulalltag dieser Zeit! Er argumentierte dagegen – und ich hatte schließlich keine Argumente mehr. Ein Jahr lang verlor ich diesen argumentativen Test Woche für Woche und setzte mich beschämt. Am Ende des neunten, des ersten Schuljahres an dieser Schule, ging es dann in der Politinformationsstunde um die Erhöhung des Zwangsumtausches für Bürger aus Westdeutschland und Westberlin. Und siehe da: Diesmal hatte der Klassenlehrer keine Argumente mehr. Ich ging erstmalig aus dieser »Schlacht« als Sieger hervor. Es gab keinerlei Disziplinierung. Mit stolzgeschwellter Brust setzte ich mich und erzählte es später weiter. Das war ein Durchbruch! Solche Fairness war an einer sozialistischen Schule durchaus ungewöhnlich. An anderen Schulen wäre man längst für solche Positionen, wie ich sie vertrat, der Schule verwiesen worden.
Die Klasse an dieser Schule war eine völlig andere als an der alten Schule. Hier waren lauter Schüler, die etwas wollten, sich einbrachten mit ihren Interessen und ihrer Persönlichkeit und auch über den Schulbereich hinaus Kontakt suchten. Dazu hatte ich keine Zeit, war in anderen Bereichen zu beschäftigt. Doch an der Schule selbst war nun alles viel lebendiger, ich erhielt Anregungen, mit denen ich nicht gerechnet hatte, und lernte durch einige Lehrer und die Klassenkameraden andere Horizonte kennen.
In diese Schulzeit fiel auch der »Prager Frühling« 1968. Er erweckte bei uns zu Hause und allen, mit denen ich verkehrte, große Hoffnungen, auch bei vielen Mitschülern. Sollte es wirklich möglich sein, einen »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« zu errichten? Ich diskutierte auch an der Schule offen und ohne Vorbehalte. Doch waren hier plötzlich Grenzen der offenen Aussprache spürbar. Ich spürte die Angst, das Falsche zu sagen. Im August leitete ich in Lobetal bei Bernau eine Jungscharrüstzeit mit. Ich könnte noch heute zeigen, wo ich dort die Nachricht vom Einmarsch der Truppen in Prag erhielt – es war ein tiefer Schock. Nach der Sommerpause sollte unsere Klasse (wie alle anderen an der Schule auch) eine Stellungnahme zum Einmarsch abgeben. Nach intensiven Diskussionen beschloss die ganze Klasse, keine solche abzugeben. Susanne Rummel musste das als zuständiges Mitglied der FDJ-Leitung vor den Lehrern verkünden. Es geschah – nichts! Ich vertrat in der Schule offen meine Meinung, unternahm sonst aber nichts, was ich mir selber übelnahm. An meiner Schule aber gab es Schüler oberer Klassen, die mutiger und aktiver waren: Rosita Hunzinger, Tochter der bekannten Bildhauerin Ingeborg Hunzinger, und Erika Berthold, Tochter von Lothar Berthold, dem Direktor des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, der dann auch seine Stelle verlor. Sie verteilten mit Thomas Brasch, Bettina Wegener, Frank Havemann und anderen Freunden Flugblätter, wurden zu Haftstrafen verurteilt und der Schule verwiesen.
Auch wenn ich damals selbst nicht an Aktionen gegen den Einmarsch in der CSSR beteiligt war, so half es nichts. Später fand ich im Nachlass meines Vaters einen Brief vom Magistrat von Groß-Berlin, Abteilung Volksbildung, in welchem man ihm schon im Februar 1969 erklärte hatte, dass man mich nicht in die Abiturstufe delegieren werde. Man hatte erwartet, »daß Markus ernsthafte Anzeichen zeigt, sein gesellschaftliches Gesamtverhalten zu verändern. […] Leider müssen wir feststellen, daß sich Ihr Sohn seiner gesellschaftlichen Verpflichtung nicht bewußt ist und auch keine Entwicklung in dieser Hinsicht zeigt.« Da half dann auch kein Abschluss der 10. Klasse mit »Sehr gut«, ich musste die Schule verlassen.
Abitur auf Hermannswerder
Hätte ich Mathematiker oder anderes werden wollen, wäre dieser Berufswunsch mit der Verweigerung, Abitur machen zu dürfen, passé gewesen. Für mich aber, der ich Pastor werden wollte, gab es einen Ausweg. Auf jeweils unterschiedlichem institutionellem Hintergrund und deshalb auch mit sehr verschiedenen Namen gab es vier kirchliche Schulen in der DDR, die für mich zur Auswahl standen: die »Proseminare« in Naumburg und Moritzburg, das »Missionshaus« in Leipzig und das »Kirchliche Oberseminar« in Potsdam. Der Abschluss dieser Schulen durfte sich nicht Abitur nennen und war als solcher auch nicht anerkannt, obwohl die Ausbildung dort auch dazu diente, junge Menschen an die Hochschulreife heranzuführen. Die kirchlichen Schulen ermöglichten den Mädchen und Jungen, die nach der 8. oder 10. Klasse aus dem sozialistischen Bildungssystem herausfielen, ihre Ausbildung weiterzuführen. Für Theologen, Kirchenmusiker und Katecheten gab es daran anschließend weitere Institutionen, an denen auch das Studium oder der Berufsabschluss absolviert werden konnte.
Ich entschied mich, an das Kirchliche Oberseminar nach Potsdam-Hermannswerder zu gehen. An der Schule gab es ein Internat, in dem ich die Woche über blieb. Es dauerte nicht lange, dass sich – anders als es vorher am Grauen Kloster gewesen war – der Schwerpunkt meines Lebens ganz nach Potsdam verlagerte, so wohl fühlte ich mich in der dortigen Gemeinschaft, so sehr nahm mich auch geistig diese neue Welt in Anspruch.
Die Ausbildung war frei von staatlicher Einflussnahme. Es gab keine Ideologie, keine Vorgaben. Der Schwerpunkt lag auf den geisteswissenschaftlichen Fächern. Die Klassen waren klein, die Lehrer engagiert, sie schufen eine Atmosphäre des Interesses, der Partizipation und großer Offenheit, die sonst in diesem Land kaum zu finden war. Das hat mich und viele maßgeblich geprägt. Man fühlte sich geistig unter Seinesgleichen und war an dieser Schule zu Hause – wir lebten damit nicht nur geographisch auf einer Insel.
Es gab natürlich auch Konflikte an diesem Haus, zum Teil sogar schwere. Kurz vor Weihnachten 1969 etwa wurde Dieter Liebig, ein Seminarist, von dem interimistischen Rektor, Oberkirchenrat Kunkel, des Unterrichts verwiesen. Er sollte geschwänzt haben; er selber sagte jedoch, er sei beim Arzt gewesen. Alle drei Klassenstufen solidarisierten sich mit ihm – wir streikten. Christian Funke, Mathematik- und Physiklehrer am Oberseminar, meinte, jetzt käme wohl der Geist der westdeutschen Außerparlamentarischen Opposition, der APO, an die Schule. Wir wurden nach Hause geschickt, das Oberseminar geschlossen – Ausgang offen. Doch irgendwann im Januar ging der Lehrbetrieb weiter, mit Walter Schulz, dem neuen Rektor, der aus Mecklenburg kam. Schulz brachte einen neuen Geist der Bereitschaft zur Veränderung und Reform mit. Ein besonderes Verhältnis hatte ich zu Werner Koltzer, dem Geschichts- und Deutschlehrer, der gleichzeitig Internatsleiter war, er wurde mir zu einem wichtigen Vertrauten. Umso unfassbarer ist es für mich bis heute, dass gerade er über viele Jahre Berichte für die Staatssicherheit über Kollegen und Seminaristen geschrieben hat. Ich konnte mich bis heute nicht überwinden, in diese Akten zu schauen.
Das Kirchliche Oberseminar war mitten in der Diktatur ein Ort der Freiheit, ein Ort engagierten Sich Bemühens um Erkenntnis, an dem auf breiter Grundlage und auf vielfältige Weise Interesse an dieser Welt in ihren Zusammenhängen geweckt und weitergegeben wurde.
Freiheit hatte in der DDR in den vorgegebenen gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen keinen Ort. Entsprechend schwierig war es auch mit den Menschen, die von solcher Freiheit geprägt waren – auch sie hatten es schwer, ihren Ort in diesem Land zu finden. Wer nicht Theologie studieren und in den Dienst der Kirche treten wollte, hatte kaum eine Chance, eine seiner Bildung entsprechende berufliche Existenz zu finden. So fanden sich – insbesondere wohl in den 1980er-Jahren – viele, sehr viele, die hier das Abitur abgelegt hatten, nach Ausreiseantrag oder Flucht im Westen wieder.
2. Kapitel: Studentenzeit 1971 – 1980
Studentenleben in Naumburg
Zum Abschluss und Abitur feierten wir in Hermannswerder ein rauschendes Fest, bei dem wir Abiturienten mit einzelnen Szenen verabschiedet wurden. In Anspielung auf mein bald beginnendes Studium in Naumburg wünschte man mir eine gute Zeit mit beiden Utas. Die eine Uta war meine Freundin aus Potsdam-Babelsberg, deren Vater dort die diakonische Einrichtung das »Oberlinhaus« leitete. Sie ging ebenfalls nach Naumburg, um am »Proseminar« ihr – staatlich nicht anerkanntes – Abitur zu machen. Die andere Uta war die berühmte Stifterfigur im Naumburger Dom. Diese Stifterfiguren sowie der Westlettner, eine gotische Chorschranke, gehören zum Berühmtesten, was Naumburg zu bieten hat. Deshalb wurde der Naumburger Dom auch 2018 in die UNESCO-Welterbe-Liste aufgenommen. Den Dom kennenzulernen, die Stifterfiguren auf sich wirken zu lassen und ein Stück mit ihnen zu leben, war für mich und viele andere Studenten in den kommenden Jahren bewegend und von großer Bedeutung. Das »Katechetische Oberseminar Naumburg«, mein künftiger Studienort, lag direkt neben dem Dom. Zum Oberseminar gehörte die romanische Ägidienkapelle, in der die täglichen Andachten stattfanden. Die herrliche Akustik regte zu gemeinsamem Gesang an. In ihrer beeindruckenden Schlichtheit und Ausdruckskraft war sie das geistliche Zentrum dieses Ortes und stand mit dem nahen Dom in einer besonderen Beziehung.
Das »Katechetische Oberseminar Naumburg« war nach dem Zweiten Weltkrieg speziell für die Ausbildung von katechetischen Fachkräften gegründet worden. Nachdem der Religionsunterricht an den Schulen abgeschafft worden war, brauchte die Kirche einen eigenen Ort, an dem das eigene Fachpersonal für die Christenlehre ausgebildet wurde. Aus diesen Anfängen entwickelte sich dann das Oberseminar immer stärker in Richtung einer Theologischen Hochschule, denn der Bedarf einer eigenen Pastorenausbildung wuchs mehr und mehr. Der Name blieb, ihn hatte die Sowjetische Besatzungsmacht zugelassen, geändert werden konnte er nur mit einer neuen Genehmigung, die zu erhalten aber nicht möglich war. Neben dem Oberseminar gab es in Naumburg auch das bereits erwähnte Proseminar. Mit zwei solchen Ausbildungsstätten, zwei bedeutenden Kirchen – dem Dom und der St. Wenzelskirche – sowie dem Dienstsitz des Superintendenten und des Propstes war die Kleinstadt Naumburg ein Zentrum kirchlichen Lebens. Ich wurde in dieser Atmosphäre schnell heimisch.
Anders als an den staatlichen Universitäten gab es an den Theologischen Hochschulen keine festen Stundenpläne. Außer dem Sprachunterricht war jeder frei in der Belegung von Lehrveranstaltungen. Natürlich wurde empfohlen, zu Beginn Einführungsveranstaltungen und etwa Bibelkunde zu belegen. Bis zum Ende des Studiums mussten in den Hauptfächern Proseminare und Seminare belegt und entsprechende Arbeiten geschrieben werden. Dazu kamen die regelmäßig wiederkehrenden Hauptvorlesungen. Die Freiheit in der Studiengestaltung war sehr groß. Manche, die von staatlichen Schulen kamen, hatten damit große Schwierigkeiten, sowohl was die Orientierung als auch die Selbstdisziplin betraf. Durch diese flexiblen Studienabläufe gab es auch keine richtigen Studienjahrsgruppen. Trotzdem fühlte ich mich anfangs besonders denen verbunden, mit denen ich das Studium begonnen hatte. Mit Michael Rafalski und Albrecht Warweg verband mich dann eine lange Freundschaft. Michael führte mich in die Breite der klassischen Musik ein. Während ich vorher fast nur Bach und andere barocke Musik gehört hatte, lernte ich durch ihn die Wiener Klassik kennen, aber auch die Romantik und die russische Musik von Tschaikowski bis Rachmaninow. Stundenlang hörte ich bei ihm eine Schallplatte nach der anderen. Hier öffneten sich mir weite Horizonte. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Albrecht wiederum hat mich später getraut.
Obwohl wir in der Stadt verteilt wohnten, waren Leben und Studieren in Naumburg eng miteinander verbunden. Das gemeinsame Mittagessen und die Andachten gaben dem Leben am Oberseminar einen Rahmen und Zusammenhalt. Durch gemeinsame Arbeitseinsätze im Garten, in der Bibliothek oder im Haus wurde die Verantwortung aller für die Erhaltung der Lebensumstände unterstrichen. Das studium universale eröffnete uns neue Horizonte und weitete den Blick mit Vorlesungen zu Literatur- und Kulturwissenschaften sowie weiteren gesellschaftspolitischen Themen. Schon damals wurden hier Umweltprobleme behandelt. 1972 lernte ich beim studium universale die Dichter Rainer Maria Rilke und Johannes Bobrowski kennen und schätzen.
Durch meine Freundin Uta kam ich in einen kleinen Literaturkreis, die »Teerunde«. Hier trafen sich einige Seminaristen des Proseminars und Studenten, um eigene und fremde Gedichte vorzutragen. Ich selber war weit davon entfernt, Gedichte zu schreiben. Es beeindruckte mich aber sehr, wie andere riskierten, eigene Gefühle und Erfahrungen nach außen zu tragen und sich damit der Kritik auszusetzen.
Bereits in den ersten Wochen in Naumburg ging die Beziehung mit meiner Freundin Uta in die Brüche. Das machte mir schwer zu schaffen. Ich kämpfte um sie. Dies führte zu vielen Besuchen im Internat des Proseminars, manchmal noch abends spät durchs Fenster. In meiner Trauer wurde ich von einigen Mädchen dort sehr einfühlsam begleitet. Auf diese Weise lernte ich Heidi Hellmund kennen, meine spätere Frau.
Auf Grund der kleinen Zahl an Studenten war auch die Teilnehmerzahl an Lehrveranstaltungen nicht groß. Das erhöhte die Intensität, da es meist nach dem Vortrag auch zum Gespräch kam. Auf diese Weise entwickelte sich zu den meisten Dozenten ein intensiverer persönlicher Kontakt, als dies an anderen akademischen Einrichtungen üblich war und ist. Bei Martin Seils und Wolfgang Ullmann erinnere ich mich zum Beispiel an abendliche Runden in ihren Wohnungen mit Tee und Keksen zur Lektüre und an die Diskussion von Texten Martin Luthers und zur Bekennenden Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus.
Damals hatte mich eine große Neugier auf Lebensbereiche erfasst, die ich bis dahin nicht kannte. Die Suche nach neuen Horizonten nahm mich in Anspruch. So vieles war mir unbekannt und spannend. Es fiel mir schwer, mich zwischen den verschiedenen Angeboten zu entscheiden – es gab so vieles und ich hatte noch keine eigene Orientierung.
1972 nahm ich bei Wolfgang Ullmann an einem kirchengeschichtlichen Proseminar über die Bekennende Kirche in der Kirchenprovinz Sachsen teil. Da ging es nicht um eine ferne Wirklichkeit, sondern um die Kirche in unserer Region. Manche Namen kannte ich noch, einige Personen lebten noch. Geschichte bekam plötzlich einen realen Bezug zur Gegenwart, und das fand ich außerordentlich spannend. Erschüttert hat mich bei diesem Seminar die Lektüre eines westdeutschen Autors, der in den Anmerkungen zu den handelnden Personen auch deren weiteren Lebensweg vermerkte. Hier erfuhr ich zum ersten Mal, wie viele Mitverantwortliche des Nationalsozialismus sich in der Bundesrepublik – manchmal nach kurzer Haft durch die Alliierten – schon bald wieder in hohen Funktionen in Staat und Kirche befanden.
Wenige Wochen, nachdem ich Heidi Hellmund kennengelernt hatte und wir ein Paar geworden waren, besuchte ich sie zu Silvester 1971 bei ihren Eltern auf dem kleinen bäuerlichen Hof in Günstedt im Kreis Sömmerda. Sehr schnell schloss ich ihre Eltern in mein Herz – einfache Bauersleute voller Herzensgüte und menschlicher Weisheit. Bald schon zog sie zu mir in die Schulstraße, in meine Studentenwohnung. Als mein Vater mich einmal in Naumburg besuchte und feststellte, dass wir zusammen in dieser kleinen Wohnung lebten, war er sehr erstaunt – und akzeptierte es.
Aber in Naumburg selbst hatte es Folgen, dass wir unverheiratet zusammenlebten. Heidi wurde von der Leitung des Proseminars mit der Drohung, sonst das Abitur nicht machen zu können, aufgefordert, wieder ins Internat zu ziehen. Heidi und ich verlobten uns schließlich und heirateten im April 1973 erst einmal standesamtlich im Naumburger Rathaus. Damit war dieses Problem aus der Welt. Um die kirchliche Trauung, die dann im August stattfand, hatten wir meinen Vater gebeten. Sie sollte in der Marienkirche in Berlin stattfinden, wo die ganze Geschwisterschar in der Marienkantorei sang. Kantor Heinz Georg Oertel spielte auf meinen Wunsch die von mir so geliebte Passacaglia in c-moll von Johann Sebastian Bach. Meinem Vater hatte ich eine kleine Ausarbeitung geschrieben über mein Verständnis der evangelischen Trauung. Darin ging ich davon aus, dass anders als bei der üblichen kirchlichen Praxis alles zu vermeiden sei, das den Eindruck erwecken könne, erst in der Kirche werde die Ehe geschlossen, der Ringtausch zum Beispiel. Es ginge darum, in einem Gottesdienst zur Eheschließung um den Segen Gottes für das Paar zu bitten. Mein Vater sah sich das an, fragte mich, ob er wirklich die Trauung halten solle. Ich bejahte es, worauf er nur bemerkte, dann sei ja alles klar. Er folgte keinem meiner Gedanken und Überlegungen, ja, sprach mit mir nicht einmal darüber.
Im Juli 1973 fanden in Berlin die Weltfestspiele statt. Das war für die DDR zwei Jahre nach der Machtübernahme Erich Honeckers ein internationales Ereignis von höchster Bedeutung. Die beiden deutschen Staaten waren gerade Mitglieder der Vereinten Nationen geworden und die DDR wollte sich als anerkanntes Mitglied der Staatengemeinschaft und offenes Land darstellen. Jugendliche aus der ganzen Welt nahmen teil. Es kamen auch Teilnehmer aus der Bundesrepublik, nicht nur kommunistische, sondern auch Delegationen der »Jungsozialisten« und der »Jungen Union«. Ich ging jeden Tag auf den Alexanderplatz und nahm an den Diskussionen teil, die in vielen informellen Gruppen auf dem ganzen Platz verteilt stattfanden. Es wurde heftig gestritten über die politischen Fragen der Zeit und natürlich auch über die DDR selbst. Die Jusos, die ich dort traf, gefielen mir gar nicht, sie wollten mir die DDR schönreden. Da waren mir die von der »Jungen Union« näher, denn sie argumentierten in ähnlicher Weise wie ich selbst. Eines Tages verteilten sie auch Flugblätter. Ich erwischte einige, die von Stasileuten schon zerknüllt waren, und nahm sie mit. Ich erinnere mich an eine »ältere Frau« – sie muss zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein –, die, als sie mitbekam, dass ich DDR-Bürger war und in einer Weise diskutierte, die sie dem Westen zuschrieb, meinte: »Und der läuft hier noch frei rum?!« Diese Worte haben mich wieder in die Realität der DDR zurückgeholt, in der eine offene Diskussion wie auf dem Alexanderplatz damals eine große Ausnahmesituation war.
Landesweite Vernetzung von Theologiestudenten
1973 nahm ich durch die Vermittlung von Curt Stauss, einem befreundeten Kommilitonen im höheren Semester, an einer Theologiestudententagung in Halle zum Thema »Christenheit und Weltverantwortung« teil. Es ging um die Standortbestimmung der Kirche in der DDR. Heino Falcke und Martin Seils waren eingeladen und stellten ihre Ansätze dar, die intensiv diskutiert wurden. Hier lernte ich Hans Misselwitz kennen, der den ersten Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums vorstellte. Mit ihm blieb ich über viele Jahre verbunden, 1990 wurde er mein Staatssekretär. Diese Tagung war vom Bund der Evangelischen Kirche finanziert, aber von einem studentischen Kreis vorbereitet worden. Reinhard Kähler aus Teltow, der an der Universität in Greifswald studierte, kannte ich schon, unsere Eltern waren befreundet. Er und Stephan Flade waren, wenn ich mich richtig erinnere, die Initiatoren dieses seit 1970 bestehenden Kreises von Theologiestudenten aus fast allen Orten, an denen man Theologie studieren konnte. Sehr früh war auch Curt Stauss dabei. Damals sollten im Rahmen der 3. Hochschulreform an den Universitäten im zweiten Studienjahr Wehrlager stattfinden. Es kam die Frage auf, wie das Theologen an den staatlichen Universitäten handhaben sollten, da nicht wenige von ihnen den Waffendienst verweigert hatten. Der Erfahrungsaustausch über den Umgang mit Wehrdienstverweigerern und Bausoldaten an den verschiedenen Universitäten spielte anfangs eine zentrale Rolle. Curt Stauss hatte Bausoldaten an ihren jeweiligen Standorten besucht und berichtete darüber. Stephan Flade hatte den Kontakt zu Manfred Stolpe und dem Bund der evangelischen Kirche hergestellt, der an solchen Informationen und regelmäßigem Austausch sehr interessiert war. Paul Wätzel, der Ausbildungsreferent des Bundes, suchte wiederum den Kontakt zu profilierten Studenten, da der Bund eine Reform der